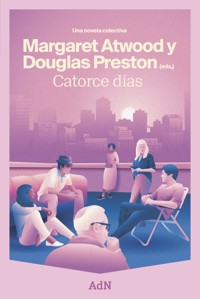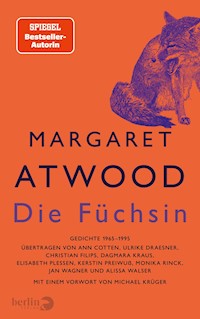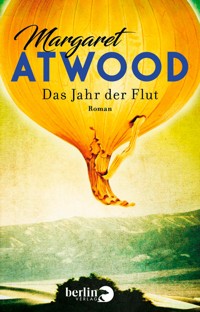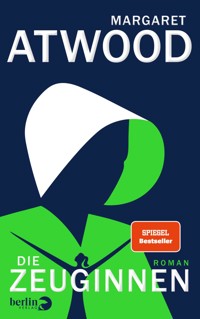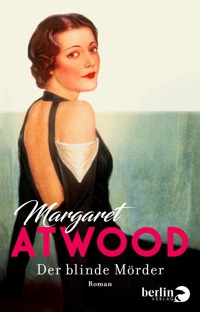
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kanada, in den 1930er Jahren: Laura, fünfzehnjährige Tochter eines Fabrikanten, verfällt einem Gewerkschaftsagitator. Doch auch für ihre Schwester Iris verkörpert er das romantische Ideal eines Mannes. Als Laura von seinem Tod erfährt, begeht sie Selbstmord. Zurück bleibt ein Manuskript mit dem Titel »Der blinde Mörder«, das Laura postum berühmt macht. Aber ist sie wirklich die Autorin? Iris versucht Jahre später, sich rückblickend Klarheit über die Geschehnisse zu verschaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von Brigitte Walitzek
ISBN 978-3-492-31348-3
© O. W. Toad Ltd. 2000
Titel der kanadischen Originalausgabe:
»The Blind Assassin«, McClelland & Stewart Inc., Toronto 2000
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2000
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagabbildung: Illustration von The Advertising Archives (c)
The Curtis Publishing Co.
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Denk an Schah Agha Mohammed Khan, er befiehlt, im Kampf um den Thron alle Bewohner der Stadt Kerman zu erschlagen oder zu blenden. Ohne Ausnahme! Und seine Prätorianer machen sich eifrig ans Werk. Sie lassen die Einwohner in langen Reihen Aufstellung nehmen – den Erwachsenen wird der Kopf abgeschlagen, den Kindern stechen sie die Augen aus. […] Später brechen aus jener Stadt Prozessionen geblendeter Kinder auf. Sie ziehen durchs Land, manche verirren sich in der Wüste und kommen elendiglich um. Andere Gruppen erreichen menschliche Ansiedlungen, wo sie [um Essen betteln und] das Lied von der Ausrottung der Stadt Kerman singen.
Ryszard Kapuściński
Ich schwamm, das Meer war grenzenlos, keine Küste, Tanit war ohne Erbarmen, meine Gebete erfüllten sich. Oh Ihr, die Ihr in Liebe ertrinkt, gedenket mein.
Inschrift auf einer karthagischen Graburne
Das Wort ist eine brennende Flamme in einem dunklen Spiegel.
Sheila Watson
I
Die Brücke
Zehn Tage nach Kriegsende lenkte meine Schwester Laura ein Auto von einer Brücke. Auf der Brücke wurde gebaut: Laura fuhr mitten durch die Absperrung. Das Auto stürzte dreißig Meter in die Tiefe, krachte durch die Bäume mit ihren fedrigen neuen Blättern, ging in Flammen auf und blieb in dem seichten Bach am Grund der Schlucht liegen. Brückenteile stürzten darauf herab. Außer ein paar verkohlten Überresten blieb nicht viel von ihr übrig.
Ein Polizist informierte mich über den Unfall: das Auto gehörte mir, sie hatten mich über das Nummernschild ausfindig gemacht. Der Ton des Polizisten war respektvoll: zweifellos wusste er, wer Richard war. Er sagte, vielleicht habe sich ein Reifen in einer Straßenbahnschiene verklemmt, oder die Bremse habe versagt, aber er fühlte sich auch verpflichtet, mir mitzuteilen, dass zwei Zeugen – ein Anwalt im Ruhestand und ein Bankkassierer, beide glaubwürdig – angegeben hatten, den Vorfall beobachtet zu haben. Sie hatten ausgesagt, Laura habe das Steuer scharf und absichtlich herumgerissen und das Auto so beiläufig, wie man von einem Bürgersteig heruntertritt, über den Rand der Brücke hinausgelenkt. Durch die weißen Handschuhe, die sie getragen hatte, hatten sie ihre Hände auf dem Steuerrad deutlich sehen können.
Es waren nicht die Bremsen, dachte ich. Sie hatte ihre Gründe. Nicht dass diese Gründe je dieselben Gründe wie die anderer Leute gewesen wären. In dieser Hinsicht war sie absolut skrupellos.
»Wahrscheinlich wollen Sie, dass jemand sie identifiziert«, sagte ich. »Ich komme, sobald ich kann.«Wie aus weiter Entfernung hörte ich, wie ruhig meine Stimme klang. In Wahrheit bekam ich die Worte kaum über die Lippen; mein Mund war taub, mein ganzes Gesicht war starr vor Schmerz, als wäre ich gerade beim Zahnarzt gewesen. Ich war wütend auf Laura, weil sie getan hatte, was sie getan hatte, und auf den Polizisten, weil er angedeutet hatte, dass sie es getan hatte. Ein heißer Wind blies um meinen Kopf, hob meine Haare an und wühlte in ihnen, quirlte sie wie Tinte in Wasser.
»Ich fürchte, es wird eine gerichtliche Untersuchung geben, Mrs. Griffen«, sagte er.
»Natürlich«, sagte ich. »Aber es war ein Unfall. Meine Schwester war noch nie eine gute Fahrerin.«
Ich konnte mir das glatte Oval von Lauras Gesicht vorstellen, ihren ordentlich festgesteckten Haarknoten, das Kleid, das sie sicherlich getragen hatte: ein Hemdblusenkleid mit einem kleinen runden Kragen, in einer gedämpften Farbe – marineblau oder stahlgrau oder krankenhausflurgrün. Büßerfarben – weniger wie etwas, was sie sich ausgesucht hatte, als vielmehr wie etwas, worin sie eingesperrt worden war. Ihr feierliches Halblächeln; die erstaunt hochgezogenen Augenbrauen, als bewundere sie eine Aussicht.
Die weißen Handschuhe: eine Pontius Pilatus-Geste. Sie wusch ihre Hände in Unschuld. Wusch mich von sich ab. Uns alle.
Woran hatte sie gedacht, als das Auto von der Brücke segelte und im nachmittäglichen Sonnenlicht schwebte, glitzernd wie eine Libelle in dem einen Augenblick des Atemanhaltens vor dem Sturz? An Alex, an Richard, an Falschheit, an unseren Vater und seinen Ruin; an Gott vielleicht und ihren unheilvollen Dreieckspakt? Oder an den Stapel billiger Schulhefte, die sie an ebendiesem Morgen versteckt haben musste, in der Kommodenschublade mit meinen Strümpfen, wohl wissend, dass niemand anderes als ich sie finden würde?
Als der Polizist fort war, ging ich nach oben, um mich umzuziehen. Für den Gang ins Leichenschauhaus würde ich Handschuhe brauchen, und einen Hut mit einem Schleier. Etwas, was die Augen verdeckte. Möglicherweise würden Reporter da sein. Ich würde mir ein Taxi rufen müssen. Außerdem musste ich Richard warnen, der in seinem Büro war: er würde eine Betroffenheitsbekundung parat haben wollen. Ich ging in mein Ankleidezimmer: Ich würde Schwarz brauchen, und ein Taschentuch.
Ich zog die Schublade auf, ich sah die Hefte. Ich löste die Küchenschnur, mit der sie zusammengebunden waren. Meine Zähne klapperten, mein ganzer Körper war eiskalt. Ich musste einen Schock haben, entschied ich.
Und dann musste ich an Reenie denken, damals, als wir noch klein waren. Reenie war diejenige gewesen, die uns immer verpflastert hatte, bei Abschürfungen und Schnittwunden und sonstigen kleineren Verletzungen: Mutter ruhte sich vielleicht aus oder tat sonstwo gute Werke, aber Reenie war immer da. Sie hob uns hoch und setzte uns auf den weiß emaillierten Küchentisch, neben den Pastetenteig, den sie gerade ausrollte, oder das Hühnchen, das sie zerteilte, oder den Fisch, den sie ausnahm, und gab uns ein Stück Kandiszucker, damit wir den Mund zumachten. Sag mir, wo es wehtut, sagte sie. Hör auf zu heulen. Beruhig dich und sag mir wo.
Aber manche Menschen können nicht sagen, wo es wehtut. Sie können sich nicht beruhigen. Sie können niemals aufhören zu heulen.
Toronto Star, 26. Mai 1945
TODESFALL WIRFT FRAGEN AUF
Exklusiv für den Star
Laut gerichtlicher Leichenschau ist der tödliche Unfall, der sich letzte Woche auf der Brücke an der St. Clair Avenue ereignete, auf menschliches Versagen zurückzuführen. Miss Laura Chase, 25, war am Nachmittag des 20. Mai in westlicher Richtung unterwegs, als ihr Auto die Absperrung durchbrach, die eine Baustelle auf der Brücke abriegelte, in die darunterliegende Schlucht stürzte und in Flammen aufging. Miss Chase war augenblicklich tot. Ihre Schwester, Mrs. Richard E. Griffen, die Gattin des bekannten Industriellen, sagte aus, Miss Chase habe unter heftigen Kopfschmerzen gelitten, die ihr Sehvermögen beeinträchtigten. Auf weitere Befragung hin verneinte sie jede Möglichkeit von Trunkenheit, da Miss Chase nie Alkohol zu sich genommen habe.
Nach Meinung der Polizei könnte ein Reifen, der sich in einer freiliegenden Straßenbahnschiene verklemmt hatte, zu dem Unfall beigetragen haben. Fragen nach der Hinlänglichkeit der städtischen Sicherheitsvorkehrungen wurden aufgeworfen, nach der sachkundigen Zeugenaussage von Straßenbauingenieur Gordon Perkins allerdings wieder fallen gelassen.
Der Unfall bewirkte neuerliche Proteste über den Zustand der Straßenbahnschienen in diesem Teil der Straße. Mr. Herb T. Jolliffe als Vertreter der Gemeinde teilte Reportern des Star mit, dies sei nicht der erste Unfall, der auf vernachlässigte Schienen zurückzuführen sei. Der Stadtrat solle sich mit diesem Problem befassen.
DER BLINDE MÖRDER
von Laura Chase
Reingold, Jaynes & Moreau, New York, 1947
Vorwort: Winterharte Pflanzen für den Steingarten
Sie besitzt ein einziges Foto von ihm. Sie verwahrt es in einem braunen Umschlag mit der Aufschrift Zeitungsausschnitte. Den Umschlag hat sie zwischen den Seiten von Winterharte Pflanzen für den Steingarten versteckt, wo niemand sonst je nachsehen würde.
Sie hat dieses Foto so sorgsam verwahrt, weil es praktisch alles ist, was ihr von ihm geblieben ist. Es ist ein Schwarzweißfoto, aufgenommen mit einer dieser klobigen, unhandlichen Blitzlichtkameras aus der Zeit vor dem Krieg, mit ihren ziehharmonikaförmigen Rüsseln und ihren sorgfältig gearbeiteten Lederetuis, die mit ihren Riemen und komplizierten Schnallen wie ein Maulkorb aussehen. Das Foto zeigt sie beide, sie und diesen Mann, bei einem Picknick. Picknick steht mit Bleistift auf der Rückseite – nicht sein Name, nicht ihrer, nur Picknick. Sie kennt die Namen, sie braucht sie nicht aufzuschreiben.
Sie sitzen unter einem Baum; es könnte ein Apfelbaum gewesen sein; sie hat den Baum damals kaum wahrgenommen. Sie trägt eine weiße Bluse mit bis zu den Ellbogen hochgekrempelten Ärmeln und einen weiten Rock, den sie um ihre Knie gezogen hat. Es muss windig gewesen sein, man sieht es daran, wie der Rock sich an ihre Beine schmiegt; aber vielleicht war es auch gar nicht windig, vielleicht klebte er von selbst; vielleicht war es heiß. Es war heiß. Wenn sie die Hand über das Foto hält, kann sie die Hitze immer noch davon aufsteigen fühlen, wie die Hitze von einem sonnenwarmen Stein um Mitternacht.
Der Mann trägt einen hellen Hut, der schief auf seinem Kopf sitzt und sein Gesicht zum Teil überschattet. Sein Gesicht wirkt gebräunter als ihres. Sie ist ihm halb zugewandt und lächelt auf eine Weise, wie sie, ihres Wissens, seitdem nie wieder jemanden angelächelt hat. Sie wirkt auf dem Foto sehr jung, zu jung, obwohl sie sich selbst damals nicht für zu jung hielt. Auch er lächelt – das Weiß seiner Zähne leuchtet wie ein angerissenes aufflammendes Streichholz –, aber er hält die eine Hand hoch, wie um sie spielerisch abzuwehren; oder wie um sich vor der Kamera zu schützen, vor der Person, die da sein muss, die das Foto aufnimmt; oder wie um sich vor jenen in der Zukunft zu schützen, die ihn ansehen, ihn durch dieses viereckige helle Fenster aus glänzendem Papier anstarren könnten. Wie um sich vor ihr zu schützen. Wie um sie zu schützen. In seiner schützend ausgestreckten Hand hält er einen Zigarettenstummel.
Wenn sie allein ist, holt sie den braunen Umschlag hervor und sucht das Foto zwischen den Zeitungsausschnitten heraus. Sie legt es flach auf den Tisch und starrt in es hinein wie in einen Brunnen oder einen Teich – als suche sie jenseits ihres eigenen Spiegelbilds nach etwas anderem, etwas, was sie fallen gelassen oder verloren haben muss, etwas, was außerhalb ihrer Reichweite, aber immer noch sichtbar ist, schimmernd wie ein Edelstein im Sand. Sie betrachtet jedes Detail. Seine Finger, gebleicht vom Blitzlicht oder vom Gleißen der Sonne; die Falten ihrer Kleidung; die Blätter des Baums und die kleinen runden Früchte, die daran hängen – waren es doch Äpfel? Das struppige Gras im Vordergrund. Das Gras war gelb, weil es so lange nicht geregnet hatte.
Auf der einen Seite – auf den ersten Blick kaum zu sehen – ist eine Hand, vom Rand abgeschnitten, am Handgelenk abgeschnitten, die wie weggeworfen im Gras ruht. Sich selbst überlassen.
Der Hauch einer verwehten Wolke am strahlenden Himmel, wie auf Chrom geschmierte Eiscreme. Seine nikotinfleckigen Finger. Das ferne Glitzern von Wasser. Alles inzwischen versunken.
Versunken, aber schimmernd.
II
Der blinde Mörder: Das hart gekochte Ei
Also dann, was soll es sein? sagt er. Abendkleider und Romanzen, oder gestrandete Schiffe an unwirtlichen Gestaden? Du kannst es dir aussuchen: Urwälder, tropische Inseln, Berge. Oder eine andere Dimension, eine andere Dimension des Raums – darin bin ich am besten.
Eine andere Dimension? Was du nicht sagst!
Spotte nicht, andere Dimensionen können sehr nützlich sein. Alles ist dort möglich. Raumschiffe und hautenge Uniformen, Strahlenwaffen, Marsbewohner, die wie gigantische Tintenfische aussehen, solche Sachen.
Entscheide du, sagt sie. Du bist der Fachmann. Wie wäre es mit einer Wüste? Ich wollte schon immer mal eine sehen. Mit einer Oase natürlich. Ein paar Dattelpalmen wären nett. Sie reißt die Kruste von ihrem Sandwich ab. Sie mag keine Krusten.
Wüsten lassen einem keinen großen Spielraum. Nicht genug Unterscheidungsmerkmale, außer man tut noch ein paar Gräber dazu. Dann könnte man eine Horde nackter Frauen haben, seit dreitausend Jahren tot, mit üppigen Figuren, rubinroten Lippen, azurblauen Haaren, die sich in einem Geschäum wallender Locken ergießen, und Augen wie Schlangengruben. Aber ich glaube nicht, dass ich dir diese Frauen zumuten kann. Zu wild. Das ist nicht dein Stil.
Das kann man nie wissen. Vielleicht würden sie mir gefallen.
Das bezweifle ich. Sie sind mehr was für die elenden Massen. Aber sehr beliebt auf den Titelseiten – machen sich an jeden Kerl ran, man muss sie sich mit dem Gewehrkolben vom Leib halten.
Könnte ich die andere Dimension haben, und dazu die Gräber und die toten Frauen? Bitte?
Du bist ganz schön anspruchsvoll, aber ich will sehen, was sich machen lässt. Ich könnte noch ein paar Jungfrauen drauflegen, die als Opfer dargebracht werden, mit metallenen Brustplatten und silbernen Fußkettchen und halb durchsichtigen Gewändern. Und ein Rudel räuberischer Wölfe, als kostenlose Dreingabe.
Wie ich sehe, schreckst du wirklich vor nichts zurück.
Wären die Abendkleider dir lieber? Kreuzfahrtschiffe, weiße Tischdecken, Handküsse und heuchlerisches Gesäusel?
Nein. Ist gut. Tu, was du nicht lassen kannst.
Zigarette?
Sie schüttelt den Kopf. Er steckt sich eine an, reißt das Streichholz mit dem Daumennagel an.
Irgendwann wirst du dich noch selbst in Brand stecken, sagt sie. Bis jetzt habe ich es noch nie getan.
Sie betrachtet seinen aufgerollten Hemdsärmel, weiß oder hellblau, dann sein Handgelenk, die braunere Haut seiner Hand. Ein Strahlen geht von ihm aus, es muss der Abglanz der Sonne sein. Wie kommt es, dass die Leute nicht alle starren? Er fällt viel zu sehr auf, um hier zu sein – hier draußen im Freien. Um sie herum sind andere Menschen, die im Gras sitzen oder liegen, auf einen Ellbogen gestützt, und picknicken, in hellen Sommerkleidern. Alles sehr schicklich. Trotzdem hat sie das Gefühl, dass sie beide allein sind; als wäre der Apfelbaum, unter dem sie sitzen, kein Baum, sondern ein Zelt; als wäre ein Kreidekreis um sie herum gezogen. Innerhalb dieses Kreises sind sie unsichtbar.
Der Weltraum also, sagt er. Mit Gräbern und Jungfrauen und Wölfen – aber auf Raten, einverstanden?
Auf Raten?
Du weißt schon, so wie man Möbel kauft.
Sie lacht.
Nein, ich meine es ernst. Man muss sich bei so was Zeit lassen. Es könnte Tage dauern. Wir werden uns wiedersehen müssen.
Sie zögert. In Ordnung, sagt sie. Wenn ich kann. Wenn ich es einrichten kann.
Gut, sagt er. Jetzt muss ich nachdenken. Er achtet darauf, dass seine Stimme beiläufig klingt. Zu viel Dringlichkeit könnte sie verschrecken.
Auf dem Planeten – lass mich überlegen. Nicht Saturn, der ist zu nah. Auf dem Planeten Zykron, der in einer anderen Dimension als der unseren angesiedelt ist, gibt es eine von Geröll übersäte Ebene. Nördlich davon liegt der Ozean, der eine violette Farbe hat. Westlich liegt eine Bergkette, von der es heißt, dass sie nach Sonnenuntergang von den untoten, räuberischen Bewohnerinnen der zerfallenen Gräber unsicher gemacht wird, die sich dort befinden. Du siehst, ich hab die Gräber gleich auf Anhieb eingebaut.
Sehr gewissenhaft von dir, sagt sie.
Ich halte mich immer an meine Abmachungen. Im Süden liegt eine sengende Einöde und im Osten gibt es mehrere tiefe Täler, die einst vielleicht Flussläufe waren.
Gibt es auch Kanäle, wie auf dem Mars?
Natürlich. Kanäle und alle möglichen Sachen. Zahlreiche Spuren einer alten und einst hoch entwickelten Zivilisation, obwohl die Region jetzt nur noch spärlich von herumstreifenden Gruppen primitiver Nomaden bevölkert ist. In der Mitte der Ebene erhebt sich ein großer Steinhügel. Das Land ist trocken und nur mit ein paar kümmerlichen Sträuchern bewachsen. Es ist nicht direkt eine Wüste, aber doch annähernd. Ist noch ein Käsesandwich da?
Sie kramt in der Papiertüte. Nein, sagt sie, nur noch ein hart gekochtes Ei. Sie war noch nie so glücklich. Alles ist wieder neu, alles wartet darauf, neu inszeniert zu werden.
Herz, was begehrst du mehr? sagt er. Eine Flasche Limonade, ein hart gekochtes Ei und du. Er rollt das Ei zwischen den Handflächen, zerbricht die Schale und pellt sie ab. Sie beobachtet seinen Mund, seinen Kiefer, seine Zähne.
An meiner Seite, singend im Park, sagt sie. Hier ist Salz. Danke. Du hast wirklich an alles gedacht.
Niemand erhebt Anspruch auf die ausgedörrte Ebene, fährt er fort. Oder vielmehr, fünf verschiedene Stämme tun es, aber keiner von ihnen ist stark genug, die anderen zu vernichten. Alle ziehen sie von Zeit zu Zeit an diesem Steinhügel vorbei, entweder um ihre Thulks zu weiden – blaue, schafähnliche, bösartige Kreaturen – oder um auf ihren Packtieren, einer Art dreiäugigem Kamel, Waren von nur geringem Wert zu transportieren.
Der Steinhügel hat, in ihren verschiedenen Sprachen, verschiedene Namen: Reich der fliegenden Schlangen, Berg aus Geröll, Wohnstatt der heulenden Mütter, Pforte des Vergessens, Grube der abgenagten Knochen. Jeder Stamm erzählt eine ähnliche Geschichte darüber. Unter den Steinen, sagen sie, liegt ein König begraben – ein König ohne Namen. Und nicht nur der König, sondern auch die Überreste der prachtvollen Stadt, über die er einst herrschte. Die Stadt wurde in einer Schlacht zerstört, und der König wurde gefangen genommen und zum Zeichen des Triumphs an einer Dattelpalme aufgehängt. Bei Mondaufgang wurde er abgeschnitten und begraben, und die Steine wurden aufgehäuft, um die Stelle zu markieren. Was die anderen Bewohner der Stadt angeht, so wurden sie allesamt abgeschlachtet. Massakriert – Männer, Frauen, Kinder, Babys, sogar die Tiere. Enthauptet, in Stücke gehackt. Nichts Lebendiges wurde verschont.
Das ist ja schrecklich.
Wenn du egal wo eine Schaufel in die Erde stößt, kommt fast überall irgendeine Schrecklichkeit zu Tage. Gut für mein Metier. Gebeine sind unser Lebenselixier: ohne sie gäbe es keine Geschichten. Ist noch Limonade da?
Nein, sagt sie. Wir haben alles ausgetrunken. Erzähl weiter.
Der wirkliche Name der Stadt wurde von den Eroberern aus der Erinnerung gelöscht, und deshalb – sagen die Geschichtenerzähler – ist der Ort nur unter dem Namen seiner eigenen Vernichtung bekannt. Der Steinhügel verkörpert folglich sowohl einen Akt der bewussten Erinnerung als auch einen Akt des bewussten Vergessens. In jener Region liebt man alles, was paradox ist. Jeder der fünf Stämme behauptet, der siegreiche Angreifer gewesen zu sein. Jeder erinnert sich mit Vergnügen an das Gemetzel. Jeder glaubt, es sei von ihrem jeweiligen Gott als gerechte Strafe angeordnet worden, wegen der unheiligen Praktiken, die in der Stadt gang und gäbe waren. Alles Böse muss mit Blut reingewaschen werden, sagen sie. An jenem Tag floss das Blut in Strömen, also muss hinterher alles sehr sauber gewesen sein.
Jeder Hirte oder Händler, der vorbeikommt, legt einen weiteren Stein auf den Hügel. Es ist ein alter Brauch. Man tut es zur Erinnerung an die Toten, die eigenen Toten; aber da niemand mit Bestimmtheit weiß, wer die Toten unter dem Steinhügel sind, hinterlegen alle ihre Steine – für alle Fälle. Sie sagen, dass was immer sich dort abgespielt habe, der Wille Gottes gewesen sein müsse. Indem sie einen Stein ablegen, ehren sie seinen Willen.
Es gibt aber noch eine andere Version der Geschichte, derzufolge die Stadt keineswegs wirklich zerstört wurde. Stattdessen sei sie durch einen Zauber, der nur dem König bekannt war, mitsamt ihren Bewohnern hinwegtransportiert und durch Phantome ersetzt worden, und nur diese Phantome seien verbrannt und abgeschlachtet worden. Die wirkliche Stadt wurde winzig klein geschrumpft und in eine Höhle unter dem großen Steinhügel verlagert. Alles, was sich einst in ihr befand, ist immer noch da, einschließlich der Paläste und der Gärten voller Bäume und Blumen; einschließlich der Menschen, die jetzt nicht größer sind als Ameisen, aber wie zuvor ihr Leben leben – ihre winzigen Kleider tragen, ihre winzigen Bankette feiern, ihre winzigen Geschichten erzählen und ihre winzigen Lieder singen.
Der König weiß, was geschah, und es bereitet ihm Albträume, aber die anderen sind völlig ahnungslos. Sie wissen nicht, dass sie so klein geworden sind. Sie wissen nicht, dass sie angeblich tot sind. Sie wissen nicht einmal, dass sie gerettet wurden. Für sie sieht die Decke aus Steinen wie ein Himmel aus: Licht fällt durch ein winziges Loch zwischen den Steinen, und sie denken, dass es die Sonne ist.
Die Blätter des Apfelbaums rascheln. Sie sieht zum Himmel, dann auf ihre Uhr. Mir ist kalt, sagt sie. Außerdem ist es spät. Könntest du die Beweise vernichten? Sie sammelt die Eierschalen ein, knüllt das Wachspapier zusammen.
Du musst doch nicht wirklich schon gehen, oder? Es ist gar nicht kalt hier.
Es weht vom Wasser herauf, sagt sie. Der Wind muss umgeschlagen sein. Sie beugt sich vor, macht Anstalten aufzustehen.
Geh noch nicht, sagt er zu schnell.
Ich muss. Sie werden sonst nach mir suchen. Wenn ich zu spät komme, wollen sie wissen, wo ich gewesen bin.
Sie streicht den Rock glatt, schlingt die Arme um ihren Oberkörper, wendet sich ab. Die kleinen grünen Äpfel beobachten sie wie Augen.
Globe and Mail, 4. Juni 1947
GRIFFEN TOT IN SEGELBOOT AUFGEFUNDEN
Exklusiv für Globe and Mail
Nach einer unerklärten Abwesenheit von mehreren Tagen wurde der Industrielle Richard E. Griffen, 47, von dem es heißt, dass die Fortschrittlich Konservative Partei die Absicht hatte, ihn als Kandidaten für den Wahlbezirk St. David’s in Toronto aufzustellen, tot in der Nähe seiner Sommerresidenz »Avilion« in Port Ticonderoga aufgefunden, wo er Urlaub machte. Mr. Griffen befand sich auf seinem Segelboot, der Wassernixe, die an seiner privaten Anlegestelle am Jogues-River festgemacht war. Anscheinend hatte er eine Gehirnblutung erlitten. Die Polizei teilt mit, dass ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden könne.
Mr. Griffen war ein erfolgreicher Unternehmer. Er war Chef einer großen Firma, die Textilien, Konfektionsartikel und Kurzwaren herstellt. Er wurde für seine Verdienste um die Ausrüstung alliierter Truppen mit Uniformteilen und Waffenzubehör ausgezeichnet, war ein häufiger Teilnehmer der Pugwash-Konferenzen und eine führende Persönlichkeit sowohl im Empire- als auch im Granite-Club. Er war leidenschaftlicher Golfspieler und prominentes Mitglied des Royal Canadian Yacht-Club. Der Premierminister, den wir telefonisch auf seinem Privatsitz »Kingsmere« erreichten, kommentierte: »Mr. Griffen war einer der fähigsten Männer dieses Landes. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust.«
Mr. Griffen war der Schwager der verstorbenen Laura Chase, die in diesem Frühjahr posthum ihr Debüt als Romanschriftstellerin gab. Er hinterlässt seine Schwester, Mrs. Winifred (Griffen) Prior, seine Ehefrau, Mrs. Iris (Chase) Griffen, und seine zehnjährige Tochter Aimee. Die Bestattung findet am Mittwoch in der Apostel-Simon-Kirche in Toronto statt.
Der blinde Mörder: Die Parkbank
Wieso gibt es Menschen auf Zykron? Menschen wie uns, meine ich? Wenn Zykron in einer anderen Dimension des Raums liegt, müssten die Bewohner dann nicht sprechende Eidechsen oder so was sein?
Nur in den Schundromanen, sagt er. Alles an den Haaren herbeigezogen. In Wirklichkeit war es so: die Erde wurde von den Zykroniten kolonisiert, die mehrere Jahrtausende nach der Epoche, von der wir sprechen, die Fähigkeit entwickelten, von Dimension zu Dimension zu reisen. Vor achttausend Jahren trafen sie auf der Erde ein. Sie brachten eine Menge Pflanzensetzlinge mit, weshalb wir Äpfel und Apfelsinen haben, von den Bananen ganz zu schweigen – ein Blick auf eine Banane, und man weiß gleich, dass sie nicht von dieser Welt sein kann. Außerdem hatten sie Tiere dabei – Pferde und Hunde und Ziegen und so weiter. Sie waren die Erbauer von Atlantis. Dann jagten sie sich aus Überschlauheit selbst in die Luft. Wir stammen von den wenigen Überlebenden ab.
Oh, sagt sie. So erklärt sich das also. Trifft sich ja gut für dich.
Auf die Schnelle muss es genügen. Was die anderen Besonderheiten von Zykron angeht, so hat es sieben Meere, fünf Monde und drei Sonnen von unterschiedlicher Farbe und Leuchtkraft.
Was für Farben? Schoko, Vanille und Erdbeer?
Du nimmst mich nicht ernst.
Tut mir Leid. Sie neigt ihm den Kopf zu. Jetzt höre ich dir zu. Siehst du?
Er sagt: Vor ihrer Zerstörung war die Stadt – wollen wir sie bei ihrem früheren Namen nennen, Sakiel-Norn, was sich ungefähr als Perle des Schicksals übersetzen lässt – dem Vernehmen nach ein wahres Weltwunder. Selbst jene, die behaupteten, ihre Vorfahren hätten sie zerstört, schilderten begeistert ihre Schönheiten. Natürliche Quellen waren umgeleitet worden und flossen durch die reich verzierten Brunnen in den gekachelten Höfen und den Gärten der zahlreichen Paläste. Überall blühten Blumen, und die Luft war erfüllt von Vogelgesang. In der Nähe lagen fruchtbare Ebenen, auf denen Herden fetter Gnarrs grasten, und es gab Obstgärten und Haine und Wälder mit mächtigen Bäumen, die noch nicht von Händlern abgeholzt oder von rachsüchtigen Feinden abgebrannt worden waren. Die inzwischen trockenen Schluchten waren damals Flüsse; Kanäle, die von ihnen abgeleitet worden waren, bewässerten die Felder rund um die Stadt, und der Boden war so fruchtbar, dass es hieß, die Getreideähren hätten einen Durchmesser von sechs Zoll gehabt.
Die Aristokraten von Sakiel-Norn wurden Snilfards genannt. Sie waren geschickte Metallhandwerker und die Erfinder vieler genialer Gerätschaften, deren Geheimnisse sorgfältig gehütet wurden. Zu der Zeit, von der wir sprechen, hatten sie die Uhr erfunden, die Armbrust und die Handpumpe, obwohl sie noch nicht bis zum Verbrennungsmotor vorgedrungen waren und immer noch Tiere als Transportmittel benutzten.
Die männlichen Snilfards trugen Masken aus gewebtem Platin, die sich zwar mit ihren Gesichtsmuskeln bewegten, aber dazu dienten, ihre wahren Empfindungen zu verbergen. Die Frauen verhüllten ihre Gesichter mit seidenähnlichen Tüchern, die aus den Kokons der Chaz-Motte gemacht wurden. Nicht-Snilfards war es bei Todesstrafe verboten, ihre Gesichter zu verhüllen, da die Undurchschaubarkeit ein Vorrecht des Adels war. Die Snilfards kleideten sich prachtvoll, liebten die Musik und spielten verschiedene Instrumente, um ihren Kunstsinn und ihre Talente unter Beweis zu stellen. Sie liebten Palastintrigen, veranstalteten rauschende Feste und hatten ständig ausgeklügelte Liebschaften mit den Frauen anderer Snilfards. Duelle wurden wegen dieser Affären ausgefochten, obwohl es für einen Ehemann akzeptabler war, sich unwissend zu stellen.
Die Pächter, Diener und Sklaven wurden Ygnirods genannt. Sie trugen schäbige graue Kittel, die bei den Männern eine Schulter und bei den Frauen auch eine Brust frei ließen, wobei es sich erübrigt zu sagen, dass diese Frauen für die Snilfard-Männer Freiwild waren. Die Ygnirods hassten ihr Los, verbargen dies jedoch unter der Maske der Dummheit. Hin und wieder zettelten sie eine Revolte an, die gnadenlos niedergeschlagen wurde. Die Niedrigsten unter ihnen waren die Sklaven, die gekauft und getauscht und außerdem ganz nach Belieben getötet werden konnten. Es war ihnen per Gesetz verboten, lesen zu lernen, sie besaßen aber trotzdem geheime Schriftzeichen, die sie mit Steinen in die Erde ritzten. Die Snilfards spannten sie vor ihre Pflüge.
Wenn ein Snilfard in Zahlungsschwierigkeiten geriet, konnte er zum Ygnirod degradiert werden. Er konnte jedoch versuchen, dieses Schicksal abzuwenden, indem er seine Frau oder seine Kinder verkaufte, um seine Schulden zu bezahlen. Viel seltener kam es vor, dass ein Ygnirod in den Rang eines Snilfard aufstieg, da der Weg nach oben für gewöhnlich mühsamer ist als der Weg nach unten: selbst wenn es ihm gelang, das nötige Geld zusammenzutragen, um für sich selbst oder seinen Sohn eine Snilfard-Braut zu erwerben, ging das Ganze nicht ohne ein gewisses Maß an Bestechung ab, und es konnte eine ganze Weile dauern, bevor er von der Gemeinschaft der Snilfards akzeptiert wurde.
Wahrscheinlich kommt hier dein Bolschewismus zum Vorschein, sagt sie. Ich wusste gleich, dass du früher oder später damit ankommen würdest.
Im Gegenteil. Die Kultur, die ich beschreibe, basiert auf dem alten Mesopotamien. Es steht alles im Kodex Hammurabi und in den Gesetzen der Hethiter und so weiter. Oder wenigstens ein Teil. Jedenfalls der Teil mit den Schleiern, und dass man seine Frau verkaufen konnte. Ich könnte dir Kapitel und Vers nennen.
Bloß nicht, nicht heute, sagt sie. Ich habe nicht die Kraft, ich bin zu schlapp, ich vergehe vor Hitze.
Es ist August, viel zu heiß. Feuchtigkeit streicht über sie wie ein unsichtbarer Dunst. Vier Uhr nachmittags, das Licht wie geschmolzene Butter. Sie sitzen auf einer Parkbank, nicht zu dicht nebeneinander; ein Ahorn mit erschöpften Blättern über ihnen, rissige Erde unter ihren Füßen, verdorrtes Gras um sie herum. Eine Brotkruste, an der Spatzen herumpicken, zerknülltes Papier. Nicht die beste Gegend. Ein tröpfelnder Trinkwasserspender; drei schmuddelige Kinder, ein Mädchen in einem Spielanzug und zwei Jungen in kurzen Hosen, lungern daneben herum und hecken irgendetwas aus.
Ihr Kleid ist primelgelb; ihre Arme sind bis zu den Ellbogen nackt; feine helle Härchen darauf. Sie hat ihre Baumwollhandschuhe ausgezogen, hat sie zu einer Kugel zusammengeknüllt, die Hände nervös. Ihre Nervosität stört ihn nicht: vielmehr gefällt ihm der Gedanke, dass er ihr jetzt schon zu schaffen macht. Sie trägt einen Strohhut, rund wie der eines Schulmädchens; ihre Haare sind zurückgesteckt; eine feuchte Strähne hat sich daraus gelöst. Früher haben die Leute Haarsträhnen abgeschnitten, sie aufbewahrt, sie in Medaillons am Hals getragen – oder, die Männer, dicht am Herzen. Bis jetzt hat er nie verstanden, warum.
Wo bist du angeblich? sagt er.
Einkaufen. Sieh dir meine Ausbeute an. Ich hab Strümpfe gekauft; sehr gute – aus bester Seide. Sie tragen sich, als hätte man gar nichts an. Sie lächelt leise. Ich hab nur noch fünfzehn Minuten.
Sie hat einen Handschuh fallen lassen, er liegt neben ihrem Fuß. Er behält ihn im Auge. Wenn sie ihn beim Weggehen vergisst, wird er ihn einstecken. Sie einatmen, wenn sie nicht da ist.
Wann kann ich dich sehen? sagt er. Der heiße Wind raschelt in den Blättern, Licht fällt durch sie hindurch, Pollen umschweben sie, eine goldene Wolke. Eigentlich Staub.
Du siehst mich doch jetzt, sagt sie.
Sei nicht so, sagt er. Sag mir wann. Die Haut im V-Ausschnitt ihres Kleides glitzert, ein Schweißfilm.
Ich weiß noch nicht, sagt sie. Sie sieht über die Schulter, sucht den Park ab.
Es ist niemand da, sagt er. Niemand, den du kennst.
Man kann nie wissen, wann doch jemand da ist, sagt sie. Man kann nie wissen, wen man kennt.
Du solltest dir einen Hund zulegen, sagt er.
Sie lacht. Einen Hund? Wieso?
Dann hättest du einen Vorwand. Du könntest ihn ausführen. Den Hund und mich.
Der Hund wäre eifersüchtig auf dich, sagt sie. Und du würdest denken, dass ich den Hund lieber habe.
Aber du würdest ihn nicht lieber haben, sagt er. Oder?
Sie macht die Augen groß. Und wieso sollte ich ihn nicht lieber haben?
Weil Hunde nicht reden können, sagt er.
Toronto Star, 25. August 1975
NICHTE BERÜHMTER SCHRIFTSTELLERIN ZU TODE GESTÜRZT
Exklusiv für den Star
Aimee Griffen, 38, Tochter des verstorbenen Industriellen Richard E. Griffen und Nichte der bedeutenden Schriftstellerin Laura Chase, wurde am Mittwoch tot in ihrer Souterrainwohnung in der Church Street aufgefunden, nachdem sie sich bei einem Sturz das Genick gebrochen hatte. Anscheinend war sie bereits seit mindestens einem Tag tot. Ihre Nachbarn, Jos und Beatrice Kelley, wurden durch Miss Griffens vierjährige Tochter Sabrina auf das Unglück aufmerksam, die oft zum Essen zu ihnen kam, wenn ihre Mutter nicht auffindbar war.
Wie es heißt, hatte Miss Griffen seit längerem mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen, derentwegen sie sich bereits mehrmals einer Behandlung unterziehen musste. Ihre Tochter wurde vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung der Obhut von Mrs. Winifried Prior, ihrer Großtante, übergeben. Weder Mrs. Prior noch die Mutter der Verstorbenen, Mrs. Iris Griffen aus Port Ticonderoga, standen für einen Kommentar zur Verfügung.
Das unglückliche Geschehen ist ein weiterer Beweis für die Laxheit unseres derzeitigen Sozialsystems und die Notwendigkeit besserer Gesetze zum Schutz gefährdeter Kinder.
Der blinde Mörder: Die Teppiche
Die Leitung summt und knackt. Irgendwo ist ein Gewitter, oder hört jemand mit? Aber es ist eine öffentliche Telefonzelle, sie können ihn nicht aufspüren.
Wo bist du? fragt sie. Du sollst doch nicht hier anrufen.
Er kann sie nicht atmen hören, er kann ihren Atem nicht hören. Er will, dass sie den Hörer an ihren Hals drückt, aber er wird sie nicht darum bitten, noch nicht. Ich bin ganz in der Nähe, sagt er, nur ein paar Blocks weiter. Ich könnte in den Park kommen, den kleinen mit der Sonnenuhr.
Oh, ich glaube nicht …
Schleich dich einfach raus. Sag, dass du frische Luft brauchst.
Ich werd’s versuchen.
Den Eingang zum Park bilden zwei steinerne Torpfosten, vierkantig, oben abgeschrägt, irgendwie ägyptisch. Aber keine triumphalen Inschriften, keine Basreliefs von knienden Feinden in Ketten. Nur Herumlungern verboten und Hunde sind an der Leine zu führen.
Komm hierher, sagt er. Weg von den Straßenlampen.
Ich kann nicht lange bleiben.
Ich weiß. Komm hier hinten hin. Er nimmt ihren Arm, führt sie: sie bebt wie ein Telegrafendraht im Wind.
Hier, sagt er. Hier kann uns niemand sehen. Keine alten Damen, die ihre Pudel Gassi führen.
Keine Polizisten mit Schlagstöcken, sagt sie. Sie lacht kurz auf. Das Lampenlicht sickert durch die Bäume; das Weiß ihrer Augen blitzt in diesem Licht auf. Ich hätte nicht kommen sollen, sagt sie. Es ist zu riskant.
Eine steinerne Bank schmiegt sich in ein paar Sträucher. Er legt ihr seine Jacke um die Schultern. Alter Tweed, alter Tabak, ein versengter Geruch. Ein Unterton von Salz. Seine Haut war hier, an diesem Stoff. Jetzt ist es ihre.
So, so hast du es wärmer. Und jetzt werden wir gegen das Gesetz verstoßen. Wir werden herumlungern.
Und was ist mit Hunde sind an der Leine zu führen?
Dagegen verstoßen wir auch. Er legt nicht den Arm um sie. Er weiß, sie will, dass er es tut. Sie erwartet es; sie fühlt die Berührung im Voraus, wie Vögel Schatten fühlen. Er hat sich eine Zigarette angezündet. Er bietet ihr eine an; dieses Mal nimmt sie sie. Kurzes Streichholzflackern im Schutz ihrer gehöhlten Hände. Rote Fingerspitzen.
Sie denkt: Noch mehr Flammen, und man würde die Knochen sehen. Wie bei Röntgenstrahlen. Wir sind nur eine Art Dunst, nur farbiges Wasser. Wasser macht, was es will. Es läuft immer bergab. Ihr Hals füllt sich mit Rauch.
Er sagt: Jetzt werde ich dir von den Kindern erzählen.
Den Kindern? Was für Kindern?
Die nächste Fortsetzung. Über Zykron, über Sakiel-Norn.
Oh. Ja.
Es gibt dort auch Kinder.
Von Kindern war keine Rede.
Es sind die Kinder von Sklaven. Ich brauche sie. Ohne sie komm ich nicht aus.
Ich glaube nicht, dass ich Kinder in der Geschichte haben will.
Du kannst jederzeit sagen, dass ich aufhören soll. Niemand zwingt dich. Es steht dir frei zu gehen, wie die Polizei immer sagt, wenn man Glück hat. Er achtet darauf, dass seine Stimme völlig ruhig klingt. Sie geht nicht.
Er sagt: Sakiel-Norn ist nur noch ein Geröllhaufen, aber einst war es ein blühendes Handelszentrum, gelegen an einer Kreuzung, an der drei Überlandstraßen aufeinander trafen – eine aus Osten, eine aus Westen, eine aus Süden. Nach Norden zu war es durch einen breiten Kanal mit dem Meer verbunden, wo es einen gut befestigten Hafen besaß. Nichts ist von all diesen Erdarbeiten und Befestigungsanlagen übrig geblieben: nach der Zerstörung der Stadt wurden die behauenen Steinblöcke von Feinden oder Fremden weggeschleppt und für den Bau von Häusern und Ställen oder zum Ausbau ihrer primitiven Festungen verwendet, oder sie wurden von Wellen und Wind mit Sand zugedeckt.
Der Kanal und der Hafen wurden von Sklaven erbaut, was nicht weiter überraschend ist: den Sklaven schuldete Sakiel-Norn seine Größe und Macht. Aber Sakiel-Norn war auch berühmt für seine handwerklichen Fertigkeiten, vor allem auf dem Gebiet der Weberei. Die Geheimnisse der von den Handwerkern benutzten Färbebäder wurden sorgsam gehütet: die von ihnen angefertigten Tücher schimmerten wie flüssiger Honig, wie zerstampfte rote Trauben, wie ein Glas Stierblut, das in der Sonne vergossen wird. Die zarten Schleier waren so leicht wie Spinnweben und die Teppiche so weich und fein, dass man glaubte, auf Luft zu gehen, einer Luft, die Blumen und fließendem Wasser ähnelte.
Sehr poetisch, sagt sie. Ich bin überrascht.
Stell es dir als eine Art Kaufhaus vor, sagt er. Im Grunde genommen waren es einfach nur Luxusgüter. Wenn man es so betrachtet, ist es weniger poetisch.
Die Teppiche wurden von Sklaven gewebt, und zwar ausschließlich von Kindern, weil nur die Finger von Kindern klein genug für eine derart kunstvolle Arbeit waren. Aber die unermüdliche Feinarbeit, die diesen Kindern abverlangt wurde, führte dazu, dass sie im Alter von acht oder neun Jahren erblindeten, und ihre Erblindung war der Gradmesser, anhand dessen die Teppichhändler ihre Waren bewerteten und anpriesen: Dieser Teppich hat zehn Kinder blind gemacht, sagten sie beispielsweise. Dieser hier fünfzehn, dieser hier zwanzig. Da der Preis dementsprechend stieg, übertrieben sie immer. Es war Brauch, dass die Käufer über die Behauptungen der Händler spotteten. Ganz gewiss höchstens sieben, höchstens zwölf, höchstens sechzehn, sagten sie, während sie den Teppich befingerten. Er ist so derb wie ein Wischlappen. Er ist so kratzig wie die Decke eines Bettlers. Er wurde von einem Gnarr gemacht.
Wenn die Kinder blind geworden waren, wurden sie, gleich ob Junge oder Mädchen, an Bordellbesitzer verkauft. Die Dienste von Kindern, die auf diese Weise erblindet waren, brachten hohe Summen ein; ihre Berührungen waren so zart und geschickt, hieß es, dass man unter ihren Fingern Blumen auf der eigenen Haut erblühen und Quellen hervorsprudeln fühlte.
Sie waren auch geschickt im Öffnen von Schlössern. Jene von ihnen, denen die Flucht gelang, verlegten sich darauf, im Schutz der Dunkelheit Kehlen durchzuschneiden, und sie waren als gedungene Mörder sehr gefragt. Sie besaßen ein überaus feines Gehör, konnten sich völlig geräuschlos bewegen und sich durch die kleinsten Öffnungen zwängen; sie rochen den Unterschied zwischen einem Menschen im Tiefschlaf und einem, der unruhig träumte. Sie töteten so sanft wie ein Falterflügel, der einen Hals streift. Sie galten als völlig mitleidslos. Sie waren gefürchtet.
Die Geschichten, die die Kinder sich gegenseitig zuflüsterten – während sie ihre endlosen Teppiche webten, als sie noch sehen konnten –, handelten von diesem zukünftigen Leben. Unter sich sagten sie, dass nur die Blinden frei seien.
Das ist zu traurig, flüstert sie. Warum erzählst du mir eine so traurige Geschichte?
Die Schatten sind inzwischen tiefer geworden. Seine Arme haben sich endlich um sie gelegt. Sei vorsichtig, denkt er. Keine plötzlichen Bewegungen. Er konzentriert sich auf seinen Atem.
Ich erzähle dir die Geschichten, in denen ich gut bin. Und die du glauben kannst. Du würdest doch kein Süßholzgeraspel glauben, oder?
Nein, ich würde kein Süßholzgeraspel glauben.
Außerdem ist die Geschichte nicht nur traurig – einige der Kinder konnten entkommen.
Aber sie wurden Halsabschneider.
Doch nur, weil sie keine andere Wahl hatten. Sie konnten nicht selbst zu Teppichhändlern oder Bordellbesitzern werden, weil ihnen das nötige Kapital fehlte. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Drecksarbeiten zu übernehmen. Pech für sie.
Nicht, sagt sie. Es ist nicht meine Schuld.
Meine auch nicht. Sagen wir einfach, dass wir nicht von den Sünden unserer Väter loskommen.
Das ist unnötig grausam, sagt sie kalt.
Wann ist Grausamkeit je nötig? sagt er. Und wie viel davon? Lies die Zeitungen, ich hab die Welt nicht gemacht. Außerdem stehe ich auf der Seite der Halsabschneider. Wenn du die Wahl hättest, Hälse abzuschneiden oder zu verhungern, was würdest du tun? Oder dir deinen Lebensunterhalt als Hure verdienen? Diese Möglichkeit besteht schließlich immer.
Er ist zu weit gegangen. Er hat sich seinen Zorn anmerken lassen. Sie rückt von ihm ab. Immer dasselbe, sagt sie. Ich muss zurück. Die Blätter um sie herum bewegen sich hier und da. Sie streckt die Hand aus, die Handfläche nach oben: ein paar Tropfen fallen. Der Donner klingt jetzt näher. Sie lässt seine Jacke von den Schultern gleiten. Er hat sie nicht geküsst; er wird es nicht tun, nicht heute Abend. Sie empfindet es als Aufschub.
Stell dich ans Fenster, sagt er. Dein Schlafzimmerfenster. Lass das Licht an. Steh einfach nur da.
Er hat sie erschreckt. Wieso? Wieso denn das?
Weil ich es will. Ich will wissen, dass du sicher nach Hause gekommen bist, fügt er hinzu, obwohl Sicherheit nichts damit zu tun hat. Ich werd’s versuchen, sagt sie. Nur für eine Minute. Wo wirst du sein? Unter dem Baum. Unter der Kastanie. Du wirst mich nicht sehen, aber ich werd da sein.
Sie denkt: Er weiß, wo das Fenster ist. Er weiß, was für ein Baum es ist. Er muss da gewesen sein. Er muss sie beobachtet haben.
Es regnet, sagt sie. Es wird gießen. Du wirst nass werden.
Es ist nicht kalt, sagt er. Ich werde da warten.
Globe and Mail, 19. Februar 1998
Prior, Winifred Griffen. Nach langer Krankheit im Alter von 92 Jahren in ihrem Haus in Rosedale. Mit Mrs. Prior, die für ihren Gemeinsinn bekannt war, verliert die Stadt Toronto eine ihrer treuesten und ältesten Wohltäterinnen. Mrs. Prior, die Schwester des verstorbenen Industriellen Richard Griffen und die Schwägerin der berühmten Schriftstellerin Laura Chase, war während der Gründungsjahre Mitglied im Förderverein des Toronto Symphony Orchestra. In jüngerer Zeit engagierte sie sich für die Kunsthalle von Ontario und die Kanadische Krebsgesellschaft. Zudem war sie im Granite Club, im Heliconian Club, in der Junior League und beim Dominion Drama Festival aktiv. Sie hinterlässt ihre Großnichte Sabrina Griffen, die zurzeit Indien bereist.
Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung auf dem Mount-Pleasant-Friedhof findet am Dienstag in der Apostel-Simon-Kirche statt. Anstelle von Blumen wird um Spenden für das Princess-Margaret-Hospital gebeten.
Der blinde Mörder: Das Lippenstiftherz
Wie viel Zeit haben wir? sagt er.
Viel, sagt sie. Zwei oder drei Stunden. Die anderen sind alle weg, irgendwo beschäftigt.
Womit?
Was weiß ich. Geld verdienen. Einkaufen. Wohltätigkeitsveranstaltungen. Was sie so machen. Sie streicht eine Haarsträhne hinter das Ohr, setzt sich gerader hin. Sie kommt sich vor wie bestellt, als hätte er nach ihr gepfiffen. Ein billiges Gefühl. Wem gehört das Auto? fragt sie.
Einem Freund. Ich bin eine wichtige Persönlichkeit. Ich habe einen Freund mit einem Auto.
Du machst dich über mich lustig, sagt sie. Er antwortet nicht. Sie zerrt an den Fingern eines Handschuhs. Was, wenn jemand uns sieht?
Sie werden nur das Auto sehen. Und das Auto ist ein Schrottauto, ein Armeleuteauto. Selbst wenn sie dich direkt ansehen, würden sie dich nicht sehen, weil eine Frau wie du sich nicht einmal tot in so einem Auto erwischen lassen würde.
Manchmal magst du mich nicht besonders, sagt sie.
Ich kann in letzter Zeit an kaum was anderes denken. Aber Mögen ist anders. Mögen erfordert Zeit. Ich hab nicht die Zeit, dich zu mögen. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren.
Nicht da, sagt sie. Da ist ein Verbotsschild.
Verbotsschilder sind was für andere Leute, sagt er. Hier – hier runter.
Der Pfad ist kaum mehr als ein Trampelpfad. Weggeworfene Papiertücher, Kaugummipapierchen, benutzte Kondome, die wie Fischblasen aussehen. Flaschen und Kiesel; getrockneter Schlamm, rissig und furchig. Sie hat die falschen Schuhe an, die falschen Absätze. Er nimmt ihren Arm, stützt sie. Sie macht eine Bewegung, als wolle sie sich losreißen.
Es ist praktisch ein offenes Feld. Jemand wird uns sehen.
Wer denn? Wir sind unter der Brücke.
Die Polizei. Nicht. Noch nicht.
Die Polizei schnüffelt nicht am helllichten Tag herum, sagt er. Nur nachts, mit Taschenlampen, auf der Suche nach gottlosen Perversen. Dann eben Landstreicher, sagt sie. Verrückte.
Hier, sagt er. Hier runter. Wo es schattig ist.
Gibt es da Giftsumach?
Nicht die Spur. Ich verspreche es dir. Und auch keine Landstreicher oder Verrückte, bis auf mich.
Woher weißt du das? Das mit dem Giftsumach? Warst du schon mal hier?
Mach dir nicht so viele Sorgen, sagt er. Leg dich hin.
Nicht. Du zerreißt es. Warte einen Augenblick.
Sie hört ihre eigene Stimme. Es ist nicht ihre Stimme, sie ist zu atemlos.
Auf dem Zement ein Lippenstiftherz, das vier Initialen umschließt. Ein L verbindet sie: L für Liebt. Nur die Beteiligten selbst wissen, wem die Initialen gehören – dass sie hier waren, dass sie das hier getan haben. Das Herz verkündet Liebe, verschweigt die Einzelheiten. Um das Herz herum vier weitere Buchstaben, wie die vier Richtungen eines Kompasses:
F
I
C
K
Das Wort auseinander gerissen, auseinander gespreizt: die unerbittliche Topographie des Sex.
Sein Mund schmeckt nach Rauch, ihrer nach Salz; um sie herum riecht es nach zerdrückten Gräsern, nach Katzen, nach Schmuddelecken. Feuchtigkeit und Wachstum, Schmutz an den Knien, schmierig und üppig; spindeliger Löwenzahn, der sich dem Licht entgegenreckt.
Ein Stück unterhalb der Stelle, an der sie liegen, das Gekräusel eines Bachs. Über ihnen blättrige Zweige, dünne Ranken mit roten Blüten; die Pfeiler der Brücke, die sich in die Höhe recken, die eisernen Träger, die Reifen, die über ihren Köpfen dahinrollen; der blaue Himmel in Splittern. Harte Erde unter ihrem Rücken.
Er streicht ihr die Stirn glatt, fährt mit dem Finger über ihre Wange. Du solltest mich nicht derart anbeten, sagt er. Ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der einen Schwanz hat. Irgendwann wirst du das merken.
Darum geht es nicht, sagt sie. Außerdem bete ich dich nicht an. Schon stößt er sie weg, in die Zukunft.
Egal worum es geht, du wirst mehr davon bekommen, sobald ich dich nicht mehr aufhalte.
Was willst du damit sagen? Du hältst mich nicht auf.
Dass es ein Leben nach dem Leben gibt, sagt er. Nach unserem Leben.
Lass uns über was anderes reden.
In Ordnung, sagt er. Leg dich wieder hin. Tu deinen Kopf hierhin. Er schiebt sein feuchtes Hemd zur Seite. Sein Arm hält sie, seine andere Hand fischt in seiner Tasche nach den Zigaretten, reißt das Streichholz mit dem Daumennagel an. Ihr Ohr in der Mulde seiner Schulter.
Er sagt: Also, wo war ich stehen geblieben?
Bei den Teppichwebern. Bei den blinden Kindern.
Ach ja. Ich weiß wieder.
Er sagt: Der Reichtum Sakiel-Norns beruhte auf seinen Sklaven, vor allem auf den Kindersklaven, die seine berühmten Teppiche webten. Aber es bedeutete Unglück, das zu erwähnen. Die Snilfards behaupteten, ihr Reichtum hänge keineswegs von den Sklaven ab, sondern von ihrer eigenen Tugendhaftigkeit und Rechtschaffenheit – anders ausgedrückt davon, dass den Göttern die gebührenden Opfer dargebracht wurden.
Es gab eine Menge Götter. Götter sind immer gut zu gebrauchen, sie rechtfertigen praktisch alles, und die Götter von Sakiel-Norn waren keine Ausnahme. Sie waren alle Fleischfresser; sie mochten Tieropfer, aber menschliches Blut war ihnen das Allerliebste. Bei der Gründung der Stadt, die so lange zurücklag, dass sie zur Legende geworden war, hatten neun gottesfürchtige Väter ihre eigenen Töchter geopfert und sie als heilige Hüterinnen unter den neun Toren begraben.
Jede der vier Himmelsrichtungen besaß zwei dieser Tore, eins für jene, die kamen, und eins für jene, die gingen: durch dasselbe Tor hinauszugehen, durch das man hereingekommen war, bedeutete einen frühen Tod. Das neunte Tor war eine horizontale Marmorplatte auf einem Hügel in der Mitte der Stadt; es öffnete sich, ohne sich zu bewegen, und schwang zwischen Leben und Tod, zwischen Fleisch und Geist, hin und her. Es war das Tor, durch das die Götter kamen und gingen: sie brauchten keine zwei Türen, da sie anders als die Sterblichen gleichzeitig auf beiden Seiten einer Tür sein konnten. Die Propheten von Sakiel-Norn sagten: Was macht den wirklichen Atem eines Mannes aus – das Ausatmen oder das Einatmen? Dergestalt war die Natur der Götter.
Das neunte Tor war auch der Altar, auf dem das Blut der Opfer vergossen wurde. Männliche Kinder wurden dem Gott der drei Sonnen geopfert, also dem Gott des Tages, der hellen Lichter, der Paläste, der Feste, der Feuer, der Kriege, des Alkohols, der Eingänge und der Worte. Weibliche Kinder wurden der Göttin der fünf Monde geopfert, der Schutzpatronin der Nacht, des Nebels und der Schatten, der Hungersnöte, der Höhlen, der Geburten, der Ausgänge und des Schweigens. Den männlichen Kindern wurde auf dem Altar mit einem Knüppel der Schädel eingeschlagen, anschließend wurden sie in den Rachen des Gottes geworfen, der sich über einem lodernden Ofen öffnete. Den weiblichen Kindern schnitt man die Kehle durch und ließ sie verbluten, um mit diesem Blut die fünf abnehmenden Monde zu nähren, auf dass sie nicht völlig verblassten und für immer verschwanden.
Jedes Jahr wurden zu Ehren der neun ursprünglichen Mädchen, die unter den Toren der Stadt begraben lagen, neun weitere Mädchen geopfert. Sie wurden »Jungfrauen der Göttin« genannt, und man brachte ihnen Gebete und Blumen und Weihrauch dar, damit sie sich zu Fürsprecherinnen der Lebenden machten. Die letzten drei Monate des Jahres galten als »gesichtslose Monate«; es waren die Monate, in denen keine Feldfrüchte wuchsen und die Göttin fastete, wie es hieß. Während dieser Zeit herrschte der Sonnengott in seiner Eigenschaft als Gott der Kriege und der Feuer, und die Mütter von männlichen Kindern steckten sie zu ihrem Schutz in Mädchenkleidung.
Das Gesetz verlangte, dass die vornehmsten Snilfard-Familien mindestens eine ihrer Töchter opfern mussten. Es wäre eine Beleidigung der Göttin gewesen, Mädchen zu opfern, die hässlich oder verunstaltet waren, und mit der Zeit fingen die Snilfards an, ihre Töchter zu verstümmeln, damit sie verschont blieben: sie schnitten ihnen einen Finger oder ein Ohrläppchen oder sonst eine Kleinigkeit ab. Bald nahmen die Verstümmelungen einen nur noch symbolischen Charakter an: eine ovale blaue Tätowierung am Ansatz des Schulterbeins. Derartige Kastenzeichen zu tragen, wenn man kein Snilfard war, galt als Verbrechen, aber die Bordellbesitzer, immer auf Geschäfte aus, malten sie trotzdem mit Tinte auf die Haut jener ihrer jüngsten Huren, die ein vornehmes Gebaren vortäuschen konnten. Das sprach Kunden an, die das Gefühl haben wollten, eine blaublütige Snilfard-Prinzessin zu schänden.
Gleichzeitig begannen die Snilfards, Findelkinder zu adoptieren – größtenteils die Nachkommen weiblicher Sklavinnen und ihrer Herren – und diese als Ersatz für ihre legitimen Töchter zu benutzen. Natürlich war das eigentlich Betrug, aber die vornehmen Familien waren mächtig, und man drückte ein Auge zu.
Dann wurden die vornehmen Familien noch bequemer. Sie wollten sich nicht mehr die Mühe machen, die fremden Mädchen in ihren Häusern aufzuziehen, und übergaben sie gleich dem Tempel der Göttin – ähnlich wie man ein Pferd in einen Mietstall gibt –, wobei sie jedoch gut für ihren Unterhalt bezahlten. Da die Mädchen den Namen der jeweiligen Familien trugen, wurde ihnen das Opfer angerechnet. Diese Praxis war nur noch ein schäbiger Abklatsch des hochherzigen Originals, aber inzwischen war in Sakiel-Norn alles käuflich geworden.
Die zur Opferung bestimmten Mädchen wurden im Inneren des Tempelgeländes gehalten, mit den feinsten Leckerbissen genährt, damit sie schlank und gesund blieben, und einer strengen Ausbildung unterzogen, um sie auf den großen Tag vorzubereiten – damit sie ihre Pflicht mit Würde und ohne Angst erfüllten. Idealerweise, so lautete die Theorie, sollte eine Opferung wie ein Tanz sein: majestätisch und lyrisch, harmonisch und anmutig. Die Mädchen waren keine Tiere, die brutal abgeschlachtet wurden; sie sollten ihr Leben aus freien Stücken geben. Viele von ihnen glaubten, was ihnen eingetrichtert wurde: dass das Wohlergehen des ganzen Königreichs von ihrer Selbstlosigkeit abhing. Sie verbrachten lange Stunden im Gebet, um sich in einen angemessenen Gemütszustand hineinzuversetzen; sie lernten, beim Gehen die Augen niederzuschlagen, mit sanfter Melancholie zu lächeln und die Lieder der Göttin zu singen, die von Abwesenheit und Stille handelten, von unerfüllter Liebe und unausgesprochenem Bedauern, und von Wortlosigkeit – Lieder über die Unmöglichkeit des Singens.
Noch mehr Zeit verging. Nur die wenigsten Bewohner von Sakiel-Norn nahmen die Götter noch ernst, und jeder, der übermäßig fromm oder gar zu sehr auf die Einhaltung der Vorschriften bedacht war, galt als Sonderling. Die Bürger hielten sich weiter an die alten Rituale, weil sie das immer getan hatten, aber diese Dinge waren längst nicht mehr das eigentliche Geschäft der Stadt.
Obwohl die Mädchen so isoliert waren, erkannten einige von ihnen, dass sie nur als Lippenbekenntnis an eine längst überholte Vorstellung ermordet werden sollten. Manche versuchten wegzulaufen, wenn sie das Messer sahen. Andere fingen an zu schreien, wenn sie an den Haaren gepackt und rücklings über den Altar gebeugt wurden, und wieder andere verfluchten den König, der bei diesen Gelegenheiten als Hohepriester fungierte. Eine hatte ihn sogar gebissen. Die Massen fürchteten diese immer wieder vorkommenden Ausbrüche von Panik und Wut, da sie schlimmstes Unglück nach sich zogen. Oder nach sich ziehen konnten, falls die Göttin tatsächlich existierte. Jedenfalls waren derartige Ausbrüche dazu angetan, einem die Festlichkeiten zu verderben: und alle genossen die Opferungen, sogar die Ygnirods, sogar die Sklaven, da sie an diesem Tag nicht arbeiten mussten und sich betrinken durften.
Daher ging man dazu über, den Mädchen drei Monate vor ihrer Opferung die Zunge herauszuschneiden. Dabei handelte es sich nicht um eine Verstümmelung, sagten die Priesterinnen, sondern um eine Vervollkommnung – denn was könnte für die Dienerinnen der Göttin des Schweigens angemessener sein?
Und so wurden die Mädchen, zungenlos und angeschwollen von Worten, die sie nie wieder aussprechen konnten, zum Klang feierlicher Musik, gehüllt in Schleier und bekränzt mit Blumen, die gewundene Treppe zum neunten Tor der Stadt hinaufgeführt. Heutzutage würde man vielleicht sagen, dass sie aussahen wie verhätschelte Bräute der besten Gesellschaft.
Sie setzt sich auf. Diese Bemerkung war wirklich unangebracht, sagt sie. Du willst nur deine Verbitterung an mir auslassen. Es macht dir Spaß, diese armen Mädchen in ihren Brautkleidern umzubringen.
Wetten, dass sie blond waren?
Nicht an dir, sagt er. Nicht an dir an sich. Außerdem ist das alles keine reine Erfindung von mir. Es hat eine solide Grundlage in der Geschichte. Die Hethiter …
Hör auf mit den Hethitern! Tatsache ist, dass du dir geradezu die Lippen leckst. Du bist rachsüchtig – nein, du bist neidisch, weiß der Himmel, wieso. Deine Hethiter und deine geschichtliche Grundlage und der ganze Kram können mir gestohlen bleiben – sie sind doch nur ein Vorwand.
Moment mal. Du warst schließlich mit den Jungfrauenopfern einverstanden, du hast sie selbst auf die Speisekarte gesetzt. Ich halte mich nur an deine Anweisungen. Was passt dir denn auf einmal nicht? Die Garderobe? Zu viel Tüll?
Lass uns nicht streiten, sagt sie. Sie hat das Gefühl, gleich weinen zu müssen. Sie ballt die Fäuste, um die Tränen zurückzuhalten.
Ich wollte dich nicht verletzen. Komm schon, ist ja gut.
Sie stößt seinen Arm weg. Du wolltest mich sehr wohl verletzen.
Du weißt genau, dass du es kannst, und das gefällt dir.
Ich hab gedacht, es würde dich amüsieren. Zu hören, wie ich mich bemühe. Wie ich mit den Adjektiven jongliere. Wie ich für dich den Hanswurst spiele.
Sie zieht den Rock herunter, stopft die Bluse hinein. Tote Mädchen in Brautschleiern, wieso sollte mich das amüsieren? Mit herausgeschnittener Zunge. Du musst mich für völlig gefühllos halten.
Ich nehm es zurück. Ich änder es ab. Ich schreibe die Geschichte für dich um. In Ordnung?
Das kannst du nicht. Die Worte sind ausgesprochen. Du kannst sie nicht zurücknehmen. Ich muss jetzt gehen. Sie kniet inzwischen, jeden Moment wird sie aufstehen.
Es ist noch reichlich Zeit. Leg dich wieder hin. Er ergreift ihr Handgelenk.
Nein. Lass los. Sieh dir an, wo die Sonne steht. Sie werden bald zurückkommen. Ich werd Ärger bekommen, obwohl das für dich wahrscheinlich nicht zählt, diese Art von Ärger. Dir ist das alles völlig egal – alles, was du willst, ist ein schneller, ein schneller – Komm schon, spuck’s aus.
Du weißt, was ich meine, sagt sie mit müder Stimme.
Das stimmt nicht. Es tut mir Leid. Ich bin derjenige, der gefühllos ist, ich bin zu weit gegangen. Außerdem ist es nur eine Geschichte.
Sie legt den Kopf auf ihre Knie. Nach einer Minute sagt sie: Was soll ich bloß machen? Später – wenn du nicht mehr da bist?
Du wirst drüber wegkommen, sagt er. Du wirst weiterleben. Komm, ich klopf dich ab.
Es lässt sich nicht abklopfen. Abklopfen allein genügt nicht.
Lass mich deine Knöpfe zumachen, sagt er. Sei nicht traurig.
Information des Verbandes ehemaliger Schüler der Colonel Henry Parkman High School, Port Ticonderoga, Mai 1998
LAURA CHASE-PREIS AUSGESCHRIEBEN
von Myra Sturgess, Vizepräsidentin
des Verbandes ehemaliger Schüler
Die Colonel Henry Parkman High School freut sich, einen wertvollen neuen Preis vergeben zu können. Zu verdanken ist dieser Preis der großzügigen Spende der kürzlich verstorbenen Mrs. Winifred Griffen Prior aus Toronto, deren allseits bekannter Bruder, Richard E. Griffen, vielen noch in Erinnerung sein wird, da er seine Ferien häufig in Port Ticonderoga verbrachte und gerne auf unserem Fluss segelte. Der »Laura Chase-Gedenkpreis für kreatives Schreiben«, mit dem die beste Kurzgeschichte aus den Reihen des Abschlussjahrgangs ausgezeichnet werden soll, ist mit 200 Dollar dotiert. Die Preisrichter, drei Mitglieder des Verbandes ehemaliger Schüler, werden den Preis unter Berücksichtigung der literarischen und der moralischen Qualitäten der Geschichte vergeben. Direktor Eph Evans sagte dazu: »Wir sind Mrs. Prior sehr dankbar, dass sie neben all ihren zahlreichen anderen Stiftungen auch an uns gedacht hat.«
Benannt nach der berühmten, hier gebürtigen Autorin Laura Chase, wird der Preis erstmalig bei der Abschlussfeier im Juni vergeben werden. Mrs. Iris Griffen, geborene Chase, die Schwester von Laura Chase und Nachfahrin der Familie, die in der Vergangenheit so viel für unsere Stadt getan hat, hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, den Preis zu überreichen. Da bis dahin noch ein paar Wochen Zeit sind, sollten alle ihre Kinder auffordern, die Kreativitätsärmel hochzukrempeln und sich an die Arbeit zu machen.
Der Verband ehemaliger Schüler bittet nach der Abschlussfeier zum Tee in die Turnhalle. Karten sind bei Myra Sturgess im Gingerbread House erhältlich. Der Erlös wird den dringend benötigten neuen Football-Trikots zugute kommen. Kuchenspenden sind sehr willkommen, geben Sie jedoch bitte an, welche Nüsse in ihnen enthalten sind.
III
Die Preisverleihung
Heute Morgen wurde ich mit einem beklommenen Gefühl wach. Zuerst konnte ich es nicht einordnen, aber dann fiel es mir wieder ein. Heute war der Tag der Zeremonie.
Die Sonne stand hoch, das Zimmer war schon zu warm. Licht sickerte durch die Gardinen und hing in der Luft wie Schwebstoffe in einem Teich. Mein Kopf fühlte sich an wie ein Sack voller Brei. Noch im Nachthemd, schweißfeucht von irgendeiner Angst, die ich beiseite geschoben hatte wie Laubwerk, stemmte ich mich hoch, kletterte aus meinem zerwühlten Bett und zwang mich durch die üblichen Morgenrituale – die Zeremonien, die wir vollführen, damit wir für andere Menschen normal und akzeptabel aussehen. Die Haare müssen nach den wie auch immer gearteten nächtlichen Erscheinungen, die sie zu Berge stehen ließen, glatt gestrichen werden, der Ausdruck starrender Ungläubigkeit muss aus den Augen gewaschen werden. Die Zähne, oder was davon noch übrig ist, müssen geputzt werden. Weiß der Himmel, was für Knochen ich im Schlaf zernagt hatte.
Dann trat ich unter die Dusche, wobei ich mich an der Griffstange festhielt, die ich auf Myras Drängen hin habe installieren lassen, und sorgfältig darauf achtete, die Seife nicht fallen zu lassen: Ich habe Angst davor, auszurutschen. Aber der Körper muss nun einmal abgespritzt werden, um den Geruch der nächtlichen Dunkelheit von der Haut zu vertreiben. Ich habe den Verdacht, einen Geruch an mir zu haben, den ich selbst nicht mehr wahrnehmen kann – den Gestank von schalem Fleisch und wolkigem, alterndem Urin.
Abgetrocknet, eingecremt und eingepudert, überhaucht wie von Mehltau, war ich in gewisser Weise wiederhergestellt. Bloß dass das Gefühl einer Gewichtslosigkeit, oder vielmehr das Gefühl, jeden Augenblick von einer Klippe herabzustürzen, immer noch da war. Jedes Mal, wenn ich einen Fuß vorstreckte, setzte ich ihn nur provisorisch auf, als könne der Boden unter mir jeden Augenblick nachgeben. Als würde nur die Oberflächenspannung mich an Ort und Stelle halten.
Meine Kleider anzuziehen half. Ohne äußeres Gerüst bin ich nicht in Bestform. (Aber was ist aus meinen wirklichen Kleidern geworden? Diese formlosen Pastellsachen und diese orthopädischen Schuhe können doch nur einer anderen Person gehören. Aber sie gehören mir; schlimmer, sie passen jetzt zu mir.)
Als nächstes kam die Treppe. Ich habe panische Angst davor, sie hinunterzustürzen – mir das Genick zu brechen und verrenkt und mit hervorguckender Unterwäsche dazuliegen und mich in eine stinkende Pfütze zu verwandeln, bevor jemand auf die Idee kommt, mich zu suchen. Es wäre eine so unattraktive Art zu sterben. Fest an das Geländer geklammert, nahm ich jede Stufe einzeln in Angriff; dann durch den Flur in die Küche, wobei die Finger meiner linken Hand an der Wand entlangstreiften wie die Schnurrhaare einer Katze. (Ich kann immer noch sehen, größtenteils. Ich kann immer noch gehen. Seid dankbar für kleine Gaben, hatte Reenie immer gesagt. Wieso sollten wir? hatte Laura gefragt. Und wieso sind sie so klein?)
Ich hatte keine Lust auf Frühstück. Ich trank ein Glas Wasser und verbrachte die Zeit mit Herumzappeln. Um halb zehn kam Walter, um mich abzuholen. »Heiß genug für Sie?« fragte er, seine übliche Eröffnung. Im Winter lautet sie: Kalt genug? Nass und trocken sind dem Frühling und dem Herbst vorbehalten.
»Und wie geht’s selbst, Walter?« sagte ich, wie ich es immer tue.
»Geb mir alle Mühe, mich aus Scherereien rauszuhalten«, sagte er, wie er es immer tut.
»Mehr kann keiner von einem erwarten«, sagte ich. Er setzte seine Version eines Lächelns auf – ein schmaler Riss in seinem Gesicht, wie trocknender Schlamm –, hielt mir die Autotür auf und half mir auf den Beifahrersitz. »Großer Tag heute, was?« sagte er. »Schnallen Sie sich an, sonst werd ich noch verhaftet.« Er sagte es, als wäre es ein Witz; er ist alt genug, um sich an frühere sorglosere Zeiten zu erinnern. Garantiert war er einer von den Jungs gewesen, die beim Fahren einen Ellbogen auf das offene Fenster stützten, eine Hand auf dem Knie seiner Freundin. Erstaunlich, wenn man daran denkt, dass diese Freundin Myra gewesen ist.