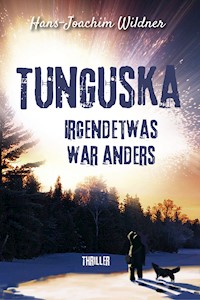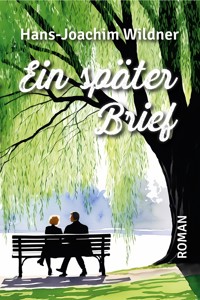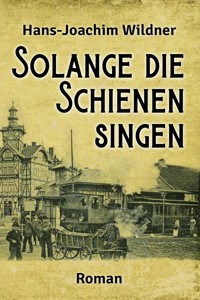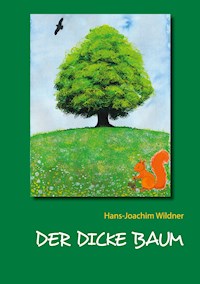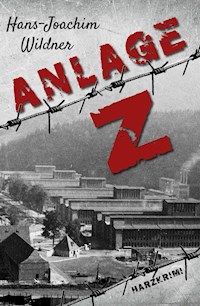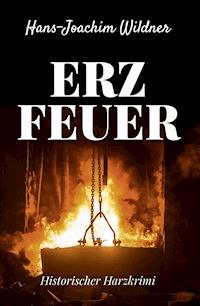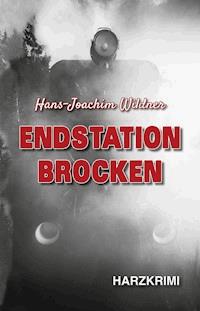Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Hexencode wurde entschlüsselt, und Marie ist keine Hexe mehr. Deshalb will Rahim, der Hexenmeister, sie vernichten, um die Herausgabe der Fluchtafel zu erzwingen. Marie, ihre Familie und ihr Freund Felix geraten in große Gefahr. Sie muss den Hexenfluch löschen, um endlich Ruhe zu haben. Dazu braucht sie ihre Hexenfreundinnen Wanda und Anila, die auf der Burg Anhalt gefangen sind. Aber Marie kann die Parallelwelt der Burg nicht mehr erreichen. Außer Rahim ist auch eine Geheimorganisation namens Corona hinter Marie her und trachtet ihr nach dem Leben. Da tauchen der geheimnisvolle Gozo und die mysteriöse Zyrima auf und bringen Marie auf ein geheimnisvolles Buch. Darin soll der Schlüssel zur Vernichtung der Fluchtafel zu finden sein. Kann Marie den Fluch endgültig auslöschen? Dies ist die Fortsetzung von Hans-Joachim Wildners Jugend-Fantasyroman "Der Schlüssel von Schielo".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Joachim Wildner
Der Brockendom
- Rahims Rache -
Für Darian, Lorena und Elida
Inhaltsverzeichnis
Innentitel
Impressum
Was im ersten Buch geschah
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Spielorte des Buches
Der Autor
Der Schlüssel von Schielo
Impressum
Der Brockendom
ISBN 978-3-943403-86-2
ePub Edition
Version 1.0 - 01-2017
© 2017 by Hans-Joachim Wildner
Lektorat: Anke Höhl-Kayser
Covergestaltung: Alina Groß
DTP & eBook-Konvertierung: Sascha Exner
Druck: WirMachenDRUCK GmbH, Backnang
Verlag: EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1163, 37104 Duderstadt
Alle Figuren dieses Romans sind frei erfunden.
Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen - lebendig oder tot - und Ereignissen wäre reiner Zufall.
Was im ersten Buch geschah
»Du bist auserwählt«, sagte die unheimliche Gestalt mit eiskalter Stimme, »du gehörst jetzt mir.« In der Nacht vor ihrem dreizehnten Geburtstag erwacht Marie aus einem furchtbaren Alptraum mit einem blutenden Finger. Als sie in den Spiegel schaut, haben ihre Augen plötzlich einen fremden Glanz. Und das ist nicht alles. Sie kann durch ihren bloßen Willen Kerzen anzünden und Verkehrsampeln auf grün schalten. Als dadurch beinahe ein schrecklicher Unfall geschieht, möchte sie diese Talente lieber ablegen. Doch sie ist von einem Fluch betroffen und gehört jetzt zu den Hexen. Und die haben sie fest im Griff, beobachten, verfolgen und verschleppen sie.
Sie brauchen Marie, die Herrin über das Feuer und die Blitze, um die Welt zu beherrschen, aber Marie ist fest entschlossen, sich von dem Hexenfluch zu lösen. Doch das ist nicht so einfach. Zum Glück hat sie einen guten Freund, der ihr zur Seite steht und mutig genug ist, um mit ihr die gefährlichsten Abenteuer zu bestehen. Sie müssen die Hexenkladde und die Fluchtafel finden, um den Lösungscode zu entschlüsseln. Doch das scheint ein aussichtsloses Unterfangen zu sein. Da taucht ein Franziskanermönch auf und entdeckt ein altes Amulett mit der Inschrift: Dies ist der Schlüssel von Schielo. Damit gelingt es ihnen schließlich, den Code zu knacken. Bei Sonnenaufgang auf dem Brocken muss Marie mit ihrem Blut den Zahlencode auf den Hexenaltar schreiben, dann ist der Fluch gelöst. Als sie wieder zu Hause ist und in den Spiegel schaut, ist das Leuchten in ihren Augen verschwunden.
Marie ist überglücklich. Sie ist den Hexen entkommen.
Oder doch nicht?
Zwei Jahre danach passieren erneut seltsame Dinge. Marie, ihre Eltern und ihr Freund Felix geraten in große Gefahr. Rahim will die Fluchtafel zurück, und eines Tages …
Prolog
Nie würde Marie den Augenblick vergessen, als ihre Eltern mit Tränen in den Augen vor ihr standen. Sie konnte sich nicht erinnern, ihren Vater je weinen gesehen zu haben. Nun sahen sie sie beide mit feuchten Augen an. Es ging ihr durch Mark und Bein. »Marie«, sagte ihre Mutter mit zittriger Stimme, »Marie, du bist alles was wir lieben. Wir sind eine Familie, wir gehören zusammen und haben keine Geheimnisse voreinander. Deshalb ist es für deinen Vater und für mich unerträglich, nicht zu wissen, wer dich entführt hat und was man dir angetan hat.« Ich wusste, dass sie das irgendwann fragen, dachte Marie in diesem Moment. Sie hatte immer Angst davor gehabt. Ihre Mutter hatte ja recht, gestand sie sich ein, aber würden ihre Eltern ihr diese unglaubliche Geschichte abnehmen, ohne sie für verrückt zu halten? Konnten sie ihr danach jemals wieder etwas glauben? Was wäre, wenn sie ihr Geheimnis trotz alledem für sich behielte? Ihre Eltern würden ihr das sicher nicht verzeihen und ihr womöglich auch niemals mehr vertrauen können. Nein, das wäre noch schlimmer, als für verstört zu gelten.
»Was ich erlebt habe, ist kaum zu fassen«, begann Marie mit schwacher Stimme. »Ich hatte Angst, ihr könntet mich nach so einer Geschichte für geistesgestört halten. Ich habe mich einfach nicht getraut.«
»Aber Marie«, rief ihre Mutter bestürzt, »wir sind deine Eltern. Wenn du uns nicht vertrauen kannst, wem dann?« Eine Träne zog eine feuchte Spur auf ihrer Wange. Marie schluckte. Noch immer zögerte sie.
»Wir wollen dich nicht damit quälen Marie«, sagte Torsten einlenkend, »wenn du es uns lieber später erzählen möchtest?« Er wollte gehen.
Marie spürte die Enttäuschung in den Worten ihres Vaters. Ja, ihre Eltern hatten ein Recht darauf, alles zu erfahren. Jetzt und nicht irgendwann.
»Warte«, sagte Marie, »setz dich.« Dann begann sie, ihre Erlebnisse von vor zwei Jahren zu schildern. Unheimliche Dinge waren geschehen. Eine sprechende Katze hatte ihr gesagt, dass sie nun eine Hexe sei.
Ihre Eltern hörten ihr bis zum Schluss geduldig zu. Danach sahen sie ihre Tochter schweigend an. Dieses Schweigen hing wie Blei an Marie. Und dann der Schock, als nach einigen Minuten ihr Vater fragte: »Wie kann man das glauben, wenn man es nicht selbst erlebt hat?« Marie stockte der Atem. Er nahm es ihr nicht ab, sie hatte es kommen sehen. Was konnte sie jetzt noch tun, um die Eltern zu überzeugen? Bonzo, schoss es ihr durch den Kopf. Der sprechende Mäuserich lebte seitdem verborgen in der Werkstatt ihres Vaters. Wenn sie ihn sprechen hören, müssten sie mir glauben, dachte sie. Sie hatte ihrem kleinen Mäusefreund zwar den Schwur abgenommen, mit niemandem darüber zu reden, aber das hier war ein Notfall.
»Bonzo ist hier bei uns«, sagte sie, »ich habe ihn draußen im Anbau versteckt.« Marie ging hinaus. Kurz darauf kam sie zurück die Hände so übereinander gelegt, dass sie einen Hohlraum bildeten. Vor den Augen ihrer Eltern nahm sie die obere Hand weg. Zusammengekauert saß der Mäuserich auf Maries Handfläche und sah ängstlich zu ihnen auf. „Bitte sag etwas, Bonzo“, forderte ihn Marie auf. Ihre Eltern sahen sie mit Blicken an, als sei sie komplett verrückt geworden. »Aber nur, wenn ich ein Stück Käse bekomme«, fiepste Bonzo seine Bedingung.
»Oh Gott, wie ist das möglich?« Maries Mutter wurde kreidebleich und setzte sich wankend auf einen Stuhl. Ihr Vater sah sie eine Weile stumm an. Dann umarmten beide Marie schweigend.
1. Kapitel
- 1 -
Donnernd und fauchend, in Flammen gehüllt, erschien Rahim scheinbar aus dem Nichts inmitten des Hofes der Burg Anhalt. Die Hexen zuckten wie vom Blitz getroffen zusammen und rannten davon. Einige stolperten über die Katzen, die panisch kreuz und quer über den Hof hetzten und aufschrien, wenn sie unter ihre Füße gerieten. Von dem Tumult offensichtlich aufgeschreckt, kamen die anderen Hexen aus ihren Zimmern gelaufen und schauten über die Brüstung. Als sie Rahim erblickten, liefen sie entsetzt zurück und schlossen die Türen ab. Sie ahnten Schlimmes.
Wie eine übergroße Fackel stand er da, brüllte einen unverständlichen Fluch und sank aus seiner Schwebeposition auf den Boden. Das Feuer um ihn herum erstarb, und eine Rauchwolke stieg auf. Seine grässliche Gestalt wurde sichtbar. Schwefelgeruch zog über den Burghof und die elektrisch aufgeladene Luft um ihn herum schmeckte metallisch.
Die Hexen verkrochen sich in ihren Gemächern. Sie wussten, wenn Rahim im Feuer erschien und seine Schwebehaltung aufgab, wurde es brenzlig. Dann war er noch unberechenbarer und man ging ihm besser aus dem Weg.
Wutentbrannt stampfte er über das Pflaster des Hofes zum Pallas, stürmte die steinerne Treppe hinauf und brüllte: »Odila, Philomena! Her zu mir, ihr Hexenbrut!«
Es dröhnte durch alle Hallen und Gänge der Burg. Die Flammen der Fackeln und Kerzen neigten sich, als würde ein Windstoß über sie hinweg blasen.
Rahim betrat den Eckturm und riss die Tür der ehemaligen Kemenate auf, die von den Hexen als Versammlungssaal genutzt wurde. Mit lautem Knall schlug er sie hinter sich zu und setzte sich auf den Teufelsthron.
Eine geheimnisvolle Stille lag auf einmal über der Burg. Nichts rührte sich. Nur Rahims schwerer Atem war zu hören.
Knarrend schwenkte der Türflügel auf und Odila kam zögernd herein, gefolgt von Philomena. Die beiden Haupthexen stellten sich mit gesenktem Kopf in respektvollem Abstand vor ihm auf. Weißglühend blitzten Rahims Augen auf und Funken sprühten aus. Odila und Philomena wichen einen Schritt zurück und blieben stocksteif stehen.
»Mehr als fünfhundert Jahre lag die Fluchtafel verborgen an dem Ort, den ich ihr zugewiesen habe.« Rahim stand auf und ging einige Schritte auf die beiden Hexen zu, die weiter zurückwichen, bis sie mit dem Rücken an der Wand standen. Rahim richtete drohend seinen verkrüppelten Zeigefinger auf die Hexen, aus dem eine blaurote Flamme züngelte.
»Mehr als fünfhundert Jahre war das Wissen um die Tafel und den Lösungssatz ebenfalls verborgen«, brüllte er sie an. Er kam immer näher. Beide Hexen drückten sich fest an die Wand und drehten die Köpfe mit vor Ekel verzerrten Gesichtern zur Seite. Der Gestank nach Schwefel und Fäulnis aus Rahims Mund nahm den beiden Hexen den Atem.
»Jetzt ist unser größtes Geheimnis gelüftet. Von einer kleinen Göre, die noch nicht einmal die Hexenweihe empfangen hatte. Was noch folgenschwerer ist: Die Fluchtafel befindet sich nicht mehr unter meiner Kontrolle. Ihr wisst, was das bedeutet!«, donnerte er. Seine Stimme erschütterte die Burganlage wie ein Erdbeben. »Wie konnte das geschehen?« Aus seinen Augen sprühten erneut Funken.
Odila traute sich einen Schritt nach vorne. Mit gesenktem Blick sagte sie kleinlaut: «Wir haben ihre Stärke unterschätzt, Rahim.«
»Unterschätzt?«, grölte er, »versagt habt ihr. Jämmerlich versagt.«
Odila schaute auf den Boden. »Sogar die Kammer der stillen Finsternis konnte ihren Willen nicht brechen«, verteidigte sie sich, ohne ihre Stimme zu erheben, »selbst den Ekel vor Mäusen, der uns Hexen zu eigen ist, konnte sie überwinden.«
Rahim setzte sich wortlos.
Seine Augen wurden schwarz und verrieten die Bosheit Luzifers.
»Zwei Jahre sind seitdem vergangen«, fauchte er in den Raum, »zwei Jahre habe ich die Hölle nicht verlassen können. Luzifer lehrte mich die dunkle Welt. Sie muss kommen. Das ist sein Wille.«
»Bald, in zwei Jahren, werden wir eine neue Hexe aufnehmen können«, erklärte Philomena und traute sich in kleinen Schritten näher.
»Schweig!«, fuhr Rahim sie an. »Und rede nur, wenn du gefragt wirst. Du bist überhaupt an allem schuld. Du hattest die Verantwortung für die Belehrung und Unterwerfung der Neuen. Du bist dieser Aufgabe scheinbar nicht mehr gewachsen. Ich werde mir dafür eine andere suchen, und du wirst aus dem Hexenrat ausscheiden.«
Philomena blieb geschockt stehen, ihr Gesicht rötete sich. Sie war so empört, dass sie sich zu widersprechen traute.
»Nein!«, schleuderte sie Rahim entgegen. »Das kannst du nicht machen. Nicht nach den Hunderten von Jahren, die ich dir treu ergeben war. Gewähre mir einen Weg der Wiedergutmachung.«
Rahims Augen glühten wieder auf, er erhob sich aus dem Stuhl und richtete seine verkrüppelte Hand gegen sie. Philomena sank augenblicklich zu Boden und wand sich vor Schmerzen.
»Wage es nicht, mir zu widersprechen!«, röhrte er, und seine Hand zitterte. Philomena stöhnte und krümmte sich wie ein Regenwurm auf einem heißen Stein.
Schließlich beendete er die Folter. Philomena blieb regungslos liegen und schnappte nach Luft.
»Gut«, sagte Rahim in drohendem Ton, »ich zeige dir einen Weg, einen letzten Weg für dich.« Er machte eine Pause. Philomena blickte wie ein bettelnder Hund zu ihm auf. »Im Harz schlägt das Herz der Hexen, und dieses Herz blutet.“ Seine Stimme wurde lauter: „Mich dürstet nach Vergeltung. Bestrafe Marie aus Schielo, zur Abschreckung für all jene, die sich ermutigt sehen, es ihr gleich zu tun. Und nun ...«, er brüllte so, dass die Holzdecke knarrte, »... bringe mir diese beiden Hexen, die meinen, sie könnten sich gegen mich stellen. Sofort!«
Wortlos verließen Odila und Philomena den Raum und rannten zum Wohntrakt, um Wanda und Anila zu Rahim zu schicken.
- 2 -
Heike stellte das Bügeleisen in die Ablagemulde und wischte sich mit dem Ärmel die Schweißperlen von der Stirn. Sie blickte zu Marie hinüber, die auf der Eckbank vor ihren Schulbüchern saß. Es war schon vier Uhr an diesem sommerlich heißen Freitagnachmittag und mit den Hausaufgaben war Marie noch längst nicht fertig.
»Ach! Hast du schon das Neuste gehört?«, fragte Heike unvermittelt.
»Was meinst du denn?«, fragte Marie nach, ohne aufzusehen.
»Beate Köster, die drüben am Schusterberg wohnt, hat gestern ihr Baby bekommen, einen kleinen Jungen. Er heißt Jonas.«
»Beate? Oh wie schön. Das hat sie sich doch so gewünscht. Und? Alle wohlauf?«
»Ja, ja, beide sollen gesund und munter sein«, antwortete Maries Mutter und lächelte dabei. Sie bügelte weiter. »Ich muss gleich morgen noch etwas für den kleinen Jonas besorgen. Hast du eine Idee, was man schenken könnte?«
»Einen Strampler und soʼn Greifling, das kommt bestimmt gut an«, meinte Marie, »und ein neues Bügeleisen.«
Heike verdrehte die Augen. »Was soll ein kleiner Junge mit einem Bügeleisen?«
Marie lachte laut auf. »Nicht für das Baby, für dich, Mama«, stellte sie richtig und zeigte auf die Kabelschnur. »Sieh mal, die Isolierung ist gebrochen. Das hält nicht mehr lange.«
Heike untersuchte das Kabel. »Oh ja, ich glaube, du hast recht«, bestätigte sie. »Das muss ich heute Abend gleich Papa zeigen. Er kann das sicher reparieren. Aber für die restliche Wäsche muss es noch halten.«
Sie nahm sich das nächste Arbeitshemd von Maries Vater vor. Es wies wie immer Ruß- und Dreckspuren auf, denn Torsten arbeitete bei den Harzer Schmalspurbahnen als Lokführer. Sie legte das Hemd aufs Bügelbrett.
»Du könntest das Kabel ein wenig hochhalten«, bat Heike, »damit keine Spannung darauf kommt. Ich bin ja gleich fertig, dann kannst du deine Hausaufgaben weiter machen.«
Marie war das beschädigte Kabel nicht geheuer und sie sorgte sich um ihre Mutter. Sicher ist sicher, dachte sie und führte es der Bügelbewegung nach, um es locker zu halten. Es war umständlich, aber funktionierte. Dann setzte Heike das Bügeleisen weiter vorne am Hemdkragen an. Marie konnte nicht so rasch folgen. Das Kabel straffte sich und riss mit einem knirschenden Geräusch aus dem Gehäuse. Marie griff reflexartig nach der Schnur. Sie rutschte durch ihre Finger, und auf einmal sah sie die blanken Kupferadern in ihrer Hand liegen. Für einen kurzen Moment war sie wie gelähmt. Sie spürte nichts mehr. Ihr Körper schien sich von ihrem Bewusstsein gelöst zu haben. Das Kabelende fiel zu Boden. Heike sprang mit einem Schrei zur Küchenzeile, riss den Stecker heraus. „Ist dir etwas passiert“, schrie sie.
Marie stand immer noch bewegungslos vor dem Bügelbrett und konnte es nicht fassen.
Als der Schreck sich legte, nahm Heike ihre Tochter in die Arme und seufzte: »Ein Glück. Die Sicherung ist bestimmt noch rechtzeitig rausgeflogen.«
Maries Schockstarre löste sich allmählich. Sie ging zur Küchentür und betätigte den Lichtschalter neben dem Türrahmen. Die Deckenlampe ging an.
»Die Sicherung ist nicht rausgeflogen«, murmelte Marie. »Normalerweise hätte ich einen gewischt kriegen müssen.«
»Kind«, flüsterte Heike, »ich will das gar nicht verstehen. Hauptsache, dir ist nichts passiert.«
Marie spürte Hitze in ihrem Gesicht. Wirre Gedanken gingen ihr durch den Kopf. So etwas hatte sie doch schon einmal erlebt, vor zwei Jahren. Damals waren plötzlich seltsame Dinge geschehen. Dieses sonderbare Leuchten in ihren Augen, und Kerzen, die sich von selbst entzündeten. Geht das jetzt wieder los? Bitte nicht, flehte sie im Stillen.
Marie lief zur Flurgarderobe und schaute in den Spiegel. War das Augenleuchten wieder da? Zum Glück nicht. Erleichtert ging sie zurück und setzte sich auf die Eckbank zu ihrer Mutter, die kreidebleich im Gesicht war.
Sie saßen eine Weile stumm zusammen. Marie wandte sich wieder den Hausaufgaben zu, und Heikes Gesicht bekam allmählich die Farbe zurück.
»Auf den Schrecken mach ich mir erst einmal einen Kaffee und für dich einen Kakao«, schlug Heike vor.
»Ich würde auch lieber einen Kaffee trinken«, meinte Marie und sah ihre Mutter aufrührerisch an. Der Blick sollte ihrer Mutter sagen: „Mama, aus dem Kakaoalter bin ich raus.“ Der schmeckte ihr zwar noch, aber wenn sie mit Freunden im Eiscafé zusammen war, tranken sie eh längst Cappuccino oder Latte Macchiato.
Heike wirkte überrascht. »In deinem Alter? Putscht dich das nicht zu sehr auf?«, fragte sie.
»Mama! Ich habe dich nicht um Drogen gebeten«, belehrte Marie ihre Mutter, »in meinem Alter trinkt man nicht mehr nur Pfefferminztee und Apfelsaft, sondern auch Cola, und da ist auch Coffein drin.«
Heike sah Marie eine Weile stumm an, dann begann sie zu lächeln und sagte: »Ja, du hast recht. Und außerdem ist Kaffee nicht so schädlich, hab ich neulich in einem Fernsehbericht gehört.« Sie ging an die Küchenzeile und schaltete die Kaffeemaschine ein.
Der Kaffee lief durch, und Marie stellte die Tassen auf den Tisch. Sie hörte die Gartenpforte quietschen. »Papa kommt«, ließ sie ihre Mutter wissen, ohne aufzublicken. Heike lachte jedes Mal, wenn Marie am Quietschton der Gartentür zu erkennen glaubte, wer gerade aufs Haus zukam. Meistens lag sie damit richtig.
»Endlich Feierabend und Wochenende«, rief Torsten über den Flur. Dann kam er in die Küche gestürmt, umschlang Heike von hinten und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Wir gehen heute Abend ins Kino«, sagte er, entließ sie aus der Umarmung und strich Marie sanft übers Haar. »Hi, Schatz!«, begrüßte er seine Tochter, »ist das okay für dich?«
Bevor Marie vor zwei Jahren von den Hexen entführt worden war, hatte sie sich über eine »sturmfreie Bude« gefreut. Seitdem jedoch hatte sie oft Angst, wenn sie allein im Haus war. Jedes fremde Geräusch konnte sie in Panik versetzen.
»Ja, ja, geht nur. Ich werde Sabine fragen, ob sie mir Gesellschaft leistet«, räumte sie seine Bedenken aus und griff zur Kaffeetasse.
»Wie, du trinkst Kaffee?«, fragte er besorgt, »putscht dich das nicht zu sehr auf?« Heike hielt sich die Hand vor den Mund, um ihr Grienen zu verbergen.
»Papaaa!«, ermahnte ihn Marie. »Weißt du, wie alt ich bin?«
»Entschuldigung! Ich will doch nur dein Bestes«, antwortete er.
»Eben!«, erwiderte Marie, »und dazu gehört auch ab und zu eine Tasse Kaffee. Möchtest du auch eine?«
»Aber nur eine, ich will gleich noch in meine Werkstatt«, sagte er und setzte sich mit an den Tisch. Marie holte eine weitere Tasse und schenkte den Kaffee ein. Torsten trank rasch aus und ging dann hinaus. Heike und Marie nahmen sich Zeit und redeten über dies und das. Irgendwann führte sie die Plauderei wieder auf den Neugeborenen Jonas.
»Wie war das eigentlich bei meiner Geburt?«, erkundigte sich Marie und goss noch etwas Kaffee nach.
»Du bist ja hier zu Hause zur Welt gekommen«, erzählte Heike lächelnd, »es ist schon fünfzehn Jahre her, aber mir ist, als sei es gestern gewesen. Einen solchen Moment vergisst man eben nie.« Sie strahlte. »Als ich dich zum ersten Mal in meinen Arm hatte, hast du mir kurz zugeblinzelt und ich sah ein wunderbares Leuchten in deinen Augen, nur ganz kurz. Aber da wusste ich: Du bist etwas Besonderes.« Heike legte ihre Hand auf Maries und seufzte.
»Ein Leuchten?«, Marie spürte, wie ihr Gesicht wieder heiß wurde. »Was für ein Leuchten, Mama?«
»So genau kann ich das nicht beschreiben. Normalerweise sind Babyaugen ja dunkel, sie bekommen erst später ihre richtige Farbe. Vielleicht hat sich auch nur das Licht darin gespiegelt. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass es etwas zu bedeuten hatte. Es war ein schönes Gefühl.«
Marie sah ihre Mutter verwundert an. »Das hast du mir noch nie erzählt.«
»Wirklich nicht? Aber jetzt weißt du es«, antwortete Heike und stellte die Tasse in den Geschirrspüler. »So, nun aber genug davon. Mach deine Hausaufgaben fertig. Ich geh noch mal eben nach oben.«
Oben im Dachgeschoss des kleinen Hauses in der Schulstraße war Heikes Nähzimmer, in dem sie ihre knappe Freizeit mit dem Schneidern von Sachen für Marie und Torsten verbrachte. Es war ihr leidenschaftliches Hobby. Maries Eltern hatten nicht immer gemeinsam freie Zeit, weil beide im Schichtdienst arbeiteten. Torsten als Lokführer und Heike in Teilzeit im Seniorenheim.
An Hausaufgaben war vorerst nicht mehr zu denken. Marie gingen der Vorfall mit dem Stromkabel und die Neuigkeit über ihre leuchtenden Babyaugen nicht aus dem Kopf. Was hatte das jetzt wieder zu bedeuten? Sie hatte sich vor zwei Jahren von dem schrecklichen Fluch lösen können. Seitdem war alles wieder normal gewesen. Fast jedenfalls, bis auf diesen Traum, der sie regelmäßig plagte.
Er begann immer damit, dass um sie herum alle Konturen zu einem grauen Nebel verschwammen. Wenn der Nebel sich auflöste, gab er den Blick auf einen Spiegel frei, aus dem sie zwei leuchtende Augen anstarrten. Sie erkannte: Es waren ihre eigenen! Das mystische Leuchten des Hexenblickes war stärker als zuvor. »Nein! Ich bin keine Hexe mehr!«, wollte sie schreien, doch sie brachte keinen Ton hervor. Dann wachte Marie schweißgebadet auf.
Ein schrecklicher Traum. Manchmal ging sie schon mit Angst ins Bett und konnte lange nicht einschlafen. Der Fluch hing ihr immer noch nach. Aber konnte überhaupt wieder alles normal werden? Damals war sie als Hexe aufgewacht, und auch wenn sie sich von dem Fluch hatte lösen können, war die Erinnerung immer noch belastend.
Gedankenversunken starrte sie vor sich hin. Von oben hörte sie das gleichmäßige Surren der Nähmaschine. Es wurde immer leiser.
Sie dachte an den Augenblick, als sie ihre Augen ohne den leuchtenden Hexenblick im Spiegel gesehen hatte. Es war wie die Befreiung aus der Hölle. Einen solchen Sturm der Gefühle hatte Marie noch nie zuvor erlebt. Diese Erleichterung, den Hexen entkommen zu sein, und die Genugtuung, sich gegen diese Teufelsbrut gewehrt zu haben, ließ ihr einen Gänsehautschauer über den Rücken laufen.
Bilder ihrer Entführung und der Gefangenschaft auf der Burg Anhalt, ihrer Qualen in der Kammer der stillen Finsternis und ihrem Kampf gegen eine dunkle Übermacht auf dem Brocken, rasten durch ihren Kopf. Sie hatte schreckliche Ängste während dieser Zeit ausgestanden.
Maries Augen füllten sich mit Tränen, aber sie wischte sie mit dem Ärmel ihres Shirts ab.
Was Marie trotz allem immer wieder tief bewegte, war, dass das Schreckliche für sie nie die Übermacht erlangt hatte, denn wo Feinde gewesen waren, hatte es auch Freunde gegeben. Das war ihre Rettung gewesen. Die beiden Hexen, Wanda und Anila, hatten sich mit ihr angefreundet und sogar verschworen. Trotz der Gefahr, selbst erwischt und bestraft zu werden, verhalfen sie ihr zur Flucht.
Und natürlich Bonzo. Marie musste bei dem Gedanken an ihn lächeln. Der kleine Mäuserich hatte sich als mutiger Held entpuppt. Ohne ihn hätte sie sich nie aus der Gewalt der Hexen befreien können. Er hatte es verdient, dass sie sich um ihn kümmerte. Er hatte ihr sogar auf dem Brocken mutig beigestanden. Seitdem lebte Bonzo bei den Stöbers, sozusagen in Rente. Nachdem Maries Eltern von seinen Taten wussten, hatte ihm ihr Vater ein Häuschen mit einem Labyrinth gebaut, in dem er sich verstecken und schlafen konnte. Marie verwöhnte ihn mit Käse, Wurst und was immer er sich sonst wünschte. Ironischerweise hatte er irgendwann sogar Geschmack an Katzenfutter gefunden.
Marie lächelte noch immer in Gedanken und kämmte sich mit den Fingern durch ihr fast schulterlanges Haar. Es war eine Idee von ihrer Mutter gewesen, die Haare länger wachsen zu lassen, nachdem sie Maries ständiges Jammern über ihre strubbelige Kurzhaarfrisur nicht mehr hatte hören können. Und es passierte das Unerwartete, die Haare lagen locker und füllig, sie mussten nur sorgfältig geföhnt werden. Selbst Felix ließ sich zu einem bewundernden »Wow« hinreißen, was aus seinem Mund ein nicht zu unterschätzendes Kompliment war.
Oh ja, Felix, dachte Marie, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Sie sah sein Gesicht ganz nah vor sich. Bei dem Gedanken an ihn fühlte sie sich wohl und spürte gleichzeitig ein Kribbeln im Bauch, das sie sich nicht erklären konnte. Vielleicht weil er für sie etwas Besonderes war, ein Vorbild und ein Kumpel, auf den sie sich blind verlassen konnte. Sie war so stolz und dankbar, ihn als Freund zu haben. Leider sah sie ihn nicht mehr so oft, nachdem er auf das Gymnasium in Ballenstedt gewechselt hatte. Er fuhr schon früh am Morgen mit dem Bus und kam erst spät nachmittags zurück. An den Wochenenden musste er lernen und die wenige Freizeit, die ihm blieb, nutzte er zum Fußballspielen. Er war jetzt siebzehn, sportlich, intelligent und sah nach Maries Empfinden sehr gut aus. Andere Mädchen fanden das allerdings auch und Marie ertappte sich dabei, dass sie sich aufregte, wenn andere nach ihm schielten oder schwärmerisch über ihn redeten. Es machte sie fast rasend, wenn er sich nach anderen umdrehte.
Marie öffnete die Augen wieder. Diese Gedanken waren ihr unangenehm. Sie hatte kein Recht, darüber zu urteilen. Ihre Freundschaft war zwar eng, aber rein platonisch, so wie bei Geschwistern eben. Oder doch nicht? Maries Gedanken stockten. Schließlich musste sie sich eingestehen, dass sich etwas verändert hatte. Sie sah in ihm nicht mehr nur den großen Bruder, sondern den Freund, den sie bewunderte und dessen Nähe sie sich wünschte. Nein, rügte sie sich selbst, an so etwas darf ich nicht denken. Wir sind gute Freunde, mehr nicht, und Felix sieht das sicher genauso. Ich darf das nicht kaputtmachen.
Wenn er nicht gewesen wäre, würde sie jetzt nicht hier vor ihren Hausaufgaben sitzen und träumen, sondern wahrscheinlich als Hexe in einer Parallelwelt auf der Burg Anhalt leben und mit den anderen über ihre »Ungute Verrichtung« prahlen.
Marie erschrak bei dem Gedanken. Sie sah auf die Uhr.
- 3 -
Bonzo hat bestimmt schon wieder Hunger und wartet auf sein Käsebrot, ging es Marie durch den Kopf. Sie packte ihre Bücher und Hefte in den Schulrucksack, belegte eine Scheibe Brot mit Käse und ging nach oben in ihr Zimmer. Bonzo lag auf Maries Schreibtisch auf dem Kissen, das Heike für ihn genäht hatte. Vor ihm stand eine kleine Futterschale, auf der noch ein Stück Käse lag.
»Was hat dir denn den Appetit verdorben, dass du nicht aufgegessen hast? Oder ist etwas nicht in Ordnung mit dir?«, erkundigte sich Marie. Dass Bonzo Essen übrig ließ, war neu für sie.
»Es ist so weit alles okay, nur mit zunehmendem Alter nimmt der Appetit ab«, gab Bonzo zur Antwort und ergänzte murmelnd: »Bis beides zum Stillstand kommt.«
»Was hast du gerade gesagt?«, fragte Marie irritiert.
»Ich meinte, dass DU lieber das Brot essen solltest. Sieh dich doch mal an!«
»Wieso? Was ist mit mir?«
»Na, so dünn, wie du bist«, flachste Bonzo.
»Schlank, bitte schön«, berichtigte Marie, »und ich bin stolz auf meine Figur. Dünn ist etwas anderes.«
»Egal, du musst mehr essen!«, mahnte er.
»Musst du gerade sagen«, konterte Marie und zeigte auf die Schale.
Irgendetwas stimmte mit ihm nicht, und sie machte sich Sorgen. Er war nicht mehr der Jüngste und seit geraumer Zeit auch nicht mehr annähernd so agil und frech wie sonst. Marie versuchte, den Gedanken zu verdrängen, denn sie hing sehr an diesem kleinen Tier und wollte alles tun, damit er noch viele Käsebrote essen konnte. Sie ging nach nebenan in das Nähzimmer ihrer Mutter, um Rat zu holen. »Mama, Bonzo leidet an Appetitlosigkeit, vielleicht sollten wir mal mit ihm zum Tierarzt. Was meinst du?«
Heike sah ihre Tochter mitfühlend an und sagte schließlich: »Appetitlosigkeit ist bei Mäusen eher ungewöhnlich. Aber sieh mal, er ist schon sehr alt und ...«
Marie wollte das nicht hören. Sie fuhr ihrer Mutter über den Mund: »Nein! So alt ist er noch nicht. Wir müssen mit ihm zum Arzt.«
Heike zögerte und schien zu überlegen. »Na gut, wenn es dich beruhigt«, antwortete sie, »dann fahr ich dich Montag zu Dr. Grobmeier nach Harzgerode.«
»Danke, Mama!« Marie lief zufrieden zurück in ihr Zimmer.
»Wir bringen dich am Montag zu Dr. Grobmeier. Er soll dich mal richtig untersuchen«, richtete sie Bonzo aus und drückte die Tür hinter sich zu. Keine Antwort. »Bonzo?« Nichts rührte sich. »Bonzo, wo steckst du?« Marie suchte das Zimmer ab. Er war nirgends zu entdecken. Sie lauschte eine Weile. Es blieb still, nur die Gardine wehte durch einen Windhauch wie ein Schleier über den Schreibtisch. Der Fensterflügel, den sie einen Spalt breit zum Lüften aufgemacht hatte, stand jetzt weit offen. Eine schlimme Ahnung beschlich Marie. Sie riss die Gardine zur Seite und schaute nach unten auf das Dach der Werkstatt, unterhalb des Hauses, und in den Garten. Auf einem Zaunpfahl zum Nachbargrundstück saß eine schwarze Katze und blickte mit ihren grünen Augen zu Marie hinauf. Sie erkannte sie sofort. Es war Brenda, die Katze der Oberhexe Odila und sie trug etwas zwischen ihren Fängen!
Marie schrie in Panik, rannte wie von Sinnen die Treppen hinunter und weiter hinaus in den Garten. Brenda war verschwunden. Marie lief auf die Straße, aus dem Dorf hinaus und in die Feldflur, bis kurz vor der Wegkreuzung, wo die Schutzhütte stand. Keuchend hielt sie Ausschau nach der Katze. Nach einigen Schritten blieb sie erschrocken stehen. Mitten auf der Kreuzung lag etwas Kleines, Pelziges. Marie stolperte darauf zu. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie blieb vor dem leblosen Körper stehen und wischte sich mit dem Ärmel über die Augen. Dann beugte sie sich hinunter und strich mit dem Finger über sein Fell. »Oh nein, Bonzo, mein kleiner Freund«, flüsterte sie und nahm ihn hoch. Sein weicher Körper war noch warm. Dicke Tränen rollten über Maries Wangen und tropften auf den Betonweg.
»Das ist erst der Anfang«, hörte sie plötzlich eine hämische Stimme hinter sich. Marie erkannte diese Stimme sofort und drehte sich um. Brenda saß auf dem Dach der Schutzhütte. Das vernarbte Gesicht der Katze kam ihr wie eine dämonische Fratze vor. Marie hätte am liebsten einen Stock nach ihr geworfen, wenn nicht Bonzo in ihren Händen gelegen hätte. So spuckte sie nach ihr aus. Dann drehte sie sich um und trug ihren toten Freund nach Hause.
Auf halbem Weg kamen ihr ihre Eltern entgegen.
»Marie!« Ihre Mutter sah sie besorgt an. »Warum bist so aus dem Haus gerannt? Was ist denn passiert?«
Wortlos streckte Marie ihren Eltern die Hände entgegen. Sie schauten, was dort lag, dann sahen sie in Maries tränenverschmiertes Gesicht. Stumm nahmen sie ihre Tochter in die Mitte und gingen zurück nach Hause.
Heike nähte einen kleinen Beutel und Torsten baute aus Sperrholzreststücken eine passende Schachtel. Sie bestatteten das liebgewordene Familienmitglied im Garten unter dem Apfelbaum. Eine bedrückende Stille herrschte für den Rest des Tages im Haus. Es wurde kaum geredet. Marie lag auf dem Bett und tippte eine SMS an Felix: »Bonzo ist tot.«
»Ich komme«, simste Felix sofort zurück. Zehn Minuten später hörte Marie Stimmen von unten. Kurz danach klopfte es an ihrer Zimmertür. Sie öffnete. Wortlos nahm Felix sie noch auf der Schwelle in die Arme und streichelte ihr sanft über den Rücken. »Das tut mir so leid, Marie. Wie konnte das passieren?« Er löste die Umarmung und sah sie mitfühlend an.
»Brenda hat ihn geholt«, schluchzte Marie.
»Brenda?« Felix klang erschrocken und setzte sich auf den Sessel. »Was hat die noch hier zu suchen? Verflixt!«
»Sie lassen mich nicht in Ruhe. Das sei erst der Anfang, hat sie gesagt.«
»Das verstehe ich nicht, was wollen die noch von dir? Jetzt nach zwei Jahren? Ich dachte, es ist endgültig vorbei.«
»Ich glaube nicht daran. Ich bin gespannt, was als Nächstes kommt.«, sagte Marie und sah ihn eindringlich an, doch Felix schien gar nicht richtig zuzuhören. „Ich habe Angst“, fügte Marie noch hinzu. Felix stand auf und machte Anstalten, zu gehen.
»Felix?«, rief sie irritiert.
»Es tut mir wirklich leid, Marie, aber ich habe gerade Besuch zu Hause und muss zurück. Annika ist da. Lass uns morgen weiter reden, okay?«
Marie war enttäuscht und ratlos. So kannte sie Felix gar nicht, dass er sie in einer solchen Situation im Stich ließ, und dann noch wegen eines anderen Mädchens.
»Annika? Kenn ich sie?«, fragte Marie und bemühte sich so zu tun, als wäre es ihr egal.
»Ich glaube nicht. Sie ist aus meiner Klasse und braucht etwas Nachhilfe in Physik«, erklärte Felix und verließ das Zimmer.
»Nur in Physik?«, rief sie ihm wütend nach und knallte die Tür zu.
So, so – Physiknachhilfe braucht diese Annika, dachte sie. Das scheint ihm wichtiger zu sein als meine Trauer um Bonzo. Enttäuscht legte sie sich aufs Bett und versuchte, die aufkommenden Tränen zurückzuhalten. Es gelang ihr nicht.
- 4 -
Wanda und Anila durften die Burg nicht mehr verlassen, nachdem sich Marie auf dem Brocken von dem Fluch hatte befreien können. Man warf ihnen vor, Marie zur Flucht verholfen zu haben. Das stimmte zwar, aber sie gaben es nie zu. So wurde die Burg zu ihrem Gefängnis, und sie wussten nicht, wie lange noch. Diese Ungewissheit fraß an ihrem Widerstand, die Strafe geduldig zu ertragen. Sie sehnten sich nach dem freien Hexenleben und nach Marie. Nach seiner Niederlage im Kampf gegen Marie hatte sich Rahim auf der Burg nicht mehr blicken lassen. Wanda empfand Schadenfreude bei dem Gedanken, dass er Zeit brauchte, um sich von der Niederlage zu erholen.
Doch nun war er wieder da, und sie standen vor ihm. Er saß auf dem Teufelsthron und starrte mit tiefschwarzen Augen scheinbar durch sie hindurch. Nach einer Weile des Schweigens begannen die Augen zu glühen. Wanda und Anila fassten sich fest an den Händen und sahen Rahim mit erhobenen Köpfen an. Wanda spürte das Zittern von Anilas Hand. Sie griff fester zu, um ihrer Freundin Mut zu machen, hatte aber selber Mühe, ihre Angst im Zaum zu halten.
»Ihr habt euch einer Sache bemächtigt, die mir gehört und ich verlange sie zurück«, sagte er mit frostiger Stimme.
»Sie ist an einem sicheren Ort aufgehoben«, antwortete Wanda kaum hörbar. Sie traute sich nicht, sich zu bewegen, aber sie wusste, sie hatten mit der Fluchtafel einen Trumpf in der Hand.
»Kein Ort ist sicherer als bei mir.« Seine Stimme wurde lauter. »Sagt mir, wo ich sie finde, bringt sie mir, oder euch erwarten unsägliche Qualen in der Kammer der stillen Finsternis.« Beide zuckten bei dieser Drohung zusammen. Sie hatten es geahnt. Das war die einzige Waffe, die er noch gegen sie einsetzen konnte. Die Kammer würde sie willenlos machen und wer konnte sagen, ob sie ihm hinterher nicht sogar das Versteck der Fluchtafel verraten würden. Das durfte niemals geschehen.
»Wir holen sie«, versprach Wanda. Sie tat so, als hätte sie überhaupt keine Bedenken mehr. Anila sah sie entgeistert von der Seite an und drückte ihre Hand so fest, dass es ihr fast wehtat. »Das ist nicht dein Ernst«, flüsterte sie ihr zu.
Rahims Augen glühten inzwischen weiß. »Ihr werdet diesen Ort nicht verlassen, bis ich die Tafel in meiner Hand halte«, brüllte er, erhob sich und kam auf sie zu. »Eine andere wird für euch gehen.«
»Wir werden niemandem den Ort verraten. Du musst uns schon gehen lassen«, rief Wanda entschlossen und wich vor ihm zurück.
»Ihr habt mir keine Bedingungen zu stellen«, donnerte er. Seine Stimme ließ die Bilder an der Wand schaukeln wie bei einem Erdbeben. Dann wurden seine Augen wieder abgrundtief schwarz. Wanda und Anila lief ein Schauer über den Rücken.
»Bringt mir die Tafel, sonst werdet ihr auf ewig in Luzifers Abgrund schmoren«, raunte er drohend und verließ das Gebäude.
***
Mitten auf dem Burghof streckte er seine Arme in die Luft und zischte, kaum hörbar, einen Fluch gen Himmel. Die Luft begann zu vibrieren und lud sich immer stärker elektrisch auf, sodass sie hoch über der Burg wie ein Nordlicht flimmerte. Rahim erhob sich vom Boden, schwebte entlang der Mauern zum Burgbrunnen und verschwand darin. Ein grünliches Licht glomm kurz aus der Tiefe heraus, dann erlosch es.
- 5 -
»Hast du sie noch alle?«, fuhr Anila Wanda an, als sie zurück in ihrem Zimmer waren. »Wir können doch nicht einfach die Tafel holen und sagen: Hier bitte schön, lieber Rahim, hast du deine Tafel. Damit würden wir uns ihm ausliefern.« Sie ließ sich entnervt auf ihr Bett sacken. Wanda lief nervös auf und ab.
»Genau das wird auch passieren, wenn wir willenlos aus der Kammer zurück sind«, entgegnete sie. »Und hinterher werden wir sogar den Schwur mit Marie lösen, das finde ich noch entsetzlicher.«
»Das war es dann also«, seufzte Anila, verbarg ihr Gesicht in den Händen und schluchzte. »Auch unsere Freundschaft wird dann vorbei sein.«
Wanda strich Anila über das lange, schwarze Haar. »Niemals wird unsere Freundschaft enden, auch nicht der Schwur mit Marie«, tröstete sie ihre Freundin.
»Es ist ausweglos. Er wird uns in die Kammer der stillen Finsternis schicken. Wir können es nicht verhindern«, jammerte Anila und drückte wieder ihre Hände vors Gesicht. Wanda streichelte ihr zur Beruhigung über die Oberarme und überlegte.
»Doch, können wir«, sagte sie mit fester Stimme. »Bevor uns die Kammer vernichtet, müssen wir sie vernichten.«
Anila blickte aus ihren braunen Augen zu Wanda auf. Falten bildeten sich auf ihrer Stirn. »Ich glaube, das habe ich jetzt nicht verstanden«, gab sie zu. Wanda rückte den Schreibtischstuhl ans Bett und setzte sich. »Na ja, ist nur so eine Idee, aber ich bin sicher, sie ist auch unsere einzige Chance. Wir müssen die Kammer vernichten.«
Anila schnellte von der Bettkante hoch. »Vernichten?«, fragte sie verständnislos. »Hab ich das eben richtig gehört? Du willst die Kammer vernichten? Wie denn?« Anila blieb stehen und schüttelte den Kopf. Wanda wusste, was sie dachte: Was ist das bloß für eine verrückte Idee? Die Kammer der stillen Finsternis befand sich im Bergfried der Burg, einem zwanzig Meter hohen Turm mit Mauern so dick wie ein Bunker.
»Wir werden die Kammer verbrennen«, sagte Wanda.
»Verbrennen?« Anila setzte sich wieder auf die Bettkante. »Einen Turm aus Stein mit einer Tür aus Eisen. Verbrennen? Wie soll das denn gehen?« Sie lachte gekünstelt und schüttelte den Kopf.
Wanda beugte sich dicht zu Anila vor. »Der Dachstuhl, die Zwischendecke und die Treppen sind aus Holz, trocken wie Zunder. Heute Nacht brennt alles lichterloh.«
»Heute Nacht schon? Wir brauchen doch Zeit zur Vorbereitung«, gab Anila zu bedenken.
»Je eher, desto besser«, meinte Wanda, »wenn wir erst in der Kammer sitzen, ist es zu spät. Wir improvisieren, ich weiß auch schon wie.« Anila schaute Wanda fragend an. Dann sagte sie: »Ja, und wie – darf ich das vielleicht auch erfahren?«
Wanda grinste. »Warum bist du nur immer so skeptisch? Nimm dir ein Beispiel an Marie. Wie entschlossen und kämpferisch sie sich widersetzte. Obwohl sie noch so jung war und viel ertragen musste, hat sie sich nie unterkriegen lassen. Sie hat hier einiges verändert.«
»Du hast recht. Entschuldige«, lenkte Anila ein.
»Wir sind Hexen«, versuchte Wanda, sie weiter zu ermutigen. »Wir können Dinge schweben, sie herunterfallen, sie umkippen lassen. Damit lässt sich doch ein prächtiges Feuer entfachen, meinst du nicht auch?« Dann erklärte sie Anila ihren Plan.
- 6 -
Um zwei Uhr klingelte der Wecker. Wanda drückte ihn sofort aus. Sie hatte ohnehin nicht geschlafen vor Aufregung. »Anila, bist du wach?«, flüsterte sie.
»Ich bin noch gar nicht eingeschlafen«, antwortete Anila. Sie streckte die Hand aus, um eine Kerze anzuzünden.
»Kein Licht! Das könnte uns verraten«, fuhr Wanda Anila an. Die pustete das Streichholz sofort wieder aus. Sie stiegen aus ihren Betten und zogen sich an, was im Dunkeln nicht so einfach war. »Bist du fertig?«, fragte Anila und tastete mit der Hand nach ihrer Zimmerkameradin.
»Ja, ich bin hier«, flüsterte Wanda, tastete ebenfalls herum, bis sich ihre Hände berührten.
Am Abend zuvor hatten sie eine Petroleumlampe mit Nachfüllkanister neben der Tür bereitgestellt.
Hand in Hand gingen sie zum Ausgang, wo sie die Petroleumlampe und den Kanister nahmen. Wanda öffnete die Tür, erst nur einen Spalt, dann lauschte sie in den Laubengang hinaus. Nur das Säuseln des Windes war zu hören, sonst rührte sich nichts. Wanda ging auf Zehenspitzen auf den Gang hinaus und sah sich um. Dann winkte sie Anila nachzukommen, und drückte hinter ihr die Tür vorsichtig wieder zu. Die kühle Luft ließ sie frösteln. Um laute Geräusche zu vermeiden, schlichen sie zur Treppe, die zum Hof hinunter führte. Die Fackeln und Öllampen, die abends die Gänge und den Hof spärlich beleuchteten, waren bereits gelöscht worden. In dieser mondlosen Nacht konnten sie die Hand vor Augen kaum sehen. Nur hier und da blinzelten grüne Augenpaare der Katzen auf Mäusejagd aus der Dunkelheit hervor. »Hoffentlich ist Brenda nicht dabei, sie könnte uns verraten«, befürchtete Anila.
Wanda blieb stehen. »Ja, du hast recht, an die habe ich überhaupt nicht gedacht.«
»Was machen wir nun?«, flüsterte Anila. Wanda überlegte kurz und entschied dann: »Wir ziehen das trotzdem durch. Jetzt oder nie.« Anila war sichtlich unschlüssig, doch Wanda legte die Hand auf ihre Schulter. »Denk an Marie«, sagte sie.
Stufe für Stufe gingen sie die Treppe hinunter und drückten sich unten an der Außenwand des Wohngebäudes entlang bis zur Quermauer, die den Hof in zwei Bereiche teilte. Der Bergfried stand auf der gegenüberliegenden Seite.
Angespannt schlichen sie dicht an der Mauer weiter, blieben immer wieder stehen und lauschten mit angehaltenem Atem in die Nacht hinein. Doch nur ein Windhauch war zu hören und manchmal das zarte Flattern einer Fledermaus. Sie gingen lautlos. Ihre Augen hatten sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt, sodass sie schemenhaft die Burganlage erkennen konnten. Wie ein unheilbringender Schatten reckte sich der wuchtige Turm des Bergfrieds vor ihnen in den Nachthimmel. Nur wenige Schritte waren sie noch von ihrem Ziel entfernt, als Anila stehen blieb und Wanda am Ärmel zupfte.
»Ich glaube, wir werden beobachtet«, flüsterte sie. Wanda schaute sich um. Nichts bewegte sich, kein Lichtschein war zu sehen. Alles schien friedlich. Zu friedlich. Sie spürte diese ungewöhnliche Stille, die wie ein Gespenst über der Burg lag.