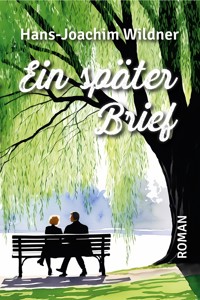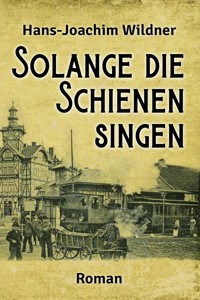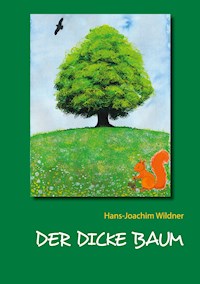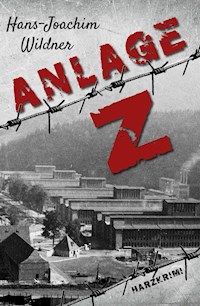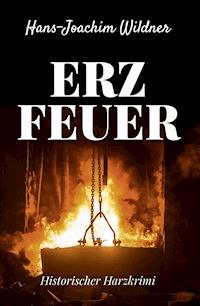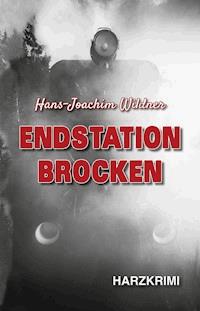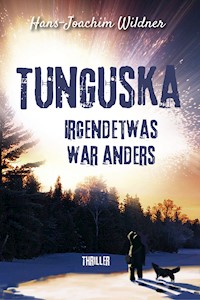
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elektronik-Praktiker
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Irgendetwas war anders am 30. Juni 1908 in Sibirien. Jeder spürte es. Dann vernichtet eine gewaltige Explosion eine riesige Waldfläche in der Tunguska-Region. Die Ursache des Ereignisses bleibt rätselhaft. Doch die Katastrophe hat etwas wachgerufen, was nach menschlichem Ermessen nicht sein kann und besonders den Vatikan nervös macht. Er hüllt sich in Schweigen. Als 1949 in der Wüste von Nevada ein Versuchsflugzeug abstürzt, fördert der Einschlagkrater etwas ans Licht, was Militär und Geheimdienste in Panik versetzt. Sie greifen zu äußersten Mitteln, um die Wahrheit zu vertuschen. Mitwisser geraten in tödliche Gefahr. Eine letzte Expedition im Jahr 2019 nach Sibirien soll das Rätsel des Tunguska-Ereignisses endgültig lösen. Dabei gelingt einem deutschen Wissenschaftler eine unglaubliche Entdeckung, die die Weltordnung bedrohen könnte. Darf die Wahrheit ans Licht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Joachim Wildner
Thriller
Es sind viele andere Lebensformen möglich,
allerdings scheint es, als ließen die Zahlenwerte, die
die Entwicklung intelligenten Lebens ermöglichen, wenig Spielraum.
Stephen W. Hawking: Eine kurze Geschichte der Zeit
Impressum
Tunguska - Irgendetwas war anders
ISBN 978-3-96901-027-3
epub Edition
V1.0 (10/2022)
© 2022 by Hans-Joachim Wildner
Abbildungsnachweise:
Umschlagmotiv © MondolithicxStudios/Novapix/Leemage |
#0073281592 | imago-images.de
Aufstellung der verwendeten Abbildungen: siehe hier
Lektorat & dtp:
Sascha Exner
Verlag:
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsgesellschaft mbH
Obertorstr. 33 · 37115 Duderstadt
Fon: +49 (0)5527/8405-0 · Fax: +49 (0)5527/8405-21
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis:
Bei den Schauplätzen dieses Romans handelt es sich um reale Orte. Die Handlung und die Charaktere hingegen sind bis auf einige wenige Ausnahmen frei erfunden. Hierzu zählt u.a. die historische Persönlichkeit des Leonid Alexejewitsch Kulik, der im Jahre 1927 als Geologe die erste Forschungsexpedition in das Tunguska-Gebiet geleitet hat. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen wären reiner Zufall und sind nicht beabsichtigt.
Inhaltsverzeichnis
TITELSEITE
IMPRESSUM
TEIL I - SIBIRIEN - 1908-1929
1 - DIENSTAG, 30. JUNI 1908 - IN DER NÄHE VON WANAWARA, SIBIRIEN
2 - DIENSTAG, 30. JUNI 1908 - FORSCHUNGSSTATION DER SCHIERA, SIBIRIEN
3 - DIENSTAG, 30. JUNI 1908 - WANAWARA, SIBIRIEN
4 - DIENSTAG, 30. JUNI 1908 - IN DER NÄHE VON WANAWARA, SIBIRIEN
5 - 1927 - WANAWARA, SIBIRIEN
6 - OKTOBER 1928 - KRASNOJARSK, SIBIRIEN
7 - ZUR SELBEN ZEIT - HAUPTQUARTIER DER MILIZ, KRASNOJARSK, SIBIRIEN
8 - APRIL 1929 - KRASNOJARSK, SIBIRIEN
9 - MITTWOCH, 17. APRIL 1929 - VATIKAN, ROM, ITALIEN
TEIL II - VEREINIGTE STAATEN - 1949
1 - MITTWOCH, 1. JUNI 1949 - AIR FORCE TESTGELÄNDE, NEVADA, USA
2 - FREITAG, 3. JUNI 1949 - REDAKTION ›DESERT NEWS‹, SALT LAKE CITY, UTAH
3 - FREITAG, 3. JUNI 1949 - TONOPAH AIRPORT, NEVADA
4 - DIENSTAG, 7. JUNI 1949 - TONOPAH AIRPORT, NEVADA
5 - MITTWOCH, 8. JUNI 1949 - TONOPAH AIRPORT, NEVADA
6 - FREITAG, 10. JUNI 1949 - LAS VEGAS AIR FORCE BASE, NEVADA
7 - SAMSTAG, 11. JUNI 1949 - PRESSEHAUS DER DESERT NEWS, SALT LAKE CITY, UTAH
8 - MONTAG, 20. JUNI 1949 - TONOPAH AIRPORT, NEVADA
9 - FREITAG, 24. JUNI 1949 - UNIVERSITY OF UTAH, SALT LAKE CITY
10 - DIENSTAG, 5. JULI 1949 - AREA 51, NEVADA
11 - FREITAG, 8. JULI 1949 - SALT LAKE CITY, UTAH
12 - SAMSTAG, 9. JULI 1949 - PENTAGON, ARLINGTON, VIRGINIA
13 - SAMSTAG, 9. JULI 1949 - DESERT NEWS, SALT LAKE CITY, UTAH
14 - SAMSTAG, 9. JULI 1949 - PENTAGON, ARLINGTON, VIRGINIA
15 - SAMSTAG, 9. JULI 1949 - DESERT NEWS, SALT LAKE CITY, UTAH
16 - SAMSTAG, 9. JULI 1949 - POTOMAC RIVER, WASHINGTON D.C.
17 - SAMSTAG, 9. JULI 1949 - SALT LAKE CITY, UTAH
18 - SAMSTAG, 9. JULI 1949 - WASHINGTON D.C.
19 - SAMSTAG, 9. JULI 1949 - PENTAGON, ARLINGTON, VIRGINIA
20 - SONNTAG, 10. JULI 1949 - WASHINGTON D.C.
21 - DIENSTAG, 12. JULI 1949 - PROVO, UTAH
22 - MONTAG, 18. JULI 1949 - LIBERTY PARK, SALT LAKE CITY
TEIL III - FRANKREICH - 1949
1 - MONTAG, 18. JULI 1949 - LE HAVRE, FRANKREICH
2 - DIENSTAG, 19. JULI 1949 - CAFÉ DE FLORE, PARIS
3 - DONNERSTAG, 21. JULI 1949 - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, PARIS
4 - MONTAG, 1. AUGUST 1949 - SORBONNE, PARIS
5 - DONNERSTAG, 4. AUGUST 1949 - VATIKAN, ROM, ITALIEN
6 - FREITAG, 12. AUGUST 1949 - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, PARIS
7 - FREITAG, 12. AUGUST 1949 - RUE VISCONTI, PARIS
8 - FREITAG, 12. AUGUST 1949 - ESIRA-STATION, PARIS
9 - MITTWOCH, 17. AUGUST 1949 - PARIS
10 - MONTAG, 22. AUGUST 1949 - EIFFELTURM, PARIS
TEIL IV - DEUTSCHLAND - 2019
1 - MITTWOCH, 5. MÄRZ 2019 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT CLAUSTHAL-ZELLERFELD, DEUTSCHLAND
2 - DONNERSTAG, 6. MÄRZ 2019 - NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK, GÖTTINGEN
3 - DIENSTAG 2019, 13. AUGUST - FLUGHAFEN FRANKFURT AM MAIN
4 - SAMSTAG, 17. AUGUST 2019 - WANAWARA, SIBIRIEN
5 - DIENSTAG, 24. SEPTEMBER 2019 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
6 - DONNERSTAG, 26. SEPTEMBER 2019 - TECHNISCHE UNIVERSITÄT, CLAUSTHAL-ZELLERFELD
7 - FREITAG, 11. OKTOBER 2019 - UNIVERSITÄT GÖTTINGEN
ANHANG
ÜBER DEN AUTOR
MEHR VON HANS-JOACHIM WILDNER
EINE KLEINE BITTE
ABBILDUNGSNACHWEISE
1
Dienstag, 30. Juni 1908
In der Nähe von Wanawara, Sibirien
Irgendetwas war anders. Aber was? Andrej Jakowitsch konnte es nicht genau benennen. Er stand am Fenster seiner selbstgezimmerten Blockhütte und schaute hinaus. Raureif verzierte die Sträucher und Moose der Lichtung mit einer glitzernden Kruste. Der nächtliche Frost hatte selbst die Kiefern und Fichten ringsum mit einer funkelnden Kristallschicht überzogen. Aber das war es nicht, was seine Aufmerksamkeit weckte. Es war diese ungewöhnliche Ruhe, die wie ein Geheimnis über der Taiga lag. Wo waren die Vögel geblieben, die ihn und Lidia in den Sommermonaten mit ihren Liedern aus dem Schlaf holten? Warum pfiff der Wind nicht durch das Nadeldickicht des Waldes und ließ die Äste knarren? Ein wolkenloser Himmel wölbte sich über das Land, als wolle er es behüten. Warum war es so beunruhigend still?
Andrej strich sich gedankenverloren über den Vollbart und lauschte weiter, ob nicht doch ein Geräusch zu hören sei, aber die Taiga schwieg. Ein ungutes Gefühl beschlich ihn. Selbst der Hund kauerte zusammengerollt in seiner Nische hinter dem Ofen, drückte den Kopf auf den Boden und blinzelte zu seinem Herrchen auf.
Es war nicht die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, auch nicht die Stille der Abgeschiedenheit seiner Behausung inmitten der sibirischen Taiga, die sonst nur Väterchen Frost zum Schweigen brachte. Nein, es musste etwas anderes sein, etwas Großes, Bedrohliches. Das spürten er und auch der Hund, der offenbar ein aufziehendes Unheil witterte und vor sich hin fiepste.
»Du solltest beizeiten die Fallen kontrollieren, anstatt mit Kinderaugen aus dem Fenster zu gucken? Oder hat dir die Taiga den Kopf verdreht?«
Andrej wandte sich zu seiner Frau um, die das Feuer in dem großen Kaminofen schürte. Der Schein der Flammen leuchtete über ihr Gesicht und ihre Hände, die von der Härte Sibiriens und dem kärglichen Leben in dieser Wildnis gezeichnet waren. Trotzdem war sie eine schöne Frau, eine starke Frau. Und sie war klug. Andrej entging es nicht, wenn beim Marktbesuch in Wanawara andere Männer nach ihr schielten.
»Lidia Aljonowna, DU hast mir den Kopf verdreht«, antwortete er und lächelte. »Aber wenn die Taiga schweigt, ist es entweder Winter oder Gefahr droht. Und sie schweigt heute Morgen.«
Lidia schloss die Ofenklappe, stellte sich neben ihren Mann und beide lauschten einen Moment in die Stille hinaus. Aber nur das leise Fipsen des Hundes war zu hören.
»Wenn du von Gefahr sprichst, meinst du aufgeschreckte Bären oder Elche, vielleicht auch Mückenschwärme, wenn sie so groß sind, dass sie die Sonne verdunkeln? Oder von welcher Gefahr sprichst du?«, fragte Lidia und schmiegte sich an ihn.
»Ich kann es dir nicht sagen, Lidia, es ist so eine Ahnung, weißt du? In letzter Zeit bleiben immer mehr Fallen leer. Selbst der Pelzhändler Piotr Antonowitsch in Wanawara klagt darüber. Hängt das vielleicht mit dieser ungewöhnlichen Ruhe zusammen?«
»Die Tiere verstehen die Stimme der Natur besser als wir Menschen. Die Taiga ist alles, was wir haben, sie ist unser Leben. Geh und finde heraus, was sie uns sagen will.«
Lidia ging zurück und griff prüfend an die Zobelfälle, die auf Holzgestellen aufgespannt von der Decke hingen, und nahm drei davon herunter. »Sie sind trocken«, sagte sie und zog sie von den Spannrahmen ab. Andrej stopfte sich derweil eine Pfeife, zündete sie an und schlüpfte in die Lederstiefel. Sofort sprang der Hund bellend auf, rannte zur Tür und wedelte aufgeregt mit dem Schwanz. Andrej zog die Rentierfell-Jacke über und schulterte sein Mosin-Nagant-Repetiergewehr.
»Ich bin in drei Stunden zurück«, sagte er zu Lidia und drückte sie fest an sich, was er selten tat, wenn er die Hütte verließ.
»Na, na, was für Gedanken hegst du so früh am Tag, Andrej Jakowitsch? Heb dir das für später auf«, erwiderte sie.
Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn und trat vor die Tür. Die frostige Morgenluft krallte sich in sein Gesicht. Andrej sah sich einen Augenblick um. Im Osten kroch der rosa Schein des ersten Sonnenlichtes über die Wipfel. Der Himmel war klar wie lange nicht mehr. Doch kein Insekt schwirrte umher, keine Spinne krabbelte zwischen den Zweigen der Büsche. Das Leben schien sich zurückgezogen zu haben.
Und dann spürte er es plötzlich, ein leichtes Vibrieren im Boden, sodass der Raureif von den Bäumen rieselte. Kleine Erdbeben waren nichts Ungewöhnliches in diesem Gebiet, aber dies fühlte sich anders an. Der Hund drängte zurück zum Haus und jaulte vor der Tür. Lidia kam herausgeeilt. »Was war das eben?«, fragte sie. Der Hund zwängte sich sogleich an ihren Beinen vorbei ins Haus, sodass sie sich festhalten musste, um nicht umgestoßen zu werden.
»Nur ein Erdstoß, weiter nichts«, sagte Andrej. »Sei unbesorgt. Ich lass den Hund zurück, damit du nicht allein bist. Er ist mir heute eh keine Hilfe.« Er rückte den Gewehrriemen zurecht und begann seinen Weg in nördlicher Richtung. Drei Werst1 von hier hatte er die ersten Fallen aufgestellt.
»Gib auf dich acht«, rief Lidia ihrem Mann nach.
Nach wenigen Schritten tauchte Andrej in den dichten Kiefernwald ein, der die Lichtung umschloss, auf der er die Hütte erbaut hatte. Er folgte dem Pfad, der sich im Lauf der Jahre im Unterholz ausgetreten hatte und ihn zu den Stellen führte, wo die Fallen auf ihre Opfer warteten. In dieser Jahreszeit bekam er nur wenige Kopeken für die Felle. Winterfelle waren begehrter und brachten gutes Geld. In den frostfreien Monaten stellte er hauptsächlich den Bibern nach, deren Pelze das ganze Jahr über gleichmäßig dicht blieben. Außerdem schmeckte ihr Fleisch.
Der Nadelwald wandelte sich bald in einen Mischwald aus Birken, Erlen und Wacholderbüschen. Diese Gegend war sumpfig und von unterschiedlich großen Wasserflächen durchzogen, auf denen der Nachtfrost eine dünne Eisschicht zurückgelassen hatte. Aber sie glänzte nicht in der Sonne und spiegelte nicht wie sonst den Himmel wider. Andrej blieb verwundert stehen und betrachtete die Eisfläche, die zu lauter kleinen Scherben zersprungen war. Es sah aus wie ein feines Mosaik aus Glas. In diesem Zustand hatte er die Eisschicht noch nie gesehen. Was ist hier passiert?, überlegte er. War die ungewöhnliche Vibration, die vorhin den Boden erzittern ließ, dafür verantwortlich? Andrej kannte die Zeichen der Natur nur zu gut, aber das hier war ihm völlig fremd, und das machte ihm Angst. Er hatte Ehrfurcht vor der rauen Wildnis und war sich seiner Abhängigkeit und der Gefahren bewusst. Doch er fürchtete weder die klirrende Kälte im Winter noch die unerträgliche Hitze des Sommers, und zu stärkeren Tieren hielt er respektvollen Abstand. Aber jetzt wurde zum ersten Mal das Vertrauen in seinen Lebensraum erschüttert. Wie sollte er diese befremdlichen Zeichen deuten? Andrej entschloss sich, seinen Weg fortzusetzen, nur aufmerksamer als sonst und immer auf der Hut. Doch nichts rührte sich – keine Wildente flatterte auf, kein Kaninchen wurde aufgeschreckt und rannte davon. Es kam ihm vor, als sei er in eine fremde Welt geraten.
Seit seiner Geburt lebte er in der Unendlichkeit Sibiriens. Schon sein Vater hatte die Familie als Pelzjäger ernährt. Von ihm lernte er, in und von der Natur zu leben und sich deren Rhythmus anzupassen. So wurde er rasch ein Teil von ihr. Vor zwölf Jahren hatte er sich zusammen mit Lidia in dieser Einsamkeit die Hütte gebaut. Es gab weit und breit keine Nachbarn. Auf seinen Beutezügen traf er manchmal auf Ewenken, die verstreut in Zelten lebten und deren Schamanentrommeln ab und zu durch die Taiga schallten.
Und dann gab es noch diese geheimnisvollen Stammesleute, die sich selbst Schiera nannten. Sie lebten zurückgezogen und mieden den Kontakt zu Fremden. So rankten sich allerhand Gerüchte um sie und ihre geheimnisumwitterte Lebensweise schürte Vorurteile, die ihnen den Ruf einbrachten, sie seien zwielichtig und man müsse sich vor ihnen in acht nehmen. Andrej war bisher keinem von ihnen begegnet, nicht einmal in Wanawara, der kleinen Handelssiedlung am Ufer der Steinigen Tunguska. Dieser Ort war für Andrej die alleinige Verbindung zur Außenwelt, zu anderen Pelzjägern, Rentierzüchtern und Händlern.
Er blieb abermals stehen und horchte. Das einzige vertraute Geräusch, das er jetzt wahrnahm, war das Rauschen der Chamba, die sich nicht weit von hier durch die Taiga schlängelte und der Steinigen Tunguska zufloss. Das gewohnte Glucksen der Wellen gab ihm das Gefühl, dass die Welt, wie er sie kannte, doch noch existierte. Der Fluss war fischreich und auch bei den Bären als Nahrungsquelle begehrt. Um sein Kommen anzukündigen, klopfte er mit einem Stock gegen die Baumstämme, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich in den Wald zurückzuziehen. Diese Methode hatte sich bewährt.
Versteckt im Uferbereich, wo die Biber ihr Revier hatten, hatte Andrej vor zwei Tagen Lebendfallen aufgestellt, die er zuerst inspizieren wollte. Er kannte die Fährten der Tiere und hatte die getarnten Fallen wie einen Durchgang in ihren Pfade platziert. Dann musste er nur einige Tage warten.
Andrej folgte der Biberspur in westlicher Richtung, die an dem einzigen Felsen dieser Region vorbeiführte, der wie ein Monolith aus dem Boden ragte. Er war weit und breit die höchste Erhebung in der Landschaft und alle nannten ihn den verrückten Fels, weil Kompassnadeln hier keine erkennbare Himmelsrichtung anzeigten. Andrej hatte in der Nähe zwei Fallen gesetzt. Entlang der Fährte fand er einige frisch angenagte Bäume. Ein Zeichen, dass die Biber hier bis vor Kurzem aktiv gewesen waren, und er hoffte auf einen ergiebigen Fang. Aber so weit kam es nicht mehr. Wenige Schritte vor ihm bewegten sich die Wacholderbüsche so, als schleiche ein Tier darin herum – vielleicht ein Biber. Doch plötzlich trollte ein Bärenjunges aus dem Gebüsch, sah ihn erschrocken an und jaulte nach der Mutter.
Andrej erstarrte vor Schreck. Warum hatten die Bären sein Klopfen ignoriert? Konnte er sich denn heute auf nichts verlassen, was ihn seine Erfahrung gelehrt hatte? Er wusste, dass die Bärin ihr Junges nie aus den Augen lassen würde und hatte ihn als Feind längst im Blick. Nur wenige Saschen2 hinter ihm brüllte sie auch schon ihren Drohruf. Andrej verstand augenblicklich, was das für ihn bedeutete. Sein Herzschlag schnellte nach oben und schien ihm die Brust zu zerreißen. Was sollte er tun? Das Gewehr, das er auf dem Rücken trug, durchzuladen und in Anschlag zu bringen, würde zu lange dauern. Hätte er doch bloß den Hund mitgenommen, der hätte die Bärin für eine Weile in Schach gehalten, aber so blieb ihm nur eine Chance – die Flucht.
In dem verrückten Felsen war eine schmale Spalte, die sich zu einem Hohlraum weitete. Dort drinnen hatte er einmal vor einem Unwetter Schutz gesucht. Der Zugang war etwa zwanzig Saschen entfernt. Wenn er sofort losrennen würde, bevor die Bärin angriff, könnte ihm das ein bis zwei Saschen Vorsprung verschaffen, um den rettenden Unterschlupf zu erreichen. Er hatte den Gedanken kaum beendet, als er unvermittelt losrannte. Die Bärin brüllte auf und Andrej hörte, wie sie antrabte. Ihre Tatzen donnerten in wildem Rhythmus über den Boden. Bären waren schneller als der beste Läufer, und wenn sie ihn erwischen würde, dann ... Im Gedanken spürte er bereits die Fangzähne in seine Kehle eindringen, und das verlieh ihm zusätzliche Kräfte. Er streifte sein Gewehr ab, warf es hinter sich und hoffte, dass würde die Bärin kurz ablenken. Doch es schien sie nicht zu beeindrucken, ihr Schnauben kam näher und näher.
Noch fünfzehn Saschen, dem Tod zu entkommen.
Jeder Atemzug fühlte sich an wie ein weiteres geschenktes Leben, das vielleicht das Letzte sein konnte. Äste schlugen ihm ins Gesicht, Dornen rissen die Haut auf. Die Angst lähmte jede Empfindung.
Noch sieben Saschen.
Die Bärin schien jetzt direkt hinter ihm zu sein. Ihr Brüllen dröhnte in seinen Ohren wie der Donner eines einschlagenden Blitzes. Ihm war, als spüre er bereits ihren heißen Atem im Nacken.
Noch drei.
An einigen dicht stehenden Birken musste er sich noch vorbeischlängeln, dann war die Felsspalte greifbar nah. Das Labyrinth der Bäume zwang auch die Bärin, ihren Trab zu verlangsamen. Andrej schöpfte Hoffnung. Gleich hatte er den Felsen erreicht, doch plötzlich stoppte etwas abrupt seine Flucht. Es fühlte sich an, als hätte die Bärin den Rucksack gepackt und würde ihn rücklings umreißen. Andrej schrie auf und drehte sich entsetzt um. Die Bärin steckte jedoch ein Stück hinter ihm zwischen zwei Baumstämmen, brüllte und schlug wild um sich. Dann bemerkte er, dass sich der Schulterriemen seines Rucksackes an einem Aststummel verfangen hatte. Er drehte sich rasch aus dem Riemen heraus und rannte dem Felsen entgegen. Offenbar gleichzeitig hatte sich die Bärin befreit und sprang mit einem Riesensatz hinter ihm her. Andrej zwängte sich im letzten Moment in die schmale Felsspalte, aber er befand sich längst nicht in Sicherheit. Die Pranke der Bärin langte nach ihm und erreichte seinen Arm. Die Krallen rissen das Leder des Ärmels und seine Haut auf. Ein glühender Schmerz brannte sich langsam tiefer ins Fleisch und lähmte jede weitere Bewegung. Andrej schrie, als könne er damit das Tier verscheuchen. Er musste den Hohlraum erreichen, erst dort war er von dem Raubtier unerreichbar. Die Bärin schlug wieder und wieder mit der Pranke nach ihm und brüllte ihre Wut aus sich heraus. Andrej konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, die Schmerzen wurden unerträglich, so, als risse die Bestie ihm das Fleisch von den Knochen. Und dann wichen scheinbar der Schmerz und das Leben von ihm.
Lidia tauchte plötzlich wie eine Erscheinung aus dem Dunkel auf und Andrej glaubte, sie sei sein letzter Gedanke. Aber auf einmal wurde es hell, so hell, als blicke er mit weit geöffneten Augen in die Sonne. Wie glühende Nadeln bohrte sich der Schmerz in sie hinein, obwohl er die Lider fest geschlossen hielt. Das musste das Ende sein.
Dann brach die Hölle los.
2
Dienstag, 30. Juni 1908
Forschungsstation der Schiera, Sibirien
Der abgedunkelte Kontrollraum wirkte verlassen, nur verschiedenfarbige Lämpchen schillerten oder blinkten an der Schalttafel und den Steuerpulten, als tanzten bunte Lichter durch den Raum. Im Hintergrund leuchtete ein Monitor, so groß, dass er die gesamte Wand bedeckte. Auf der Anzeigefläche waren, in zahlreiche Sektionen unterteilt, Grafiken, Diagramme, Zahlenkolonnen und Fließbilder zu erkennen. In der Mitte des Bildschirmes sah man ein rotumrandetes Rechteck, in das die unterschiedlichen Sektionen abwechselnd hineinsprangen und vergrößert erschienen. Kritische Werte wurden augenfällig mit einem Pfeil markiert.
Für Adna, die zum ersten Mal die Neiribis-Station besuchte, war dieser Raum voller Geheimnisse und sie empfand Bewunderung für diejenigen, die diese komplexe Anlage bedienen konnten. Es erschien ihr wie Magie, die sie einen Moment innehalten und ihren Blick auf den verwirrenden Anzeigen der Schalttafel ruhen ließ. Wie kann man aus diesem Chaos die richtigen Informationen ablesen und Entscheidungen treffen?, fragte sie sich.
»Die Elektronik nimmt uns viel Verantwortung und Einflussnahme ab«, hörte sie eine Stimme aus dem Hintergrund. Ein stämmiger Mann, der scheinbar ihre Gedanken lesen konnte, tauchte aus der Dämmerung des Raumes auf. Die Spitzen seiner fuchsbraunen Haare lugten unter der blauen, randlosen Kappe hervor. Er trug einen gleichfarbigen Overall mit dem Schiera-Symbol auf der linken Brustseite. »Deshalb komme ich mir manchmal wie ein Torwächter vor, den die Langeweile stumpfsinnig macht und die Laune vermiest.« Der Blick aus seinen dunklen Augen schien Adna warmherzig zu umarmen.
»Ich hoffe, ich kann dich etwas aufheitern, Nomis, mein Freund«, begrüßte Adna ihn. Sie kannten sich seit ihrer Studienzeit an der Lomonossow-Universität in Moskau. Adna hatte Biologie und Psychologie studiert und er Mechanik, Physik und Mathematik. Als Nachfolger vieler Generationen leitete Nomis nun die Station seit vielen Jahren als Chefingenieur.
»Wenn nicht du, wer dann?« Sie begrüßten sich auf Schiera-Art, drückten ihre beiden Handflächen gegeneinander und sahen sich dabei intensiv in die Augen. »Selbst an einem Tag wie heute«, fügte er hinzu. Adna bemerkte die Traurigkeit des Abschiednehmens in seinem Blick.
»Wie steht es mit deiner Forschungsarbeit? Du bist eine angesehene Wissenschaftlerin, wie ich höre«, sagte Nomis und wollte offenbar von dem anstehenden Ereignis ablenken.
»Danke, ich bin zufrieden und die Ergebnisse sind für den Nachweis unserer Evolutionsgeschichte unverzichtbar, aber es war für mich in der männerdominierten Forschung nicht einfach.«
Nomis nickte. »Das glaube ich dir. Menschen verschwenden mit ihrem Rollenverständnis die Hälfte ihrer geistigen Ressourcen.«
Adna wollte nicht weiter darauf eingehen und versuchte ihrerseits, die bedrückende Stimmung, die wie ein unsichtbarer Schleier über der Station lag, zu ignorieren und sagte: »Ich habe dich lange nicht gesehen.«
»Du musst deine Gefühle nicht verstecken, meine Freundin. Es geht uns allen so«, sagte Nomis und legte eine Hand auf ihre Schulter. »Heute ist ein schicksalhafter Tag für uns Schiera.«
»Ja, ich weiß«, antwortete sie. »Wir sind uns vor zwei Jahren bei der Bestattung von Idur das letzte Mal begegnet. Seitdem gab es wenige hoffnungsvolle Ereignisse.«
Nomis senkte betroffen den Blick und verharrte in einem Moment des Gedenkens. »Ja, ich erinnere mich«, sagte er dann und sah wieder auf. »Es war auf dem dritten Kontinent, in der Wüste von Nevada. Idur ist ein großartiger Präsident gewesen.« Adna nickte zustimmend.
Die andächtige Stille wurde plötzlich von einem durchdringenden Wummern durchbrochen und Adna hatte das Gefühl, als stünde sie auf den wankenden Planken eines Schiffes. Sie klammerte sich reflexartig ans Pult, um nicht den Halt zu verlieren. Dann knallte es wie ein Blitzschlag und eine Erschütterung rüttelte das unterirdische Gewölbe so heftig, dass aus einigen Anzeigeinstrumenten Funken sprühten. Nomis geriet ins Stolpern und wurde von der rückwärtigen Felswand vor einem Sturz bewahrt. Das tiefe Brummgeräusch, das ihnen das Atmen erschwerte, erlosch so abrupt, wie es gekommen war.
»Was war das?«, fragte Adna und hielt sich noch immer krampfhaft fest. Nomis trat mit einigen Schritten näher ans Pult und fixierte aufmerksam die Anzeigetafel. Die rote Umrandung in der Mitte des Monitors blinkte. Das konnte nur ein Warnsignal sein, deutete Adna dieses Zeichen, das war unschwer zu erkennen.
»Einer der Kondensatoren scheint durchgeschlagen zu sein. Wir haben seit ein paar Tagen damit Probleme. Es ist Zeit, alles zu beenden«, antwortete er, zog ein besorgtes Gesicht und betätigte hastig verschiedene Schalter und Stellelemente, wonach sich das Blinken des Rahmens einstellte.
»Du solltest jetzt zu den anderen gehen, ich muss den Schaden prüfen und noch einiges vorbereiten. Ich sehe dich später«, bedeutete er ihr, ihn seine Arbeit machen zu lassen.
Adna verließ die Schaltwarte und betrat den Gang, der sich vor ihr ausstreckte. Der nackte Fels der Tunnelröhre war in manchen Abschnitten mit Beton verkleidet, hauptsächlich dort, wo Türen in angrenzende Labore und Generatorhallen führten. Der Fußboden bestand ebenfalls aus Beton mit rotem Anstrich und an der Decke verliefen Rohrleitungen und dicke Kabelstränge. Männer und Frauen in orangefarbenen Overalls hasteten durch die Anlage und verbreiteten spürbare Alarmstimmung.
Leuchtende Hinweisschilder an den Wänden zeigten Fluchtwege auf und gaben Orientierung. Am Ende eines abzweigenden Einschnittes befand sich der Besprechungsraum, in dem die letzte Zusammenkunft der Stationsbesatzung stattfinden sollte. Reniar, der Leiter der Neiribis-Station, hatte Wissenschaftler, Ingenieure sowie Bedien- und Wartungspersonal zu einer Abschiedsfeier eingeladen. Auf der schweren Eingangstür prangte ein vergoldetes Symbol. Eine zweilagige Blüte, deren Blätter als Pentagramm geteilt waren, was dem goldenen Winkel entsprach. Für die Schiera war diese Blüte ein Sinnbild für Frieden, die Quelle ihrer Kultur. Besinnlich legte Adna ihre Hand auf das Relief, schloss die Augen und sogleich blitzten Erinnerungen des Überlebenskampfes ihres Volkes in Fragmenten auf. Eine tiefe Traurigkeit überkam sie und sie schluckte in diesem Augenblick das hinunter, was sie am Liebsten herausgeschrien hätte. Nachdem sie ihre Fassung zurückerlangt hatte, öffnete sie die Tür. Bedrückende Stille warf sich ihr wie ein Netz entgegen, aus dem es kein Entrinnen gab. Sie blieb stehen. Der ovale Tisch in der Mitte des Raumes war rundum besetzt. Etwa dreißig Augenpaare sahen sie erwartungsvoll an. In ihnen spiegelte sich Wehmut, die aus der Gewissheit des Unumkehrbaren genährt wurde. Adna vermisste das übliche Gemurmel vor dem Beginn einer Besprechung.
»Adna«, rief Reniar und kam auf sie zu. »Wir freuen uns, dass du uns die Ehre gibst.«
Adna ging ihm ebenfalls entgegen und begrüßte ihn auf die gleiche Weise wie Nomis zuvor. »Alter Schmeichler«, erwiderte sie, »ich teile deine Freude nur persönlich, nicht aufgrund des heutigen Anlasses, den ich weniger als Ehre, sondern als Akt der Solidarität und Pflichterfüllung empfinde.«
Bei solch herausragenden Ereignissen, wie es heute stattfinden würde, bezog man Adna grundsätzlich mit ein. Sie fungierte neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit als Botschafterin aller Schiera-Gruppen und -familien rings um den Globus und stellte die Kommunikation zwischen ihnen und den offiziellen Stellen der restlichen Welt sicher.
»Selbstverständlich«, sagte Reniar und bat mit einer Handbewegung, neben ihm Platz zu nehmen. Adna setzte sich und blickte mit einem bemühten Lächeln in die Runde, doch niemand lächelte zurück. Die Gesichter zeigten keinerlei Regung, und Adna ahnte, was in ihnen vorging.
Reniar blieb stehen und schaute einen Augenblick stumm ins Leere. »Es hat leider einen Zwischenfall gegeben, der hoffentlich nicht das Projekt gefährdet«, begann er. »Die Techniker kümmern sich darum.« Er räusperte sich und fuhr fort: »Liebe Freunde, ich sehe euren Gesichtern an, wie ihr euch fühlt, und mir geht es ebenso. Vor vielen Generationen wurde diese Forschungseinrichtung gebaut und betrieben. Unsere Brüder und Schwestern rund um den Globus haben hier gewirkt und Wissen erarbeitet, um diese Welt besser zu verstehen. Leider ist es uns nicht gelungen, diesen einzigartigen Schatz mit den Menschen zu teilen, ohne den Frieden zu gefährden. Sie sind waffenversessen und unbeherrscht, weswegen wir uns zurückgezogen haben, wie ihr wisst. Aber das ist nicht der Grund, warum wir heute diese Einrichtung aufgeben müssen. Es fehlt uns schlicht an Nachwuchs, und wenn sich unsere Population durch das Virus weiter dezimiert, dann werden die Schiera in den kommenden einhundert Jahren von diesem Planeten verschwinden.« Er unterbrach die Rede, damit seine Worte einen Moment wirken konnten. »Aber es gibt Hoffnung«, fuhr er fort, »und deshalb freue ich mich über Adnas Besuch. Sie wird uns über die aktuelle Entwicklung berichten. Bevor wir anschließend evakuieren und den Impulsgenerator zum letzten Einsatz hochfahren, möchte ich euch, auch im Namen unseres Präsidenten Eriam, herzlich für die ehrenvolle Arbeit danken.« Reniar schaute zu Adna hinunter, die mit dem Kloß im Hals kämpfte. Sie erhob sich.
»Liebe Brüder und Schwestern, es fällt mir schwer, heute vor euch zu stehen, denn ich weiß, was diese Veranstaltung für uns alle bedeutet. Es ist ein Abschied ohne Wiederkehr, und das macht ihn so bedrückend und so schmerzlich. Wohlwissentlich, dass es wenig tröstlich ist, versichere ich euch die Solidarität aller Schiera.« Sie unterbrach für einen Moment, um ihren aufkommenden Gefühlssturm abklingen zu lassen, dann sprach sie weiter: »Wir haben gelernt, das Unabwendbare anzunehmen und zusammenzustehen. Dieses Gefühl hat uns von Anbeginn geleitet und wird uns bis zum Ende begleiten. Darauf gründet unsere Kultur und Wertegemeinschaft.« Adna ließ ihre Worte eine Sekunde nachhallen. »Wir sind dankbar und stolz auf die Fähigkeiten, die uns von der Schöpfung zugedacht wurden. Doch als uns der Wendepunkt überraschend traf, standen wir vor der größten Herausforderung unserer Existenz. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wir begingen eine Erbsünde, und die Natur erteilte uns eine Lektion dafür. Die Gesetzte des Universums sind unantastbar, und wer mit der Schöpfung spielt, kann nur verlieren. Wir haben verloren und müssen heute dieses herausragende Werk unserer Wissenschaftler und Ingenieure aufgeben. Den Impulsverstärker, der eine gigantische Energiemenge mit Lichtgeschwindigkeit transportieren kann und hier entwickelt wurde. Ebenso wie die Quantentechnologie, beides sind Spitzenleistungen. Leider können sie als Waffe missbraucht werden. Und davor müssen wir uns und die Welt schützen, bevor der letzte Schiera ...« Sie brachte den Satz nicht zu Ende, weil einige am Tisch schluchzten und sich die Augen wischten. Adna selbst kämpfte abermals mit den Tränen und gab den anderen Zeit, ihre Emotionen zu besänftigen, erst dann führte sie ihre Ansprache fort.
»Wenn der Tod greifbar wird, sollte man seine Angelegenheiten am besten mit einem Testament ins Reine bringen.« Sie griff unter ihre Jacke und holte ein Buch hervor und zeigte es in die Runde. Dann zog sie eine kleine, silbern glänzende Scheibe aus der Innenseite des Buchdeckels heraus und hielt sie hoch. »Dies ist das Vermächtnis der Schiera. Es beinhaltet eine komplette Enzyklopädie unserer Spezies, gespeichert in diesem Quantenchip.« Alle starrten andächtig auf das, was Adna in der Hand hielt. Sie schwieg einen Moment, der von Totenstille begleitet wurde. Sie steckte die Scheibe zurück, blickte auf das Buch und sagte: »Wenn die Menschen es lesen, wird ihre Weltordnung ...«
Weiter kam sie nicht, weil erneut dieses intensive Brummen den Raum durchdrang. Adna hatte das Gefühl, als vibriere ihr ganzer Körper. Alle Augen richteten sich wie auf Kommando auf Reniar, der ängstlich zur Decke schielte, als erwarte er von dort eine Antwort. Unvermittelt rannte er zur Tür und rief im Lauf: »Moment bitte, ich bin gleich zurück.« Bevor er den Türgriff berührte, wurde die Tür von außen schon aufgerissen.
Nomis kam hereingestürmt und sein Gesicht war von Panik gezeichnet. »Alle ...«, stotterte er, »alle ... raus hier ... sofort. Die Regelung der Kondensatoren ist ...« Eine Erschütterung, stärker als beim ersten Mal, ließ den Raum erzittern. Aus der Decke lösten sich Platten und krachten auf den Tisch, Monitore rutschten von den Wänden. Alle sprangen erschrocken auf.
»Adna, du zuerst. Du hast eine Mission zu erfüllen«, sagte Reniar und schob sie nachdrücklich auf den Gang hinaus.
Das Brummen schwoll weiter an und klang, als würde die Erde auseinanderbrechen. Adna rannte zum Hauptstollen, verharrte kurz, um sich zu orientieren. Sie studierte rasch den Fluchtplan und erkannte, dass vom Kontrollraum ein Nottunnel ins Freie führte. Er war der einzige und sicherste Fluchtweg. Aber wo blieben die anderen? Sie werden sicher gleich kommen, dachte sie und wollte gerade losrennen, als der dämmrige Stollen rötlich aufflackerte, als wenn ein Holzfeuer die Wände beleuchten würde. Adna drehte sich um und zuckte zusammen. Was da aus der Tiefe des Tunnels auf sie zurollte, sah nicht nach gemütlichem Kaminfeuer aus, sondern eher wie eine todbringende Feuerwalze. Zu allem Unglück musste sie dem Feuer entgegenlaufen, was die Chance, den Kontrollraum rechtzeitig zu erreichen, deutlich verschlechterte. Sie durfte nicht länger auf die anderen warten und rannte um ihr Leben. Wie ein wütender, feuerspeiender Drache wälzte sich die Flammenfront ihr entgegen. Adna konnte die Tür zum Steuerstand schon sehen, als sie die Strahlungshitze fühlte, die den Flammen vorauseilte und wie tausend Nadeln ihre Gesichtshaut traf. Noch eine Armeslänge zur rettenden Tür. Das brodelnd heiße Drachenmaul hatte sie beinahe erreicht und würde jeden Moment zuschnappen. Im letzten Augenblick erlangte sie die Zugangstür, schlüpfte hindurch und drückte sie zu. Sie spürte den Gegendruck der Explosionswelle, lehnte sich mit dem Rücken gegen den Türflügel und stemmte sich dagegen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes befand sich eine Stahltür, die in den Nottunnel führte. Adna katapultierte sich von der Tür weg, die sofort krachend aufflog. Das Feuer züngelte lechzend hinter ihr her. Mit drei, vier Sätzen hechtete sie zur Stahltür, riss sie auf und verschwand im Tunneleingang. Der Druck der Feuerwalze wurde von dem großen Kontrollraum abgefangen, sodass sie die Tür zurück ins Schloss drücken konnte. Sie hörte, wie die Feuersbrunst hinter der geschlossenen Tür wütete.
Panisch rang sie nach Luft und wischte sich über die schweißnasse Stirn. Erst jetzt spürte sie, wie ihr Herz raste. Wo blieben ihre Brüder und Schwestern, mit denen sie gerade noch am Tisch gesessen hatte? Die schlimmsten Befürchtungen quälten ihre Gedanken und sie schrie ihr Entsetzen in den Tunnel hinein.
Was war nur passiert? Die Station sollte kontrolliert zur Unkenntlichkeit zerstört werden, so die Planungen. Darüber hatte Reniar sie in der Einladung informiert. Der Impulsgenerator hätte eine Leistung, die von der Anlage nur Staub zurücklassen würde. Nichts sollte an die einstige Verwendung der unterirdischen Einrichtung erinnern, und die Menschen dürften auf keinen Fall in Besitz dieser Technik gelangen, denn sie konnte als furchtbare Waffe missbraucht werden.
Was war schiefgelaufen? Adna hatte keine Idee, aber eine Mission zu erfüllen. Der Gedanke daran rüttelte sie auf und trieb sie erneut an. Sie rannte dem Ausgang entgegen, der weit vor ihr lag und noch nicht sichtbar war. Im Hintergrund hörte sie ein neues Geräusch, das sie nicht zuordnen konnte. Es klang schrecklich, wie ein schrilles Pfeifen, das ohrenbetäubend anschwoll und mit einem dumpfen Schlag abrupt endete. Eine erdbebenartige Erschütterung riss sie von den Beinen. Sie stürzte. Aus der Tiefe des Stollens dröhnte das Poltern aufeinanderfallender Steine. Offenbar brach der Schacht in sich zusammen. Adna stand auf und rannte um ihr Leben, verfolgt von dem fortschreitenden Einsturz des Tunnels.
Endlich kam der Ausgang als heller Punkt in Sicht. Die rettende Öffnung ins Freie. Ihre Beine wurden schwer und die Luft knapp. Nur nicht aufgeben, feuerte sie sich wieder und wieder selbst an. Gleich ist es geschafft. Sie schleppte sich Schritt für Schritt dem rettenden Tunnelausgang entgegen. Der Lichtpunkt vergrößerte sich und wuchs zu einem Halbrund an, das sich bald zu einem Torbogen formte. Nach ein paar Schritten taumelte sie nach Luft hechelnd auf eine Waldwiese. Ein makelloser Himmel empfing sie mit angenehmer Wärme. Dann sackten ihre Beine unter ihr weg. Sie fiel kraftlos auf den Rücken und schloss die Augen. Für einen Moment glaubte sie, in einer anderen Welt angekommen zu sein, was genau genommen auch stimmte, und sie wähnte sich in Sicherheit, was nicht stimmte. Das wurde ihr schlagartig bewusst, als sie die Augen öffnete und ihr Blick zum Himmel gerichtet war. Von weit oben, gerade noch erkennbar, stürzte etwas auf die Erde zurück, etwas Großes, etwas Riesiges. Es glühte und zog einen Feuer- und Rauchschweif hinter sich her. Was ist das?, schoss wie ein schmerzender Pfeil durch ihren Kopf. Wurde von der Explosion ein Gesteinsbrocken hochgeschleudert oder war es einer der gewaltigen Kondensatoren, die die Energie für den Impulsgenerator speicherten? Adna suchte gar nicht erst nach der Antwort, denn sie musste schnellstens hier weg. Ihr wurde klar, wenn das Ding, was immer es war, einschlug, gab es eine Katastrophe, die sie hier draußen nicht überleben konnte. Wo das Objekt genau herunterkommen würde, konnte sie nicht abschätzen, aber auf jeden Fall befand sie sich im Gefahrenbereich und brauchte einen Unterschlupf. Der Fluchttunnel war ihre einzige Möglichkeit. Die Todesangst katapultierte sie auf die Beine zurück und brachte sie im Laufschritt zum Eingang des Tunnels. Wie weit er eingestürzt war und ob er eine weitere Schockwelle überstehen würde, war völlig ungewiss. Im Freien erwartete sie der sichere Tod, im Stollen hatte sie zumindest eine Chance. Also lief sie hinein. Jeden Augenblick die Explosion des Einschlages erwartend, rannte sie weiter, je tiefer sie eindrang, umso besser für sie.
Plötzlich hüllte ein grelles Licht die Tunnelröhre in ein alles durchdringendes Weiß, als würde die Sonne direkt in den Eingang hineinblinzeln. Nur kurz, dann wurde Adna erneut von der Dunkelheit verschluckt. Gespenstische Ruhe blieb zurück, sodass sie ihr Herz pochen hörte.
Dann brach das Inferno los. Ein Donnerschlag wie tausend Gewitter brach über sie herein, dass ihre Ohren schmerzten. Adna warf sich auf den Boden und vergrub ihren Kopf unter den Armen. Sie drückte instinktiv ihre Hände fester darauf und schloss die Augen.
Wie lange sie auf dem Boden gelegen hatte, wusste sie nicht. Die Angst nahm ihr jedes Zeitgefühl. Vorsichtig erhob sie sich und blinzelte in die Dunkelheit. Trotz der abermaligen Erschütterung schien der Stollen nicht weiter eingestürzt zu sein. Angespannt und mit rasendem Herzen schleppte sie sich aus dem schützenden Tunnel heraus, und was sie dort sah, übertraf ihre schlimmsten Befürchtungen.
Hier draußen erwartete sie eine fremde und lebensfeindliche Welt. Die Luft brannte ihr im Gesicht wie ein Feuer, dem sie zu nahe gekommen war, und die einstige Wiese lag wie ein schwarzer Ascheteppich vor ihr. Der Wald ringsum existierte nicht mehr. Schlimmer hätte es kaum kommen können, dachte sie und brauchte einige Zeit, um die veränderte Situation zu begreifen.
Ihre Mission drohte unter diesen Umständen zu scheitern, und das durfte sie auf keinen Fall. Adna tastete ihre Jacke nach dem Buch ab, das sie als Gesandte der Schiera an eine Forschungsstation in Paris überreichen sollte. Als sie es unter dem Stoff spürte, wurde ihr schwer ums Herz und Wehmut heftete sich wie eine Schlinge um ihren Hals. Demütig wurde ihr bewusst, was sie da bei sich trug. Dieses Buch enthielt eine Datenscheibe, auf der die komplette Geschichte der Schiera gespeichert war und Zeugnis ihrer Existenz sowie ihrer Evolution geben würde. Wenn ihre Ära auf diesem Planeten vor dem Ende stand, dann sollte die Erinnerung daran gewahrt bleiben. Irgendwann würden die Menschen in der Lage sein, diese Daten zu lesen, und sie sollten erfahren, wer sie wirklich waren. Vielleicht hätten sie bis dahin zu einer globalen und friedlichen Gesellschaftsordnung gefunden und hinterfragten technische Erfindungen nicht zuerst nach ihrer Waffentauglichkeit.
Ich muss eine Siedlung finden, dann werde ich weitersehen, dachte sie. Sie hatte von der Handelsstation Wanawara gehört, die an dem Fluss ›Steinige Tunguska‹ lag, dort würde sie sicher Hilfe bekommen. Die Sonne gab ihr die grobe Himmelsrichtung an. Sie musste sich nach Westen orientieren, um den kleineren Fluss Chamba zu erreichen, der sie zur Steinigen Tunguska leiten würde.
Adna überquerte die verbrannte Lichtung und dann wurde ihr das gesamte Ausmaß der Zerstörung bewusst. So weit das Auge reichte, wohin sie blickte, nur umgestürzte Bäume, Flammen und schwarzer Rauch. Das war alles, was von der grandiosen Taiga übrig geblieben war. Adna erschrak bei dem Gedanken an die Menschen und Tiere, die in dieser Gegend lebten, und sie fühlte sich für diese Katastrophe mit verantwortlich. Der Kloß in ihrem Hals schwoll weiter an und erschwerte ihr das Atmen.
Einige Stunden schon kämpfte sie sich durch das Chaos und war der Erschöpfung nahe. Ein paar Schritte weiter stand eine Kiefer, die der Druckwelle widerstanden hatte, zwar etwas gebeugt, aber offenbar stabil. In ihrem Schatten wollte sie einen Moment durchatmen und setzte sich auf einen Wurzelast, schloss die Augen und lauschte dem Prasseln und Knistern der Feuer ringsum – aber da war noch ein anderes Geräusch. Es klang wie das Rauschen eines Flusses. Das muss die Chamba sein, dachte sie erleichtert und wollte sich unverzüglich auf den Weg machen. Sie erhob sich und reckte ihre Gliedmaße. Plötzlich erschrak sie vor einem berstenden Krachen. Sie drehte sich um und erstarrte vor Schreck, als ein Nadelbaum, der hinter der Kiefer stand, auf sie zustürzte. Anscheinend hatte das Feuer ihren Stamm geschwächt. Adna wollte mit einem Satz ausweichen, stolperte über eine Wurzel und fiel. Sie spürte etwas in ihren Bauch eindringen und einen Schlag und danach nichts mehr.
3
Dienstag, 30. Juni 1908
Wanawara, Sibirien
Piotr Antonowitsch stand vor seiner Werkbank und kratzte gerade Rost von alten Eisenbeschlägen herunter, als er von einem merkwürdigen Geräusch aufgeschreckt wurde. Die Luft vibrierte in einen tiefen Wummerton, der die Fensterscheiben der Werkstatt zum Klirren brachte. Entfernte Schreie und Kreischtöne mischten sich darunter und wurden allmählich lauter. Piotr unterbrach seine Arbeit und überlegte einen Augenblick, ob er ähnliche Töne schon einmal gehört hatte, doch er konnte sich nicht entsinnen. Der Lärm schien den gesamten Luftraum zu erfüllen und klang bedrohlich. Er rannte auf die Dorfstraße hinaus, wo sich bereits eine große Menschenmenge versammelt hatte. Piotr erkannte Nachbarn, Pelzjäger und Fischer, mit denen er Geschäfte machte. Sie alle suchten mit ängstlichen Blicken den Himmel ab.
»Seht doch, dort oben«, rief eine Frau mit heiserer Stimme. Sie hielt noch ein Messer in der Hand und wies damit in östlicher Richtung gen Himmel. Ein Raunen ging durch die Menge, als sie eine flatternde und wogende Wolke aus lärmenden Vögeln sahen, die über den Wipfeln der Taiga die aufgehende Sonne verdunkelte. Ähnlich einer unheilvollen Gewitterfront wälzte sich die brodelnde Schar in Panik geratener Vögel wie ein aufkommender Sturm ohrenbetäubend kreischend über sie hinweg und zog weiter nach Westen ab. Die Sonne über Wanawara strahlte erneut aus einem makellosen Blau, als sei nichts geschehen, nur das wabernde Rauschen hing noch eine Weile über dem Ort, bis es sich in der Weite des Himmels verlor.
»Das verheißt nichts Gutes«, sagte Piotr zu den Umstehenden.
»Da kommt sicher noch etwas nach«, bemerkte ein dicker Mann, der kurz vorher in Piotrs Laden eine Schnappfalle gekauft hatte.
»Vielleicht hat ein Feuer die Vögel aufgescheucht«, mutmaßte jemand.
Plötzlich war die Luft von einem Wummern erfüllt, das rasch anschwoll und ein Druckgefühl in ihren Köpfen verursachte.
»Kein Feuer«, rief ein anderer und zeigte zum Himmel, dort wo die Sonne aufgegangen war und nun wie eine helle Scheibe über den Baumwipfeln stand. Alle Köpfe drehten sich gleichzeitig dorthin. »Oh nein, was ist das?«, schrie eine Frau hysterisch aus der Menge und wies ebenfalls zum Himmel.
Und dann sahen sie es, und versetzte sie augenblicklich in Fassungslosigkeit. Ein glühender Feuerball kam wie aus der Sonne herausgeflogen, als hätte sie ein Teil von sich ausgespuckt, und zog eine Spur aus weißem Rauch über den Himmel. Das Feuer bewegte sich schneller als alles, was Piotr sich vorstellen konnte. Schneller als ein Pfeil, ja sogar schneller als eine Kanonenkugel.
Alle, die sich auf der Straße versammelt hatten, und es wurden immer mehr, verstummten angesichts dieses unfassbaren Schauspiels. Ihre Blicke folgten dem brennenden Körper, der sich rasch der Erde näherte und jeden Moment am Horizont einschlagen würde. Und dann geschah das Unbegreifliche. Noch in der Luft löste sich der Feuerball in einem Lichtblitz auf, der heller war als die Sonne, wenn sie im Zenit stand. Die Menschen wandten sich geblendet ab und wagten erst wieder hinzusehen, als das grelle Licht erloschen war. Für einen Moment blieb von dem Spektakel nur die Rauchspur übrig, die wie ein warnendes Zeichen am Himmel schwebte.
Piotr stierte gebannt auf dieses unheilvolle Rauchzeichen doch dann wollte er nicht glauben, was seine Augen sahen. Weit in der Ferne wölbte sich über der Taiga ein steil aufragender Pilz aus schwarzem Rauch. Die Leute neben ihm starrten sprachlos auf das Spektakel, das sich offenbar keiner von ihnen erklären konnte.
»Vielleicht eine Sternschnuppe«, brach jemand nach einer Weile die Stille.
»Dann war es aber eine ziemlich große«, lachte ein anderer gekünstelt. Gemurmel wallte jetzt unter den Leuten auf. Sie riefen sich verschiedene Mutmaßungen zu. Die Spekulationen reichten von einer Sternschnuppe über einen Kometen bis zu einem Felsbrocken, der sich vom Mond gelöst hätte. Eine Frau betete und meinte, das wäre ein Zeichen Gottes gewesen, der erzürnt sei, weil sich die Menschen immer noch über unterschiedliche Glaubensgrundsätze streiten würden, anstatt in der einzig wahren orthodoxen Glaubenslehre vereint zu sein.
Das sei alles Quatsch, hielt jemand dagegen und meinte, er hätte gehört, dass Zar Alexander eine neuartige Waffe testen ließ. »Wir sind gerade Zeuge ihrer verheerenden Wirkung geworden«, prahlte er patriotisch. »Damit ist unser russisches Kaiserreich unbesiegbar«, ergänzte er. Piotr hatte kein Ohr für solches Gerede und beobachtete weiter den Rauchpilz, der offensichtlich seinen Gipfel erreicht hatte und dessen Schirm sich nun zu einem riesigen Teller ausbreitete. Für einen Augenblick war es still. Sprachlos starrten die Leute auf das riesige Rauchgebilde. Doch es war noch nicht vorbei. Es sollte schlimmer kommen. Plötzlich vernahm Piotr einen entfernten Heulton, laut und schrill, als summe der Teufel eine Melodie. Der fremdartige Klang dröhnte aus der Ferne herüber und wurde rasch lauter. Dann erstarrte er erneut vor Schreck, als er eine dunkle Wand aus herumfliegenden Zweigen, Blättern und Staub auf Wanawara zugerast kommen sah.
»Seid doch mal still!«, rief er in die Menschenmenge. Sie sahen ihn verdutzt an. »Seht, was da auf uns zukommt«, rief er und zeigte in die Richtung. Er selbst erschrak, wie rasend schnell sich die Wand auf sie zubewegte, sie hatte bereits die Ortsgrenze erreicht. »Lauft in die Häuser!«, schrie er gegen das Heulen an, aber er kam nicht mehr von der Stelle. Wie von einer riesigen Faust getroffen erfasste ihn die Druckwelle und riss ihn zu Boden. Menschen schrien, Staub wurde aufgewirbelt, Fensterscheiben zersprangen und Türen rissen aus den Angeln. Piotr versuchte sich aufzurichten und stemmte sich mit aller Kraft gegen den Sturm, der jedoch stärker war und ihn mit sich schleifte. Er stolperte einige Schritte rückwärts, bis er einen heftigen Schlag im Rücken spürte.
So schnell, wie die Staubwolke kam, war sie vorüber, hinterließ Chaos und verschreckte Menschen. Nachdem sich der letzte Staub gelegt hatte, versuchte Piotr die Lage zu erfassen. Er selbst saß am Straßenrand an einem Lattenzaun gelehnt, der ihn offenbar aufgefangen hatte. Langsam mühte er sich, auf die Beine zu kommen. Der linke Arm schmerzte. Ansonsten konnte er keine Verletzungen an sich feststellen. Um ihn herum stöhnten und husteten die Menschen und rappelten sich allmählich auf. Kinder weinten. Diejenigen, die bereits auf den Füßen standen, klopften sich den Schmutz aus der Kleidung und den Haaren und sahen sich irritiert um. Auf der Dorfstraße lagen allerhand Unrat, Glassplitter und abgerissene Äste herum. Wie durch ein Wunder schien niemand ernsthaft verletzt worden zu sein. Piotr half einem alten Mütterchen, aufzustehen, und reichte ihr den Stock, den sie verloren hatte.
Eine gespenstische Ruhe legte sich über den Ort. Ohne ein Wort zu verlieren, begannen die Leute von sich aus, die Straße von Trümmerteilen und Unrat freizuräumen. Wie benommen und von einer Eingebung geführt, verrichteten sie ihre Arbeit, bis die Plätze und Wege aufgeräumt waren. Nach und nach löste sich die Menge auf und alle gingen ihrer Wege. Piotr schlich sich schwerfällig zu seinem Laden hinüber, um nachzusehen, was kaputtgegangen war. Zum Glück weniger, als er befürchtet hatte. Einige Fensterscheiben wurden von dem Sturm aus den Rahmen gedrückt und ein Feld des Bretterzaunes war umgefallen.
Bevor er ins Haus ging, schaute er noch einmal zu der Stelle, wo der Feuerball explodiert war. Ihm schauderte bei dem Anblick. Eine schwarze Rauchwolke verdunkelte den Himmel und lag wie eine Totendecke über der Taiga. Piotr wusste, dass in dem Gebiet häufig Ewenken ihre Zelte aufgestellt und der Pelzjäger Andrej Jakowitsch mit seiner Frau ihre Hütte hatten. Andrej und Lidia kannte er seit vielen Jahren, sie machten gute Tauschgeschäfte miteinander. Piotr wurde von einer bitteren Vorahnung ergriffen.
4
Dienstag, 30. Juni 1908
In der Nähe von Wanawara, Sibirien
Ein Donner wie von tausend Gewittern, die gleichzeitig niedergingen, schien Andrejs Kopf platzen zu lassen. Der Felsen, in dem er vor der Bärin Schutz gesucht hatte, bebte, als würde er gleich auseinanderbrechen. Die Angst lähmte alle Empfindungen. Er bekam kaum Luft und erwartete jeden Moment sein Ende – doch es kam anders.
Seine Ohren schmerzten von dem Druckstoß, den der Knall verursacht hatte, und ein piepender Dauerton setzte sich darin fest. Draußen tobte ein Höllensturm. Es krachte, barst und schepperte, als würde die Welt untergehen.
Er überlegte, was eben geschehen sein konnte, und fand nur eine Erklärung: Es musste das gewaltigste Gewitter gewesen sein, das er je erlebt hatte. Aber wie konnte es so rasch und ohne Vorzeichen entstehen? Als er in diese Felsöffnung flüchtete, strahlte die Sonne von einem tiefblauen Himmel.
Allmählich verebbte der Lärm der Zerstörung und Andrejs Gedanken kreisten um Lidia und sein Zuhause. Hoffentlich war ihr nichts zugestoßen, die Hütte war kaum vier Werst entfernt von hier. Seine Angst steigerte sich abrupt in Panik, als er Brandgeruch bemerkte. Er musste nachsehen und zwängte sich durch den schmalen Durchgang nach draußen. Dort schlug ihm eine unerträgliche Hitze ins Gesicht, als würde die Luft glühen. Jeder Atemzug brannte in der Lunge. Er schaute sich um und erstarrte ein weiteres Mal vor Entsetzen. Sein Mund wurde trocken und das Herz schien einige Schläge auszusetzen. Er wollte nicht wahrhaben, was er sah.
Die Taiga – seine Taiga – existierte nicht mehr. Die Bäume, so weit er gucken konnte, waren umgestürzt, entweder entwurzelt oder abgebrochen. Entsetzt von diesem furchterregenden Anblick umrundete er den Felsen, doch ringsumher bot sich das gleiche Bild. Gefallene Bäume bis zum Horizont. Dazwischen loderten überall Flammen, Funken stieben auf und Rauch verdunkelte zusehends die Sonne. Von der Bärin, deren Opfer er beinah geworden wäre, war keine Spur mehr zu erkennen.
Dank ihr hatte er die Apokalypse überlebt. Auf der anderen Seite war es der Feuersturm, der ihn vor dem Raubtier gerettet hatte. Fassungslos machte er sich auf und kämpfte sich schleppend einen Weg durch das Inferno. Sein Arm schmerzte höllisch, aber die Angst um Lidia trieb ihn voran. Es gab keinen Pfad mehr, der ihn hätte nach Hause führen können. Stattdessen musste er über Baumstämme klettern und Feuernestern ausweichen und kam nur mühsam voran. Darüber hinaus fiel ihm die Orientierung in dieser verwüsteten Landschaft schwer, in der nichts mehr wie vorher war. Er musste den Fluss erreichen, der würde ihn vor den Flammen schützen und die Richtung weisen.
Irgendwann erreichte er das Flussufer der Chamba, in dessen Nähe die Lichtung sein musste, auf der seine Hütte stand. Am Flusslauf, der sich durch die Gelände schlängelte, erkannte er die Stelle, von wo aus er nach Westen gehen musste, um nach Hause zu gelangen. Er schaute in die Richtung und sah nur Zerstörung, Flammen und Rauch. Bittere Vorahnungen und Angst beherrschten seine Gedanken. Sein Herz überschlug sich und die heiße Luft erschwerte das Atmen.
Als er die Lichtung erreichte, versagten seine Beine. Er sackte auf die Knie und schrie sein Entsetzen aus sich heraus. Es gab keine Hütte mehr, nicht einmal ein Feuer, das sich über sie hermachte. Sein Zuhause war verschwunden, so, als hätte es nie existiert. Von Lidia und dem Hund fehlte jedes Lebenszeichen. Andrej hatte das Gefühl, als sei er nach dieser Katastrophe allein auf der Welt zurückgeblieben.
»Lidiaaaa!«, schrie er seine Verzweiflung und Trauer in diese Hölle, die ihm alles genommen hatte, aber niemand antwortete, nicht einmal ein Echo war zu hören. Nur das Prasseln der Flammen um ihn herum und manchmal lautes Krachen, wenn verbrannte Baumkronen in sich zusammenbrachen. Er kauerte sich auf den Boden und weinte um Lidia und um sein eigenes Leben, das von einem Moment zum nächsten seinen Sinn verloren hatte.
Andrej wusste nicht, wie lange er seinen Gedanken nachgehangen hatte, doch irgendwann kehrte sein Überlebenswille zurück. Aufgeben kam für ihn nicht infrage, er würde sich ins Leben zurückkämpfen. Müde erhob er sich und überlegte. Wanawara war der nächstgelegene Ort, wo er Zuflucht finden könnte. Hoffentlich haben die Menschen dort das Unglück überstanden, dachte er. Bis dorthin könnte er es schaffen. Die kleine Siedlung am Ufer der Steinigen Tunguska war etwa fünfzig Werst entfernt. Normalerweise würde er die Strecke in einem Tagesmarsch bewältigen, aber unter diesen Bedingungen musste er mit zwei Tagen rechnen. Sein verletzter Arm machte ihm Sorge, die Wunden würden sicher bald anfangen zu eitern. Von seinem Vater hatte er gelernt, wie man tiefe Fleischwunden mit einer heißen Messerschneide ausbrennt, um sie vor Wundbrand zu schützen. Sein Messer, mit dem er die gefangenen Tiere tötete, steckte in der Lederscheide am Hosengürtel. Er tastete sogleich danach und wurde enttäuscht. Sie war leer. Er hatte es offenbar auf der Flucht vor der Bärin verloren. Die Wunde musste bald behandelt werden, um seinen Arm und vielleicht sogar sein Leben zu retten. Ein heißer Stein wird es ebenfalls tun, dachte er und brauchte nicht lange danach zu suchen. Feuer mit Glutstellen gab es genügend, um ihn zu erhitzen. Als es so weit war, zog er die Jacke aus und angelte mit einem Stock den erhitzten Stein aus der Glut heraus. Dann legte er sich auf den Boden und platzierte seinen Arm dicht neben den Gesteinsbrocken. Er kannte die höllischen Schmerzen und wusste, je länger man darüber nachdachte, umso mehr regte sich der innere Widerstand. Kurzerhand wälzte er mit einer blitzschnellen Drehung den Arm auf den Stein und presste ihn mit seinem Körpergewicht darauf. Im selben Augenblick schienen sein Kopf und Arm zu explodieren und alle Empfindungen spielten verrückt. Ein lang gezogener Schrei schallte über die geschundene Taiga und begrub jedes weitere Geräusch unter sich. Schweiß quoll aus all seinen Poren und Tränen versickerten in seinem Bart.
Nach diesem Schmerzerlebnis brauchte er eine Weile, um seine Sinne wieder in Gleichklang zu bringen. Dann rappelte er sich auf die Beine und kämpfte sich durch das Chaos und die Flammen zurück zu dem Flüsschen Chamba, das in die Steinige Tunguska mündete. Von dort musste er nur dem Fluss stromaufwärts folgen, um nach Wanawara zu gelangen. Diese Route war länger, aber sie führte sicher zum Ziel. Außerdem war er am Wasser besser vor den Feuern geschützt und konnte notfalls hineinspringen. Zu allem Unglück kam jetzt stürmischer Wind auf, der die Flammen und Glutnester immer wieder anfachte.
Die Sonne hatte den Zenit längst überschritten, als Andrejs Beine schwer und seine Schritte langsamer wurden. Die Kräfte schwanden und sein Arm brannte wie Feuer, obwohl er ihn ab und zu mit Flusswasser kühlte. Er brauchte dringend eine Pause und etwas im Magen. Seit dem frühen Morgen hatte er nichts mehr gegessen und sein Rucksack, in dem er Speck und Brot mitgenommen hatte, war verloren, genauso wie sein Gewehr. Aber was sollte er jetzt damit schießen? Alles Leben schien ausgelöscht, selbst die Fische trieben tot in der Strömung der Chamba. Fische, ging ihm wie ein Geistesblitz durch den Kopf, sie waren nicht lange tot und sicher noch genießbar, und Feuer zum Garen gibt es genug. Doch bevor er zu weiteren Anstrengungen fähig war, musste er sich ein wenig ausruhen und ließ sich matt auf einem Baumstamm nieder, um erst einmal tief durchzuatmen. Mit jedem Atemzug kehrte etwas Leben in ihn zurück.
Als er sich besser fühlte, suchte er eine Astgabel, ging zum Flussufer und fischte damit einen vorbeitreibenden Taimen heraus. Anschließend schichtete er an der steinigen Böschung ein Paar Zweige zu einem Lagerfeuer aufeinander und zündete sie mit einem brennenden Kiefernzweig an. Als das Feuer zu einem Gluthaufen heruntergebrannt war, klemmte er den Fisch in die Astgabel und hielt ihn über die Feuerstelle. Während der Taimen garte, blickte Andrej gedankenversunken in die Glut, aus der ab und zu kleine Flammen zuckten, und dachte an Lidia. Es war schwer zu begreifen, dass es sie nicht mehr gab. Was um alles in der Welt war passiert?
In seine ungeordneten Gedanken mischte sich auf einmal eine Stimme. Zunächst glaubte Andrej, seine Sinne würden ihm in seiner tiefen Trauer etwas vorgaukeln oder das Knistern und Fauchen der Feuer würden sich wie Klagelaute anhören, aber dann hörte er es deutlich. Jemand stöhnte und ächzte, als hätte er große Schmerzen. Andrej lauschte angestrengt, um herauszufinden, aus welcher Richtung die Laute kamen. Als er sich der Herkunft sicher war, steckte er den Ast in den Boden und lief der Stimme entgegen. Er musste einige Baumstämme überwinden und sich durch brennendes Gestrüpp zwängen. Dann entdeckte er unter einer entwurzelten Kiefer, über der die Krone einer Fichte lag, die Beine eines Menschen. Er stieg über den Stamm hinüber, drückte die Äste des Nadelbaumes beiseite und blickte in das angsterfüllte Gesicht einer Frau. Als sie Andrej erblickte, mühte sie sich, zu lächeln. In ihren ausdrucksvollen Augen lag eine Tiefe, die nicht zu erfassen war. Nach ihren prägnanten Gesichtsmerkmalen zu urteilen, wie den vollen Lippen, der markanten Nase und den braunen Augen, musste sie eine Schiera sein. Er hatte nie zuvor jemanden von diesem Volksstamm gesehen, nur aus Erzählungen über sie gehört. Trotz ihrer Andersartigkeit bewunderte Andrej die natürliche Schönheit dieser Frau. Viele Gerüchte und Mythen rankten sich um dieses kontaktscheue Volk. Pelzjäger, die zufällig mal einem Schiera begegneten, erzählten allerhand merkwürdige Geschichten über sie. Zum Beispiel, dass sie über außergewöhnliche Körperkraft verfügten, sich aber nie feindselig verhielten. Weiter berichteten sie von ungewöhnlicher Kleidung und fremdartigen Geräten, die die Schiera bei sich trugen, und dass sie Russisch sprachen. Hier in der Wildnis der Taiga hatte niemand gesehen, wo und wie sie wohnten und lebten. Man fand nie eine Behausung von ihnen. Sie mieden jeglichen Kontakt zu anderen Stämmen.
»Kannst du mir helfen?«, fragte sie mit gesenkter Stimme, als wenn es ihr peinlich wäre, jemanden um Hilfe bitten zu müssen.
»Natürlich helfe ich dir«, antwortete Andrej, obwohl er noch keine Idee hatte, wie. Er nahm die Situation in Augenschein. Die Äste der Kiefer brannten lichterloh und die Flammen fraßen sich immer näher an die Frau heran. Wenn die Fichte, die direkt über ihr lag, Feuer finge, würde die arme Frau bei lebendigem Leibe ... Andrej wollte sich das nicht vorstellen. Er musste rasch handeln. Aber wie sollte er die Frau unter diesem massigen Stamm herausbekommen? Selbst mit einem Ast als Hebel wäre er nicht imstande, diese Last auch nur ein Stück anzuheben.
»Vielleicht gelingt es dir, den Boden unter mir ein wenig wegzugraben, dann könntest du mich unter dem Stamm hervorziehen«, schlug sie vor. Das ist die Lösung, dachte Andrej. Aber womit graben?
Die Zeit drängte, einige Fichtennadeln knisterten bereits unter der Hitze des sich heranfressenden Feuers und erste Flämmchen loderten auf. Andrej schaute sich nach einem geeigneten Werkzeug um. An der Bruchstelle des Fichtenstammes war das Holz aufgesplittert, vielleicht konnte er ein flaches Bruchstück herausreißen, was sich zum Graben eignete. Plötzlich schlug ihm ein Hitzeschwall ins Gesicht. Ein Fichtenzweig hatte Feuer gefangen und loderte hell auf. Andrej sprang erschrocken zur Seite. Er musste sofort handeln. Mit letzten Kraftreserven kämpfte er sich durch das Gewirr der Äste und Zweige bis zur Bruchstelle. Ein abgeplatztes Stammholz mit Borke schien brauchbar zu sein. Er packte es mit beiden Händen, hebelte es vom Stamm ab und drehte es hin und her, bis sich die letzten Holzfasern lösten. Den Schmerz in seinem Arm spürte er unter der körperlichen und psychischen Anstrengung nicht mehr.
Das Feuer prasselte lauter, die Frau schrie in Todesangst. Andrej drehte sich um und geriet in Panik. Die Spitze der Fichtenkrone stand in Flammen, Funken stieben auf. Kopflos eilte er zurück und hektisch, als würde ein Kaninchen einen Bau graben, schaufelte er mit dem Holzstück die Erde unter dem Körper der Frau zur Seite. Die Hitze der Feuersbrunst wurde allmählich unerträglich. Er wandte sein Gesicht ab und keuchte nach Luft. Mit letzter Energie, die er mobilisieren konnte, und die ihn vor dem endgültigen Zusammenbruch bewahrte, rammte er das Holz wieder und wieder in die Erde. Dann endlich glitt der Körper der Schiera-Frau seitlich in die flache Mulde, die Andrej in den Boden gekratzt hatte. Er ließ das Holzstück fallen, griff der Frau unter die Arme und zerrte an ihr. Sie stöhnte auf, als wollte sie den Schmerzensschrei unterdrücken. Die Flammen hatten sich längst bis direkt über sie vorangefressen und schickten Funkenschauer gen Himmel. Ihre Haare kräuselten sich durch die Hitze zusammen und rochen verbrannt. Sie schrie erneut und stemmte sich mit den Füßen gegen den Boden, um Andrejs Bemühungen zu unterstützen. Dann endlich gab der Stamm sie frei, sodass Andrej stolpernd auf den Rücken fiel. Erschöpft blieben beide liegen und atmeten schwer. Aber sie hatten keine Zeit, sich zu erholen, sie mussten schnellstens hier weg, um nicht doch am Ende von den Flammen überrollt zu werden.
Die Schiera-Frau kam zuerst auf die Füße. Als sich Andrej aufrappelte, zitterten seine Beine und gaben nach. Die Frau fing ihn auf und trug ihn auf beiden Armen zum Flussufer hinunter, wo sie vor dem Feuer sicher waren. Staunend sah er sie an. Andrej war ein muskelbepackter Mann, aber diese Frau hielt ihn wie eine Puppe in ihren Armen und setzte ihn sanft auf dem Uferkies ab. Sie war etwa so groß wie er, nur stämmiger und mit kräftigen Armen und Beinen sowie breiten Schultern. Sie trug Stiefel, die scheinbar aus Leder und nach hoher handwerklicher Machart gefertigt waren. Ihre Hose und Jacke bestanden aus einem Material, das Andrej nicht kannte. Es zeigte trotz der Hitze und der Funken, die auf sie niedergegangen waren, keinerlei Beschädigungen oder Schmutzflecken. Außer dem Blutfleck, den Andrej seitlich am Bauch entdeckte und aus dessen Mitte ein Holzstück herausragte.
»Du bist verletzt«, sagte er betroffen.
»Danke, dass du mir geholfen hast«, erwiderte sie, sackte auf einmal mit verzerrtem Gesicht auf die Knie und stöhnte. Sie musste furchtbare Schmerzen haben, beugte sich leicht nach vorn und schloss für einen Moment die Augen. Dann drehte sie sich zur Seite, um in eine Sitzposition zu gelangen. »Ich wünschte, du hättest mir damit das Leben retten können, aber es ist zu spät«, sagte sie.
»Wie meinst du das?«, fragte Andrej. Sie zeigte auf das Holzstück in ihrem Bauch.
Andrej machte eine ausladende Handbewegung. »Sieh dich um. Was ist unsere Leben noch wert?«, antwortete er.
Die Schiera-Frau sah ihn stumm an und Andrej war von ihrem Blick tief berührt. In diesem Moment flackerten in ihren Augen Sanftmut und Zuversicht auf, obwohl sie in dieser Feuerhölle dem Tod näher gerückt war als dem Leben.
»Wie heißt du?«, fragte Andrej.
»Ich bin Adna«, sagte sie und lächelte ihren Schmerz beiseite. »Und wer bist du?«
»Ich heiße Andrej Jakowitsch. Heute Morgen noch war ich Pelzjäger und lebte glücklich mit meiner Frau Lidia und einem Hund in einer Blockhütte, ein paar Werst nördlich von hier. Und dann kam diese Hölle über uns.«
»Es ist gut, dass du hier bist. Du bist anders als die anderen, Andrej Jakowitsch«, sagte sie.
»Welche anderen?«, fragte Andrej nach.
»Die anderen Menschen«, erklärte Adna.
»Was ist mit denen?«, wollte Andrej wissen.