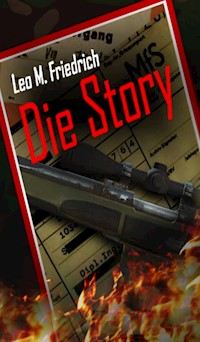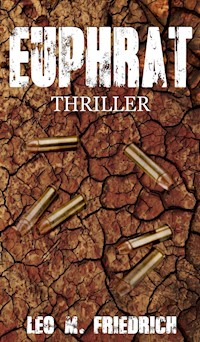2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nachdem ein Killerkommando des Islamischen Staates aus kurdischer Gefangenschaft befreit wurde, zieht sich eine Spur des Terrors durch Europa. Ramon Bohm, der nach dem plötzlichen Ende seiner Eishockeykarriere eine neue Aufgabe sucht, gerät zwischen die Fronten eines gnadenlosen Krieges. Er braucht dringend die Hilfe seiner Familie. Allerdings ist der Kampf damit noch lange nicht gewonnen. Denn hinter den Terroristen steht eine Macht mit nahezu unbegrenzten Ressourcen. Und die verfolgt einen ungeheuerlichen Plan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Leo M. Friedrich
Der Brookman-Plan
Thriller
© 2021 Leo M. Friedrich
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-28188-2
Hardcover:
978-3-347-28189-9
e-Book:
978-3-347-28190-5
Cover:
fayefayedesigns
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Glücklich ist, wer das, was er liebt, auch wagt, mit Mut zu beschützen.
Ovid
Südliches Montana, USA, März 2019
Die aufgehende Sonne würde bald die Luft über der Prärie erwärmen. Doch noch war es im südlichen Montana bitterkalt. Lucius C. Brandham stellte den Thermobecher mit dem Kaffee auf die Motorhaube seines Hummers, um die pelzgefütterte Jacke zu schließen. Fröstelnd blickte er die schmale Startbahn entlang in Richtung Osten. Das Flugzeug mit den Besuchern, die sich erst vor zwei Tagen bei ihm angemeldet hatten, ließ noch auf sich warten.
Man sah ihm nicht an, dass er zu den reichsten Menschen der Welt gehörte. Der Fünfundsiebzigjährige war mit seinen beinahe einen Meter neunzig und dem vollen, grauen Haar eine beeindruckende Erscheinung. Jedoch hatte er, wie schon seine Vorfahren, stets das Licht der Öffentlichkeit gemieden. Brandham zog es vor, im Hintergrund zu bleiben. So tauchte sein Gesicht nie in der jährlichen „Forbes-Liste“ der vermeintlich wohlhabendsten Menschen der Welt auf, obwohl sein Vermögen das der Spitzenreiter um ein mehrfaches übertraf. Sein Geld steckte in einem Geflecht von tausenden Unternehmen rund um den Erdball und würde sich nur mit sehr viel Mühe und Sachkenntnis überhaupt bis zu ihm zurückverfolgen lassen. Doch es waren die Männer und Frauen von seinem Schlag, die seit über zweihundert Jahren die Geschicke Amerikas und der meisten anderen Staaten der Welt bestimmten.
Er kannte die Geschichte seiner Familie bis ins Detail. Sein Vorfahre Wilburn Henry Brandham kämpfte an der Seite von George Washington im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten und gründete am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts in Boston eine Gießerei für Gewehr- und Kanonenkugeln. Unter Führung dessen Enkels Jason expandierte das Unternehmen während des Bürgerkrieges. Vor allem, weil es als eines der ersten in gewaltigen Stückzahlen die neuartigen Minié-Geschosse produzieren und an die Unionstruppen liefern konnte. Wenige Jahre später gehörten die Brandhams bereits zu den reichsten Familien Amerikas. Der Aufstieg setzte sich bis zum heutigen Tage unaufhaltsam fort, obwohl nur die wenigsten Menschen mit dem Namen etwas anfangen konnten. Lucius C. Brandham war stolz auf die Geschichte seiner Familie und bezeichnete sich selbst gern als einen der unbekanntesten amerikanischen Patrioten. Er kehrte den enormen Reichtum nicht nach außen und legte auch Wert darauf, dies den Nachkommen zu vermitteln. Jedes seiner drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn, führte eine eigene Holding, die wiederum über die Geldströme in den weltweit verschachtelten Unternehmen wachten. Brandham hatte sich zeit seines Lebens nie um den Gedanken geschert, mit trickreichen Manövern Steuern zu sparen. Im Gegenteil sah er dies als staatsbürgerliche Pflicht an der Nation. Deshalb befand sich das Hauptquartier seines weltweiten Imperiums in einem unscheinbar wirkenden Landhaus am Stadtrand von Boston, das bereits Wilburn als Wohn- und Geschäftsadresse diente. Lucius C. Brandham hatte, wie seine Vorfahren auch, stets der Versuchung widerstanden, dieses Gebäude gegen ein moderneres und vor allem repräsentativeres einzutauschen. Ihm grauste bei der Vorstellung, jeden Morgen in eine Tiefgarage unter einem Palast aus Glas und Stahl fahren zu müssen. Er liebte die Natur und konnte vom Fenster seines Büros einen Blick auf den Blue Hill Nationalpark werfen, wenn es die Zeit erlaubte.
Die zwanzigtausend Hektar große Ranch hier in Montana hatte er erst vor zehn Jahren erworben. Damals beschloss er, beruflich etwas kürzer zu treten und sich verstärkt der Pferdezucht zu widmen. Die Start- und Landebahn ließ er erst im vergangenen Jahr anlegen, um schneller mit einem seiner stets startbereiten Privat-Jets zu geschäftlichen und privaten Terminen gelangen zu können oder einem der wenigen Besucher eine bequemere Anreise zu ermöglichen.
Lucius C. Brandham hatte aus dem umfangreichen Fuhrpark für den heutigen Tag den Hummer ausgewählt, eine zivile Version des legendären Militärfahrzeugs. Er wollte mit seinen beiden Besuchern einen Ausflug in die nahen Black Hills unternehmen. Einer von ihnen, der amtierende CIA-Direktor Jasper Moss, war ein alter Freund aus Studienzeiten an der Stanford University. Obwohl der auch schon fast siebzig Jahre alt war, hatte ihn der aktuelle Präsident aus dem Ruhestand an die Spitze des Geheimdienstes beordert. Er galt als enger Vertrauter des mächtigsten Mannes der Welt. Moss war mit dem festen Vorsatz nach Langley gekommen, die Agency wieder zu einem schlagkräftigen Geheimdienst zu machen, nachdem sie in den letzten Jahrzehnten gegenüber der inzwischen wesentlich mächtigeren NSA erheblich ins Hintertreffen geraten war. Der CIA-Direktor hatte, obwohl ihm in seinem Amt ein eigener Jet zustand, seinen alten Freund Brandham gebeten, ihm einen Privatflieger zu schicken. Die Sache, die er mit ihm zu besprechen hätte, wäre außerordentlich geheim und er wolle so wenig Spuren wie möglich hinterlassen. Brandham stimmte ohne zu zögern zu, schließlich stand ihm eine ganze Flotte von Privatmaschinen zur Verfügung. Und so kam es, dass er jetzt am Horizont die Silhouette seiner eigenen Gulfstream G650, dem Premiummodell des amerikanischen Herstellers, erblickte. Wenige Minuten später stoppte die Maschine direkt neben Brandhams Wagen. Eine Stewardess, die mit ihrem Aussehen die Favoritin jedes Schönheitswettbewerbes wäre, öffnete die Tür und schenkte ihren beiden einzigen Passagieren dieses Fluges zum Abschied ein bezauberndes Lächeln. Jasper Moss eilte mit schnellen Schritten zu seinem alten Freund und umarmte ihn herzlich, während sich sein wesentlich jüngerer Begleiter ein wenig schüchtern im Hintergrund hielt. Der CIA-Direktor drehte sich um und winkte ihn heran.
„Calvin, kommen Sie her und lernen Sie einen der größten amerikanischen Patrioten kennen!“
Er drehte sich wieder zu Brandham um.
„Du wirst sehen, Calvin Brookman ist der brillanteste Stratege, den dieses Land hat. Leider ist er nicht bereit, direkt in den Dienst der Agency zu treten. Also muss ich aus meinem Etat seine horrenden Honorarforderungen begleichen.“
„Die aber jeden Penny wert sind. Freut mich, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Mister Brandham.“ Brookman schüttelte dem Milliardär die Hand und deutete auf das Flugzeug.
„Eine tolle Maschine. Ich glaube, ich bin noch nie so komfortabel geflogen.“
Brandham nickte gönnerhaft und wies auf den Hummer.
„Bevor wir hier festfrieren, würde ich vorschlagen, einen kleinen Ausflug zu unternehmen. Im Wagen warten heißer Kaffee und frische Bagels.“
Nach einer knappen Stunde Fahrt über unebene Straßen und schließlich direkt durch das halbhohe Präriegras erreichten sie eine Anhöhe, auf der sich ein paar Felsen türmten. Brandham stieg aus dem Wagen. Seine Gäste folgten ihm ins Freie und streckten sich.
„Hier dürften wir einigermaßen ungestört sein. Im Übrigen ist dies historischer Boden.“ Brandham wies mit dem Arm nach Süden. „Etwa zehn Meilen entfernt von hier fand achtzehnhundertsechsundsiebzig die Schlacht am Little Big Horn River statt. Der letzte Sieg der Indianer über die Armee der Vereinigten Staaten.“
Calvin Brookman schlug den Kragen seines Mantels hoch und starrte in Richtung Horizont, als erwartete er in den nächsten Minuten einen Angriff der Indianer.
„Custer hat damals einen schweren taktischen Fehler gemacht, als er entschied, sein Regiment aufzuteilen. Er hätte seine Männer zusammenhalten müssen, dann wäre diese Katastrophe nie passiert.“
Brandham, der gerade begonnen hatte, drei Campingstühle aus dem Hummer zu laden, hielt inne und baute sich neben dem deutlich jüngeren Mann auf.
„Custer war ein Idiot. Er hätte auf die Hauptstreitmacht von General Terry warten sollen. Aber er wollte den Ruhm für sich allein. Für die Army war diese Niederlage eine nützliche Erfahrung. Den Gang der Geschichte hat sie nicht aufhalten können, Mister Brookman. Jetzt nehmen Sie Platz und erklären Sie uns beiden alten Männern, warum wir in aller Herrgottsfrühe an einen so abgelegenen Platz fahren mussten, um ungestört konferieren zu können. Mein Freund Jasper tat dermaßen geheimnisvoll, dass meine Neugier inzwischen riesengroß ist. Und ich bin nicht mehr leicht zu beeindrucken.“
Der CIA-Direktor rückte seinen Stuhl so zurecht, dass ihm die Morgensonne in den Rücken schien und streckte die Beine aus.
„Ich gebe dir mein Wort, Lucius. Du wirst beeindruckt sein. Genauso, wie ich es war, als unser Freund Calvin hier mit seiner Idee zu mir kam.“
Brandham ließ sich langsam auf den Stuhl sinken und trank einen Schluck aus seinem Kaffeebecher.
„Bevor Sie uns Ihren sehr wahrscheinlich äußerst brilllianten Plan darlegen, Mister Brookman, würde ich gern mehr erfahren. Was Sie qualifiziert, sich so etwas auszudenken? Mit anderen Worten, wer sind Sie?“
Brookman errötete für einen kurzen Moment, fasste sich dann aber schnell wieder.
„Ich war drei Jahre bei den Marines, ein Einsatz in Afghanistan. Danach habe ich in Harvard und an der Sorbonne Politikwissenschaften studiert und zwei Wahlperioden im Kongress für verschiedene Abgeordnete gearbeitet. Vor vier Jahren gründete ich dann mit einem Partner die Firma Gonerstin & Brookman Strategic Consulting. Wir spezialisieren uns auf Außen- und Sicherheitspolitik und beraten vorwiegend das State Department.“
„Ihr Partner ist Harold Gonerstine, der Senator? Der ist doch schon fast achtzig.“
„Einundachtzig, um genau zu sein. Sein Name macht sich gut auf dem Briefkopf und er hat uns in Washington etliche Türen geöffnet. So bin ich auch an Mister Moss geraten. Wir analysieren im Vorfeld die eine oder andere geplante Operation der Agency auf ihre möglichen Folgen für unsere Außenpolitik.“
Der CIA-Direktor nickte.
„Und das macht er wirklich gut.“
Brandham nippte wieder an seinem Kaffee.
„Dann schießen Sie mal los, mein junger Freund. Ich bin gespannt.“
Brookman räusperte sich ein wenig verlegen und schaute den beiden Männern nacheinander in die Augen.
„Das, was ich Ihnen gleich vortrage wird, wenn wir es umsetzen, den Lauf der Geschichte ändern. Und zwar nachhaltig. Wir werden die Vereinigten Staaten wieder an den Platz auf der Welt führen, auf den es gehört. Nämlich den an der Spitze.“
Brandham runzelte die Stirn.
„Sind wir denn nicht mehr die führende Macht in der Welt? Ist mir da etwas entgangen?“
Brookman schüttelte den Kopf.
„Sir, unser derzeitiger Präsident fokussiert sich zu sehr auf die Innenpolitik. Er will Amerika wieder groß machen, indem er die einheimische Wirtschaft stärkt. Das ist sicher nicht falsch. Aber er gibt damit nach und nach unsere Führungsrolle in der Welt preis. Die Europäer gehen auf Distanz, China wächst und wächst und selbst die Russen werden wieder zunehmend selbstbewusster und glauben, mit uns auf Augenhöhe zu sein. Wir geraten politisch in eine Art Isolation.“
„Und Sie haben jetzt den Masterplan, wie man den Prozess umkehren kann? Und ich spiele darin eine tragende Rolle?“
Um Brandhams Mundwinkel herum zuckte es spöttisch, wie immer, wenn er von einer Sache nicht überzeugt war. Moss, der CIA-Direktor, hob abwartend die Hand.
„Höre es dir erst einmal an, Lucius. Am Anfang war ich genau so skeptisch wie du. Aber er hat mich dann schnell überzeugt, weil sein Plan Hand und Fuß hat. Und ja, du spielst eine wichtige Rolle. Auch wenn es niemand merken wird. Aber das ist ja für dich kein Problem. Es war übrigens meine Idee, dich da mit einzubinden. Denn erstens bist du der größte amerikanische Patriot, den ich kenne. Und zweitens hast du die Ressourcen, um die Sache durchzuziehen.“
Die Falten auf Brandhams Stirn wurden noch ein wenig tiefer.
„Was für Ressourcen sollte ich haben, die unsere Regierung nicht hat?“
Brookman räusperte sich erneut.
„Sir, Mister Brandham, wissen Sie, wir reden hier über einen Plan, der nie und nimmer an die Öffentlichkeit gelangen darf. Deshalb wird er auch nicht aus Steuergeldern zu finanzieren sein. Wir brauchen dafür privates Kapital aus sehr verschwiegener Quelle. Und da kommen nur Sie in Frage. Weil Sie dieses Land lieben wie kein zweiter.“
„Und wenn Ihr grandioser Plan, wie auch immer der aussieht, scheitert, Mister Brookman? Dann bin ich der große Buhmann und die ganze Welt wird mit dem Finger auf mich zeigen.“
„Niemand wird herausbekommen, dass Sie dahinterstehen, Mister Brandham. Ich habe mich ein wenig mit Ihrem Firmenimperium beschäftigt. Es ist so verschachtelt, dass nur sehr wenige Leute wissen, was eigentlich alles Ihnen gehört. Und diese Handvoll Menschen arbeitet in Ihrem engsten Umfeld. Der Rest der Menschheit weiß gar nichts über Sie. Alle kennen Mark Zuckerberg oder Bill Gates. Aber von einem Lucius C. Brandham, der um ein Vielfaches reicher ist als all die Anderen, hat noch niemand etwas gehört. Was mir einen gewaltigen Teil der Bewunderung abringt, die ich für Sie hege.“
Brandham rutschte ungeduldig in seinem Stuhl herum.
„Jetzt haben Sie mir genug geschmeichelt, junger Mann. Nun erklären Sie mir endlich Ihren Plan. Und nennen Sie mich gefälligst Lucius, schließlich bin ich ab sofort einer Ihrer Mitverschwörer.“
Brookman richtete sich auf und lächelte.
„Sehr gern, Mister, äh, ich meine Lucius. Was ich Ihnen im Folgenden erklären werde, wird zunächst ziemlich ungeheuerlich klingen. Doch es ist die beste Option, unser Land wieder nach vorn zu bringen.
Und ich meine, ganz weit nach vorn, dorthin, wo unsere große Nation stehen sollte. Und Ihr finanzieller Beitrag, Lucius, wird sich in überschaubaren Grenzen halten. Sie werden es in Ihrer Portokasse gar nicht merken, das verspreche ich Ihnen. Aber es ist entscheidend für unseren Plan.“
„Was soll ich denn tun, dass mich nicht viel kosten wird?“
Brandhams Augen verengten sich zu Schlitzen.
„Einer der von Ihrem Unternehmen kontrollierten Investmentfonds, Westburn Capital, hält eine fünfzigprozentige Beteiligung an einem kleinen mexikanischen Chemieunternehmen, der Salidas Pharmazia in Torreón. Die anderen fünfzig Prozent sind im Besitz der Wilson & Wilson Group in Corpus Christi, Texas. Und die Mehrheit an Wilson & Wilson hält die Waggerman Invest Company, die zu der Holding Ihres Sohnes gehört.“
„Ich bin an tausenden Unternehmen in der ganzen Welt beteiligt. Es mag also richtig sein, was Sie herausgefunden haben. Aber ich werde daraus immer noch nicht schlauer.“
„Diese Recherche hat mich fast eine Woche gekostet, Lucius. Und das auch nur, weil ich wusste, wonach ich suche. Für jemanden, der keine Ahnung hat, was vor sich geht, ist das fast unmöglich.“
„Das mag ja sein. Aber was hat das alles mit dieser kleinen Chemiefabrik in Mexiko zu tun?“
„Jetzt wird es ja erst spannend, meine Herren.“
Brookman lehnte sich einen kurzen Moment zurück.
„Salidas Pharmazia stellt Medikamente her, mit denen diverse Tropenkrankheiten behandelt werden können. Und aus diesem Grund wird dieses Unternehmen ein Labor in Kisangani erwerben. Das liegt im Kongo. Die Firma gehört einem örtlichen Apotheker, der dringend einen Nachfolger sucht. Und für eine nicht unbedeutende Summe würde er liebend gern an die Mexikaner verkaufen.“
Brandham betrachtete seine Fingernägel.
„Und was ist im Kongo eine nicht unbedeutende Summe?“
„Etwa eine Viertelmillion Dollar.“
„Meine Anfangsinvestition wären also zweihundertfünfzigtausend Dollar?“
„Das wäre Ihre Investition in einen Teil unserer Operation. Den Teil, der noch einen satten Gewinn abwerfen wird.“
„Und was haben Sie dann mit der kleinen Chemiebude vor, die ich in Afrika für Sie gekauft habe?“
„Einen Impfstoff entwickeln. Ein Medikament gegen einen neuartigen Virus, mit dem wir einen großen Teil der chinesischen Wirtschaft über einige Zeit lahmlegen werden. Jedenfalls so lange, wie wir brauchen, um uns wirtschaftlich wieder einen ausreichenden Vorsprung zu verschaffen. Wenn das erreicht ist, wird Salidas Pharmazia die Produktion hochfahren und unglaublich viel Geld verdienen.“
Brandham nickte. Die Aussicht auf einen einträglichen Gewinn gefiel ihm.
„Was ist das für ein Virus? Etwas Tödliches, sowas wie Ebola?“
Brookman schüttelte den Kopf.
„Um Gottes willen, nein! Ein kleines Labor in Nevada hat vor einigen Jahren im Auftrag der Army mit dem Erreger der spanischen Grippe herumgespielt und einen neuen Typ entwickelt. Der braucht mindestens eine Woche, bis sich irgendwelche Symptome zeigen, ist aber in dieser Zeit schon ansteckend. Das macht ihn so tückisch. Das Pentagon hat dann aber die Mittel für dieses Projekt gestrichen. Das Labor musste schließen. Wir haben aber ein paar Wissenschaftler aufgetrieben, die daran gearbeitet haben und ihnen einen neuen Job gegeben. Das heißt, wir haben die Krankheit und entwickeln den passenden Impfstoff dafür. Das machen wir in Afrika. Da wird niemand einen Zusammenhang herstellen können. Und für Sie springt noch ordentlich was raus. Mehr wollen Sie auch gar nicht darüber wissen, Lucius.“
„In Ordnung. Und was machen wir mit Europa?“
„Da haben wir einen etwas anderen Plan. Der wird alles in allem ein wenig teurer. Wir werden einige, ich nenne es mal, Eingriffe in ihre Infrastruktur tätigen. Das wird sie eine ganze Zeit lang beschäftigen. Und Zeit ist alles, was wir brauchen.“
Calvin Brookman sprach eine gute halbe Stunde, ohne von den beiden alten Männern unterbrochen zu werden. Brandham wurde abwechselnd blass und wieder rot, während der CIA-Direktor mit versteinertem Gesicht in seinem Campingstuhl saß und hinaus in die Prärie schaute.
Als der junge Mann die Ausführungen beendet hatte, lehnte sich Brandham, der ihm aufmerksam gefolgt war, in seinem Stuhl zurück und schaute in den Himmel.
„Dreißig Millionen Dollar halte ich in diesem Falle für absolut angemessen. Aber ich habe eine Bedingung.“
Brookman, der gerade seinen Kaffeebecher leerte, blickte überrascht auf.
„Und die wäre?“
„Ich möchte nicht, dass einer unserer Landsleute Schaden nimmt.“
„Sir, natürlich sind wir vorsichtig, aber wir können nicht garantieren, dass…“
Der Milliardär beugte sich zu seinem Gesprächspartner vor.
„Mister Brookman! Ich sagte: Keine amerikanischen Opfer!“
Ottawa; Kanada März 2019
Zum zwanzigsten Mal an diesem Tag klappte er die Bettdecke zurück und betrachtete sein in einen dicken Verband gehülltes linkes Knie. Und ihm war klar, dass seine Karriere damit vorbei war. Jetzt lag er, Ramon Bohm, siebenundzwanzig Jahre alt und das einstmals größte Torwarttalent des kanadischen Eishockeys der letzten zwei Jahrzehnte, in einem Krankenbett einer Klinik in Ottawa. Er konnte immer noch nicht glauben, was ihm die Ärzte heute früh beizubringen versucht hatten. Dass er nie wieder würde spielen können. Gewiss, in ein paar Tagen bekäme er ein neues, ein künstliches Kniegelenk, das ihm ein normales Leben ermöglichte. Aber eben nur ein normales. Mit dem Hochleistungssport, den er seit über zwanzig Jahren betrieb, war es vorbei. Ramon Bohm hatte den Eishockeysport gelebt. Von Kindheit an legte er einen ungeheuren Fleiß an den Tag, übte, trainierte und spielte sich Schritt für Schritt nach oben. Immer stand er bereits in der nächst höheren Altersklasse im Tor, musste sich gegen harte Jungs durchsetzen, die größer und kräftiger waren als er und die ihn das bei jedem Training und jedem Spiel spüren ließen. Doch er biss sich durch. Mit sechzehn schaffte er bereits den Sprung in die Junioren-Nationalmannschaft. Und wurde noch im selben Jahr Weltmeister. Der Verband verlieh ihm die „Calder Memorial Trophy“ als bestem Rookie der Saison. Mit achtzehn lief er zum ersten Mal für das kanadische Männer-Team auf. Spätestens ab diesem Augenblick erregte er die Aufmerksamkeit der amerikanischen Profi-Teams.
Es hagelte Angebote der Top-Clubs aus den USA. Er entschied sich, zunächst in Kanada zu bleiben, bekam in der Zeit dreimal die „Vezina Trophy“ als bester Torhüter der NHL. Vor vor drei Jahren nahm er schließlich eine Offerte der Washington Capitals an, mit denen er in der vergangenen Saison den Stanley Cup, die nordamerikanische Meisterschaft gewann. Und nun das. Im Spiel gegen die Boston Bruins passierte es. Ramon hechtete nach dem Puck und blieb auf dem Bauch liegen. In dem Getümmel über ihm bekam ein Bostoner Spieler einen Stoß, verlor das Gleichgewicht und trat mit dem Schlittschuh auf die am wenigsten geschützte Stelle des Torhüters, die Kniekehle. Ramon erinnerte sich wieder an den plötzlichen Schmerz und seinen Schrei, den man bis in die obersten Ränge der Halle gehört hatte. Der Schlittschuh hatte wie ein Fallbeil mehrere Sehnen durchschnitten und das Kniegelenk unrettbar beschädigt. Er bekam nicht mehr mit, dass einer seiner Mannschaftskameraden dem Verursacher einen solchen Schlag versetzte, dass dieser drei Vorderzähne verlor und sich das Nasenbein brach. Nur mit Mühe konnten die Schiedsrichter eine Massenschlägerei auf dem Eis verhindern und sicherstellen, dass Ramon vom Mannschaftsarzt und den Physiotherapeuten versorgt und auf einer Trage aus der Halle gebracht werden konnte. Zwei Tage später stand Dave Bower an seinem Bett in der Klinik. Der Nachbar und gute Freund der Familie war Chefarzt einer der angesehensten Privatkliniken Kanadas. Auf dessen Intervention hin schob man Ramon Bohm kurze Zeit später auf einer Trage in einen Privatjet für den Flug nach Ottawa. Doch auch die Spezialisten in Kanada konnten nur bestätigen, was ihre US-amerikanischen Kollegen bereits angedeutet hatten. Mit dem Eishockey war es vorbei.
Ramon deckte sein lädiertes Bein wieder zu und kämpfte einen Moment lang mit den Tränen. Okay, finanziell musste er sich keine Sorgen machen. Er hatte in den vergangenen Jahren mehr Geld verdient, als er ausgeben konnte. Dazu dürfte ein üppiges Abfindungsangebot der Krankenversicherung kommen, die damit versuchen würde, sich um die dauerhafte Rente zu drücken, die sie ihm laut Vertrag in so einem Fall zahlen müsste. Ramon hatte, im Vergleich zu vielen seiner Kollegen sparsam, beinahe asketisch, gelebt und den Großteil des Geldes, das ihm die Vereine und Sponsoren geradezu nachwarfen, beiseitegelegt. Er hatte nie Interesse daran gefunden, in teuren Clubs herumzuhängen oder sich eine Sammlung von Luxusautos zuzulegen. Die letzte Beziehung zu einer Frau hatte er vor einigen Monaten beendet, als er merkte, dass Vanessa lediglich bemüht war, auf der Basis seines Bekanntheitsgrades eine Modelkarriere zu begründen. Sie versuchte über Wochen, ihn immer wieder zur Teilnahme an irgendwelchen Galas, Partys und sonstigen Jetset-Events zu überreden, auf die er gar keine Lust hatte. Ihm war es von jeher lieber, dem Rampenlicht fernzubleiben und sich seinem Sport zu widmen.
Den einzigen wirklichen Luxus, den sich Ramon Bohm in den letzten Jahren gegönnt hatte, war eine sündhaft teure Kameraausrüstung nebst einer High-Tec-Drohne, die gestochen scharfe Bilder lieferte. Bei einer der ganz wenigen Promi-Veranstaltungen, die er vor etlicher Zeit einmal besucht hatte, lernte er Gerry Myers kennen, den Guru der kanadischen Naturfilm-Szene. Der überredete ihn, im Sommer an einer Expedition an den Polarkreis teilzunehmen, um Eisbären zu filmen. Von da an hatte es Ramon gepackt und wann immer es die Zeit erlaubte, ging er mit dem graubärtigen Filmemacher und dessen Team auf Reisen rund um den Erdball. Dabei entdeckte er seine zweite Leidenschaft nach dem Eishockey, die der Filmerei. Und da er es sich leisten konnte, beschaffte er sich nach und nach die beste Kameratechnik, die es auf dem Markt gab. Seinen Mannschaftskollegen gab das immer mal wieder Anlass für ein paar kleine Lästereien. Wenn sie nach Saisonende in den Karibikurlaub flogen, packte Ramon seine Sachen, um für ein paar Wochen im Regenwald zu campieren oder auf einer abgelegenen russischen Insel Walrosse zu filmen.Ein Klopfen an der Tür schreckte ihn aus seinen Gedanken. Statt einer der rührend um ihn besorgten Krankenschwestern schob eine ihm unbekannte Frau den Kopf durch den Türspalt.
„Ramon Bohm, der Eishockeytorwart, richtig?“
Sie schlüpfte blitzschnell ins Zimmer und schloss die Tür. Bohm schaute überrascht auf.
„Ob ich noch Torwart bin, weiß ich nicht, aber wenn Sie Ramon Bohm suchen, sind Sie richtig. Und wer sind Sie noch gleich?“
Die junge Frau, Ramon schätzte sie auf Anfang dreißig, schob eine Strähne ihrer dunkelblonden Haare hinter das rechte Ohr und lächelte. Während sie sich einen Stuhl heranzog, betrachtete er sie genauer. Ihr Gesicht wies auf eine osteuropäische Herkunft hin. Er hatte auch einen schwachen Akzent in ihrer Stimme bemerkt, den er allerdings nicht deuten konnte. Die unerwartete Besucherin ließ sich auf dem Stuhl neben seinem Bett nieder und lächelte ihn an.
„Entschuldigen Sie vielmals, dass ich hier so hereinplatze. Mein Name ist Jolana Kubina. Ich arbeite für Tydenik Gol. Das ist ein tschechisches Sportjournal.“
Bohms Kopf sank auf das Kissen.
„Sie sind Reporterin? Wie haben Sie mich hier gefunden? Man hat mir versichert, dass niemand außerhalb dieser Klinik weiß, dass ich hier bin.“
Sie lächelte erneut.
„Ramon, ich darf Sie doch Ramon nennen? Ich bin nicht einfach nur Reporterin, ich bin eine verdammt gute Journalistin. Deshalb habe ich auch ohne große Probleme herausgefunden, wo Sie behandelt werden. Ich hätte mich gern mit Ihnen unterhalten. Nur ein paar kurze Fragen, dann bin ich wieder verschwunden. Versprochen!“
Sie zückte ihr Smartphone und tippte auf dem Display herum. Er beobachtete sie dabei und erwog für einen kurzen Moment, nach der Schwester zu klingeln. Wenn er in seiner jetzigen Situation etwas überhaupt nicht wollte, dann Interviews geben. Das hatte er schon immer gehasst. Aber irgendetwas war es heute anders. Er verwarf den Gedanken und atmete tief durch.
„Na gut, wenn Sie schon mal hier sind… Wo sagten sie kommen Sie her? Tyden…?“
„Tydenik Gol. Aus Prag. Das ist die Hauptstadt von Tschechien.“
„Sie werden sich wundern, aber das weiß ich. Ich war sogar mal dort. Eine wunderschöne Stadt!“
„Danke! Unser Blatt ist spezialisiert auf Fußball und Eishockey. Ich berichte aus Nordamerika.“
Jetzt musste Bohm lächeln.
„Interessant! Eine Frau, die über Eishockey schreibt.“
Sie legte ihr Smartphone auf seine Bettdecke.
„Ich komme aus einer hockeyverrückten Familie. Mein Bruder Jakub spielt in Russland und mein Vater Vaclav…“
„Ist Trainer bei den Detroit Red Wings. Ich habe ihn sogar einmal persönlich kennengelernt. Netter Kerl. Aber als Coach soll er knallhart sein. Sehen Sie, Jolana, so klein ist die Welt.“
Eine geschlagene Stunde plauderten sie über Eishockey, gemeinsame Bekannte und schließlich fragte sie nach seinen Zukunftsplänen. Ramon Bohm hob die Schultern.
„Das weiß ich noch nicht. Okay, finanziell muss ich mir keine Sorgen machen. Sagt zumindest mein Manager. Aber ich brauche noch eine Idee für ein sinnvolles Leben nach dem Eishockey.“
Als hätte er auf dieses Stichwort gewartet, stand mit einem Male ein großgewachsener graubärtiger Mann im Zimmer. Mit seinem Hut und dem roten Tuch um den Hals wirkte er wie ein Cowboy. Jolana schaute überrascht zu ihm auf.
„Sie sind doch Gerry Myers, der Filmproduzent, richtig?“
Der Besucher lachte dröhnend und zeigte mit dem Finger auf Ramon Bohm.
„Ramon, alter Freund. Wer ist denn das? Deine neue Freundin? Du hast mir noch gar nichts von ihr erzählt!“
Ramon setzte sich aufrecht ins Bett und schob sich das Kissen hinter den Rücken.
„Das ist Miss Kubina. Sie hat es doch tatsächlich geschafft, mich hier ausfindig zu machen. So wie du offensichtlich auch. Haben die draußen ein Bild von mir aufgehängt oder wieso weiß die ganze Welt, dass ich hier liege?“
Wieder dröhnte Myers Lachen durch den Raum.
„Ich habe einfach deinen alten Herrn angerufen und gefragt. Schließlich mache ich mir doch Gedanken um meinen Expeditionspartner.“
Jolana fuchtelte mit den Händen.
„Einen Moment. Wollen Sie damit andeuten, dass Ramon schon mal mit Ihnen unterwegs war?“
„Nicht nur einmal, Schätzchen. Er ist ein geborener Kameramann und hat zudem eine Filmausrüstung, um die ihn jedes Fernsehteam beneidet. Sie sollten mal sehen, wie unser Held hier mit einer Drohne umgeht. Der steuert sie direkt in den Hintern eines Grizzlybären und ebenso unbeschadet wieder hinaus.“
Bohm winkte ab.
„Er übertreibt wie immer. Aber ich war wirklich schon ab und zu mal mit ihm unterwegs. Und glauben Sie mir, es ist nie langweilig.“
Myers schaute sich die junge Frau nun etwas genauer an.
„Entschuldigen Sie meine Neugier, Lady. Woher stammen Sie? Aus Russland?“
Sie schüttelte heftig den Kopf.
„Aus Tschechien.“
Er schaute ungläubig.
„Ehrlich jetzt? In die Gegend plane ich meine nächste Expedition. Ich will im Oktober in die Hohe Tatra. Dort soll es noch Wölfe und Bären geben. Die will ich gern sehen.“
„Das ist aber in der Slowakei. Meine Mutter stammt von dort. Ich bin als Kind viel mit meinem Großvater in den Bergen gewesen. Die Region kenne ich ziemlich gut.“
„Vielleicht sollte ich Sie engagieren. Wenn unser Held hier bis dahin wieder fit wird, kann er uns ebenfalls gern begleiten. Wie sieht es aus, Champion?“
Ramon Bohm hob die Schultern und wies auf sein Bein.
„Ich gebe mir Mühe.“
Gerry Myers erhob sich und streckte der Journalistin die Hand hin.
„Das will ich hoffen. Bis dahin werde ich erst einmal mit meiner neuen Bergführerin hier essen gehen und ihr Honorar drücken.“
Nairobi; Kenia August 2019
Mühsam quälte sich die betagte Antonow-26 auf achttausend Meter über dem Boden. Claudia Bohms Nervosität stieg mit jeder Sekunde, die sie in diesem Flugzeug verbrachte. Es würde ihr erster Fallschirmsprung aus so großer Höhe und damit gleichzeitig der Abschluss ihrer Ausbildung an der privaten Akademie der African Gard & Security sein, die sie vor etwas mehr als vier Monaten begonnen hatte.
Sie erinnerte sich noch genau an den Tag im Frühling, als Maurice Mankundé und Sam Awenu in einem Restaurant in Rostock vor ihr und ihrem Freund Steffen Kern saßen.
Die beiden Afrikaner waren alte und sehr enge Freunde ihrer Familie. Maurice Mankundé, ein hünenhafter Kenianer mit familiären Wurzeln bei den legendären Massai, herrschte über eines der mächtigsten Firmenimperien des schwarzen Kontinentes. Ihm gehörten unterschiedlichste Unternehmen in ganz Afrika, unter anderem auch die Mehrheit an dem privaten Sicherheitsunternehmen AGS, African Guard & Security, das vorrangig mit der Bewachung von Firmen, aber zunehmend auch öffentlichen Einrichtungen in ganz Afrika betraut wurde. Von Anfang an verfügte die AGS zudem über eine speziell ausgebildete Einheit, die sich aus ehemaligen Angehörigen von Eliteeinheiten aus Armeen und Polizeitruppen zusammensetzte und für besonders gefährliche Einsätze angefordert wurde. Speziell dann, wenn es um terroristische Anschläge oder Entführungen ging, vertrauten viele Privatunternehmen und zunehmend auch Politiker eher den exzellent ausgebildeten Kämpfern Mankundés als ihren eigenen Polizeikräften.
Zu den Mitbegründern dieses inzwischen in Afrika legendären Sicherheitsunternehmens, dessen Mitarbeiter schwarze Uniformen trugen und militärische Dienstgrade führten, gehörte auch Claudias Vater, Peter Bohm. Obwohl er selbst nur an wenigen Einsätzen der AGS-Elitetruppe teilgenommen hatte, genoss er innerhalb der Firma den Status eines Helden.
Sam Awenu war Anfang der Zweitausender als Captain von den Fallschirmjägern der kenianischen Armee zur AGS gewechselt und hatte vor einigen Jahren die Geschäftsführung übernommen. Intern bekleidete er inzwischen den Rang eines Generals. Ein Dienstgrad, der ihm immer noch Unbehagen bereite.
Mankundé und Awenu hatten Claudia Bohm und Steffen Kern in eines der teuersten Restaurants in Rostock eingeladen. Die vier kannten sich seit Jahren und gaben sich so entsprechend unverkrampft.
Mankundé klappte die Speisekarte zu und schaute der Tochter eines seiner besten Freunde tief in die Augen.
„Wie geht es deinem Bruder?“
Claudia schüttelte den Kopf.
„Nicht so gut. Er wurde vor zwei Wochen bei einem Spiel ziemlich schwer am Knie verletzt.
Wahrscheinlich ist seine Karriere als Eishockey-Torwart damit im Eimer. Und das gerade jetzt, wo er in der letzten Saison die amerikanische Meisterschaft gewonnen hat. Es ist zum Heulen.“
Mankundé trank einen Schluck Wein.
„Ich habe letzte Woche mit deinem Vater telefoniert. Ramon ist im Moment ziemlich fertig. Habt ihr ihn schon besucht?“
Claudia schüttelte den Kopf.
„Ich bin gerade in der Schlussphase meines Studiums und sitze an meiner Masterarbeit. Die wird, wenn alles glattgeht, in den nächsten vier Wochen fertig. Dann habe ich Zeit, um mal rüber zu fliegen. Ich denke, Ramon wird das verstehen.“ Mankundé nickte nachdenklich.
„Da sind wir schon beim Thema. Claudia, mein Kind, du weißt, warum wir hier sind?“
Die schüttelte den Kopf.
„Ich habe keine Ahnung. Aber es muss schon wichtig sein, wenn Ihr beide Euch auf den Weg in das kalte Europa macht.“
Mankundé lächelte.
„Ich kenne dich, seit du ein kleines Mädchen warst. Und irgendwie bist du für mich so etwas wie eine Tochter. Eigentlich für uns beide, nicht wahr Sam?“ Awenu lächelte.
„Natürlich. Schließlich haben wir ja gemeinsam schon eine ganze Menge durchgemacht.“
Claudia nickte.
„Unsere Familie wird dir nie vergessen, dass du mich damals befreit hast, als ich als kleines Kind entführt wurde.“
Awenu hob sein Glas und prostete ihr zu.
„Das war hauptsächlich das Werk deines Vaters. Aber ich kann stolz darauf sein, ihm ein wenig geholfen zu haben.“
Steffen Kern, der der Unterhaltung bisher schweigend gelauscht hatte, stellte sein Glas beiseite und schaute fragend in die Runde.
„Mal zurück zum Thema. Warum seid Ihr nun eigentlich hier?“
Mankundé lächelte erneut.
„Um euch beiden Jobs anzubieten.“
Claudia lehnte sich überrascht zurück.
„Wie jetzt? In Afrika?“
Awenu richtete sich auf und warf einen kurzen Blick auf Mankundé. Der nickte ihm zu.
„Erzähl es ihnen, Sam!“
„Wir wollen uns als AGS internationaler aufstellen. Raus aus Afrika. Das wird mein letztes großes Projekt, bevor ich in den Ruhestand gehe. Und Maurice und ich sind uns einig, dass wir dich, Claudia Bohm, dabei haben wollen. Du hast dein Studium so gut wie beendet. Und wir bieten dir an, im Vorstand der AGS zu arbeiten. Quasi als meine rechte Hand. Du hast mehr als einmal bewiesen, dass du genau so kaltblütig wie dein Vater bist. Du könntest uns helfen, in anderen Ländern der Welt Fuß zu fassen.“
„Und für dich“ Maurice Mankundé zeigte auf Steffen Kern, „gibt es auch eine Aufgabe, die dich ausfüllen wird. Zu meinem Konzern gehören auch diverse Zeitungen. Ich möchte, dass du dich damit befasst, für einige von ihnen das Online-Geschäft anzuschieben. Ich möchte eine Art Redaktionspool gründen, für den ich gestandene Journalisten suche. Und da wärst du gerade richtig. Was sagt Ihr dazu?“ Claudia legte den Kopf in den Nacken und atmete laut hörbar aus. Dann schaute sie Maurice Mankundé in die Augen.
„Meinst du nicht, dass ich ein wenig zu jung und zu unerfahren für so einen Job bin?“
Der Afrikaner setzte ein breites Lächeln auf.
„Für dein Alter hast du mehr erlebt als mancher Fünfzigjährige. Es ist kein Makel, jung zu sein. Und Erfahrung hast du mehr als genug.“
Claudia wiegte den Kopf.
„Das Angebot ehrt mich wirklich. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob ich das hinkriege. Vielleicht wäre es besser, wenn ich vorher noch einen Kurs an Eurer Akademie mache. Ich meine eine Ausbildung für Eure Spezialtruppe.“
Mankundé hob die Augenbrauen.
„Das wird deinem Vater aber gar nicht gefallen. Der möchte bestimmt nicht, dass seine Tochter Elitesoldatin wird und sich in irgendwelche Einsätze stürzt. Außerdem sind die körperlichen Anforderungen enorm. Wir nehmen dort nur ehemalige Angehörige von Spezialeinheiten auf.
Und die werden dort noch einmal richtig gedrillt.
Das wird schwierig.“
„Das mit meinem Vater überlasse mal mir. Und außerdem wäre es glaubwürdiger, wenn ich eine richtige Guards-Ausbildung habe, findest du nicht?“ Sam Awenu legt seine Hand auf Mankundés Unterarm.
„Claudia hat gar nicht so unrecht. Und ich habe schon länger die Idee, mal einen Frauenkurs an der Akademie einzurichten. Wir basteln da ein spezielles Programm zusammen. Du machst den normalen Grundkurs, wie ihn das ganze normale Wachpersonal bekommt und dann ein Spezialtraining, wo du alles lernen wirst, was unsere Sondertruppe, die sich übrigens seit kurzem die Black Lions nennt, können muss. Nur die körperlichen Anforderungen werden wir etwas herunterschrauben, weil du ja nicht für Einsätze geplant wirst. Da würden wir in der Tat Ärger mit deinem Vater bekommen. Und den will keiner als Feind haben, wie du weißt.“
Das Flugzeug durchflog einige Turbulenzen und schüttelte alle an Bord kräftig durch. Claudia schaute in die Runde. Neben ihr saßen vier junge Frauen, mit denen sie in den letzten Monaten die Ausbildung absolviert hatte. Auf der Bank zu ihrer linken kauerte Safya, eine kleine, kräftig gebaute Kenianerin mit kurzen gelockten Haaren. Mit ihr teilte sich Claudia unter der Woche ein Zimmer an der Akademie, die etwa fünfzig Kilometer außerhalb von Nairobi lag. Die Wochenenden verbrachte sie mit ihrem Freund in einem kleinen Appartement in einem ruhigen, mehrheitlich von Europäern und Amerikanern bewohnten Viertel in der kenianischen Hauptstadt. Safya wirkte genau so nervös wie Claudia. Obwohl beide in den letzten Monaten mehr als hundert Fallschirmsprünge absolviert hatten, war dieser heute etwas besonderes. Die Aufgabe bestand darin, aus etwa achttausend Meter Höhe abzuspringen und bei siebentausend Metern den Fallschirm zu öffnen.
Dann sollten sie den Schirm genau auf den knapp vierzig Kilometer entfernten Sportplatz der Akademie steuern und dort sicher landen. Das war etwas völlig anderes als die bisherigen Trainingssprünge aus tausend Metern Höhe, die sie bisher absolviert hatten. Claudia versuchte ein Lächeln. Safya griff nach ihrer Hand und drückte sie kurz. Dann beschäftigten sie sich mit den Sauerstoffmasken, die sie bei einem Absprung aus dieser Höhe unbedingt benötigten.
Claudias Gedanken wanderten zurück zu ihrer ersten Woche in der Grundausbildung. Sie hatte einige Schwierigkeiten, die harten Normen der zahlreichen Fitnesstests zu erfüllen, ganz im Gegensatz zu ihren afrikanischen Mitstreiterinnen, die ihr in Fragen der körperlichen Konstitution oftmals weit überlegen waren. Nie vergessen würde sie ihre erste Stunde in der Nahkampfausbildung. Ihr Trainer stellte sich als Stanley Nandwa vor. Der kleine, sehr kräftige ehemalige Sergeant der kenianischen Armee musterte sie und ihre Kameraden. Schließlich baute er sich direkt vor ihr auf. Abfällig betrachtete er sie von Kopf bis Fuß. Claudia fühlte sich von Sekunde zu Sekunde unwohler.
„Oh, was haben wir denn da? Eine vornehme weiße Lady mitten unter uns Schwarzen? Woher stammst du?“
„Aus Kanada, Sir!“
„Aha, eine Amerikanerin. Du bist also auch noch etwas Besonderes! Glaubst du, du bekommst hier eine Sonderbehandlung?“
Ihr Körper straffte sich.
„Nein Sir, ich möchte behandelt werden wie alle anderen auch!“
„Dann wirst du hier nichts zu lachen haben. Weiße sind bei mir nämlich immer die Verlierer. Und weißt du, wie ich Verlierer behandele?“
Er zog ein Messer aus dem Gürtel und hielt es ihr hin.
„Greif mich an. So hart du kannst. Dann wirst du deine erste Lektion erhalten. Und die lautet: Wie fühlt es sich an zu verlieren.“
Er wandte sich den anderen zu, die stocksteif dastanden und die Szene verfolgten.
„Schaut euch genau an, was gleich passiert. Ihr seid Schwarz! Ihr seid stolz! Ihr seid nicht solche Verlierer wie diese weiße Lady!“
Er ging ein paar Schritte zurück und blickte Claudia in die Augen.
„Na los! Zeig mal, ob du den Schneid hast, mich anzugreifen. Und ob du die Schmerzen ertragen kannst, die ein schwarzer Mann dir bereiten wird.“ Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen. Sie wog das Messer in der Hand. Seine Stimme wurde lauter.
„Was ist los, weiße Lady? Hast du Angst vor dem schwarzen Mann? Komm schon, trau dich!“
Sie zögerte.
„Sir das wollen Sie nicht wirklich. Ich bin…“
„Greif mich an, du Feigling! Das ist ein Befehl!“
Claudia hob resignierend die Schultern, dann streckte sie den linken Arm in die Luft.
„Da!“
Das Ablenkungsmanöver gelang. Unwillkürlich drehte er den Kopf in die Richtung, in die sie zeigte. Schreiend warf sich Claudia mit einer Hechtrolle auf ihren Gegner zu, der dies einen Sekundenbruchteil zu spät bemerkte. Der Absatz ihres linken Fußes traf mit voller Wucht seinen Unterleib. Während er sich vor Schmerzen krümmte, kam sie wieder auf die Beine und rammte ihm ihr Knie ins Gesicht. Mit lautem Krachen brach dabei sein Nasenbein. Obwohl er bereits vor Schmerz aufschrie, packte Claudia seinen rechten Arm und drehte ihn auf den Rücken, während sie ihm so kräftig in die Kniekehle trat, dass er zu Boden ging. Durch diese ruckartige Bewegung kugelte er sich das Schultergelenk aus, was die Qualen noch einmal vervielfachte. Claudia ließ den nutzlos gewordenen Arm ihres Widersachers los und zog mit der linken Hand sein Kinn nach oben. Das Messer in ihrer rechten ließ sie sacht um seinen Haaransatz gleiten. Dabei beugte sie sich direkt neben seinen Kopf und flüsterte: „Und da, wo ich herkomme, pflegen wir unserem Opfer nach einem gewonnenen Kampf den Skalp abzuziehen.“