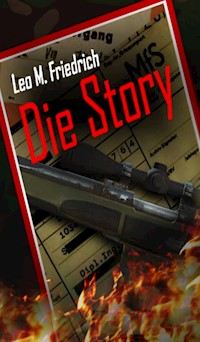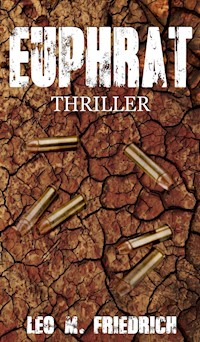5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach einem bewegten Leben als Agent und Waffenhändler will Peter Bohm nur noch eines: Das Leben mit seiner Familie genießen. Doch dann verschwinden seine Kinder. Und die Entführer fordern von ihm eine Atomwaffe. Er nimmt Kontakt zu alten Freunden und Bekannten auf, die ihm bei der Suche helfen. Bald muss Bohm erkennen, dass die wahren Hintermänner nicht nur einen unglaublichen Plan verfolgen, sondern auch alte Rechnungen mit ihm begleichen wollen. Bald weiß er nicht mehr, ob er nun Jäger oder Gejagter ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
©2013 Autor: Leo M. Friedrich
Covergestaltung: Leo M. Friedrich
Verlag: tredition Hamburg
ISBN: 978-3-8495-2685-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung
Leo M. Friedrich
Schatten
der
Albatrosse
Die Interpretation der Vergangenheit ist maßgeblich von den Bedürfnissen der Gegenwart bestimmt - jeder neue Glaube macht aus den alten Göttern böse Dämonen.
Verfasser unbekannt
PROLOG
Peter´s Point nahe Ottawa, Kanada 5.September 2006, 23.45 Uhr
Die Fahrt vom Ribeau Theater nach Hause dauerte wegen des einsetzenden heftigen Regens zehn Minuten länger als üblich. Als sie das Haus von der angebauten Garage aus betraten, fiel ihnen zunächst nichts Ungewöhnliches auf. Die Kinder sollten um diese Zeit schon schlafen und auch das Kindermädchen, eine achtzehnjährige Deutsche, war sicherlich schon ins Bett gegangen.
Dass etwas nicht stimmte wurde ihnen erst klar, als sie die offenstehenden Türen der Kinderzimmer bemerkten und schließlich vor den leeren Betten standen. Im selben Augenblick hörten sie ein Wimmern und entdeckten das gefesselte und geknebelte Kindermädchen im angrenzenden Badezimmer.
Erst als er nochmals in das Zimmer seiner verschwundenen Tochter zurücklief, fiel ihm auf deren Tisch ein Handy auf, das weder ihr noch sonst wem in der Familie gehörte. Daneben lag ein Zettel, auf dem nur ein Wort stand: „CALL“. Er drückte die Wahlwiederholung und bevor er ein Freizeichen vernehmen konnte, wurde am anderen Ende schon gesprochen:
Teil I
1.Kapitel
In der Nähe von Varvara, Bulgarien 16.Mai 1983, 22.57 Uhr
Peter Bohm stand am Straßenrand und sah die Rücklichter des Lastwagens, der ihn eben hier abgesetzt hatte, hinter einer Straßenbiegung im Wald verschwinden. Eigentlich müsste er jetzt verzweifelt sein, denn er war ohne Geld, ohne Papiere und ohne Verpflegung in einem fremden Land und hatte noch nicht einmal eine Karte, um sich zu orientieren. Er hatte nichts weiter, außer einem Auftrag, der besagte, sich in drei Tagen in einer Hafentaverne in Thessaloniki mit einer Person zu treffen, die er an einer roten Baseballkappe erkennen würde und von der er weitere Instruktionen erhalten sollte. Was nichts anderes hieß, als dass er von Bulgarien über die Grenze nach Griechenland gelangen musste, ohne erwischt zu werden. Wenn es schiefging, was durchaus wahrscheinlich war, müsste er der Mündung einer entsicherten Kalaschnikow und deren Besitzer dahinter erklären, dass er Angehöriger des Geheimdienstes eines befreundeten Staates war, der zu Prüfungszwecken den illegalen Grenzübertritt ins kapitalistische Ausland vollziehen wollte. Er konnte sich dabei aber nicht sicher sein, ob sein Gegenüber soviel russisches Sprachverständnis aufbringen könnte oder wollte, um dies zu begreifen und den richtigen Anruf zu tätigen. Also war es besser, sich nicht erwischen zu lassen.
Bohm erinnerte sich, kurz vor dem Halt durch die Planen des Verdeckes die Lichter einer Ortschaft gesehen zu haben und machte sich längs der Straße auf den Weg. Tatsächlich hatte er Glück und erreichte nach einer halben Stunde die ersten Häuser eines kleinen Provinznestes am Rande der Berge. Direkt am Ortseingang fand sich eine verschlossene kleine Tankstelle, deren Hintertür ihm nur wenig Widerstand leistete. Er nahm sich eine der ausliegenden Landkarten aus dem Regal und suchte vergeblich nach etwas Essbarem. Schließlich öffnete er die Kasse und fand darin etwa einhundert Lewa, die er einsteckte und sich dann wieder zurückzog. Bei der Einweisung in den Prüfungsablauf hatte man lediglich darauf hingewiesen, dass keine Menschen zu Schaden kommen dürften, und außerdem hatte er noch so viele Gesetzesbrüche vor sich, dass so ein Diebstahl dagegen kaum ins Gewicht fiel.
Im Schutze einer Scheune betrachtete Peter Bohm die Landkarte und kam zu dem Schluss, dass er mindestens noch ein vollgetanktes Auto sowie ausreichend Verpflegung brauchte, wollte er auch nur in die Nähe der griechischen Grenze kommen. Vor ihm lag ein Gebirge, aber die letzten Tage waren angenehm warm gewesen, so dass die Kleidung, die er trug, und die selbstverständlich keinen Hinweis auf seine Herkunft gab, ausreichen sollte.
Er hatte keine Ahnung, wie viel Prozent der Bulgaren ein eigenes Auto besaßen, aber er war fest entschlossen, eines zu stehlen. Dies würde dem Besitzer sicherlich eine Menge Ärger einbringen. Jedoch beruhigte er sein Gewissen damit, dass er das Gefährt in jedem Fall vor der Grenze zurückließe und damit dessen Chance vergrößerte, es zurückzubekommen.
Tatsächlich stand auf dem Gelände einer Autowerkstatt ein etwas in die Jahre gekommener Shiguli, was sich als Glücksfall erwies. An dieser Marke hatte er in seiner Ausbildung immer wieder das elegante Aufbrechen und Kurzschließen geübt. Inzwischen war es fast vier Uhr und in Kürze würden die ersten Frühaufsteher auftauchen, so dass er sich durch die Berge in Richtung Süden aufmachte, bevor jemand zwar das Auto, nicht aber dessen Fahrer erkannte.
Mehrere Stunden fuhr er nun schon durch endlose Wälder, ohne einem anderen Fahrzeug zu begegnen. Diese Prüfungstage setzten den Schlusspunkt hinter eine drei Jahre währende Ausbildung, die zu der geheimsten seines Landes zählte. Monatelang war er mit allen Aspekten des Agentenlebens vertraut gemacht worden, hatte Schiessen und Auto fahren gelernt, man hatte ihm beigebracht, wie man tote Briefkästen anlegt und überwacht, Personen observiert, wie man erkennt, dass man selbst beobachtet wird oder sich einer Überwachung entzieht. Alle Welt dachte, er leiste nur seinen dreijährigen Militärdienst ab, stattdessen wurde er zum Agenten ausgebildet. Jetzt saß er hier in einem Shiguli und überlegte, wie er am schnellsten über die Grenze nach Griechenland käme.
Nach ungefähr vier Stunden Fahrt erreichte er Kulata, den Grenzort auf bulgarischer Seite. Er stellte das Auto auf den Parkplatz des örtlichen Lebensmittelmarktes und erkundete zu Fuß den Grenzübergang. Sofort fiel ihm auf, dass hier jede Menge Lastwagen in beide Richtungen abgefertigt wurden. Die Kontrollen waren allerdings sehr gründlich, bei jedem einzelnen Fahrzeug wurde die Unterseite mit Spiegeln gecheckt, außerdem waren ständig zwei Wachposten mit Hunden präsent.
Um nicht unnötig aufzufallen, zog sich Bohm nach einer halben Stunde wieder zurück und verließ den Ort in Richtung Norden. Er suchte entlang der Straße nach einem geeigneten Rastplatz, auf dem Lastwagenfahrer eine letzte Pause vor der Grenze einlegten. Nach einer guten Stunde fand er einen in einem kleinen Waldstück gelegenen, der von der Straße nicht einzusehen war und richtete sich in unmittelbarer Nähe im Unterholz ein. Erst als er bereits daran zu zweifeln begann, ob seine Idee wirklich so gut war, bog ein Sattelzug von der Straße ab und hielt auf sein Versteck zu. Es war einer der vielen griechischen Viehtransporter, die er bereits tagsüber am Grenzübergang beobachtet hatte. Wie die anderen stank auch dieser weithin nach Schweinekot. Der Fahrer war ausgestiegen und in den angrenzenden Wald gegangen, um sich zu erleichtern. Bohm wollte sein Versteck grade verlassen, als ein Motorrad mit zwei Jugendlichen neben dem Lastwagen hielt. Der Beifahrer sprang ab, rannte auf den Lastwagenfahrer zu, der grade aus dem Gebüsch kam, hielt ihm ein Messer an die Kehle und schrie etwas Unverständliches. Der zweite kam dazu und beide drängten ihr Opfer in Richtung seines Fahrerhauses. Bohm sprang jetzt endgültig aus seinem Versteck und rannte auf die Gruppe zu. Der erste Räuber drehte sich zu ihm um, reagierte aber viel zu spät und bekam die ausgestreckte rechte Hand gleich einem Messer in die Magengrube, woraufhin er wie eine Stoffpuppe zusammensackte, der Fausthieb an die Schläfe ließ ihn dann in tiefe Bewusstlosigkeit sinken. Der zweite schwenkte sein Messer in Bohms Richtung, welches dieser ihm aber sofort aus der Hand trat und ihm mit einem direkt folgenden Schlag das Nasenbein brach. Der nächste Hieb schickte ihn zu seinem Komplizen ins Land der Träume. Die ganze Aktion dauerte nicht mehr als 10 Sekunden. Bohm wandte sich dem Trucker zu, der wie vom Donner gerührt war und noch zu verstehen versuchte, was hier gerade vor sich ging. Er reagierte erst, als er an den Schultern gepackt und durchgeschüttelt wurde, wobei er etwas Unverständliches murmelte. Bohm sprach ihn auf Englisch an, erntete aber nur ein Kopfschütteln. Er überlegte kurz und fragte:
„Deutsch?“
Der Grieche blickte auf und nickte. Er wies auf die beiden am Boden liegenden Angreifer und fragte:
„Was jetzt?“
Gemeinsam zogen sie die Beiden ins nahe Unterholz und fesselten sie mit ihren Gürteln an einen Baum. Bohm stopfte noch jedem einen Stofffetzen in den Mund, dann überlegte er, wie er dem Griechen klarmachen sollte, dass er ihm helfen sollte, über die Grenze zu kommen.
„Wie ist dein Name?“
„Ich… Anastasius“
„Anastasius, ich muss nach Saloniki, noch heute Nacht!“
„Du hast Papiere?“
„Keine Papiere, ich will irgendwie über die Grenze, in deinem Lastwagen.“
„Ist riskant, Kontrollen sind sehr scharf hier, du aus Ostdeutschland?“
„Ja, genau deshalb, bitte hilf mir, versteck mich zwischen deinen Schweinen oder sonst wo, aber bring mich rüber!“
„Okay, du hast mir geholfen, ich versuch es.“
Anastasius stieg gewand auf den Anhänger und winkte seinem Schützling, ihm zu folgen. Auf dem Dach löste er einige Bretter und Bohm bemerkte einen Hohlraum direkt über den Schweinen. Irgendwie hatte er das Gefühl, der Grieche würde dies nicht zum ersten Mal tun. Er nickte ihm zu und zwängte sich in das Versteck. Jetzt musste er sich nur noch an den unerträglichen Gestank der Schweine gewöhnen.
Nach kurzer Fahrt erreichten sie die Grenzkontrolle, an der zu dieser Zeit schon bedeutend weniger Betrieb war. Bohm versuchte kaum zu atmen, weil der Geruch der Schweine ihm bis in die Lungen zog. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er das Gefühl, einem fremden Menschen komplett ausgeliefert zu sein. Wenn Anastasius dort vorn im Fahrerhaus die Nerven verlor oder irgendjemand die beiden Räuber am Rastplatz im Gebüsch entdeckt hatte und Alarm schlug… Dann war der Fakt, dass er damit seine Prüfung vergeigt und so seine jahrelange Ausbildung umsonst gewesen war, noch sein kleinstes Problem. Die bulgarischen Grenzer waren auch nicht grade dafür bekannt, besonders feinfühlig mit gefassten Flüchtlingen umzugehen. Bohm hörte draußen einen Hund bellen, die Schritte der Kontrolleure und machte sich darauf gefasst, dass gleich über ihm die Bretter beiseite gerissen würden und man ihn entdeckte. Stattdessen spürte er, wie plötzlich der Motor des IVECO ansprang und der Lastwagen in Richtung Griechenland beschleunigte.
Anastasius entließ seinen blinden Passagier wenige Kilometer nach der letzten Grenzkontrolle aus dem Versteck. Bohm taumelte in den Straßengraben und übergab sich. Später konnte er nicht mehr sagen, ob dies wegen dem Gestank der Schweine oder der Aufregung seines Grenzdurchbruches war. Der Grieche wirkte jetzt regelrecht fröhlich und redete wie ein Wasserfall auf seinen neuen deutschen Freund ein. Er meinte, sein Laster hätte so gestunken, dass die Grenzer nur einen flüchtigen Blick auf seine Papiere geworfen hätten und ihm dann bedeuteten, schleunigst zu verschwinden. Er würde ihn jetzt nach Saloniki bringen, in sein Haus, dort könnte er dann seine Sachen waschen. Bohm hatte sich inzwischen erholt, blieb jedoch für den Rest der Fahrt schweigsam und versuchte dem Redefluss des Griechen zu folgen.
Thessaloniki, Griechenland 19.Mai 1983, 18.50 Uhr
Die letzten vierundzwanzig Stunden verbrachte er sehr angenehm im Haus seines neuen griechischen Freundes am Stadtrand. Er durfte in einem richtigen Bett schlafen und Anastasius Frau hatte seine nach Schweinetransporter stinkenden Sachen gewaschen, so dass er sich wieder unauffällig in der Stadt bewegen konnte. Niemand hatte ihm großartig Fragen gestellt. Wahrscheinlich war er für seine Gastgeber ein geflohener Ostdeutscher, der jetzt nicht so recht wusste, wie es nun im freien Westen für ihn weitergehen sollte. Man sah ein, dass er erst einmal mit sich selbst klarkommen musste und ließ ihn in Ruhe. Bohm hoffte, dass er noch Gelegenheit haben würde, sich zu bedanken.
Bohm betrat die in einer Seitenstraße gelegene Taverne und suchte, wie man es ihm beigebracht hatte, nach einem Ecktisch im hinteren Bereich. Gleichzeitig checkte er die anwesenden Gäste, in der Hauptsache Touristen und einige wenige Einheimische und versuchte herauszubekommen, wo sich der Hinterausgang befand.
In den vergangenen Stunden hatte er die Zeit damit verbracht, die Gegend um seinen Treffpunkt zu studieren. In seiner Ausbildung hatte er gelernt, zu analysieren, welche Straßen in der Umgebung wohin führten, welche Geschäfte sich dort befanden, wie waren die Menschen gekleidet, die dort verkehrten, gab es dort viel oder wenig Polizei und private Sicherheitsdienste, wie und wo konnte man am schnellsten untertauchen. Er war das erste Mal in seinem Leben auf feindlichem Territorium auf sich allein gestellt und jetzt wurde ihm klar, dass dies sein künftiges Leben sein würde. Er musste von nun an immer mit Gefahren rechnen, immer einen Fluchtweg oder zumindest einen Plan B bereithaben, denn niemand würde mehr rufen Stopp, die Übung ist vorbei.
An einem Tisch in der Nähe des Durchganges zur Küche bemerkte er eine dunkelblonde junge Frau um die Dreißig. Was ihn stutzen ließ, war ein rotes Basecap, das sie keck mit dem Schirm im Nacken auf dem Kopf trug. Nach kurzem Zögern steuerte auf sie zu und deutete auf den freien Stuhl ihr gegenüber. Sie nickte mit einem deutlichen Schmunzeln und sah ihn erwartungsvoll an.
„Heute sind besonders viele Touristen unterwegs.“
Wenigstens hatte er seinen Erkennungssatz nicht vergessen.
„Ja besonders viele aus Bayern.“ Die Antwort stimmte.
„Ich habe aber auch schon Hamburger getroffen.“
Seine Bestätigung, ja, ich bin´s wirklich.
„Willkommen in Griechenland.“
Sie lächelte ihn an, als sie seine Verblüffung bemerkte.
„Sie glaubten doch bis jetzt nicht wirklich, dass alle Spione entweder alte Männer sind oder wie James Bond aussehen, obwohl, wenn ich mir sie so anschaue…“
Bohm war tatsächlich etwas verdattert, fing sich aber schnell wieder.
„Ich hab nur nicht damit gerechnet, in dieser Ecke des bösen Westens so schöne deutsche Frauen zu treffen.“ Sie lachte laut auf.
„Keine Sorge, sie sehen mich nicht wieder. Wenn ich aufstehe, lasse ich eine Zeitung auf dem Tisch liegen. Darin finden sie eine Adresse. Sie fahren morgen dorthin und leeren den toten Briefkasten, der sich im Spülkasten der letzten Toilettenkabine befindet. Dann befolgen sie einfach die Anweisungen. Oh mein Gott, ist das ein Gefühl, endlich mal wieder Spion spielen zu dürfen!“
Sie schob ihm die Zeitung herüber. „Besonders interessant sind die Kontaktanzeigen!“
Bohm unterdrückte den Reflex, sofort zuzugreifen und winkte erst einmal dem Kellner. Seine neue Bekanntschaft erhob sich und warf ihm spielerisch ihr Basecap zu.
„Übrigens fand ich ihre Aktion mit dem Schweinelaster ziemlich abenteuerlich, aber sie haben wenigstens Ideen!“
Objekt Daubitz , Uckermark 6.September 1983, 10.30 Uhr
Die Schorfheide, ein riesiges Waldgebiet nördlich von Berlin war schon zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in der Hand der jeweils Herrschenden, die diesen Landstrich vorwiegend als Jagdrevier nutzten. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden hier im Schutz der Wälder eine große Anzahl geheimer Anlagen der sowjetischen Truppen und der verschiedenen Sicherheitsorgane der DDR errichtet.
Einige Kilometer vor der uckermärkischen Kleinstadt Lychen zweigt ein unscheinbarer Waldweg von der Kreisstraße ab. Ein Stück weiter im Wald weist ein Schild auf ein militärisches Sperrgebiet hin, nichts Besonderes in dieser Region. Nach einigen hundert Metern versperrt ein Tor die Weiterfahrt, dahinter gewahrt man eine recht große, wenn auch etwas heruntergekommene Lagerhalle, ein Stück weiter eine zweite, die offensichtlich in keinem besserem Zustand ist. Am Tor steht „Staatlicher Forstwirtschaftsbetrieb der DDR“ und nur ganz geübte Beobachter erkennen die versteckt angebrachten Videokameras entlang des für ostdeutsche Verhältnisse sehr intakten Zaunes, der sich unauffällig durch den Wald schlängelt. Nichts deutet darauf hin, dass sich hier eine der geheimsten Dienststellen der Hauptverwaltung Aufklärung, des von Markus Wolf gegründeten Auslandsnachrichtendienstes der DDR befindet. Die erste Halle beherbergte die Wacheinheit, die in Uniformen der Forstverwaltung gelegentlich die Baumstämme zwischen den Gebäuden mit Gabelstaplern umlagert, um so einem möglichen Beobachter typische Aktivitäten vorzutäuschen. Das zweite Bauwerk wirkt ebenfalls nur äußerlich heruntergekommen. Hier ist die Heimatbasis der Einheit „Albatros“, einem aus maximal zwanzig Mitgliedern bestehenden Spezialkommandos, das direkt dem Chef der HVA unterstellt ist. Alle Mitglieder dieser Einheit, die nachrichtendienstliche Sondereinsätze in aller Welt durchführt, gingen zur Tarnung „zivilen“ Berufen nach, die eine häufige Reisetätigkeit nach Außen hin glaubhaft macht. In der speziell eingerichteten Halle, die nicht einmal von den Wachmannschaften betreten werden durfte, hatten sich die „Albatrosse“ eine Reihe von Annehmlichkeiten geschaffen, um sich auf ihre Einsätze vorzubereiten. So hatte jedes Mitglied einen eigenen Privatbereich mit Bett, Schrank und Fernseher. Man verfügte über einen großen Besprechungsraum, eine gut eingerichtete Küche und sogar einen Freizeitbereich mit Tischtennisraum und Kraftsportgeräten. Im Keller des Gebäudes befand sich das Herzstück der Anlage, eine Schießbahn und eine Waffenkammer, die alle gängigen, weltweit genutzten Handfeuerwaffen enthielt. Dieser Bestand wurde ständig aktualisiert und jedes Teammitglied verbrachte hier viel Zeit mit Schießübungen.
Der Name „Objekt Daubitz“ war insofern eine Irreführung des eigenen Ministeriums, weil dieser Ort gar nicht existierte. Allerdings wurde das gesamte Budget für dieses Spezialkommando unter dieser Bezeichnung eingestellt, so dass nur sehr wenige Personen in der DDR über dessen wahre Bedeutung Kenntnis hatten. Eine weitere Besonderheit der Einheit „Albatros“ war die Tatsache, dass sie ihr eigenes Archiv besaß und alle Personalakten und Einsatzberichte im Objekt blieben. Wenn ein Vorgesetzter aus der Hauptverwaltung Schriftstücke einsehen wollte, so musste er sich aus Berlin hierher bemühen. Dies verschaffte dem Kommando eine gewisse Unabhängigkeit.
Chef der Albatros-Agenten war seit zehn Jahren Klaus-Jürgen Becker, der in der HVA Legendenstatus hatte. Er stand in dem Ruf, gegenüber seinen Untergebenen ein „harter Hund“ zu sein, aber seine Truppe nach außen hin bedingungslos zu vertreten.
Als Peter Bohm seinem neuen Chef das erste Mal gegenüberstand, hatte er doch ein wenig weiche Knie. Bisher hatte er lediglich alle möglichen Geschichten über „KJB“ gehört, ihn aber nie persönlich getroffen. Ein geplantes Gespräch nach seiner mit Bravour bestandenen Prüfung wurde kurzfristig abgesagt, so dass er aus seiner neuen Einheit bisher lediglich seinen künftigen Mentor kannte, der ihn heute hierher gebracht hatte und ihn dann dem Chef vorstellte. Becker begrüßte sein neuestes Teammitglied und wirkte, entgegen seinem Ruf sehr umgänglich, geradezu freundlich. Er erfuhr, dass seine Hauptaufgabe darin bestehen würde, mehr oder weniger auf sich allein gestellt Aufträge vorwiegend in Asien oder Afrika auszuführen oder Operationen zu unterstützen, über die er nie oder nur ganz selten Näheres erfahren würde. In der Regel ging es darum, eine bestimmte Person eine Zeit lang zu beobachten, zu einem festgelegten Zeitpunkt ein Auto an einem vorher vereinbarten Ort abzustellen oder, wie im Training oft geübt, einen toten Briefkasten zu leeren oder zu bestücken. Zur Tarnung würde er dazu als Fotojournalist reisen, eine Tätigkeit, die seine Anwesenheit an vielen Orten der Welt schlüssig erklären konnte. Er arbeitete also ab sofort als freiberuflicher Fotograf für die staatliche Nachrichtenagentur. Einen Termin beim zuständigen Ressortleiter hatte Becker für ihn schon arrangiert.
„Dafür erhalten sie auch einen richtigen Pass und brauchen sich nicht mehr auf irgendwelchen Viehtransportern über die Grenzen schmuggeln zu lassen“ schloss KJB das Gespräch.
Eine offizielle Begrüßung würde es nicht geben, da es bisher noch nicht vorgekommen war, dass alle Mitglieder von „Albatros“ gleichzeitig anwesend waren.
Bohm war also nun vollwertiges Mitglied von Beckers Einheit. Trotzdem blieb ihm vorerst unklar, was genau man von ihm erwartete. Okay, er hatte seine Ausbildung erfolgreich bewältigt, war illegal über die Grenze nach Griechenland gegangen. In Athen beschattete er drei Tage den belgischen Militärattache und kam anschließend wieder, ohne erwischt zu werden, zurück nach Bulgarien. Auftrag erfüllt, Prüfung bestanden. Und jetzt? Wartete auf ihn jetzt ein Leben wie James Bond mit gerührtem Martini und jeder Menge schöner Frauen? Bohm stammte aus einem kleinen Dorf im Norden der DDR und war mit solchen Filmen groß geworden. Damals faszinierte ihn Agentenromantik, zumal auch die Ostdeutschen ihren eigenen Bond erschufen, der als Achim Detjen die Bösen um die Welt jagte. Leider ging der Hauptdarsteller Müller-Stahl später in den Westen und die Filme wurden nicht mehr im Fernsehen gezeigt. Er war siebzehn, als die Werber erstmals auf den sportlichen Jungen aufmerksam wurden. Er wollte sich schon für eine Offizierslaufbahn bei der Armee verpflichten, aber einige diskrete Gespräche später folgte sein Leben einem anderen Plan. Während der Ausbildung verfluchte Bohm noch oft seine James-Bond-Fantasien, wenn er stundenlang in der Kälte lag, um ein Haus zu beobachten oder im strömenden Regen irgendwelchen Zielpersonen kreuz und quer durch Berlin folgte. Auch wenn er jetzt den Dienstgrad Leutnant trug, so hatte man in der Ausbildung immer betont, dass er Zivilist bleiben sollte. Militärs bewegten sich anders durch die Welt und niemand wirkte unsicherer als ein altgedienter Uniformträger, der plötzlich im Anzug herumlaufen musste. Bohm war auch aufgefallen, dass er Umgang bei „Albatros“ im Gegensatz zum restlichen MfS betont unmilitärisch war, hier herrschte offensichtlich die Ansicht: „Uns ist klar, dass wir die Besten sind, aber niemand braucht es zu wissen.“ In dieser Welt war er nun angekommen.
Leipzig 23. Oktober 1983, 16.35 Uhr
Peter Bohm kam grade aus einer Vorlesung zur Geschichte des Journalismus in sein Wohnheim zurück. Auf Anweisung von KJB nutzte er seine freie Zeit dazu, um an einigen Lehrveranstaltungen der Universität teilzunehmen, um irgendwann einmal einen Abschluss als Journalist machen zu können. Er hatte zwar keine Ahnung, wie lange dies dauern würde, wenn er in nächster Zeit ständig auf Reisen sein würde, aber so verbrachte er seine Zeit mit etwas Sinnvollem. Er hatte auf den letzten Drücker einen Platz in einem Wohnheim für ausländische Studenten erhalten und wohnte jetzt mit Pablo, einem angehenden Schriftsteller aus der Nähe von Havanna, in einem Zimmer. Bohm brauchte nicht lange, um sich mit der Mentalität der Kubaner anzufreunden. Sie rauchten zwar alle zuviel, konnten dafür aber auch lange und ausgelassen feiern und waren soviel lockerer im Umgang als die Leute in seiner Heimat.
An diesem Tag wurde er bereits aufgeregt vom Pförtner des Wohnheimes erwartet, der ihm einen Zettel mit einer Telefonnummer in die Hand drückte und ihn zum Münzfernsprecher im Treppenhaus schob. Bohm kannte die Nummer mit Berliner Vorwahl nicht, konnte sich aber denken, wer ihn hier so dringend erreichen wollte. Sein erster Einsatz? Ihm schlackerten ein wenig die Knie als er die Nummer wählte und sich am anderen Ende jemand mit „Daubitz“ meldete. Becker. Die Anweisung war kurz, aber eindeutig, Bohm sollte in einer Stunde vor dem Hauptbahnhof stehen, dort würde ihn jemand abholen. Gespräch Ende.
Es ging also los.
Beirut, Libanon 25.Oktober 1983, 17.00 Uhr
Sie erreichten Beirut in einem Bus voller Journalisten aus aller Welt von Damaskus aus kommend. Der Flughafen der libanesischen Hauptstadt war nach den Anschlägen auf die amerikanischen und französischen Soldaten für zivile Flüge gesperrt worden. Bei den Attentaten waren über dreihundert Menschen gestorben, die meisten davon US-Marines. Die HVA wollte nun genauere Informationen. So kam Bohm zu seinem ersten Einsatz. Er wurde allerdings nicht allein geschickt, sonder reiste in Begleitung von Werner Tietz, einem erfahrenen Agenten, der ebenfalls als Reporter arbeitete. Sie checkten im „Talal“ ein, einem heruntergekommenen Hotel in der Innenstadt. Nach den Anschlägen strömten Berichterstatter und Fernsehteams aus aller Welt hierher, erklärte Tietz seinem jüngeren Kollegen. Da würden die besseren Quartiere meistens von den Amerikanern und Westeuropäern belegt. So blieben sie eben mit den Russen, Ungarn und Polen unter sich, wobei Bohm den Verdacht nicht loswurde, dass die meisten der Kollegen einen ähnlichen „Nebenjob“ hatten wie er.
Zu ersten Verbrüderungsszenen kam es am Abend in der erstaunlich gut geführten Bar des Hotels. Tietz hatte Bohm dringend ans Herz gelegt, sich abends nicht in seinem Zimmer zu verstecken, die wirklich interessanten Dinge erführe man immer erst bei einem Bier nach Feierabend. Er riet ihm, wenig zu trinken, noch weniger zu erzählen aber dafür immer gut zuzuhören. Selbst hielt er sich aber nicht daran, als ein ihm gut bekannter TASS-Reporter, wie bei den Russen üblich, eine Flasche Wodka aus der Tasche zog.
Am nächsten Vormittag war eine Pressekonferenz mit amerikanischen und französischen Militärs angesetzt. Eine Besichtigung der Anschlagsorte wurde abgesagt, weil dort angeblich immer noch geschossen wurde. Bohm, Tietz und der Russe Bulganow beschlossen daraufhin, sich auf eigene Faust auf den Weg dorthin zu machen. Der Hotelportier kannte einen Palästinenser, der für hundert Dollar bereit war, sie durch die Stadt zu fahren. Bereits eine Stunde später saßen sie in einem klapprigen Mercedes. Bohm beschlich ein mulmiges Gefühl, als er die vielen Ruinen in der Innenstadt und vor allem die ausgebrannten Autowracks am Straßenrand sah. Beirut versank in Anarchie, jeder Bezirk wurde von einer anderen Kriegspartei kontrolliert und überall lauerten Heckenschützen. Ihr Fahrer brachte sie mit viel Redefluss und Schmiergeld durch mehrere Straßensperren aber nach einer Stunde scheinbar sinnlosen Herumkurvens standen sie plötzlich vor einer Barrikade, besetzt mit mehreren hypernervösen US-Marines, die drohend ihre Gewehrläufe ins Wageninnere richteten. Nachdem sie grade so viele Kameraden verloren hatten, waren sie mehr als bereit, jeden niederzuschießen, der auch nur im Geringsten verdächtig aussah. Da wären ein Araber und drei kommunistische Reporter noch nicht mal das schlechteste Ziel. Sie versuchten es noch an zwei anderen Stellen, aber überall waren die Straßen gesperrt und immer gab man ihnen zu verstehen, dass die Presse hier unerwünscht sei.
Sie stiegen vor dem Hotel aus dem Wagen, Bohm und Tietz gingen voran, Bulganow, der noch den Fahrer bezahlt hatte, folgte ihnen, als plötzlich Schüsse fielen. Die beiden Deutschen hechteten in die Hotelhalle, während der Russe am Fuß der Treppe getroffen zusammenbrach.
Bohm rappelte sich wieder auf und rannte, ohne lange zu überlegen, nach draußen. Tietz schrie ihm nach:
„Nicht, bleib unten!“
Doch der warf sich auf den Russen und rollte mit ihm in den toten Winkel neben die Treppe, während die nächste Salve auf die Stufen prasselte. Sie pressten sich dicht an die Mauer in der Hoffnung, dass der Schütze, dessen Standort noch keiner wirklich ausgemacht hatte, sie hier nicht sehen konnte. Bulganow war am Oberschenkel getroffen und blutete stark. Er presste seine Hand auf die Wunde und beide hofften, dass die Schüsse bald aufhörten. Als nach endlosen Minuten scheinbar Ruhe war, zog Bohm den Gürtel aus der Hose des Russen und band damit das Bein ab. Im gleichen Moment warf sich Tietz neben ihnen auf den Boden und keuchte:
„Du blöder Idiot, los jetzt!“
Gemeinsam brachten sie den Verletzten in die Lobby des Hotels und legten ihn auf eines der zerschlissenen Sofas. Tietz brüllte den Portier an, er solle einen Krankenwagen rufen sowie Wasser und Verbandszeug bringen. Dann rannte er in die Bar und kam mit einer Flasche Whisky zurück. Er flößte dem Russen einen großzügigen Schluck ein und desinfizierte dann die Einschussstelle. Anschließend verband er das Bein und schrie wieder in Richtung Rezeption nach einem Krankenwagen. Ein Hotelangestellter kam dazu und sagte, man werde einen Arzt aus der Nachbarschaft holen.
Am Abend, als der Doktor gegangen war, setzte sich Tietz zu seinem Schützling und reichte ihm ein Glas Whisky.
„Trink, das hilft gegen das Zittern danach. Ich brauche nach solchen Aktionen immer eine gute halbe Flasche, bis ich mich wieder im Griff habe. Du hast heute ziemlichen Schneid bewiesen, aber trotzdem war es eine Riesendummheit. Okay, du hast Nikolai mit Sicherheit das Leben gerettet, aber beinahe wärst du dabei draufgegangen. Wahrscheinlich waren alle Schutzengel grade hier zur Hauptversammlung. Ich habe in Gedanken schon KJB beizubringen versucht, dass sein Jungstar gleich beim ersten Einsatz ins Gras gebissen hat, weil er den Helden spielen musste. Wir müssen Bulganow hier rausbringen, du wirst ihn morgen nach Damaskus begleiten. Ich bleibe hier und führe unseren Auftrag weiter.“
Bohm holte Luft aber Tietz hob warnend die Hand. „Das ist keine Bestrafung, aber er gehört zu den besten Leuten des KGB und die schätzen es, wenn man sich hilft. Außerdem ist er ein netter Kerl, er hat mir auch schon öfter mal einen Gefallen getan. Du bringst ihn morgen raus und lieferst ihn in Syrien bei seiner Botschaft ab. Dann wartest du auf mich. Mach in der Zwischenzeit ein paar nette Bilder von Damaskus.“
Am nächsten Morgen erschien wieder ihr palästinensischer Fahrer mit seinem Mercedes. Tietz führte einen kurzen heftigen Wortwechsel, dann drückte er ihm ein paar Scheine in die Hand und winkte Bohm. Der stützte den Russen und führte ihn zum Auto. Bulganow sah bleich aus und hatte offenbar starke Schmerzen. Er ließ sich auf die Rückbank fallen und schenkte Tietz noch ein gequältes Lächeln. Dieser hob grüßend die Hand, drehte sich um und verschwand wieder im Hotel. Die Fahrt in die syrische Hauptstadt dauerte mehrere endlose Stunden. Der Verletzte lag hinten und schlief, betäubt von einer halben Liter Wodka und Bohm ertrug tapfer die pausenlosen Erzählungen des Fahrers über die Geschichte seines Volkes, über Allah und den bösen Westen. Zweimal stoppten sie plötzlich, weil er sein Gebet verrichten musste und gute drei Stunden verbrachten sie an der Grenze, bis die Posten geklärt hatten, dass ein verletzter betrunkener Russe und ein Ostdeutscher keine Gefahr für den syrischen Staat darstellten. Sie brachten Nikolai Bulganow direkt zur sowjetischen Botschaft, wo man sie recht kühl in Empfang nahm. Ein Wachhabender prüfte ausführlich ihre Pässe, dann wurde der Russe von zwei Bediensteten ins Gebäude gebracht. Wortlos schloss sich die schwere Tür wieder hinter ihm.
Tietz würde noch zwei bis drei Tage im Libanon verbringen und so beschloss Bohm, seiner Schwester Kathrin, die als Archäologin zur Zeit im Osten Syriens an einer Ausgrabung teilnahm, einen Besuch abzustatten und vielleicht bei der Gelegenheit seine erste Bildreportage zu produzieren.
Irgendwo über Afrika 16.Juni 1984, 17.00 Uhr
Bohm rekelte sich auf dem unbequemen Notsitz der Interflug-Frachtmaschine. Sechs Stunden musste er bereits darauf ausharren. Gegen zwanzig Uhr sollten sie in Luanda, der angolanischen Hauptstadt landen, hatte ihm die blonde Stewardess erklärt, mit der er sich im Verlauf des Fluges hin und wieder unterhielt. Bereits kurz nach dem Start in Schönefeld erkannte sie in ihm den Fluggast wieder, der sie erst vor knapp einer Woche auf dem Rückflug von Maputo vor einem besonders unangenehmen Mitreisenden in Schutz genommen hatte. Bohm, der in Mosambik für eine Reportage über eine von seinem Land finanzierte Schule recherchierte und bei der Gelegenheit Informationen aus erster Hand über den immer noch schwelenden Bürgerkrieg im Norden des Landes besorgt. Sein Informant, ein hoher Offizier aus dem dortigen Verteidigungsministerium, hatte in der DDR studiert und war zudem mit einer Lehrerin aus Rostock verheiratet.
Eigentlich freute er sich nun auf ein paar freie Tage in der Heimat, um die Reportage zu schreiben, die Bilder zu entwickeln und einige Zeit am Strand zu verbringen. In den letzten Monaten war er wochenlang kreuz und quer durch Afrika gereist. Nun brauchte er dringend eine Pause, um die Bilder von Krieg und Elend, die ihm fast überall auf dem Kontinent begegneten, aus dem Kopf zu bekommen. Doch bereits zwei Tage nach seiner Rückkehr saß er wieder im Besprechungsraum im „Forstobjekt“. Becker ging vor einer Landkarte Angolas auf und ab und man merkte, dass er in Gedanken nicht im Raum war. Erst nach einigen Minuten des Umherlaufens kam er zur Sache:
„Unsere Freunde in Pullach haben mal wieder eine Schweinerei ausgeheckt. Wir bekamen Informationen über eine geplante Operation mit dem Codenamen Bongo, die irgendwann in nächster Zeit in Angola ablaufen soll. Unsere Quelle bei der Konkurrenz meinte, man wolle dort irgendeine wilde Aktion abziehen, um unsere Reaktionen darauf zu beobachten. Sie würden gern mitkriegen, wen wir alles in Bewegung setzen, um die Situation dort zu klären. Unsere Mann in Luanda hat bereits mitgeteilt, dass die bundesdeutsche Botschaft ihr Personal aufstockt, offiziell alles Fahrer, obwohl die dort gar nicht so viele Autos haben. Wir müssen also jemanden verdeckt dorthin schicken, bevor etwas passiert, und da bist du, Genosse Bohm, die einzige Alternative. Dein Gesicht ist in Afrika noch nicht so bekannt. Ich weiß, du bist grade erst zurück, aber mir bleibt keine andere Möglichkeit. Morgen früh fliegt eine Frachtmaschine nach Luanda. Dein Platz ist schon gebucht, offiziell bist du ein Techniker, der dringende Reparaturen in der Botschaft vornehmen muss. Alle weiteren Instruktionen bekommst du von unserem Mann dort unten. Wahrscheinlich wirst du weitgehend auf dich allein gestellt sein, wir werden uns nach Möglichkeit bedeckt halten müssen. Also dann, guten Flug!“
Der Chef hatte eben seine eigene Art, Probleme direkt auf den Punkt zu bringen.
Nach der Ankunft in Luanda verbrachte er die erste Nacht im Hotel mit Beate, der blonden Stewardess, die sich ganz speziell für die gute Unterhaltung während des langen Fluges bedankte. Am nächsten Morgen schob ihm der Afrikaner an der Rezeption diskret eine Nachricht herüber. Unmittelbar danach hielt ein Auto vor dem Eingang, der dunkelhäutige Fahrer winkte ihn zu sich heran und bedeutete ihm, schnell einzusteigen. Die Fahrt verlief schweigend, erst in der Nähe des Hafens hielt der Wagen. Der stämmige Angolaner drehte sich zu ihm um und musterte seinen Gast erst einmal gründlich.
„Senior Bohm“, sagte er in perfektem Deutsch, „mein Name ist Jose Bastos vom angolanischen…“ er zögerte kurz, dann grinste er breit, „…Innenministerium. Ich freue mich, sie willkommen zu heißen. Sagt man das so bei ihnen?“
Bohm nickte und fragte zurück: „Wo haben sie so gut deutsch gelernt?“
„Ich wurde in der DDR zwei Jahre sozusagen“, er zögerte wieder kurz, „…ausgebildet.
Sehr speziell sogar. Jetzt lautet mein Auftrag, mich um sie zu kümmern. Eigentlich wollte ich sie schon gestern Abend treffen, aber dann habe ich mich entschlossen, ihnen nicht den Spaß zu verderben nach dem langen Flug.“
Er lacht laut auf und schlug dem Deutschen kumpelhaft auf den Oberschenkel. „Kommen sie, lassen sie uns jetzt aussteigen und ein wenig das Meer genießen!“
Bohm schluckte und beschloss auf dem Weg zum Strand, erst einmal sachlich zu bleiben und an seinen Job zu denken.
„Warum haben sie mich eigentlich nicht zur Botschaft gebracht, sondern machen mit mir erst eine Stadtrundfahrt?“
Bastos blickte ernst. „Eure Botschaft wird seit zwei Tagen rund um die Uhr beobachtet. Von Weißen, die, ganz nebenbei, nicht sehr geschickt vorgehen. Wir nehmen an, dass sie im Auftrag eurer…“ er suchte scheinbar nach dem richtigen Begriff, „der anderen Deutschen handeln. Die, die nicht so unbedingt unsere Freunde sind. Wir haben sie schon seit ein paar Tagen im Auge. Irgendetwas geht da vor. Deine Leute haben entschieden, dich nicht in die Botschaft zu bringen, damit man dein Gesicht gar nicht erst registriert. So spiele ich nun den Fremdenführer.“
Er lachte wieder laut auf und ließ sich unter einer Palme nieder.
„Kannst du mir verraten, was hier los ist? Wir wurden zwar gebeten, die Westdeutschen zu beobachten, aber keiner weiß genau warum.“
Bohm zuckte mit den Schultern. „Wir wissen auch nichts genaues, nur dass hier irgendetwas passieren soll und die anderen wissen wollen, was wir dann tun werden.“
Der Afrikaner nickte. „Sie möchten also, wie man bei euch sagt, auf den Busch hauen.“
„Klopfen, das heißt auf den Busch klopfen“ korrigierte Bohm und zuckte dabei zusammen.
Bastos hatte es ungewollt auf den Punkt gebracht. Bongo! Die Buschtrommel! In Pullach saß offenbar jemand mit einem schrägen Humor. Sie mussten nicht lange warten. Zwei Tage später stürmte der Afrikaner aufgeregt in Bohms Hotelzimmer.
„Im Süden, in der Nähe von Lubango, hat man drei von deinen Landsleuten entführt, die dort eine Lastwagenwerkstatt aufbauen sollten. Es gab einen Überfall der Rebellen, sie haben zwei Polizisten erschossen und sind dann mit euren Leuten verschwunden. Wir vermuten, man hat sie über die Grenze gebracht, in ein UNITA-Camp oder zu den Südafrikanern. In einer Stunde haben wir ein Treffen mit einem Namibier von der SWAPO, vielleicht können die helfen. Wir fahren gleich ins Ministerium, von dort kannst du mit Berlin telefonieren.“
Wie versprochen hatte er kurz darauf in Bastos Büro Becker auf einer, wie die Angolaner versicherten, abhörsicheren Leitung. Der Chef war wie immer kurz angebunden.
„Unsere Botschaft veranstaltet ein bisschen Mummenschanz, und fährt ein paar Mal zum Außenministerium und zurück. Wir schicken auch jemand runter, damit die Jungs was nach Pullach zu berichten haben. Bei dir liegt jetzt die Aufgabe, unsere Leute da irgendwie wieder heil rauszuholen. Du hast freie Hand und die angolanischen Genossen dort werden dir helfen. Wenn du nicht weiterkommst, ruf mich an.“
Bohm widerstand der Versuchung, nach Lubango zu fliegen und mit der Suche am Entführungsort zu beginnen, da dieser mit Sicherheit beobachtet werden würde. Stattdessen wollten Bastos und er nach Baba, einem kleinen Fischerdorf an der Küste. In dessen Nähe befand sich ein Stützpunkt der namibischen Rebellen, die schon seit Jahren von der DDR unterstützt wurden und auf deren Hilfe Bohm hoffte.
Der Hubschrauber, den sein angolanischer Freund organisiert hatte, flog statt nach Süden zunächst weit aufs Meer hinaus und dann entlang der Küste. Besonders der Süden Angolas wurde seit Jahren von einem grausamen Bürgerkrieg erschüttert, bei dem sich vor allem die von Südafrika unterstützte UNITA heftige Kämpfe mit der regulären angolanischen Armee, lieferte, die wiederum umfangreiche Hilfe von kubanischen Streitkräften bekam. Doch auch südafrikanische Söldner selbst mischten mit und gingen besonders gegen Stützpunkte der SWAPO, der namibischen Befreiungsorganisation vor, die von angolanischem Boden aus immer wieder die Grenze in Richtung Süden überschritten und ihrerseits die Besatzer in ihrer Heimat in Bedrängnis brachten. Inmitten dieser Gemengelage versuchten nun Freiwillige vor allem aus den Ostblockstaaten, der verbliebenen Zivilbevölkerung zu helfen. Was sich als zunehmend schwieriger erwies, da sich einige regierungsfeindliche Milizen auf die Entführung eben dieser Ausländer spezialisiert hatten.
Der Rebellenführer entschuldigte sich gestenreich, als man Bohm und Bastos in seiner Hütte, die offensichtlich als Büro und Schlafplatz gleichzeitig diente, die Augenbinden abnahm, die sie seit der Landung des Hubschraubers trugen. Das in Englisch geführte Gespräch war kurz. Nein, er habe bisher keine Ahnung, wohin man die drei Deutschen gebracht haben könnte, würde aber seine Leute anweisen, Erkundigungen einzuziehen. Für die nächsten Tage könnten die Besucher aus Luanda seine Gastfreundschaft genießen. Ohne Verabschiedung verschwand er dann aus dem Raum und überließ sie seinem „Adjutanten“, einem vielleicht fünfzehnjährigem spindeldürren Namibier, der ihnen zuwinkte und sie dann zu einer gut hundert Meter entfernten Hütte führte. Die Beiden hatten sich kaum eingerichtet, als er heftig mit den Armen rudernd zurück gelaufen kam und ihnen wortreich bedeutete, ihm zum „Commander“ zu folgen. In dessen Büro trafen sie auf einen weitern Bewaffneten, der ihnen als Major Morano vorgestellt wurde. Der berichtete über eine Farm kurz hinter der Grenze, auf der nach Aussage seiner Leute vor einigen Tagen zwei Deutsche angekommen sein sollten. Es wären aber, da war er sicher, nicht die Entführten aus Angola. Der Major versicherte, die Lage weiter zu beobachten, während Bohm schweigend und grübelnd auf die Karte starrte. Plötzlich blickte er auf.
„Major, wie viele Männer haben sie in der Gegend?“ Der Rebellenoffizier versicherte ihm, dort ohne Probleme fünfzig bewaffnete und, wie er betonte, entschlossene Männer zusammenziehen zu können. Bohm murmelte auf Deutsch: „Das dürfte reichen.“ Dann erläuterte er den Plan, der in den letzten Minuten in seinem Kopf Gestalt angenommen hatte.
Zwei Tage später In der Nähe von Ondobe, Namibia
Bohm lag seit zwei Stunden im hohen Gras und beobachtete durch einen Feldstecher die weit abseits der Straße gelegene Farm. Offensichtlich wurde sie vor vielen Jahren einmal von deutschen Siedlern errichtet, denn die Gebäude waren im Fachwerkstil erbaut. Was ihm Sorgen machte, waren die gut achtzig Meter freies Feld, die sie im hellen Mondlicht überwinden mussten. Er konnte von seiner Position aus zwei bewaffnete Wachen erkennen, die längs eines etwa anderthalb Meter hohen Zaunes patrouillierten. Major Moreno hatte ihm am Nachmittag seine Streitmacht vorgestellt. Fünfundvierzig martialisch aussehende Männer, jeder mit einer MPi, einer Pistole und einem Dolch bewaffnet. Sie waren mit mehreren alten Pickups über die Grenze in diese Gegend gefahren und hatten die Autos etwa fünf Kilometer von hier in einem Wald versteckt. Dann schlichen sie durch das hohe Gras bis hierher. Bohm sah durch das Fernglas, wie plötzlich hinter den Wachen Schatten auftauchten und diese zu Fall brachten. Dann blinkte das Licht einer Taschenlampe auf und er schnappte sich die Kalaschnikow, die er sich für die Aktion vom Commander geborgt hatte. Er rannte mit den anderen SWAPO-Rebellen geduckt über das Feld auf den Zaun zu. Bohm musste feststellen, dass sie trotz ihres wilden Aussehens gut organisiert waren und diszipliniert die ihnen jeweils zugedachte Aufgabe erfüllten. Sie verteilten sich auf die drei Gebäude und durchsuchten sie, ohne dass ein Schuss fiel. Jemand packte Bohm wortlos am Ärmel und zog ihn in das große Bauernhaus. Dort knieten zwei gefesselte Männer, denen man schon schwarze Kapuzen über den Kopf gezogen hatte. Einer der Rebellen nickte in ihre Richtung:
„Your Germans.“
Dann winkte er, ihm in den Nebenraum zu folgen. Sie fanden einen Tisch voller Dokumente und Landkarten sowie zwei bundesdeutsche Reisepässe. Bohm und einer der Namibier schoben alles zusammen und stopften die Papiere in eine Segeltuchtasche, die sie unter dem Tisch fanden. Von draußen hörte man Motorengeräusche. Die Pickups, die sie zurückgelassen hatten, rollten auf den Hof. Beide Gefangene wurden nach draußen geführt und auf die Ladefläche gehoben. Was mit den restlichen Bewohnern der Farm passiert war, wollte Bohm besser gar nicht wissen.
36 Stunden später Luanda
Bastos deutete auf einen am Straßenrand parkenden klapprigen Toyota.
„Wir beobachten ihn schon seit einiger Zeit. Der Fahrer heißt Dieter Wilke. Ein Deutscher, der offenbar den Auftrag hat, eure Botschaft zu observieren. Er ist dabei allerdings nicht sehr geschickt. Wahrscheinlich macht ihm die Hitze hier ganz schön zu schaffen, deshalb würde ich vorschlagen, wir erlösen ihn jetzt von seiner Mission.“
Er hob die Hand und nur Augenblicke später hielt ein Lastwagen direkt neben dem Auto des Deutschen, so dass der keine Sicht mehr auf das Botschaftsgebäude hatte. Im gleichen Augenblick riss Bastos die Beifahrertür auf, schwang sich auf den Sitz neben dem sichtlich geschockten BND-Agenten und drückte ihm die Mündung einer Pistole in die Hüfte. Mit der linken Hand drehte er den Innenspiegel nach oben. Dies war das Zeichen für Bohm, der sich in den Fond direkt hinter Wilke setzte.
Er schob einige leere Wasserflaschen beiseite und achtete darauf, dem BND-Mann sein Gesicht nicht zu zeigen.
„Hören sie nur zu. Hier sind die Pässe zweier Herren, die gegenwärtig die Gastfreundschaft unserer Verbündeten genießen. Es geht ihnen gut, sie befinden sich an einem sicheren Ort und werden ausreichend verpflegt.“
Er reicht die Pässe nach vor, die Bastos aufklappte und dem offensichtlich immer noch verwirrten Agenten unter die Nase hielt. Bohm sprach weiter:
„Sie können sie wiederbekommen, wenn im Gegenzug die drei Männer freikommen, die ihre Freunde vor ein paar Tagen in Lubango entführt haben. Wir werden die ganze Sache sehr diskret regeln, nichts davon wird in irgendeiner Zeitung stehen. Wenn sie das Okay von ihrem Vorgesetzten haben, rufen sie einfach unsere Botschaft an und verlangen Herrn Schmidt. Er teilt ihnen dann Ort und Zeitpunkt des Austausches mit.“
Wilke holte Luft und wollte etwas entgegnen, aber Bastos drückte ihm die Pistole fester in die Seite und zischte auf Deutsch: „Nicht bewegen!“
Bohm war schon ausgestiegen und hinter dem Lastwagen verschwunden. Der Angolaner wartete noch eine halbe Minute, dann überließ er den immer noch sichtlich schockierten Wilke sich selbst.
Der Austausch fand bereits zwei Tage später an einer Straßenkreuzung etwa fünfzig Kilometer östlich von Lubango statt. Bohm und Bastos beobachteten die Aktion aus einigen hundert Metern Entfernung, auf einem getarnten kubanischen Schützenpanzerwagen sitzend, von denen noch zehn oder elf irgendwo im Umkreis in Stellung gegangen waren. Von Süden her näherte sich ein Jeep mit weißer Fahne, woraufhin ein SWAPO-Kämpfer seine beiden Gefangenen aus einem Gebüsch auf die Straße führte. Der Jeep stoppte etwa fünfzig Meter vor ihnen, zwei Männer stiegen aus und halfen einem dritten aus dem Wagen, den sie stützten mussten, als sie auf die anderen zugingen. Beide Gruppen trafen sich genau auf der Mitte der Kreuzung und würdigten sich gegenseitig keines Blickes. Offensichtlich rechnete jeder damit, plötzlich eine Salve in den Rücken zu bekommen, aber alles verlief reibungslos und die drei Entwicklungshelfer stiegen unbehelligt in einen Wagen der Botschaft.
2. Kapitel
Peter´s Point 5. September 2006, 23.55 Uhr
Ungläubig starrte Bohm auf das Telefon. Am anderen Ende meldete die Stimme sich wieder: „Du hast höchstens vier Wochen, dann erfolgt die Übergabe. Versuchst du, uns zu finden, sind deine Kinder tot. Sende uns eine SMS, wenn du soweit bist.“
Klick. Stille. Concita kam ins Zimmer gestürmt und fand ihren Mann mit offenen Mund und weitaufgerissenen Augen, noch immer das kleine schwarze NOKIA am Ohr, dastehen. So hatte sie ihn noch nie gesehen und ging instinktiv davon aus, dass die Lage wohl noch viel dramatischer war, als gedacht. Sie schrie auf und brach noch in der Tür zusammen. Bohm musste sich selbst erst einmal schütteln, bevor er ihr zur Hilfe eilen konnte. Er hob sie hoch und trug sie in ihr Schlafzimmer. Seine Frau war in einer Art Schock, sie wirkte mit einem Male völlig abwesend. Es wäre beruhigender gewesen, wenn sie geweint oder geschrien hätte. Er schnappt sich den Telefonhörer von seinem Nachtschrank und wählte die Nummer seines Nachbarn Dave. Der Chefarzt einer Privatklinik hatte offensichtlich schon geschlafen und meldete sich erst nach dem vierten oder fünften Klingeln. Bohm gab sich nicht mit großen Entschuldigungen ab. „Jemand ist in unser Haus eingebrochen und hat die Kinder entführt. Komm bitte schnell her, Cita hatte einen Zusammenbruch und auch das Kindermädchen braucht wohl dringend einen Arzt.“
Es vergingen keine fünf Minuten, bis sein Freund vor der Tür stand. Dave untersuchte beide Frauen und gab ihnen ein starkes Beruhigungsmittel, das sie sofort einschlafen ließ. Dann kümmerte er sich um seinen Freund.
„Du hast doch sicher schon die Polizei gerufen. Die werden bestimmt gleich hier sein. Sag jetzt nicht, du lässt die aus dem Spiel.“
Bohm schüttelte den Kopf und blickte ihm in die Augen.
„Die werden mir nicht helfen können.“
Er ließ sich auf die Couch fallen und starrte auf den Boden.
„Ich habe in den neunziger Jahren auch mit Waffen gehandelt. Daran hat sich wohl jetzt irgendwer erinnert.“
Dann erzählte er von dem absurden Telefonat mit den Entführern.
„Claudia und Ramon werden mit Sicherheit ins Ausland gebracht. Ich muss mir dringend etwas einfallen lassen. Aber vorher ist es wichtig, Concita in Sicherheit zu bringen. Ich will sie nicht auch noch gefährden.“
Er hob den Kopf und starrte in die Zimmerecke, wo auf einem Schränkchen eine Vase mit einer einzelnen Rose zwischen den Portraits von Silke und Miguel stand. Es war nie eine Frage gewesen, zum Gedenken an die Beiden Bilder in ihrem neuen Haus aufzustellen, auch wenn sich viele Besucher darüber wunderten.
Dave nickte. „Sie kann zu uns kommen, wir werden auf sie aufpassen.“
Bohm schüttelte den Kopf. „Ich werde euch da niemals unnötig mit reinziehen. Die Sache ist schon gefährlich genug. Außerdem muss sie von hier verschwinden, am besten ins Ausland, wo sie niemand vermutet. Ich will den Rücken frei haben, wenn ich die Kinder finden will.“ „Was hast du jetzt vor?“
Er zuckte mit den Schultern. „Ich muss mich erst mal innerlich sortieren und dann einen Plan machen. Und bitte, zu Niemandem ein Wort über die Sache hier. Ich entscheide selbst, wem ich wie viel erzähle. Wir werden uns in der nächsten Zeit nicht sehen, es wäre schön, wenn du das Haus im Auge behältst. Dave, danke für deine Hilfe.“
Er umarmte seinen Freund, der ihn besorgt ansah.
„Wenn du willst, bleibe ich hier, aber zumindest werde ich morgen früh noch mal nach den beiden sehen. Ich lasse dich jetzt wirklich ungern allein. Bitte überlege dir das mit der Polizei noch einmal, die haben doch ganz andere Möglichkeiten.“
„Die haben bei weitem nicht die Möglichkeiten, die ich habe.“
HAMBURG 14. November 1985, 02.54 Uhr
Bohm musste einen kurzen Sprint einlegen, um die Hochbahn zu erwischen. Der Abend mit den Kollegen war lang geworden, auch weil die Kneipen auf der Reeperbahn die ganze Nacht geöffnet haben und das wahre Leben hier erst weit nach Mitternacht beginnt. Er wunderte sich immer noch, wie er zu diesem Einsatz gekommen war. Becker hatte es als eine besondere Art der Belobigung dargestellt, ihn als Reporter zu dem Kongress der Friedensaktivisten zu schicken. Er war, von Kurzaufenthalten auf dem Frankfurter Flughafen einmal abgesehen, das erste Mal in Westdeutschland, obwohl Hamburg nur eine Stunde Fahrt von dem Ort entfernt lag, in dem er aufgewachsen war. Es war eine andere Welt. Nach seiner Ankunft auf dem Hauptbahnhof lief er zunächst einmal einige Stunden durch die Innenstadt, um ein Gefühl für die Metropole zu bekommen. Er hatte, im Gegensatz zu der übergroßen Mehrheit seiner Landsleute, schon eine Menge von der Welt gesehen, sogar mehr, als er manchmal verkraften konnte. Trotzdem fühlte er sich hier in einem anderen Kosmos. Der Kontrast zu den ärmsten Ecken der Erde, in denen er sonst aktiv war, ja auch zu seiner Heimat schockierte ihn zunächst zu sehr, um sofort an seinen Auftrag zu denken. Bohm sollte als Reporter an einer Konferenz der Vertreter verschiedener Gruppen der Friedensbewegung teilnehmen und geeignete Kandidaten finden, die von der HVA in Zukunft als Informanten gewonnen werden konnten. Becker nannte das „Agenten-Casting“. Zu seiner eigenen Überraschung wurde er auf der Pressetribüne von zwei westdeutschen Kollegen begrüßt, die er vor einiger Zeit in Afrika getroffen hatte, als die Weltpresse von dort über die große Hungersnot berichtete. Die beiden arbeiteten für eine linke Tageszeitung und traten anscheinend fast immer als Team auf. Bohm setzte sich zu ihnen und sie verfolgten gemeinsam gelangweilt die sich über Stunden hinziehenden Debatten. Am Abend, es war inzwischen weit nach zehn, beschlossen die beiden Westdeutschen, ihrem Kollegen die „schillernden Seiten des Kapitalismus“ zu zeigen, wie sie es ausdrückten, und steuerten die Reeperbahn an.
Jetzt saß er fast allein im Waggon auf dem Weg zu seinem Hotel und betrachtete eine junge Frau, die sich am gegenüberliegenden Ende niedergelassen hatte und schlief. Sie war etwa so alt wie er selbst und trug halblanges, kastanienbraunes Haar, das ihr halbes Gesicht verdeckte. Er vermutete, dass sie irgendwo als Kellnerin arbeitete und nun auf dem Weg nach Hause war. An der nächsten Station stiegen drei vielleicht gerade siebzehn oder achtzehnjährige Männer in den Wagen, sahen sich kurz um und steuerten sofort auf sie zu. Der erste, ein bulliger Typ mit südländischem Aussehen, setzte sich auf den Platz daneben und legte ihr die Hand aufs Knie. Die anderen beiden bauten sich vor ihr auf und johlten, als sie sich aus seinem Griff lösen wollte. Bohm war sofort hellwach, sprang auf und ging in ihre Richtung.
„He, nehmt die Finger von der Frau!“
Sie blickten sich zu ihm um und einer antwortete:
„Halt dich da raus oder du fliegst noch vor der nächsten Station raus!“
Wieder lachten alle Drei. Bohm war nicht beeindruckt und ging weiter, bis ihm der erste den Weg versperrte: „Hab ich dir nicht gesagt…“
Weiter kam er nicht, dann krümmte er sich schon nach einem Hieb in die Magengrube. Ein Ellenbogenstoß in den Rücken brach ihm zwei Rippen und nachdem er ein Knie ins Gesicht bekam, ging er bewusstlos zu Boden. Der nächste wollte etwas schlauer sein als sein Kumpel und blieb etwas auf Distanz, aber nicht weit genug. Sein Kopf wurde nach hinten geschleudert, als ihm ein Fußtritt krachend den Unterkiefer brach. Ein weiterer Schlag schleuderte ihn zwischen die Sitze, wo er wimmernd liegenblieb. Inzwischen war auch der letzte des unglücklichen Trios aufgesprungen und zog ein Messer.
„Komm her!“ brüllte er seinen Gegenüber an „Ich habe keine Angst vor dir!“
Das Zittern in seiner Stimme strafte ihn Lügen. „Ich stech dich ab!“
Bohm winkte ihm auffordernd zu. Der Angriff kam genau so, wie er es erwartet hatte, sehr amateurhaft und viel zu langsam. Ohne Mühe wich er dem Arm aus, packte die Hand mit dem Messer und verdrehte sie nur um einige Zentimeter. Im gleichen Augenblick stieß sein Ellenbogen auf den gestreckten Arm, der mit einem hässlichen Geräusch brach, dann erst drehte er ihn weiter auf den Rücken, bis er an der Schulter auskugelte und einige Bänder rissen. Damit verschaffte er dem Typen bis an sein Lebensende ein Andenken an diese Nacht. Bohm packte die junge Frau am Arm und zog sie in Richtung Tür. Beim nächsten Halt ließ sie sich wie eine Puppe von ihm auf den Bahnsteig schieben und kam erst zu sich, als beide allein in der Nacht standen. Sie starrte ihn mit großen Augen an:
„Was war das grade?“
Bohm grinste. „Das waren drei Pfeifen, die einen auf dicke Hose machen wollten und sich dabei etwas weh getan haben.“
„Sie haben aber ganz schön hart hingelangt.“
„Junge Frau, wenn man es mit drei Mann zu tun hat, bringt es wenig, sie bloß ein bisschen herumzuschubsen. Dann würde ich jetzt da drin liegen und sie mit denen hier stehen. Und ich glaube nicht, dass die sie bloß nach Hause bringen wollten.“
Sie zuckte mit den Schultern. „Danke, und weil wir grade beim Thema sind, würden sie mir jetzt noch den Gefallen tun und mich zu meiner Wohnung bringen. Ich hätte nämlich noch einige Stationen fahren müssen und stehe jetzt hier in Wilhelmsburg, wo ich eigentlich nicht mal tot über dem Zaun hängen möchte.“ Bohm lachte. „Natürlich, wenn ich schon dabei bin, sie zu beschützen, dann bringe ich den Job auch zu Ende.“
Beide verließen den Bahnhof, der um diese Jahreszeit genauso ungemütlich war, wie die in der DDR. Sie hatte sich inzwischen von dem Schock erholt und hakte sich bei ihm unter.
„Du bist nicht aus Hamburg?“