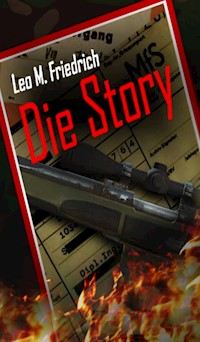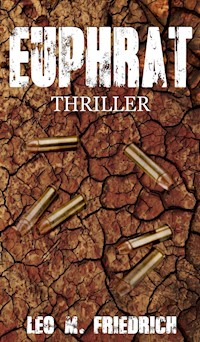2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neodym, eine der seltenen Erden, gehört zu den begehrtesten Rohstoffen des 21. Jahrhunderts. Um sich ein bedeutendes Vorkommen in Afrika zu sichern, geht ein chinesischer Bergbaukonzern verhängnisvolle Allianzen ein. Nach Bombenanschlägen in Marrakesch und Nairobi wird der ehemalige Agent Peter Bohm von seinen kenianischen Freunden zu Hilfe gerufen. Bald darauf gerät er selbst in höchste Gefahr. Seine Widersacher verfolgen Pläne, die weit über die Eroberung von Bodenschätzen hinausgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
© 2014 Autor: Leo M. Friedrich
Covergestaltung: Leo M. Friedrich
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-8495-8780-2
ISBN e-Book: 978-3-8495-8781-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Leo M. Friedrich
Neodym-Komplott
THRILLER
Einen sicheren Freund erkennt man in unsicherer Sache.
Marcus Tullius Cicero
PROLOG
Marrakesch, Marokko 28. April 2011
Bereits nach wenigen Augenblicken konnte sich Thomas Bergau nicht mehr daran erinnern, was er als erstes wahrnahm. Vielleicht war es der Brandgeruch, die Sirenen der Rettungswagen oder das Geschrei der ziellos umherlaufenden Menschen. Niemand schien Notiz von ihm zu nehmen, zumal er nicht der Einzige war, der zwischen den Trümmern des Cafe „Argana“ lag. Nach und nach kehrten seine Sinne zurück. Bergau spürte keine Schmerzen, nur in seinem Schädel hämmerte es ohne Pause. Nach einer gefühlten Ewigkeit, in der er es nicht wagte, sich zu bewegen, beugte sich ein Schatten über ihn. Jemand fühlte an seinem Hals den Puls und redete dann in einer unverständlichen Sprache mit einer anderen Person, die Bergau nicht sehen konnte. Er wollte etwas sagen, doch er brachte nur ein gequältes Krächzen zustande. Der Andere berührte ihn an der Schulter und ein stechender Schmerz durchzuckte seinen Körper. Es wirkte wie ein Weckruf. Das Gefühl für seinen Körper kehrte zurück. Arme und Beine waren noch da und ließen sich bewegen. Als Nächstes versuchte er sich zu erinnern, was eigentlich passiert war. Das letzte Bild, das sein Gehirn gespeichert hatte, war der vor Hitze flimmernde riesige Platz, auf dem sich in der Mittagszeit jedoch kaum Menschen aufhielten. Der Reiseführer hatte ihnen erzählt, dass sich hier am Abend hunderte Händler, Gaukler, Schlangenbeschwörer und Wahrsager versammeln würden. Bergau zuckte zusammen, als ihn plötzlich jemand auf Englisch ansprach und ihn vorsichtig vom Asphalt hochzog. Erst jetzt im Sitzen konnte er die gesamte Szenerie erfassen. Zwischen ihm und den rauchenden Trümmern des „Argana“ lagen in einem Chaos aus Ziegelbrocken, zerborstenen Tischen und Plastikstühlen etliche blutüberströmte Frauen und Männer. Ein Blitz durchzuckte sein Gehirn. Plötzlich war auch seine Stimme wieder da. Er sprang auf, ohne auf den Schmerz zu achten, der sich wie ein Messer in seine Schulter bohrte.
„Sylvia!“
Bergau stolperte los und achtete nur darauf, nicht auf einen der am Boden liegenden zu treten. Er begann zu rennen, strauchelte, stürzte, rappelte sich wieder hoch.
„Sylvia! Wo bist du?“
Sie war von einem wortgewandten Verkäufer in einen der zahllosen Läden gezerrt worden, während er draußen gewartet hatte. Jetzt versuchte er, sich zu erinnern, ob sie wieder herausgekommen war, bevor das Cafe explodierte.
Die vor den kleinen Shops aufgebauten Auslagen mit geschnitzten Kamelen, Lederpantoffeln, nachgemachten Krummdolchen und allem, was Touristen sich sonst noch so gern andrehen ließen, waren von der Druckwelle und den panisch flüchtenden Menschen durcheinandergewirbelt worden. Bergau fand nur mit Mühe den Laden wieder, in dem seine Freundin verschwunden war. Ohne Rücksicht auf die herumliegenden Postkarten und Marrakesch-Basecaps stürmte er hinein. Auf dem Boden zwischen den mit T-Shirts und Teppichen behängten Wänden saß eine ältere weiße Frau und versuchte erfolglos, sich mit einem Tuch einen Blutfleck von der Hose zu wischen. Sie sah nicht einmal auf, als Bergau hereinstürmte. Er hockte sich vor ihr hin. „Haben Sie meine Frau gesehen? Sie ist blond, etwa fünfzig und trägt eine rote Bluse und Jeans. War sie hier im Laden?“
Die alte Frau starrte ihn nur an und zuckte mit den Schultern. Dann bearbeitete sie weiter den Blutfleck, der sich durch das Reiben auf ihrem dicken Oberschenkel ständig vergrößerte.
Bergau sprang auf und durchsuchte den Raum. Es gab nicht einmal eine Hintertür.
Er stürmte wieder hinaus und begann, ziellos in den engen Gassen des Souks herumzulaufen. Schon wenige Minuten später wusste er nicht mehr, wo er war und bemerkte auch nicht die beiden finster dreinschauenden Männer, die ihm die ganze Zeit über folgten. Im Hinterkopf hatte er die Warnung des Reiseleiters, niemals allein einen der einem Labyrinth ähnelnden Märkte in Marokko zu betreten. Doch in diesem Moment war es ihm egal, er sucht seine Partnerin, die irgendwo hier verschwunden war. Ohne es zu merken, drang er immer tiefer in das Gewirr der kleinen Gassen ein.
Als er an einer Kreuzung verwirrt stehen blieb und sich umsah, sprach ihn ein Mann an, der wie einer der vielen hier arbeitenden Händler aussah.
„Mister, Sie suchen ein weiße Frau? Mit einer roten Bluse?“
Bergau starrte ihn mit großen Augen an.
„Ja! Haben Sie sie gesehen?“
„Sie kam gerade hier vorbei. Geben sie mir ein paar Dinar, dann zeige ich es Ihnen.“
Der Mann stürmte los und Bergau hatte Mühe, ihm zu folgen. Ständig stolperte er über auf dem Boden ausgebreitete Waren, herumsitzende Frauen und spielende Kinder. Schließlich blieben sie vor einem Teppichgeschäft stehen.
„Sie ist hier hineingegangen.“
„Woher wollen Sie das wissen, wir waren doch eben noch ganz woanders?“
Nairobi, Kenia 29. April 2011
Sam Awenu trank seinen Kaffee aus und rückte die Krawatte zurecht. Im Stillen wünschte er sich, weiterhin die Uniform der African Guard & Security tragen zu dürfen, eines der größten Sicherheitsunternehmen auf dem schwarzen Kontinent. Doch er war nun kein gewöhnlicher Mitarbeiter mehr, sondern seit heute morgen der Direktor und somit gleichzeitig der Sicherheitschef der gesamten Mankundé-Firmengruppe. Awenu zögerte lange, das Angebot anzunehmen, Nachfolger des legendären John Mgembala zu werden. Dieser hatte das Unternehmen in den späten achtziger Jahren gemeinsam mit Maurice Mankundé aufgebaut und schützte seitdem nicht nur die Firmen des eigenen Imperiums. Zu den Kunden zählten inzwischen alle größeren Unternehmen in Afrika, sogar einige Politiker vertrauten mehr auf den Personenschutz der Guards als auf den ihrer eigenen Polizei. Als äußerst profitabel erwies sich auch die Aufstellung eines eigenen Sondereinsatz-Teams, das speziell auf die Befreiung von Geiseln trainiert war. Entführungen waren in Afrika nach wie vor an der Tagesordnung und so kamen die Mitglieder dieses kleinen Kommandos, das keinen Vergleich mit regulären Einheiten der europäischen oder amerikanischen Polizei zu scheuen brauchte, ziemlich häufig zum Einsatz. Sam Awenu hatte dieses Team in den letzten vier Jahren geführt und mit ihm eine Reihe von Operationen durchgeführt, von denen zwar nicht alle erfolgreich waren, aber den Ruf der Guards in Afrika doch legendär machten. Er konnte das Kommando mit guten Gewissen abgeben. Seine Männer waren in ausgezeichneter Verfassung, die Moral stimmte und die Ausrüstung war auf dem neuesten Stand der Technik. Arbeit würde es für seinen Nachfolger genug geben. Die islamistischen Kräfte wurden auch in Afrika stärker und gingen immer aggressiver gegen Andersgläubige vor. Vor allem im Norden des Kontinents, aber auch im Sudan und in Mali standen bereits riesige Gebiete unter dem Zeichen des Halbmondes. Und erst gestern gab es in Marokko einen Bombenanschlag auf ein Cafe, bei dem vierzehn Menschen starben. Awenu legte die Zeitung vor sich auf Schreibtisch und blickte auf die Fotos aus Marrakesch. Er hatte bereits von dem dortigen Abteilungsleiter der Guards einen Bericht angefordert, der noch heute eintreffen sollte.
Sam Awenu blickte aus dem achten Stock des Maurice Mankundé gehörenden Bürogebäudes hinunter auf den Woodvale Grove. Er registrierte den schwarzen Mercedes seines Chefs, der in die Straße einbog und zügig auf die Tiefgarageneinfahrt zuhielt. Der Wagen verschwand in dem Tor schräg unter ihm. Awenu wollte sich gerade vom Fenster wegdrehen, als ein grauer Transporter mit aufheulendem Motor hinter Mankundés Auto in die Tiefgarage raste. Awenu griff instinktiv nach seiner Pistole, die er immer in einem Schulterhalfter unter seinem Jackett trug und wollte aus dem Büro sprinten, als eine Explosion das Gebäude erschütterte. Er wurde gegen den Türrahmen geschleudert und prallte dann im Flur mit einer Sekretärin zusammen, die vergeblich versuchte, ein Tablett mit Tassen vor dem Herunterfallen zu bewahren. Awenu rappelte sich wieder hoch und rannte zum Treppenhaus, ohne auf die Kaffeeflecken zu achten, die sich auf seinem Hemd und seiner Hose ausbreiteten. Überall begegneten ihm verstörte Mitarbeiter, die nicht zu verstehen schienen, was gerade passiert war. Er rief ihnen zu, sofort das Gebäude zu verlassen und setzte seinen Weg in Richtung der Tiefgarage fort. Im Erdgeschoss angekommen bot sich ein Bild des Grauens. Der Fußboden war teilweise eingestürzt. Ein Großteil der Empfangshalle lag jetzt im Keller auf den abgestellten Autos. Awenu kletterte vorsichtig hinab und versuchte sich zu orientieren. Die Explosion hatte nicht nur den Transporter in Stücke gerissen, sondern auch Maurice Mankundés gepanzerten Mercedes wie ein Spielzeug durch die Tiefgarage geworfen. Jetzt lag er auf dem Dach, eingekeilt zwischen dem, was vor kurzem noch die Wagen einiger Angestellter waren, die hier im Gebäude arbeiteten. Überall sah man Leichteile. Es würde Tage dauern, sie den jeweiligen Opfern zuzuordnen.
Sam Awenu kämpfte sich zwischen den Fahrzeugwracks hindurch zum Wagen seines Chefs. Gemeinsam mit zwei anderen Wachleuten, die ihm, ohne dass er es ihnen befohlen hatte, aus der zerstörten Lobby in die Tiefgarage gefolgt waren, räumten sie ein paar Trümmer beiseite, um an die schwere Limousine heranzukommen. Mankundé benutzte erst seit zwei Jahren ein gepanzertes Fahrzeug. Sie hatten ihn damals regelrecht überreden müssen, nachdem die allgemeine Sicherheitslage in Nairobi immer bedrohlicher wurde. Anschläge, Morde und Schiessereien waren seit den Unruhen während der letzten Wahlen ständig an der Tagesordnung. Mit Mühe öffneten Awenu und seine Helfer zunächst die Fahrertür. Jordi N’komo, der Chauffeur und einer der besten Personenschützer der Guard, hing merkwürdig eingekeilt zwischen der Frontscheibe und dem Armaturenbrett. Zwei weit aufgerissene, leblose Augen starrten Sam an. Erst als sie ihn herauszogen, bemerkten sie sein gebrochenes Genick. Sam kroch zurück in den Wagen und versuchte, zur Rückbank zu gelangen. Maurice Mankundé lebte noch, blutete aber heftig aus einer Kopfwunde. Awenu versuchte, ihn anzusprechen, bekam als Antwort jedoch nur ein leises Stöhnen. Einer der beiden Wachmänner war ihm in den Wagen gefolgt und schaute ihn fragend an.
„Lebt der Boss?“
„Ja, aber es hat ihn schwer erwischt. Versucht, die Tür hinten links aufzumachen und besorgt verdammt noch mal eine Trage!“
Er wusste, es würde ein hartes Stück Arbeit werden, den fast zwei Meter großen und gut einhundertzwanzig Kilo schweren Mann aus dem Autowrack zu bekommen. Mühsam zog er sich in dem engen Wagen sein Hemd aus und verband Mankunde damit notdürftig die blutende Wunde am Kopf. Während er darauf wartete, dass seine Männer die Tür öffneten, rasten seine Gedanken bereits in eine andere Richtung. Wer könnte für diese Tat verantwortlich sein? Er würde, unabhängig von der Polizei, eigene Ermittlungen führen müssen. Dazu brauchte er fähige Leute. Seine Guards bestanden hauptsächlich aus ehemaligen Militärs und Polizisten, die zwar durchweg Kampferfahrung hatten, aber wer von ihnen war ausgebildet, Dedektivarbeit zu leisten? Ein Stöhnen riss ihn aus seinen Gedanken. Mankundé bewegte sich und griff nach seinem Arm.
„Sam?“ Seine sonst so tiefe Stimme war zu einem schwachen Flüstern geworden.
„Ganz ruhig Boss, wir holen Sie gleich raus.“
Sam nestelte verlegen an dem provisorischen Kopfverband.
„Sie dürfen sich jetzt nicht bewegen.“
„Was ist mit Jordi? Wie geht es ihm?“
Sam schüttelte Kopf. Mankundé verstand.
„Wie schlimm ist es?“
„Boss, ich weiß es noch nicht. Aber es sieht nicht gut aus. Jetzt müssen wir Sie erst einmal hier herausbekommen.“
Im nächsten Moment wurde von außen die Tür aufgerissen und zwei Männer in den schwarzen Uniformen der African Guard steckten die Köpfe in den Wagen.
„Wie geht es ihm?“
„Er lebt, hat aber schwere Verletzungen. Wir müssen ganz vorsichtig sein, wenn wir ihn herausholen. Habt ihr eine Trage?“
Die Männer nickten und griffen behutsam nach dem Verletzten. Obwohl sie kräftig und durchtrainiert waren, hatten sie doch einige Mühe, den hünenhaften Boss aus dem Wrack seines Mercedes zu ziehen und auf die Trage zu legen. Sam krabbelte hinter ihnen aus dem Wagen und sah sich zum ersten Mal bewusst in der Tiefgarage um. Ihm bot sich ein Bild wie es schlimmer nicht sein konnte. In der Decke klaffte ein riesiges Loch, durch das man in die Lobby des Bürohauses sehen konnte. Zwischen den Trümmern der abgestellten Autos lagen Betonteile, aus einer aufgerissenen Leitung strömte Wasser und überall lagen Tote und Verletzte. Inzwischen wimmelte es in der Tiefgarage vor Menschen, die sich um die Überlebenden kümmerten. Sam kämpfte sich nach draußen und sog frische Luft in seine Lungen. Er wusste, es war jetzt sein Job, die Rettungsarbeiten zu koordinieren.
Inzwischen war vor dem Bürogebäude mehr als ein Dutzend Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge aufgefahren. Im Geschäftsviertel von Nairobi funktionieren die Rettungsdienste fast wie in jeder europäischen oder amerikanischen Großstadt. Nur draußen in den Slums wartete man stundenlang auf Hilfe, stellte Awenu verbittert fest. Neben einem Polizeiwagen traf er auf seinen Stellvertreter, der aufgeregt mit zwei Beamten diskutierte. Er sprach ihn an, ohne die beiden Polizisten zu beachten.
„Zari, ich will in einer halben Stunde alle verfügbaren Männer hier vor Ort haben, alle Kommandeure und die gesamte Geschäftsleitung schon in zwanzig Minuten. Besorg uns einen großen Transporter, den wir als Einsatzleitung nutzen können und jedes Funkgerät, das du auftreiben kannst.
Und ich brauche dringend ein funktionierendes Handy.“ Zari salutierte und verschwand umgehend zwischen den vielen Fahrzeugen, die inzwischen die gesamte Straße blockierten.
Es dauerte fast sieben Stunden, bis alle Opfer aus dem schwer beschädigten Gebäude geborgen waren. Awenus Männer hatten gemeinsam mit den zahlreich angerückten Feuerwehrleuten bis zur völligen Erschöpfung gearbeitet. Sam, der inzwischen wieder seine heißgeliebte schwarze Uniform trug, saß mit einem Becher Kaffee in der Hand in dem eilig umgebauten VW-Transporter und starrte auf die Liste der Opfer, die aus den Trümmern geborgen worden waren. Neben ihm tauchte eine schlaksige Gestalt auf und ließ sich unaufgefordert auf einen der leeren Sitze fallen. Es war Johnny Akobari, Leiter der IT-Abteilung der Mankundé-Gruppe. Der Nigerianer galt in der Firma als Computergenie, der in dem Ruf stand, in kürzester Zeit jede gewünschte Information zu beschaffen, sei sie auch noch so geheim. Akobari öffnete eine Dose Cola und nahm einen langen Schluck, bevor er dem Kommandeur der Guards in die Augen sah.
„Sam, wie schlimm ist es?“
„Ziemlich übel, wir haben bisher neun Tote und siebenundachtzig Verletzte.“
„Wie geht es dem Boss?“ „Der hat riesiges Glück gehabt. Es hat ihn schwer erwischt, aber er wird es schaffen. Ich fahre nachher zu ihm ins Krankenhaus. Wie sieht es mit den Daten aus?“
Er deutete mit dem Kopf auf das Bürogebäude.
„Wir konnten den Server sichern und einen Backup auf einen externen Host transferieren.“
Awenu schaute ihn verständnislos an.
„Das heißt jetzt was genau?“
„Alle Daten sind an einem sicheren Ort.“
„Dann sag das doch gleich.“
„Hast du schon eine Ahnung, wer diese Scheiße hier angerichtet hat?“
„Nein, damit befasse ich mich als nächstes. Und ich werde dabei deine Hilfe brauchen.“
„Meine Jungs werden dir rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Wir suchen gerade einen sicheren Ort, wo wir unser Equipment ausbreiten können.“
„Ihr zieht in den Stützpunkt der Guard, ich sorge dafür, dass ihr dort geeignete Räume bekommt.“
„Wir brauchen vor allem ein ganzes Bündel schnelle Datenverbindungen. Und jede Menge Steckdosen an einem stabilen Stromnetz.“
„Mach eine Liste und gib sie Zari. Dann packt den Computerkram und eure Zahnbürsten ein. Morgen früh will ich deine Truppe einsatzbereit haben.“ „Sam, vielleicht sollten wir Peter anrufen. Ich glaube, der wäre uns jetzt eine große Hilfe.“
Beide schwiegen einen Moment und starrten vor sich auf die Tischplatte. Vor einigen Jahren hatten sie Peter Bohm geholfen, seine entführten Kinder zu befreien. Beide waren mit ihm zwei Monate kreuz und quer durch die Welt geflogen. Nach einer wahren Schnitzeljagd hatten sie es geschafft, nicht nur seinen Sohn und seine Tochter zu finden, sondern auch eine großangelegte Verschwörung aufzudecken. Bohm wurde am Ende schwer verwundet und lag einige Zeit im Koma. Awenu und Akobari hatten in den Wochen für den Schutz seiner Frau und der Kinder gesorgt, die von den ganzen Ereignissen ziemlich traumatisiert waren. Außerdem war Peter Bohm einer der engsten Freunde ihres gemeinsamen Chefs Maurice Mankunde. Und im Moment brauchten sie jede Hilfe, die sie kriegen konnten.
„Ich denke, das sollte ich tun.“
Teil 1
Peter’s Point, Kanada
Wenn es eine Rückkehr in das, was man ein „normales“ Leben nennen konnte, überhaupt gab, dann hatten sie es geschafft. Zum einen, weil sie als Familie zusammenhielten, vor allem aber durch die Hilfe ihrer zahlreichen Freunde. Peter Bohm saß an seinem Schreibtisch und blickte durch das Fenster seines Arbeitszimmers hinaus auf den Fluss. Es war Ende April. Letzte Woche hatten sie das Boot ins noch immer eiskalte Wasser gelassen und waren gemeinsam stundenlang über den See geglitten. Obwohl die schrecklichen Ereignisse mittlerweile fast fünf Jahre zurücklagen und auch seine Schulter nicht mehr bei jeder unbedachten Bewegung schmerzte, gruben sich die Narben doch tief in ihre Gedanken. Seine Frau Concita hatte dafür gesorgt, den Kindern eine erstklassige psychologische Betreuung zukommen zu lassen. Vor allem Claudia, ihre Tochter, die als Elfjährige wochenlang mit ihrem Entführer um die Welt fliegen musste, schien die Erlebnisse von damals gut weggesteckt zu haben. Zwar saß sie immer noch gelegentlich mit ihrer Nachbarin, einer angesehenen Psychologin zusammen bei einer Tasse Kaffee, doch inzwischen dürfte es bei diesen Gesprächen eher um Dinge gehen, die viele fünfzehnjährige Mädchen bewegen. Ramon, sein Sohn, hatte sich neben der Schule voll auf seinen Sport konzentriert und war mittlerweile der jüngste Profi-Torwart der kanadisch-amerikanischen Eishockey-Liga NHL. Die größten Sorgen bereitete Peter Bohm der Zustand seiner Frau Concita. In der ersten Zeit nach den Ereignissen wirkte sie ungemein stark, kümmerte sich mit Hingabe und Enthusiasmus um ihn und die Kinder, bis es Monate später, zu einen Zusammenbruch kam, der sie ebenfalls in eine lange und aufwendige Behandlung zwang.
Mittlerweile war sie wieder vollständig erholt und hatte, auch mit Hilfe vieler guter Freunde, den Spaß am Leben zurück gewonnen. Über die Ereignisse von damals wurde in der Familie nicht mehr gesprochen, auch wenn jeder seine ganz speziellen Erinnerungen an diese Tage im Gedächtnis behielt.
Das Klingeln seines Handys ließ Peter Bohm so heftig zusammenzucken, dass sogar seine Schulter wieder einen kurzen Schmerzimpuls aussandte. Er schüttelte sich kurz, bevor er auf die grüne Taste drückte.
„Peter, hier ist Sam. Ich habe wenig Zeit. Wir hatten hier in Nairobi einen Bombenanschlag auf unser Bürogebäude. Maurice ist schwer verletzt…“
„Moment Sam, nicht ganz so schnell. Ihr hattet was?“
Während er versuchte, das kleine Handy mit der Schulter am Ohr festzuklemmen, suchte er mit einer Hand auf dem Schreibtisch die Fernbedienung für den Fernseher, mit der anderen schaltete er seinen Laptop ein.
„Heute früh ging hier in unserer Tiefgarage eine Autobombe hoch, kurz nachdem der Boss mit seinem Mercedes hereingefahren ist. Es gab mehrere Tote und eine Menge Verletzte. Das Gebäude ist auch ziemlich hinüber.“
Bohm, der die Fernbedienung inzwischen gefunden hatte, schaltete auf CNN und starrte einen Moment lang fassungslos auf den Bildschirm.
„Sam, ich sehe das hier gerade im Fernsehen. Habt ihr schon eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?“
„Unser Computergenie Johnny baut gerade eine neue Einsatzzentrale in unserem Stützpunkt auf und wird dann als erstes die Aufnahmen der Videokameras auswerten. Auf die Polizei brauchen wir uns nicht zu verlassen. Ich habe vor, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Deshalb hätte ich dich gern als Berater hier. Wir werden jeden fähigen Mann brauchen, um die Sache aufzuklären und du bist nun mal unser Experte in Sachen Terrorismus.“
„Sam, lass es gut sein. Natürlich werde ich euch helfen. Ich wäre auch gekommen, wenn du nicht gefragt hättest.“
„Vielen Dank mein Freund. Schick mir eine Mail mit deinen Flugdaten, ich lasse dich abholen. Wir sehen uns in Nairobi.“
Bevor Bohm noch etwas entgegnen konnte, war die Leitung bereits tot. Sam musste wirklich unter ungeheurem Stress stehen. Unbemerkt war Concita ins Zimmer gekommen und starrte auf den Fernseher, der immer noch Bilder aus Nairobi zeigte.
„Was ist da in Kenia passiert? Ist das…? Das ist Mankundé’s Bürohaus, richtig?“
„Genau Schatz, es gab einen Bombenanschlag. Maurice ist schwer verletzt. Gerade eben hat Sam angerufen. Er ist seit heute Sicherheitschef und…“
„Er möchte, dass du sofort hinfliegst, nicht wahr?“
„Er nimmt jede Hilfe, die er kriegen kann. Und ich kenne mich mit so etwas eben ein wenig aus, wie du weißt.“
„Bist du denn schon wieder so fit, dass du das durchstehst?“
„Cita, bitte, das ist jetzt fast fünf Jahre her. Ich bin seit vorigem Jahr wieder regelmäßig im Training. Natürlich schaffe ich das. Ich kann Sam jetzt nicht hängen lassen, nach allem, was er für uns getan hat.“
„Das ist mir schon klar. Ich mache mit nur Sorgen um dich. Wann fliegst du?“
„Sobald wie möglich. Vorher müssen wir noch sicherstellen, dass du mit Claudia irgendwo abtauchst, solange ich weg bin. Wir wissen nicht, wer hinter der ganzen Geschichte steckt. Deshalb will ich euch beide aus der Schusslinie haben.“
„Du meinst, wir sollen unsere Koffer packen und von hier verschwinden?“
„Genau das denke ich. Wir sind schließlich gebrannte Kinder. Ihr fliegt am besten gleich morgen früh nach Manaus zu deinem Bruder. Rufe ihn gleich an, ich rede mit Claudia. Ich denke, sie wird es verstehen.“
„Und was ist mit Ramon? Soll er auch… abtauchen?“
„Wenn ich richtig informiert bin, fährt er morgen in ein Trainingslager. Ich denke, er ist erst einmal sicher. Eishockeyspieler sind ja harte Jungs, die werden schon auf ihren Torwart aufpassen. Ich ruf ihn nachher an und schärfe ihm ein, vorsichtig zu sein.“
Bohm zog seine Frau an sich.
„Schatz, ich muss es tun. Maurice ist mein bester Freund. Ohne ihn hätten wir unsere Kinder damals nicht wieder bekommen. Dies ist meine Chance, mich bei ihm zu bedanken.“
Atlas-Gebirge, Marokko
Mit einem Ruck zog man ihr die schwarze Kapuze vom Kopf. Obwohl der Raum nur von einem winzigen Fenster erhellt wurde, musste Sylvia Strobel die Augen zukneifen. Ihr kam es vor, als hielte ihr jemand eine Lampe direkt vor das Gesicht. Ihr Schädel brummte, wahrscheinlich war es eine Nachwirkung der Betäubungsspritze, die sie in den vergangenen Stunden in tiefer Bewusstlosigkeit gehalten hatte. Man hatte ihre Hände mit Kabelbindern hinter dem Körper gefesselt und die Füße mit einfachen Stricken an die Beine eines Hockers gebunden. Ein dunkelhäutiger Mann mit ungepflegtem schwarzem Bart beugte sich direkt vor ihr Gesicht. Sein Atem verströmte einen undefinierbaren Geruch. Sie musste würgen. Niemand sagte etwas. Ohne den Kopf zu bewegen, sah sie sich im Raum um. Der Schemel, auf den man sie platziert hatte, war das einzige Mobiliar. In der Ecke neben der Tür stand ein zerbeulter Wassereimer, daneben zwei weitere Gestalten, in ihrem Äußeren ähnlich dem Mann vor ihr. Der Bärtige starrte ihr schweigend weiter direkt in die Augen. Sie schluckte und setzte eine weinerliche Miene auf.
„Bitte, was wollen Sie von mir? Wo bin ich?“
Ihr Gegenüber grinste sie nun breit an.
„Herzlich Willkommen Lady. Sie sind Gast der AQIM. Mein Name ist Hakim Dahrani. Sie sind in einem meiner Häuser mitten im Gebirge. Wir werden uns in Kürze ausführlicher unterhalten.“
Er richtete sich auf.
„Mister Dahrani, warum bin ich hier? Bitte, ich habe doch gar nichts.“
Er verpasste ihr ohne Vorwarnung eine so kräftige Ohrfeige, dass ihr Kopf herumgerissen wurde und sie beinahe mit dem Hocker umgekippt wäre. Dahrani beugte sich wieder herunter, packte ihre Haare und zog ihr Gesicht dicht vor seinen Bart.
„Du wirst nie wieder unaufgefordert sprechen. Merke dir das gut. Du redest nur, wenn ich es dir erlaube. Hast du das verstanden?“
Sie deutete ein Nicken an, während ihre Wange wie Feuer brannte. Er ließ sie los und ging in Richtung Tür.
„Ich muss noch einmal weg. Wenn ich wiederkomme, werden wir uns unterhalten. Du scheinst dir mächtige Feinde gemacht zu haben.“
Die zwei Begleiter Dahranis blieben im Raum, rücken ihre Maschinenpistolen zurecht und starrten sie unschlüssig an. Offenbar waren sie vom plötzlichen Verschwinden ihres Chefs überrascht und wussten nicht so recht, was sie nun tun sollten. Sylvia Strobel bemerkte, dass sie miteinander tuschelten und dabei immer wieder auf die Uhr sahen. Sie beschloss, weiterhin verzweifelt und weinerlich zu wirken, beugte sich zur Seite und fiel mitsamt dem Schemel auf die Seite. Die Männer sprangen sofort zu ihr hin und zogen sie mit groben Bewegungen wieder in eine aufrechte Position. Sylvia jammerte und stöhnte und sah ihre Bewacher mit großen, tränengefüllten Augen an.
„Bitte, ich habe Durst. Geben Sie mir etwas Wasser.“
Der Ältere der beiden schien sie zu verstehen und ging in die Ecke, wo auf dem Boden neben ihrer Handtasche eine Flasche stand. Er drehte den Verschluss auf, roch kurz daran und hielt sie ihr an den Mund. Gierig nahm sie ein paar Schlucke und begann dann zu husten. Der Anfall schien nicht enden zu wollen und wieder sahen sich die beiden Männer hilflos an. Offenbar hatten sie sich die Aufgabe anders vorgestellt.
Die Erlösung für die Männer kam erst, als sich die Tür öffnete und ein dritter Bewaffneter, der anscheinend draußen Wache gestanden hatte, den Raum betrat. Er beachtete die Gefangene, deren Hustenanfall schlagartig endete, überhaupt nicht und redete aufgeregt auf seine beiden Kameraden ein. Dabei zeigte er immer wieder auf die Uhr. Sylvia Strobels Arabisch war nicht sehr gut, allerdings verstand sie soviel, dass es wohl an der Zeit für das Gebet sei. Die drei blickten sie wieder an und beschlossen anscheinend, dass der Jüngste von ihnen, ein dürrer Bursche von vielleicht fünfzehn Jahren, die Bewachung übernehmen sollte. Der schien allerdings von der Aufgabe nicht begeistert zu sein, was zu einer erneuten heftigen Diskussion führte.
Ihre Gefangene begann nun erneut zu jammern und zu weinen, woraufhin sich die beiden Älteren schleunigst aus dem Raum verdrückten und ihren jungen Kumpan mit dem Häufchen Elend, das die Deutsche abgab, allein ließen. Kaum hatten sie die Tür hinter sich geschlossen, als Sylvia ihren Bewacher mit großen Augen ansah und auf Französisch ansprach:
„Kannst du mich verstehen?“
Er starrte sie verunsichert an und nickte.
„Wie ist dein Name?“
„Ich bin Mehdi. Aber du musst schweigen. Niemand darf mit dir sprechen.“
„Mehdi, bitte. Ich muss mal dringend. Kannst du mich losbinden?“
„Das geht nicht. Ich bekomme großen Ärger, wenn ich das tue.“
„Mehdi, ich halte es nicht mehr aus. Niemand wird etwas merken. Bitte!“
„Aber was ist…“
„Mehdi, ich werde es keinem erzählen. Und bis die anderen beiden wieder zurück sind, bin ich längst fertig.“
Der Junge zuckte mit den Schultern, schob die Maschinenpistole auf den Rücken und löste die Stricke an den Füssen. Sylvia stand auf und streckte sich. Dann drehte sie sich um.
„Bitte mach die Fesseln los.“
„Das kann ich nicht tun. Wie soll ich…?“
„Mehdi bitte, ich bin eine Frau. Oder willst du mir die Hose aufknöpfen? Nun mach schon, beeil dich!“
Tatsächlich zog er ein Taschenmesser hervor und schnitt mit einiger Mühe den Kabelbinder an ihren Handgelenken durch. Offenbar hatte er sich noch keine Gedanken gemacht, womit er seine Gefangene anschließend wieder fesseln sollte. Das war auch nicht mehr nötig, denn kaum waren ihre Hände frei, wirbelte Sylvia Strobel herum, packe ihren Bewacher an den Schultern und rammte ihm mit voller Wucht ihr Knie in den Unterleib. Er war viel zu überrascht, um aufzuschreien und krümmte sich vor Schmerz nach vorn, woraufhin seine Angreiferin einen Schritt zurückwich, um ihm dann einen Fußtritt unters Kinn zu verpassen. Der brach ihm nicht nur den Unterkiefer, sondern ließ ihn gleichzeitig rückwärts taumeln. Bevor er wieder zu sich kommen konnte, bearbeitete die Frau, die eben noch hilflos und jammernd auf ihrem Schemel gehockt hatte, seinen Körper mit einer Serie von Faustschlägen, präzise genug gezielt, um den größtmöglichen Schaden anzurichten. Innerhalb von wenigen Sekunden brach sein Nasenbein, die Spitze einer zerborstenen Rippe bohrte sich in die Lunge und die Leber bekam einen Riss. Mehdi brach zusammen und konnte nicht einmal mehr die Arme zum Schutz heben. Sylvia wand die Kalaschnikow, die er immer noch auf dem Rücken trug, von seinem verkrümmten Körper und rammte ihm den Kolben mehrmals gegen den Schädel.
Nachdem sie sich überzeugt hatte, dass er tot war, durchsuchte sie seine Kleidung, nahm sein Handy und zwei Ersatzmagazine an sich und sah sich im Raum um. In einer Ecke fand sie ihre Handtasche. Mit einem schnellen Blick überzeugte sie sich, dass der Inhalt vollständig war und öffnete die Tür einen Spalt breit. Draußen stand ein Pickup, dahinter erhoben sich die Berge. Sie schlüpfte hinaus und sah sich um. Die anderen beiden Bewacher knieten etwas abseits unter dem Vordach eines Schuppens und beteten, ohne sie zu bemerken. Ein steiniger Weg führte durch das Tal neben einem ausgetrockneten Flussbett entlang. Außer ihrer Hütte und dem Schuppen gab es offenbar keine weiteren Gebäude in der Umgebung. Sie entsicherte die Maschinenpistole und überzeugte sich, dass sie durchgeladen war.
„He Jungs, Zeit für euch, Allah persönlich zu treffen!“
Die beiden Betenden fuhren herum und starrten sie an, als wäre sie ein Geist. Obwohl sie nur ein paar Schritte entfernt war, schoss Sylvia nicht lässig aus der Hüfte, sondern gab die Feuerstöße aus dem korrekten Anschlag wie auf einem Schießstand ab.
Der Zündschlüssel des Pickup steckte und im Fahrerhaus fand sie zudem eine Flasche Wasser sowie zwei Schokoriegel. Der Besitzer würde nichts mehr dagegen haben, wenn sie diese als Proviant mitnehmen würde. Sylvia Strobel legte eine Kalaschnikow schussbereit auf den Beifahrersitz, eine zweite in den Fußraum und startete den Motor.
Hakim Dahrani kannte die Strecke zu seiner Hütte auswendig, trotzdem war er aufmerksam. Immer wieder lösten sich größere Steine von den Bergen und lagen dann plötzlich auf der Straße. Er freute sich auf das Verhör der Deutschen, denn mit Sicherheit würde es einfach werden. Sie war nur ein jammerndes Häufchen Elend, als er sie vor einigen Stunden verließ. Es würde nicht lange dauern, bis sie redete und ihm alles erzählte, was er wissen wollte.
Dahrani verachtete die Ungläubigen. Sie waren schwach, besonders wenn man ihnen Gewalt androhte. Er hatte sie schon zu hassen gelernt, als er noch ein kleiner Junge war. Geboren wurde er in Agadir, einem aufstrebenden Touristenort am Atlantik. Sein Vater war Fischer, der mit einem klapprigen Kutter hinaus auf das Meer fuhr, bis er eines Tages nicht mehr wiederkam. Hakim musste zum Familienunterhalt beitragen, indem er Souvenirs an Urlauber aus Europa verkaufte. Tag für Tag saß er an dem kleinen Stand vor dem Hotel und sah die leicht bekleideten weißen Frauen mit ihren blassen Männern an ihm vorbeilaufen. Viele beachteten ihn gar nicht und die wenigen, die sich für seine Waren interessierten, feilschten mit ihm, nur um das Gefühl zu haben, ein Geschäft zu machen. Hakim ging nun regelmäßiger in die Moschee und wurde fanatischer in seinem Glauben. Um der Armut zu entfliehen, meldete er sich als Achtzehnjähriger freiwillig zum Dienst in der Armee. Man schickte ihn nach Süden, in die Westsahara-Region. Dort führte Marokko seit Jahren einen Krieg gegen die Unabhängigkeitsbewegung POLISARIO. Dahrani bewachte zwei Jahre lang den sogenannten Westsahara-Wall, ein Verteidigungssystem, dass im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut und perfektioniert wurde. Der Dienst in der Wüste war langweilig und geisttötend, so beschäftigte er sich in seiner freien Zeit zunehmend intensiver mit dem Studium des Koran und anderer religiöser Schriften. Er hegte eine heimlich Bewunderung für die aufkommende islamistische Bewegung um den arabischen Millionär Osama Bin Laden.
Mitte der Neunziger Jahre verließ er die Armee und kehrte nach Agadir zurück. Die Stadt platzte inzwischen aus allen Nähten, überall entstanden längs der Küste neue Hotels und die Straßen wurden überschwemmt mit Ungläubigen. Dahrani kam sich vor wie auf einem fremden Planeten. Er heiratete und begann, in der Autowerkstatt eines Verwandten zu arbeiten. Noch regelmäßiger als früher besuchte er die Moschee und lauschte den Predigten des Imams, der immer unverhohlener zum Kampf gegen die Kreuzritter des Westens aufrief. Mit stiller Freude hockten sie am elften September 2001 vor dem Fernsehgerät im Büro ihres Chefs und sahen zu, wie die Türme des World Trade Centers in sich zusammenstürzten.
Wenige Wochen später kündigte Dahrani seinen Job und reiste mit einigen Gleichgesinnten nach Afghanistan. Kurz zuvor waren dort die Armeen des verhassten Westens einmarschiert, um die Taliban zu vertreiben. Er erwies sich als so zäher und geschickter Kämpfer, dass schon bald die Führung der al-Kaida auf den Marokkaner aufmerksam wurde. Aiman al-Zawahari, Bin Ladens Stellvertreter, machte ihn zum Kommandeur seiner persönlichen Leibwache und der Ägypter war es auch, der ihn später zurück nach Nordafrika schickte, um die zersplittert operierenden Terrorgruppen zur al-Kaida des islamischen Maghreb, der AQMI zu einen.
Der aktuelle Auftrag war eigentlich recht einfach zu bewerkstelligen und sollte auch noch eine schöne Stange Geld einbringen. Aus einer höheren Kommandoebene war die Information gekommen, dass in einem Restaurant in Marrakesch eine nicht näher bezeichnete Organisation eine verdeckte Übergabe von Informationen an eine europäisch aussehende Frau plante. Hakims Gruppe sollte nun diese Informationen, die wahrscheinlich auf einem USB-Stick oder einer Speicherkarte weitergereicht werden sollten, in die Hand bekommen. Dafür bot der unbekannte Auftraggeber seiner Gruppe eine Million US-Dollar. Er beriet sich mit seinem Team und sie beschlossen einstimmig, als Ablenkung das Restaurant in die Luft zu jagen und gleichzeitig die Frau zu kidnappen. Die Vorbereitungen gingen in die finale Phase, als er auf seinem Laptop ein Bild der Frau, die genaue Uhrzeit und das Datum der Übergabe vorfand. Zwei seiner Männer platzierten die in einer Gasflasche versteckte Bombe. Dann hieß es nur noch warten und beobachten. Als ihre Zielperson nach dem Treffen in der Nähe des Restaurants einen der vielen kleinen Läden betrat, in dem aller möglicher Kitsch an Touristen verkauft wurde, löste Hakim per Handy die Explosion aus. Im darauffolgenden Chaos überwältigten und betäubten zwei seiner Männer die Frau und verschwanden mit ihr im Labyrinth der Gassen des angrenzenden Souk. Alles war genau nach Plan gelaufen.
Jetzt mussten sie nur noch die gewünschten Informationen aus ihrer Gefangenen herausbekommen. Er sah darin das kleinste Problem. Bereits in Afghanistan hatte er oft Gefangene verhört und keiner hatte ihm lange widerstehen können. Die Taliban hatten effektive und unendlich grausame Foltermethoden von den Mudschaheddin übernommen und brachten sie nun ihrerseits gnadenlos zur Anwendung. Doch Hakim Dahrani war überzeugt, nichts davon heute nutzen zu müssen. Die Frau würde reden wie ein Wasserfall, noch bevor er ihr überhaupt mit Folter drohen müsste. Sie war eine Ungläubige aus dem Westen, weiß und verweichlicht. Nein, sie würde sofort reden. Fast ein wenig schade. Hakim musste bei dem Gedanken lächeln.
Eine Viertelstunde später, die Sonne war bereits hinter den Gipfeln verschwunden, erreichte er die Hütte. Sein Misstrauen wurde sofort geweckt, als er Haroufs Pickup nicht an seinem gewohnten Platz vorfand. Auch der Wachposten war nirgends zu sehen. Hakim holte die Maschinenpistole unter der Decke hervor, die scheinbar achtlos auf dem Beifahrersitz lag und glitt aus dem Wagen. Neben dem alten Schuppen hörte er ein leises Knurren. Er schlich darauf zu und erstarrte wenig später vor Schreck. Zwei verwilderte Hunde machten sich an einer Leiche zu schaffen. Er erkannte Mohammed, einen seiner Männer, dem die Tiere ein großes Stück Fleisch aus dem Oberschenkel herausgerissen hatten. Daneben lag Harouf. Das Blut, das seine Militärjacke durchtränkte, war bereits getrocknet. Seltsamerweise beachteten die Hunde ihn nicht. Hakim dachte einen Moment daran, die Hunde zu erschießen, überlegte es sich dann aber anders und wandte sich der Hütte zu. Er hielt die Maschinenpistole schussbereit vor sich und trat die Tür ein. Nach kurzem Zögern stürmte er hinein. Als erstes bemerkte er den leeren Hocker und die gelösten Stricke. Von der Gefangenen entdeckte er keine Spur. Erst als er eine Taschenlampe aus seiner Jacke zog, hatte er genug Licht, um in der Ecke die Leiche seines Sohnes Mehdi zu entdecken. Der lag mit zertrümmertem Schädel in der hintersten Ecke der kleinen Hütte. Hakim stieß einen so wilden Schrei aus, dass die Hunde, die immer noch mit Mohammeds Leiche beschäftigt waren, in die Berge flüchteten.
Sylvia Strobel starrte in die aufkommende Dämmerung. Die ersten Kilometer hatte sie, noch bei Tageslicht, zügig zurückgelegt. Doch nun wurde es dunkel und sie hatte immer noch keine genaue Vorstellung, wo sie sich befand. Sie war einfach dem Weg von der Hütte weg nach Westen gefolgt, immer entlang des ausgetrockneten Flussbettes, das sie nun nicht mehr erkennen konnte. Mehrmals musste sie größeren Steinen ausweichen, die auf der Piste lagen. Offensichtlich kam hier nur selten jemand entlang. In ihrem Kopf arbeitete es fieberhaft. Sie versuchte, sich an ihre Ausbildung zu erinnern. Die lag allerdings fast dreißig Jahre zurück. Sie lächelte grimmig in die Dunkelheit. Stell dich schwach, hatte man ihr einmal gesagt, spiele die Hilflose, weine, jammere, bettle. Sie werden dich unterschätzen, dann bekommst du deine Chance. Und dann sei stark. Sylvia lachte laut auf. Sie hatte die perfekte Show geboten. Becker wäre stolz auf sie gewesen, wenn er sie gesehen hätte. Er war eine Zeit lang ihr Vorgesetzter gewesen, eigentlich mehr eine Vaterfigur. Von ihm hatte sie alles gelernt, was man bei Auslandseinsätzen wissen und beachten musste. Sie hatte seine bärbeißige Art gemocht, seine groben Sprüche, die raue Fassade, hinter der sich eine tiefe Loyalität zu seinen Unterstellten verbarg. Den letzten Gerüchten nach war er vor einigen Jahren aus Schweden nach Deutschland zurückgekehrt. Sie nahm sich vor, ihn zu besuchen, wenn das hier vorbei war. Mehr in Gedanken griff Sylvia in ihre Tasche und kramte mit einer Hand ihr Handy hervor. Ein kurzer Blick darauf zeigte ihr, was sie eigentlich nicht anders erwartet hatte. Sie hatte in dieser Gegend nicht einmal die Spur von einem Mobilfunknetz. Abgelenkt durch den Blick auf das Telefon übersah sie einen auf dem Weg liegenden Felsbrocken von der Größe eines Schafes. Der Wagen krachte mit der rechten Ecke dagegen, wurde herumgeschleudert und rutschte in das steinige Bett des ausgetrockneten Flusses. Ihr blieb keine Zeit zum Reagieren, der Pickup rutschte die steile Böschung hinab kippte um und blieb auf der Seite liegen.
Benommen öffnete Sylvia die Augen. Zum Glück hatte sie noch vor dem Absturz die Arme über dem Kopf verschränkt. Sie lag auf der Beifahrerseite inmitten des Inhaltes ihrer Handtasche, zweier Maschinenpistolen und mehrer Magazine. Behutsam bewegte sie die Beine und änderte vorsichtig ihre Position. Dabei durchfuhr sie ein stechender Schmerz. Wahrscheinlich war eine Rippe gebrochen. Sie tastete ihren Oberkörper ab und schrie erneut auf. Mit verzerrtem Gesicht schob sie sich weiter hoch, bis sie gebückt stehend die Fahrertür über sich aufdrücken konnte. Es kostete eine Menge Energie und Sylvia brauchte fast zehn Minuten, um sich von der Anstrengung zu erholen. Dann suchte sie in dem Wrack ihre Sachen zusammen, das Handy, die Handtasche, eine Maschinenpistole und drei Magazine. Sie warf alles aus der offenen Tür und kletterte dann über den Fa hrersitz und das Lenkrad ins Freie.
Der Aufprall auf dem Boden ließ eine neue Welle von Schmerzen durch ihren Körper fahren. Schwer atmend kniete sie neben dem umgestürzten Wagen und tastete nach ihren Sachen. Ihr wurde klar, dass sie eine Horrornacht vor sich hatte. Allein, verletzt, in einer unbekannten Gegend und sehr wahrscheinlich würde man schon nach ihr suchen. Erst einmal musste sie hier verschwinden. Sylvia stützte sich auf die Waffe und kam langsam auf die Beine. Die gebrochene Rippe schmerzte weiter bei jeder Bewegung. Trotzdem beschloss sie, weiter in dem Flussbett zu bleiben und nicht auf der Straße weiterzulaufen. Zunächst ging es nur langsam voran. Immer wieder stolperte sie über herumliegende Steine, was der Körper jedes Mal mit einer neuen Schmerzattacke quittierte. Doch mit der Zeit gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit und auch das Stechen und Ziehen im Oberkörper schien ein wenig nachzulassen.