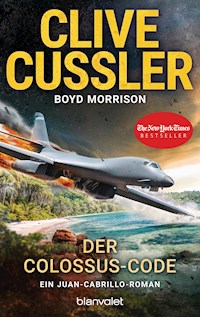
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Juan-Cabrillo-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Um die Menschheit vor sich selbst zu schützen, muss sie versklavt werden!
»Die neun Unbekannten« haben Colossus erschaffen, eine künstliche Intelligenz, die die Weltherrschaft übernehmen soll. Nur so, so glauben sie, kann man die Menschheit vor sich selbst retten. Allerdings hat einer von ihnen Zweifel. Er will seine ehemaligen Gefährten um jeden Preis aufhalten. Doch seine Konterpläne werden Millionen Menschen das Leben kosten. Beide Parteien nehmen für sich in Anspruch, die Welt zu retten – und gehen dafür über Leichen. Nur Juan Cabrillo und die Crew der Oregon können sie noch aufhalten.
Jeder Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer von Juan Cabrillo nicht entgehen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Autoren
Clive Cussler konnte bereits dreißig aufeinanderfolgende »New-York-Times«-Bestseller landen, seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, und ist auch auf der deutschen Spiegel-Bestsellerliste ein Dauergast. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Boyd Morrison arbeitete als Ingenieur für die NASA und Microsoft, bevor er sich ganz den Schreiben widmete. Außerdem ist er professioneller Schauspieler und Jeopardy!-Meister. Er lebt mit seiner Frau in Seattle.
Die Juan-Cabrillo-Romane:
1. Der goldene Buddha2. Der Todesschrein3. Todesfracht4. Schlangenjagd5. Seuchenschiff6. Kaperfahrt7. Teuflischer Sog8. Killerwelle9. Tarnfahrt10. Piranha11. Schattenfracht12. Im Auge des Taifuns13. Der Colossus-Code
Weitere Bände in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Clive Cussler
& Boyd Morrison
Der Colossus-Code
Ein Juan-Cabrillo-Roman
Deutsch von Michael Kubiak
Die englische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Shadow Tyrants (Juan Cabrillo 13)« bei G. P. Putnam’s Sons, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by Sandecker, RLLLP
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc., 551 Fifth Avenue, Suite 1613, New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Jörn Rauser
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Sascha Hahn; Zastolskiy Victor; Peter Wollinga; TigerStock’s; SilvanBachmann; Pla2na)
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-24249-7V004
www.blanvalet.de
HANDELNDE PERSONEN
DERKALINGA-KRIEG
Ashoka der Schreckliche Kaiser des Maurya-Reichs.
Kathar General und Heerführer Ashokas des Schrecklichen.
Vit Ashokas jüngerer Bruder.
DIECORPORATION
Juan Cabrillo Chairman der Corporation und Kapitän der Oregon.
Max Hanley Präsident der Corporation, Juans Stellvertreter und Chefingenieur der Oregon.
Linda Ross Vizepräsidentin des operativen Geschäfts der Corporation und Veteranin der U.S. Navy.
Eddie Seng Direktor der Abteilung für landgestützte Operationen der Corporation und ehemaliger CIA-Agent.
Eric Stone Leitender Steuermann der Oregon und Veteran der U.S. Navy.
Mark »Murph« Murphy Leitender Waffensystemoffizier der Oregon und ehemaliger Waffenkonstrukteur des U.S.-Militärs.
Franklin »Linc« Lincoln Agent der Corporation und ehemaliger U.S. Navy SEAL.
Marion MacDougal »MacD« Lawless Agent der Corporation und ehemaliger U.S. Army Ranger.
Raven Malloy Agentin der Corporation und ehemalige Ermittlerin der U.S. Army Military Police.
George »Gomez« Adams Hubschrauber- und Drohnenpilot der Oregon.
Hali Kasim Leitender Funk- und Kommunikationsoffizier der Oregon.
Dr. Julia Huxley Chefärztin an Bord der Oregon.
Kevin Nixon Chef des Magic Shop (»Zauberladens«) an Bord der Oregon.
Maurice Chefsteward der Oregon.
Chuck »Tiny« Gunderson Leitender Starrflügelflugzeugpilot der Corporation.
DIENEUNNAMENLOSENUNDDERENMITARBEITER
Romir Mallik Firmenchef von Orbital Ocean und Nachfahre eines Namenlosen; Bewahrer der Buchrolle der Kosmogonie der Gesammelten Enzyklopädie des Wissens.
Xavier Carlton Firmenchef von Unlimited News International und Nachfahre eines Namenlosen; Bewahrer der Buchrolle der Propaganda und Beeinflussung der Gesammelten Enzyklopädie des Wissens.
Jason Wakefield Firmenchef von Vedor Telecom und Nachfahre eines Namenlosen; Bewahrer der Buchrolle der Kommunikation der Gesammelten Enzyklopädie des Wissens.
Lionel Gupta Firmenchef von OreDyne Systems und Nachfahre eines Namenlosen; Bewahrer der Buchrolle der Alchemie der Gesammelten Enzyklopädie des Wissens.
Melissa Valentine Gründerin einer Internet-Search-Firma und Nachfahrin eines Namenlosen; Bewahrerin der Buchrolle der Geheimnisse des Lichts der Gesammelten Enzyklopädie des Wissens.
Daniel Saidon Firmenchef von Saidon Heavy Industries und Nachfahre eines Namenlosen; Bewahrer der Buchrolle der Geophysik und Schwerkraftlehre der Gesammelten Enzyklopädie des Wissens.
Pedro Neves Chef eines Biotechkonzerns und Nachfahre eines Namenlosen; Bewahrer der Buchrolle der Krankheiten und Gebrechen der Gesammelten Enzyklopädie des Wissens.
Boris Volanski Chef eines privaten Sicherheitsdienstes und Nachfahre eines Namenlosen; Bewahrer der Buchrolle der Physiologie der Gesammelten Enzyklopädie des Wissens.
Hans Schultz Schweizer Bankier und Nachfahre eines Namenlosen; Bewahrer der Buchrolle der Soziologie der Gesammelten Enzyklopädie des Wissens.
Asad Torkan Schwager von Romir Mallik.
Rasul Torkan Asad Torkans Zwillingsbruder.
Natalie Taylor Assistentin Xavier Carltons.
INSASSENDESVERMISSTENAIRBUS A380
Lyla Dhawan Chefin der technologischen Abteilung von Singular Solutions.
Adam Carlton Sohn Xavier Carltons.
CENTRALINTELLIGENCEAGENCY
Langston Overholt IV. Hochrangiger Beamter der CIA und Juan Cabrillos ehemaliger Vorgesetzter und Kontaktmann für alle Angelegenheiten, die die Corporation betreffen.
DIEGO-GARCIA-ZWISCHENFALL
Keith Tao Kapitän der Triton Star und Anführer des Hijackertrupps.
Major Jay Petkunas B-1B-Bomber-Pilot.
Captain Hank Larsson B-1B-Bomber-Pilot.
Lieutenant Colonel Barbara Goodman Air Force Commander und für den Betrieb des Global Positioning Systems (GPS) zuständig.
Sergeant Joseph Brandt Kommunikationsoffizier der Militärbasis Camp Thunder Cove und in seiner Freizeit Hobbyfunker.
JHOOTHAISLAND
Fyodor Yudin Oberaufseher und Gefangenenwärter in der geheimen Anlage auf Jhootha Island.
COLOSSUS
Chen Min Leitender Wissenschaftler des Colossus-Projekts.
INDIEN
General Arnav Ghosh Chef des Amtes für Waffenbeschaffung des indischen Militärs.
Kiara Jain Schauspielerin und prominenter Bollywoodstar.
Gautam Puri Kiara Jains Freund.
Prisha Naidu Bollywoodschauspielerin und Freundin von Kiara Jain.
Samar Naidu Prisha Naidus Ehemann.
Prolog
KÖNIGREICH KALINGAINDISCHER SUBKONTINENT
261 v. Chr.
Der Gestank von Rauch und verbranntem Fleisch schwängerte die Luft. Die Armee hatte ihr Hauptlager auf der anderen Seite der zerstörten Stadt aufgeschlagen. Einzig die Geräusche des ruhelosen Hufescharrens der Pferde der Imperialen Garde und das Knattern des kaiserlichen Löwenbanners waren im Wind zu hören.
»Wie viele Tote?«, fragte Maurya-Kaiser Ashoka der Schreckliche seinen leitenden General, Kathar, der auf einem ebenholzfarbenen Hengst saß, der sich von Ashokas strahlend weißem Ross abhob und ihren Rangunterschied weithin sichtbar machte.
»Es ist ein grandioser Sieg, Exzellenz«, sagte Kathar. »Während des gesamten Feldzugs haben wir nur zehntausend Männer verloren.«
Seit einer Woche, die er durch das Land ritt, über das er herrschte, hatte Ashoka nichts als Tod und Zerstörung gesehen. Nun, da sie auf den Gipfel des dicht bewaldeten Hügels gelangten und auf die Überreste von Tosali, der Hauptstadt Kalingas, hinabblickten, erkannte er schließlich das wahre Ausmaß der Folgen des von ihm angezettelten Krieges, um das letzte Königreich auf dem Subkontinent zu zerschlagen, das sich noch weigerte, seine Herrschaft anzuerkennen. Die gesamte Stadt war niedergebrannt worden, und die einst fruchtbaren und wohlbestellten Felder waren nun mit Leichen übersät, soweit das Auge reichte.
Dass seine Armee zehntausend Gefallene zu beklagen hatte, bedeutete, dass jeder siebte Soldat im Kampf getötet oder verwundet worden war. Doch trotz der schweren Verluste war sie noch immer die bedeutendste Streitmacht südlich des Himalaja, möglicherweise sogar der ganzen Welt. Keine Armee konnte sich ihm widersetzen. Aber das war nicht das, was ihn in diesem Augenblick bewegte.
Ashoka wandte sich von dem bluttriefenden Schlachtfeld ab und sah seinen General an. »Ich meine, wie viele haben wir getötet?«
Kathar lächelte mit grausamem Stolz und ohne eine Spur von Reue wegen der nahezu vollständigen barbarischen Vernichtung eines ganzen Volksstamms. »Meine Offiziere berichten mir, dass wir einhunderttausend kalingische Soldaten ausgelöscht haben. Keiner wurde verschont. Die gleiche Anzahl von Bürgern wurde während der Plünderungen nach den Schlachten getötet oder verschleppt. Damit haben wir der Welt eine Lektion erteilt. Nun wird niemand mehr das Wagnis eingehen, sich uns zu widersetzen.«
Ashoka erwiderte das Lächeln nicht. Anstatt auf seinen großen Triumph stolz zu sein, empfand er eine tiefe Scham, die schon seit Tagen wie eine eiternde Wunde in seinem Innern gärte. Da sie nicht gewillt waren, sich ihm zu unterwerfen, hatten sich die Bürger von Kalinga bis auf den letzten Mann, die letzte Frau und das letzte Kind gewehrt. Man hatte ihm berichtet, ganze Dörfer hätten es vorgezogen, freiwillig in den Tod zu gehen, um sich nicht den Misshandlungen durch seine randalierende Armee auszusetzen.
Sein Imperium erstreckte sich jetzt von Persien bis zum Gangesdelta. Den Ritt hatte er geplant, um sich einen Überblick über seine monumentalen Erfolge zu verschaffen. Doch was ursprünglich ein Triumphzug hätte sein sollen, hatte sich in einen Leidensweg der Schande verwandelt. Es war eine einzige sich ständig wiederholende Demonstration seiner Bösartigkeit und Verruchtheit, und sie veränderte seine Sicht auf die Welt grundlegend. Ashoka schwor sich, nicht zuzulassen, dass diese Grausamkeiten das einzige Vermächtnis sein würden, das er der Welt hinterließ.
Er verdiente den Titel Ashoka der Schreckliche. Er hatte grässliche Dinge getan, um seine Herrschaft als Kaiser zu sichern. Er hatte neunundneunzig seiner einhundert Halbbrüder getötet oder töten lassen, um zu verhindern, dass sie ihn stürzten. Allein seinen jüngeren Bruder Vit, der sein einziger Vertrauter und Berater war, hatte er verschont. Er hatte ein Gefängnis geschaffen – Ashokas Hölle –, in dessen Verliesen seine Kritiker und Widersacher auf jede erdenkliche Weise unbarmherzig gefoltert wurden. Kein Insasse hatte das Gefängnis jemals wieder lebend verlassen.
Aber all das verblasste im Vergleich mit dem Leid, das er während seines Ritts in der vorangegangenen Woche gesehen hatte. Diese Menschen waren keine Verräter und Verbrecher gewesen. Die Toten und Gefallenen von Kalinga waren untadelige tapfere Soldaten, die für ihre Nation und deren unschuldige Bürger kämpften, die sich nichts anderes wünschten, als ein Leben in Frieden und Eintracht führen zu können.
Vit und seine Streitmacht sollten an diesem Tag in der Hauptstadt von Kalinga mit Ashoka zusammentreffen, um ihm über die jüngste Entwicklung in den restlichen Landesteilen Bericht zu erstatten. Aber was er bisher gesehen hatte, reichte aus, um ihn umzustimmen und zu dem Entschluss zu bringen, auf weitere Eroberungen zu verzichten und stattdessen die nicht immer angenehmen Lebensbedingungen seiner Untertanen zu verbessern.
Ein Rascheln im Unterholz des Waldes ganz in ihrer Nähe veranlasste seine Leibwächter, ihre Schwerter zu ziehen. Ashoka sah sich suchend um und entdeckte eine junge Frau – verschmutzt und in zerfetzte Kleidung gehüllt –, die aus dem Wald hervortrat. Tränen rannen ihr über die Wangen, als sie das Ausmaß der Vernichtung betrachtete, die ihr Volk heimgesucht hatte. Dann wandte sie sich um und entdeckte den Kaiser und seine Männer. Sie humpelte auf die Gruppe der Krieger und ihren Anführer zu.
»Lösch dieses Ungeziefer aus«, sagte Kathar beiläufig zu einem Soldaten.
Der Wächter hob sein Schwert und machte Anstalten, sich der Frau zu nähern und sie mit einem tödlichen Hieb aufzuhalten.
»Runter mit den Waffen«, befahl Ashoka. »Steckt sie weg! Das gilt für jeden von euch!«
Die Soldaten führten seinen Befehl augenblicklich aus und schoben die Schwerter in die Scheiden an ihren Gürteln.
Kathar musterte seinen Kaiser aus schmalen Augenschlitzen. »Exzellenz?«, fragte er irritiert.
»Niemand wird dieser Frau ein Haar krümmen.«
Sie schleppte sich mit unsicheren Schritten weiter und blieb leicht schwankend, aber ohne ein Anzeichen von Furcht vor den Reitern stehen. Was Ashoka in ihrer Miene sah, war eine Mischung aus Traurigkeit und Trotz. Ihr Blick erfasste das Banner mit dem kaiserlichen Löwen und wanderte weiter zum Anführer des Reitertrupps.
»Seid Ihr Kaiser Ashoka der Schreckliche? Seid Ihr der Schlächter, der meinem Volk alles dies angetan hat?« Sie deutete mit einer matten und zitternden Armbewegung auf die Verwüstung am Fuß des Berges unter ihnen.
»Wie kannst du dich erdreisten, Seine Exzellenz, deinen Kaiser, derart respektlos anzusprechen!«, rief Kathar erbost. »Du wirst …«
Ashoka hob gebieterisch eine Hand und musterte seinen General streng. »Schweig! Ich möchte hören, was sie zu sagen hat.« Er wandte sich zu der Frau um. »Ich bin Ashoka. Bist du eine Bewohnerin dieser Stadt?«
Sie nickte. »Tosali war mein Zuhause.«
»Bist du allein?«
»Wenn einer dies wissen müsste, dann Ihr. Eure Armeen haben meinen Vater, meinen Ehemann und meine drei Brüder in der Schlacht ermordet.«
Zornig erhob Kathar die Stimme. »Niemand hat sie ermordet! Sie mussten sterben, weil sie sich weigerten, unser großzügiges Angebot anzunehmen, sich kampflos geschlagen zu geben und fortan als Untertanen des Maurya-Reichs weiterzuleben! Sie waren nicht mehr als lästiges Ungeziefer, das vom Antlitz der Erde getilgt …«
»Genug!« Ashoka überraschte seine Leibwächter, indem er sich aus dem Sattel gleiten ließ. Augenblicklich umringten sie ihn und die Frau, während er auf sie zuging.
Ashoka ergriff ihre Hand. »Ist von deiner Familie niemand mehr übrig?«
Sie schüttelte den Kopf. »Mein einziger Sohn wurde krank und starb, und meine Schwestern und meine beiden Töchter wurden geschändet, ehe man sie in die Sklaverei verschleppte. Ich konnte fliehen und streifte durch die Wälder … in der Hoffnung, Angehörige meines Volks zu finden. Aber es ist niemand mehr am Leben. Ich bin als Einzige noch übrig.« Die Frau sank auf die Knie und umklammerte die Hand des Kaisers. »Ich flehe Euch an, tötet mich!«
»Warum sollte ich das tun? Du bist keine Gefahr für mich oder meine Männer.«
»Ihr habt mir alles genommen. Ich habe nichts mehr, für das es sich lohnen würde zu leben. Wenn ich nicht vorher Hungers sterbe, werde ich das gleiche Schicksal erleiden wie die anderen Frauen.«
»Ich gebe dir als Herrscher des Maurya-Reichs mein Wort, dass dir kein weiteres Ungemach droht …«
Ehe Ashoka den Satz beenden konnte, zog Kathar sein Schwert und veranlasste den Kaiser rückwärtszuspringen, da er aus dem Augenwinkel das Blitzen der Schwertklinge gesehen hatte, und durchtrennte den Hals der Frau. Ein gurgelnder Laut, gefolgt von einem Blutschwall, drang über ihre Lippen, und sie starb mit einem Ausdruck der Ruhe und des Friedens auf ihren Gesichtszügen.
Ashoka spürte eine warme Flüssigkeit an seinem Hals. Er berührte die Stelle und ertastete einen Schnitt in seiner Haut. Als er die Hand wegzog, sah er, dass seine Fingerspitzen blutrot glänzten. Die Wunde war nicht tief, aber allein die Tatsache, dass sie in seinem Hals klaffte, erschreckte ihn. Hätte er nicht so schnell reagiert, so wäre er vom selben Schwerthieb getötet worden, der auch die Frau niedergestreckt hatte.
Das Schwert des Generals war nun auf Ashokas Brustkorb gerichtet. Die Leibwächter des Kaisers hatten bereits ihre Schwerter gezückt und waren bereit, ihn zu verteidigen. Sie erkannten jedoch, dass jede Aktion ihrerseits den Tod ihres geliebten Anführers zur Folge hätte.
»Kathar! Du hättest mich beinahe geköpft!«
Kathar lächelte und zuckte die Achseln. »Ich habe unterschätzt, wie schnell Ihr zu reagieren vermögt, Exzellenz.«
»Willst du damit … sagen, dass du uns beide töten wolltest?«
»Sie war nicht allzu hässlich anzuschauen, aber dort, wo sie herkommt, gibt es viele von ihrer Sorte. Ihr hingegen …« Kathar schüttelte missbilligend den Kopf. »Ich musste plötzlich erkennen, wie sehr Euch dieser Krieg verändert hat. Ihr strebt nicht länger danach, Euer Reich zu vergrößern. Ihr seid schwach geworden.«
Einer der Leibwächter kam einen Schritt näher, aber Kathar drückte die Spitze seiner Schwertklinge gegen Ashokas Brust, um den Mann auf Abstand zu halten.
»Sollte einer von euch versuchen, mich zu berühren, werde ich euern ach so geliebten Herrscher mit meinem Schwert durchbohren.«
»Wenn du das tust«, sagte Ashoka, »wirst du tot sein, ehe der erste Tropfen deines Blutes in der Erde versickert.«
»Schon möglich. Aber dann wäre ich als Held des Kaiserreichs gefallen.«
Aus dem Wald konnte Ashoka das Trommeln von Pferdehufen hören, die sich zügig näherten. Dies musste sein Bruder Vit mit seiner Truppe Bogenschützen sein. Wenn Ashoka es schaffte, Kathar nur noch für einen kurzen Augenblick abzulenken und hinzuhalten, würden ihn Vits Krieger niedermachen, ehe er mit seinem Schwert zustoßen könnte.
»Erkennst du nicht, dass all die Eroberungen und Unterwerfungen ein nutzloses Unterfangen sind?«, fragte Ashoka. »Welchen Sinn hat es, wenn wir mehr Land hinzugewinnen und nicht gleichzeitig das Leben unserer alten wie neuen Untertanen verbessern?«
»Es sind allein die Siege, die Eroberungen, die dafür sorgen, dass unsere Namen niemals vergessen werden und am Ende in die Ewigkeit eingehen«, erwiderte Kathar. Die Macht, die er gerade jetzt in seinen Händen hielt, erzeugte ein fanatisches Funkeln in seinen Augen. »Alexander der Große stellte die mächtigste Armee der Geschichte auf, wurde niemals in einer Schlacht besiegt und herrschte über das größte Reich, das die Welt je gesehen hatte. Die Menschen werden seinen Namen so lange im Munde führen, bis die Welt in der Unendlichkeit vergeht.«
Ashoka nickte ruhig. »Und dann starb er mit dreiunddreißig Jahren, und sein Reich wurde im Verlauf zahlreicher Bürgerkriege vollständig zerschlagen. Begreifst du nicht, dass es auch noch einen anderen Weg gibt?«
»Soll das dieser Buddhismus sein, von dem Ihr ständig faselt?«, fragte Kathar spöttisch. »Reine Zeitverschwendung. Mit unseren Armeen wären euch noch weit größere Eroberungen möglich gewesen. Ihr hättet über die ganze bekannte Welt herrschen können. Ich lasse nicht zu, dass Ihr diese Möglichkeit ungenutzt aus der Hand gebt. Erst unter meiner Herrschaft wird Maurya zu seiner wahren Größe aufsteigen. Man wird mich Kathar den Glorreichen nennen. Mein Name wird in die Geschichte eingehen, und er wird in alle Ewigkeit heller leuchten als der Name Alexanders.«
Ashoka drehte sich zu seiner treuen Leibwache um. Keiner der Männer würde Kathar davonkommen lassen, wenn er ihn zu töten versuchte.
»Was macht dich so sicher, dass du diesen Augenblick überleben wirst?«, fragte Ashoka gelassen. Ihm war keinerlei Unruhe anzumerken.
Kathar hatte für diese Frage nur ein herablassendes Lächeln übrig. Pferde brachen aus dem Wald hervor, aber sie gehörten nicht zu der Truppe, die von Ashokas Bruder Vit angeführt wurde. Auf ihnen saßen die treuesten Soldaten Kathars, und es waren zweimal so viele wie seine Leibwache. Sie umzingelten Ashokas Männer, die nun hoffnungslos in der Unterzahl waren.
»Ich tat dies nicht etwa, weil mir der Sinn nach einer Abwechslung stand«, sagte Kathar. »Ich habe einen solchen Schritt schon seit Wochen geplant und musste nur noch den geeigneten Ort finden, um Euch und Eure Männer in einen Hinterhalt zu locken. Wenn ich mit Euerm Leichnam von diesem Ritt zurückkehre, werde ich Euren Untertanen berichten, dass Ihr von rebellischen kalingischen Verrätern überfallen wurdet. Wen sonst werden sie als neuen Führer anerkennen als Euern stets loyalen General, der diesen grandiosen, aber tragischen Sieg für das Kaiserreich errungen hat?«
»Mein Bruder wird mich rächen.«
»Er wird es gewiss versuchen. Aber er ist genauso schwach wie Ihr. Wenn ich Euch bezwingen kann, werde ich nicht die geringste Mühe haben, auch ihn aus dem Weg zu räumen.«
Kathar wandte sich an einen der Reitersoldaten, in dem Ashoka einen seiner besten Kavallerieoffiziere erkannte.
»Hast du sie gefunden?«, fragte Kathar.
Der Offizier nickte und nahm eine Tasche von der Schulter. Er klappte sie auf und zog eine Buchrolle heraus, die er hoch über seinen Kopf hielt, damit alle Soldaten sie sehen konnten.
»Alle neun«, sagte der Offizier.
Als Ashoka eine der neun Buchrollen erkannte, die zusammen die Gesammelte Enzyklopädie des Wissens bildeten, die von den bedeutendsten Geistern seines Reichs zusammengetragen worden war, durchfuhr ihn ein eisiger Schreck. Die Tatsache, dass diese Buchrollen jetzt den Weg an diesen Ort gefunden hatten, konnte nur bedeuten, dass der Bibliothekar nicht mehr am Leben war und Kathar inzwischen über alle Mittel verfügte, die er brauchte, um die absolute Macht ausüben zu können.
Kathar richtete den Blick wieder auf Ashoka und lächelte triumphierend. »Vielleicht begreift Ihr jetzt, dass ich Euch vorhin mit Absicht verfehlt habe, um meinen Männern Zeit zu geben hierherzukommen. Ich ließ Euch am Leben, bis ich sicher sein konnte, dass sich die Buchrollen in meinen Händen befinden. Da dies nun der Fall ist, werdet Ihr nicht mehr benötigt. Die Dynastie der Maurya ist beendet. Hier und jetzt.«
Kathar holte mit dem Schwert zum tödlichen Streich aus, während seine Soldaten sich anschickten, die Imperiale Garde anzugreifen.
Doch Ashoka hatte nicht vor, es ihm leicht zu machen. Er duckte sich und warf sich zur Seite, als die Schwertklinge herabzuckte und seine Schulter traf. Die Lederrüstung nahm dem Treffer die Wucht, aber die Klinge schnitt tief in seinen Muskel.
Er ignorierte den Schmerz, raffte sich auf, um zu fliehen, aber Kathar befand sich im Vorteil. Er nahm die höhere Position ein und war auf seinem Pferd viel schneller als sein Gegner. Der General holte erneut mit dem Schwert aus, in den Augen den Blutrausch eines Wahnsinnigen.
In all dem Lärm aufeinanderprallender Schwerter, schnaubender Pferde und im Augenblick des Todes aufschreiender Männer vernahm Ashoka das unverwechselbare Pfeifen eines vorbeisirrenden Pfeils. Er durchbohrte Kathars Hand, und der General stieß einen heiseren Schrei aus, während er sein Schwert fallen ließ.
Das Gesicht vor rasender Wut verzerrt, zog Kathar sich die Pfeilspitze mit einem Ruck aus der Hand und schaute in die Richtung, aus der das Geschoss gekommen war. Ashoka folgte seinem Blick und gewahrte Vit und seine Bogenschützen, die in vollem Galopp auf sie zukamen, die Langbögen im Anschlag und einen Pfeil nach dem anderen abschießend. Schon von der ersten Salve wurde ein Viertel von Kathars Männern aus den Sätteln gefegt.
Als er erkannte, dass seine Niederlage nicht mehr abzuwenden war, riss Kathar sein Pferd herum und lenkte es auf den Kavallerieoffizier zu, der die Ledertasche in der Hand hielt. Er entwand sie seinem Griff und rief: »Sorge dafür, dass mich niemand verfolgt.« Dann gab er seinem Pferd die Sporen und trieb es in gestrecktem Galopp in den Wald.
Ashoka wollte ihn nicht so einfach entkommen lassen, nicht mit den Buchrollen des Wissens. Solange Kathar über sie verfügte, wäre er eine direkte Bedrohung für das von Ashoka geplante neue Zeitalter der Nation.
Ashoka schwang sich auf sein Pferd und zog mit dem unversehrten Arm sein Schwert. Trotz der Warnrufe seines Bruders, sich in Sicherheit zurückzuziehen, verfolgte er den Verräter.
Kathar war gewiss der bessere Schwertkämpfer, aber Ashoka war ein überlegener Reiter. Anstatt einen möglichst geraden und hindernisfreien Weg durch den Wald zu wählen, auf dem er das Tempo seines Pferdes hätte nutzen können, um seinem Verfolger zu entkommen, wand sich Kathar mit seinem Pferd durch dichte Baumgruppen, um mögliche Verfolger abzuschütteln.
Doch Ashoka ließ sich nicht täuschen. Er konnte Kathars Spur anhand abgebrochener Äste und zertrampelten Dickichts genau verfolgen und nahm dabei jede mögliche Abkürzung, um den Abstand zu dem Flüchtenden zu verringern.
Schließlich konnte er das gelegentliche Blinken der silbernen Schnallen von Kathars Rüstung zwischen den Bäumen wahrnehmen. Ashoka wich auf eine schmale Schneise aus, die parallel zu Kathars Fluchtweg verlief, und kam seinem abtrünnigen General mit jedem Schritt näher.
Kathar erkannte schnell, dass er verfolgt wurde, und zog seinen Dolch. In seiner Verzweiflung schleuderte er ihn auf Ashoka, verfehlte ihn jedoch, und der Dolch bohrte sich in einen Baumstamm, der sich zwischen ihnen befand.
Ashoka erkannte seine Chance, dirigierte das Pferd in eine quer verlaufende Schneise und gelangte bald schon neben Kathar. Er erhob sein Schwert und schlug mit aller Kraft zu.
Die Klinge raste singend durch die Luft und traf ins Leere.
Kathar war aus dem Sattel gesprungen, um dem mörderischen Hieb auszuweichen, und prallte gegen einen Baumstamm. Er wurde zurückgeschleudert, kam zu Fall und landete auf dem Rücken. Die Tasche sprang auf, und die Buchrollen verteilten sich auf dem Waldboden.
Ashoka wendete sein Reittier und stieg aus dem Sattel. Das Schwert abwehrbereit halb erhoben, näherte er sich dem General, der sich auf die Knie aufgerichtet hatte und sich vor Schmerzen krümmte.
Ashoka wusste, dass dies eine List war. Er machte einen großen Bogen, bis er sich hinter Kathar befand, und drückte die Schwertspitze gegen den Nacken des Generals.
»Weg mit dem Messer.«
Kathar hörte auf, sich zu krümmen, und lachte heiser. Das Messer, das er in der unversehrten Hand versteckt hatte, fiel mit einem dumpfen Laut auf den Waldboden.
»Und jetzt steh auf.«
Kathar kam auf die Füße und drehte sich um.
»Ihr werdet mich nicht töten«, sagte er mit einem hinterhältigen Grinsen.
»Warum nicht?«
»Wegen dieses buddhistischen Glaubens, zu dem Ihr, wie Ihr immer wieder erzählt, die gesamte Nation bekehren wollt. Und dieser Glaube verbietet das Töten. Ich weiß es. Denn ich habe es selbst seit vielen Wochen hören müssen. Aus Eurem Mund.«
»Du hast recht«, gab Ashoka zu. »Ich habe darüber nachgedacht, meinen Untertanen zu befehlen, die Lehren des Buddha anzunehmen und in Zukunft nach seinen Regeln zu leben. Dein Verrat bestätigt mir, dass dies der einzige richtige Weg ist. Zu töten hat nur weiteres Töten zur Folge. Hättest du deinen Willen bekommen, wären Terror und Tod die Grundfesten deiner Herrschaft.«
»Ihr wisst genau, dass dies der einzige Weg ist, um eine Dynastie aufzubauen und zu erhalten.«
Ashoka schüttelte den Kopf. »Es gibt noch einen anderen. Und diesen Weg werden wir einschlagen, solange ich lebe und herrsche.«
Galoppierende Hufe näherten sich, und Ashoka sah zu seiner Erleichterung, dass Vit, ein hervorragender Fährtenleser, ihrer Spur gefolgt war. Er brachte sein Pferd neben ihnen zum Stehen.
»Geht es dir gut, Bruder?«, fragte Vit besorgt.
Ashoka nickte. »Aber es wäre gewiss nicht der Fall, wenn du nicht zur rechten Zeit erschienen wärest. Sammle jetzt die Buchrollen auf.«
Vit stieg von seinem Pferd und begann, die Pergamentrollen zusammenzusuchen, um sie wieder sicher in der Tasche zu verstauen.
»Dieser wandelnde Abschaum muss den Bibliothekar ermordet haben, um diese Rollen in die Hände zu bekommen«, sagte Vit. »Wer wird der neue Bibliothekar sein? Nenn mir seinen Namen, und ich bringe die Buchrollen zu ihm.« Er verschloss die Tasche, hängte sie sich über die Schulter und trat zu seinem Bruder hinüber.
»Ich werde keinen neuen Bibliothekar benennen«, entschied Ashoka. »Kathar hat bewiesen, dass es zu gefährlich ist, die Buchrollen zusammen aufzubewahren. Du, Vit, mach dich auf die Suche nach neun nicht unbekannten, einfachen Männern, die sich in ihrem bisherigen Leben als rechtschaffen und ihrem Herrscher treu erwiesen haben. Jedem von ihnen wird die Aufgabe übertragen, eine der Buchrollen des Wissens aufzubewahren und zu schützen, damit sie niemals zusammen mit den jeweils anderen in die Hand einer einzigen Person fallen kann, die sie benutzen könnte, um die Herrschaft über die Welt an sich zu reißen.«
»So wird es geschehen«, versprach Vit. Dann bedachte er Kathar mit einem abfälligen Blick. »Und was soll mit ihm geschehen?«
Ashoka ging einen Schritt näher an Kathar heran und legte die Schwertklinge auf seinen Nacken. »Zu Beginn der neuen Ära werde ich als Erstes anordnen, dass der Name dieses Verräters aus sämtlichen Schriftrollen, Bildern und Zeichnungen getilgt wird. Jeder, der seinen Namen noch einmal nennt, soll aus dem Land verbannt werden.« Er betrachtete Kathar mit einem Ausdruck aufrichtigen Mitleids. »Am Ende dieses Frühlings einer neuen Zeit wird sich niemand mehr an deinen Namen erinnern. Die Geschichte wird dich für immer vergessen und über dich hinweggehen. Es wird sein, als hätte es dich nie gegeben.«
Zum ersten Mal bekam Kathars überheblicher Gesichtsausdruck einen Riss, ehe er einen halbherzigen Versuch machte, Siegesgewissheit zu signalisieren. »Aber ich bin noch immer hier. Meine Anhänger sind zahlreich, und meine Soldaten sind loyal. Sie werden sich gegen Euch erheben und mich aus Eurem Kerker befreien.«
»Nein, das werden sie nicht.« Ashoka hob das Schwert.
Kathar starrte ihn entgeistert an. Es war das einzige Mal, dass der General sich anmerken ließ, dass er Angst hatte. »Aber die Lehren des Buddha! Sie verbieten zu töten!«
»Da hast du recht«, sagte Ashoka. »Von diesem Augenblick an, so verfüge ich, darf kein lebendes Wesen, ob Mensch oder Tier, zur Strafe oder als Opfergabe getötet werden. Und von jetzt an ist es meine Aufgabe und meine Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass du, der keinen Namen hat, der Letzte seist.«
Ashokas Schwertstreich, der nach diesen Worten erfolgte, markierte den Beginn eines neuen Zeitalters.
1
ARABISCHES MEER
Gegenwart, vor achtzehn Monaten
»Verraten Sie es niemandem«, flüsterte Adam Carlton, während er über die Schulter blickte, um sich zu vergewissern, dass niemand in der Nähe war und sie belauschte. »Ich darf Sie eigentlich nicht dort hinunter mitnehmen.«
Lyla Dhawan wusste, dass sein dramatisches Getue reine Show war. Sie waren in dem mit Prunk überladenen Salon mit Mahagonitischen und Gucci-Ledersofas im Heck des Flugzeugs vollkommen allein. Obgleich der mit zwei Passagierdecks ausgestattete Airbus A380 gigantisch war und mehr als achthundert Passagieren Platz bot, wenn er als Linienflugzeug ausgelegt war, transportierte diese Maschine momentan doch weniger als einhundert Personen. Die meisten von ihnen hielten sich in den vorn gelegenen, luxuriös eingerichteten Bars auf, wo sie sich an gratis ausgeschenktem erlesenem Champagner laben und ihren Appetit mit sündhaft teurem Kaviar stillen konnten.
Lyla Dhawan konnte sich noch immer nicht erklären, weshalb sie zu den wenigen Glücklichen gehörte, die in Xavier Carltons Privatjet eingeladen worden waren, aber sie hatte bereitwillig diese – in ihrem Leben sicherlich einmalige – Gelegenheit ergriffen, eine solche Erfahrung zu machen. Die ständigen Avancen von einem der Söhne des Milliardärs abwehren zu müssen bewirkte, dass sie beinahe schon bereute, es sich im letzten Moment nicht doch noch anders überlegt zu haben. Andererseits musste sie sich eingestehen, dass sein Angebot verführerisch war.
»Sie meinen, wir können hinuntergehen und den Frachtraum besichtigen?«, fragte sie.
Adam Carlton nickte, trank den letzten Schluck des einhundert Jahre alten Scotchs in seinem Glas, lehnte sich zu ihr hinüber und schnurrte regelrecht in seinem britisch gefärbten amerikanischen Englisch: »Haben Sie jemals mit eigenen Augen einen Bugatti Chiron in natura gesehen?«
Die Alkoholfahne, die seinem Mund entstieg, löste bei Lyla beinahe ein krampfhaftes Würgen aus. Sie ertrug es aber tapfer und schüttelte den Kopf.
»Er ist das schnellste Auto der Welt«, erklärte Carlton. »Er war schon drei Millionen Dollar wert, bevor ich die massivgoldenen Zierleisten zusätzlich anbringen ließ. Ich habe ihn aus London mitgenommen, um auszuprobieren, was er auf den Pisten in der Wüste leistet. Natürlich kann ich mit Ihnen jetzt keine Probefahrt unternehmen, aber Sie dürfen sich hineinsetzen und seine Aura ausgiebig auf sich einwirken lassen. Das Leder ist weicher als alles, was Sie je gefühlt haben.«
Sie schaffte es, nicht die Augen zu verdrehen. Autos und alles, was damit zu tun hatte, waren Lyla vollkommen gleichgültig, und seine ständigen Prahlereien gingen ihr mehr und mehr auf die Nerven. Aber sie wusste nicht, wann sich ihr wieder die Gelegenheit bieten würde, einen Blick in den Frachtraum eines Airbus A380 werfen zu können. Sie war selbst ausgebildete Flugzeugpilotin und hatte in San José, Kalifornien, bisher mehr als sechshundert Flugstunden in zweimotorigen Propellermaschinen absolviert, daher war die Chance, den Frachtraum dieses Riesenjets betreten zu dürfen, so etwas wie ein Backstagepass für Disneyland. Das Einzige, was sie zögern ließ, das Angebot anzunehmen, war die wenig reizvolle Aussicht, mit diesem Typen für einige Zeit ganz allein zu sein.
»Ein verführerisches Angebot«, sagte Lyla diplomatisch. »Vielleicht haben ein paar der anderen Gäste ebenfalls Interesse, einen Blick hineinzuwerfen.«
Nicht dass sie ihn nicht abwehren könnte, falls er handgreiflich würde. Er war ziemlich klein von Wuchs und ganz eindeutig vollkommen außer Form, während sie größer war als er und dank ihres regelmäßigen Cross-Fit-Trainings im Kreuzheben zweihundert Pfund zur Hochstrecke brachte. Ihre größere Sorge war, dass sie ihn beleidigen und mögliche zukünftige Vertragsabschlüsse mit der Firma seines Vaters gefährden konnte.
Wie alle anderen Passagiere, die an diesem extravaganten Meet-and-Greet-Trip teilnahmen, war auch Lyla leitende Angestellte einer Computerfirma und gerade unterwegs nach Dubai, wo die TechNext-Verkaufsausstellung stattfand. Als Cheftechnikerin der Abteilung Singular Solutions nahm sie an der Convention teil, um potenziellen Kunden überall auf der Welt die von ihrer Firma entwickelte revolutionäre Mustererkennungssoftware vorzustellen. Bisher hatte sie Lieferverträge mit einem Gesamtvolumen von fünfzig Millionen abschließen können, aber Carltons riesiger Medienkonzern Unlimited News International war in der Lage, diesen Betrag mit einer einzigen Unterschrift noch einmal glatt zu verdoppeln.
Als Lyla Dhawan den Vorschlag machte, andere Interessenten für die Besichtigungstour zu erwärmen, zog Adam Carlton eine beleidigte Schnute und lehnte sich zurück.
»Wenn Sie sich meinen Wagen nicht ansehen wollen, dann sagen Sie es doch einfach«, schmollte er.
»Nein, es interessiert mich wirklich«, beteuerte Lyla mit einem Lächeln. Sie stand auf und strich den knappen Rock ihres schwarzen Cocktailkleides glatt. »Schnell! Wir sollten uns beeilen, ehe jemand auf die Idee kommt, dass ich zu einem privaten Rundgang eingeladen wurde.«
Carlton grinste verschwörerisch und sprang beinahe auf die Füße. »Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Der Chiron ist fast genauso schön wie Sie.«
»Gehen Sie vor.«
Er führte sie zu einem winzig kleinen Aufzug, und sie zwängten sich beide in die Kabine. Carlton genoss es sichtlich und lächelte sie selig an, während sich die Kabine langsam abwärtsbewegte.
»Sind Sie Amerikanerin?«, erkundigte er sich.
»In Kalifornien geboren und auch dort aufgewachsen. Meine Eltern stammen aus Neu-Delhi.«
»Ich bin schon des Öfteren in Indien gewesen. Mein Vater hat in der Nähe von Mumbai eine Villa.«
»Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mich bei ihm für die Einladung zu dieser Reise zu bedanken.«
»Unglücklicherweise konnte er nicht daran teilnehmen. Er hatte in Dubai eine dringende Angelegenheit zu erledigen.«
Die Fahrstuhltür glitt auf, und Carlton geleitete sie in einen kleinen Lagerraum, ehe er sie durch eine Tür in den Hauptfrachtraum einließ. Er erstarrte bei dem Anblick, der sich ihm bot.
Das riesige Abteil – Halle hätte viel besser gepasst – war vollkommen leer.
Carlton atmete zweimal pfeifend aus und ein, dann brüllte er: »Wo ist mein Wagen? Ich habe gesehen, wie er gestern ins Flugzeug eingeladen wurde, kurz bevor wir in England gestartet sind! Wenn ich herausbekomme, wer zur Hölle …«
Ohne Vorwarnung kippte das Flugzeug plötzlich in einen Sturzflug ab, sodass Lyla Dhawan und Adam Carlton zur Decke hochschnellten. Etwa drei Meter über dem Boden schwebend, ruderten sie sekundenlang mit den Armen in der Luft herum. Dann ging der Jet genauso ruckartig auf Gegenkurs, und sie sackten ab und wurden vom Frachtraumboden mit brutaler Gewalt aufgefangen.
Lyla landete auf ebenen Metallplatten, aber Carlton hatte nicht so viel Glück. Sein Kopf krachte gegen eine freie Stange, die eigentlich seinen Wagen auf seinem Stellplatz hätte sichern sollen. Lyla raffte sich auf und eilte zu ihm hinüber. Blut sammelte sich um seinen Kopf zu einer Pfütze. Er war bewusstlos, atmete jedoch.
Als sie den kleineren Lagerraum hektisch durchsuchte, fand sie einige Stofftücher, raffte sie zusammen und kehrte in den Frachtraum zurück. Sie bettete Carltons Kopf auf zwei Tücher, die sie zu Kissen zusammengefaltet hatte, ehe sie das dritte Tuch auf die Wunde presste.
Nach Hilfe zu rufen erschien sinnlos. Der Frachtraum war von den Passagierkabinen zu weit entfernt. Niemand hätte dort ihre Rufe gehört. Sie würde Carlton wohl oder übel allein lassen müssen, um medizinische Hilfe für ihn holen zu können.
Sie rannte zum Fahrstuhl zurück und musste eine halbe Ewigkeit warten, bis er von oben herabkam. Die langsame Aufwärtsfahrt war eine einzige Qual.
Als sie das Hauptdeck erreichte, sprintete sie durch den hinteren Salon, am Konferenzsaal vorbei und in die Pianobar, die gespenstisch leer war. Es verschlug ihr den Atem, als sie erkannte weshalb.
Alle Passagiere saßen auf ihren Plätzen und hatten Sauerstoffmasken auf den Gesichtern. Jeder war in sich zusammengesunken und hatte die Augen geschlossen.
Mit einer gewissen Scheu näherte sich Lyla der ihr am nächsten sitzenden Frau, denn sie befürchtete das Schlimmste. Sie legte einen Finger auf den Hals der Frau und atmete wie befreit auf, als sie einen Pulsschlag spürte. Dann machte sie das Gleiche bei zwei anderen Passagieren. Obwohl auch sie wie im Koma erschienen, waren sie doch am Leben.
Sie geriet fast in Panik, als ihr durch den Kopf ging, dass die Situation möglicherweise durch einen explosionsartigen Druckabfall hervorgerufen worden war, was auch eine Erklärung für den abrupten Sturzflug der Maschine hätte sein können.
Aber sie verwarf diese Möglichkeit sehr schnell. In diesem Fall hätte sie nicht nur den eisigen Hauch der eindringenden Außenluft gespürt, selbst wenn der Rumpf der Maschine im Bereich des oberen Passagierdecks einen Riss aufgewiesen hätte, sondern sie hätte ebenfalls nur Sekunden nach dem Erreichen des Hauptdecks das Bewusstsein verloren.
Sie überprüfte die Lage in zwei weiteren Räumen und wurde auch dort mit dem gleichen erschreckenden Szenario konfrontiert: Alle Passagiere und die Mannschaft trugen Sauerstoffmasken und waren vollständig weggetreten.
Lyla kannte sich mit großen Linienmaschinen nicht besonders gut aus. Fliegen war für sie lediglich ein Hobby – ihr einziges. Es bot ihr die Chance, für ein paar Stunden pro Woche den Stress ihres aufreibenden Jobs hinter sich zu lassen und den Luxus auszukosten, dass keine E-Mail sie erreichte. Und was noch besser war, sie brauchte in dieser Zeit ihre Mutter nicht zu ertragen, wenn sie mal wieder anrief, um ihr Vorwürfe zu machen, dass sie mit vorgerückten einunddreißig Jahren noch immer keinen Ehemann gefunden habe.
Sie wusste über alles Bescheid, was bei einer zweimotorigen Cessna Corsair versagen konnte, aber ein solcher Airbus war weitaus komplizierter. Ursache für die augenblickliche Situation könnte auch eine Fehlfunktion im Sauerstoffversorgungssystem gewesen sein. Aber sie hatte nicht die leiseste Idee, wie dieser Defekt hätte aussehen sollen. Eine bessere Frage war, weshalb sie überhaupt Sauerstoffmasken trugen, wenn die Luft im Flugzeug doch offensichtlich atembar war.
Lyla blickte aus einem Fenster und sah nichts außer der Sonne, die durch verstreute Wolken auf die ruhige See unter ihnen schien, aber sie hätten für die Dauer des Fluges über der saudiarabischen Wüste bleiben sollen. Sie befanden sich außerhalb der Reichweite eines herkömmlichen Mobiltelefons, und die Wahrscheinlichkeit, an Bord des A380 ein Satellitentelefon zu finden, war verschwindend gering. Irgendwie musste sie ins Cockpit gelangen. Wenn die Piloten aus demselben Sauerstoffsystem versorgt wurden, waren sie vielleicht ebenfalls bewusstlos. Aber in diesem Fall könnte sie über das Funkgerät einen Mayday-Notruf senden und erhielt vielleicht Hilfe von jemandem auf einer Bodenstation. Sie konnte das Flugzeug unmöglich landen, aber die Kontrollen waren heutzutage derart umfassend automatisiert, dass jemand von der Luftverkehrskontrolle in Dubai in der Lage sein müsste, ihr per Sprechfunk entsprechende Anweisungen zu geben, um die Maschine sicher auf festen Boden herunterzubringen.
Als sie die Cockpittür erreichte, stellte sie fest, dass sie geschlossen und verriegelt war. Sie trommelte mit den Fäusten gegen die Tür, aber niemand reagierte. Sie versuchte verzweifelt, sie mit Gewalt zu öffnen, aber es war eine Sicherheitstür. Seit 9/11 waren alle Linienmaschinen mit stabileren Cockpittüren und vom Pilotensitz fernbedienbaren Schließmechanismen ausgestattet worden, um das Eindringen von Terroristen zu verhindern. Es bedeutete aber auch, dass niemand hineingelangen konnte, wenn die Piloten auf irgendeine Weise ausgeschaltet worden waren, und sei es auch nur durch eine plötzliche Übelkeit.
Lyla untersuchte die Tür. Sie fand eine Zehnertastatur mit einer roten LED-Leuchte daneben und begriff, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gab, ins Cockpit zu kommen. Sie entsann sich, gelesen zu haben, dass es einen Zahlencode gab, den Flugbegleiter benutzen konnten, um sich in medizinischen Notfällen Zugang zum Cockpit zu verschaffen, wenigstens solange die Piloten die entsprechende Elektronik nicht von innen außer Betrieb gesetzt hatten, wie sie es gewöhnlich im Fall eines Terroranschlags taten.
Der Code musste irgendwo in der Nähe bereitliegen, damit alle Flugbegleiter ihn schnell fänden. Sie durchstöberte die Lebensmittelschränke in der vorderen Bordküche und fand dort, was sie suchte: ein Stück Papier mit einer sechsstelligen Zahl darauf. Das Papier klebte an der Innenseite einer Schranktür. Der arabische Text über der Zahl war unlesbar, aber die Zahl musste dem benötigten Code entsprechen.
Lyla gab die Ziffernfolge auf dem Tastenfeld ein, und das rote Licht sprang mit einem Piepton auf Grün um. Sie war überglücklich, als sie die Tür aufstieß.
Ihre Begeisterung erhielt einen bitteren Dämpfer, als sie den Piloten nach hinten gesunken in seinem Sessel liegen sah. Ein kleines Loch klaffte in seiner Schläfe.
Der Kopilot hingegen war sehr lebendig. Sie zuckte zurück und hob instinktiv die Hände, als er sich umwandte und eine kleine Pistole auf sie richtete.
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Nichts … niemand«, stammelte sie. »Nur eine Passagierin, Lyla Dhawan.«
»Wo kommen Sie her?«
»Ich war mit Adam Carlton im Frachtraum, als wir in das Luftloch gerieten.«
»Wo ist er?«
»Er hat sich den Kopf gestoßen … und ist offenbar schwer verletzt.«
»Wie sind Sie hier hereingekommen?«
»Mit dem Zugangscode. Er war auf einem Stück Papier notiert.«
Er stand aus seinem Sessel auf. »Zeigen Sie mir den Zettel.«
Er hielt sie die ganze Zeit mit der Pistole in Schach, während sie den Schrank in der Bordküche öffnete, an dessen Tür der Zettel klebte. Er riss ihn von der Tür ab, knüllte ihn zusammen und stopfte ihn in seine Hosentasche.
Mit der Pistole dirigierte er sie zurück ins Cockpit. Nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte, ließ er sich wieder in den Pilotensessel sinken und befahl ihr, sich auf den Notsitz zu setzen.
»Schnallen Sie sich an«, wies er sie an, während er auf die Uhr schaute.
Lyla gab einen erleichterten Seufzer von sich. Es klang wie ein Schluchzen. Er hatte offenbar nicht die Absicht, sie zu töten. Sie schob die Schnallenhälften des Sicherheitsgurts zusammen, bis sie einrasteten.
»Und jetzt setzen Sie die da auf.« Er deutete auf die Sauerstoffmaske, die neben ihr von der Kabinendecke herabhing.
Der Gedanke an die bewusstlosen Passagiere schoss ihr durch den Kopf. »Weshalb?«
Er hob die Pistole und richtete den Lauf auf ihren Kopf.
»Tun Sie’s einfach.«
Sie hatte keine Wahl. Der tote Pilot war der sichtbare Beweis, dass er nicht zögern würde abzudrücken.
Sie schob sich die Maske übers Gesicht, versuchte jedoch, sie so locker wie möglich aufliegen zu lassen.
Der Kopilot schaute noch einmal auf die Uhr und richtete den Blick dann wieder auf sie. »Nein. Ziehen Sie den Riemen enger.«
Widerstrebend zog sie die Gummibänder stramm. Schon nach wenigen Sekunden spürte sie, wie sie benommen wurde. Irgendein Betäubungsgas musste in den Sauerstoffkreislauf eingespeist worden sein.
»Warum tun Sie das?«, rief sie unter der Maske, aber der Kopilot ignorierte sie.
Er schaute nach rechts, dann beschattete er die Augen mit einer Hand. Nur eine Sekunde später erhellte ein greller Blitz das Innere des Cockpits.
Unmittelbar danach schob der Kopilot den Steuerknüppel nach vorn. Das riesige Flugzeug kippte in einem steilen Sturzflug ab.
Lyla versuchte, ihren Sicherheitsgurt zu lösen, damit sie den Verrückten daran hindern konnte, sie alle zu töten, aber ihre Muskeln waren wie Pudding. Sie spürte ihre Finger nicht, und ihr Geist war vollkommen benebelt. In ihr keimte plötzlich die verzweifelte Hoffnung, dass das Ganze nur ein Alptraum war, aus dem sie gleich erwachen würde. Dass all das gar nicht wirklich geschah.
Dann schaute sie durch die Fenster, während sie aus einer Wolkenbank auftauchten. Vom Himmel war nichts zu sehen. Unter ihr befand sich nur noch der Ozean.
Sie stürzten ab, und es gab nichts, was sie tun konnte, um es zu verhindern. Und dann tauchte sie in eine gnädige Dunkelheit ein.
2
NEAPEL, ITALIEN
Gegenwart
Obgleich der größte Teil der Belegschaft nach Sonnenuntergang Feierabend gemacht und sich auf den Heimweg begeben hatte, waren die weitläufigen Werftanlagen von Moretti Navi noch immer hell erleuchtet. Asad Torkan kauerte in der Nähe des äußeren Zauns in dem abgelegensten Bereich des Betriebs. Die Erkundung seines Einsatzgebietes während der vorangegangenen beiden Tage und Nächte hatte ergeben, dass nirgendwo Kameras installiert waren, die die Grundstücksgrenze überwachten. Die wenigen Wächter machten ihre Runden stets zu den gleichen Uhrzeiten, sodass es ihm keine Probleme bereitete, den günstigsten Zeitpunkt seines Eindringens mit ihren Patrouillengängen abzustimmen.
Er hängte sich seinen Seesack über die Schulter und kletterte geschickt am Zaun empor. Vor dem Rasierklingendraht, aus dem die gekräuselte Krone bestand, schützte er sich mit einer schweren Schweißdecke aus dickem Rindsleder. Als er den Zaun überwunden hatte, faltete er die Decke und versteckte sie zusammen mit dem schwarzen Overall, den er soeben abgestreift hatte, unter einem der Containerstapel, die unweit des Zauns aufgereiht waren. Unter dem Overall kam die Uniform eines Vorarbeiters der Moretti-Navi-Werft zum Vorschein. Er holte einen gelben Schutzhelm aus dem Seesack, setzte ihn auf und schwang sich wieder den Seesack über die Schulter. Dann marschierte er in Richtung der Docks los, als wolle er seinen Arbeitsplatz aufsuchen, um die Spätschicht zu beginnen.
Als Torkan an zwei Hafenarbeitern vorbeiging, die kaum einen zweiten Blick für ihn übrighatten, wusste er, dass er keine Probleme haben würde, sein Ziel unbehelligt zu erreichen. Er war vom Ministerium für Nachrichtenwesen der Republik Iran zum Saboteur ausgebildet worden und hatte bereits erfolgreiche Operationen in Saudi Arabien, Kuwait und Pakistan durchgeführt und jedes Mal den Schauplatz unerkannt wieder verlassen können.
Mit seinen braunen Augen, seinem dunklen Haar, einem ausgeprägten Kinn und der sehnigen Statur eines Langstreckenläufers wurde Torkan fälschlicherweise oft für einen Italiener oder Griechen gehalten, was ihm bei seinen Einsätzen vor allem in europäischen Staaten von großem Nutzen war. Er sprach fließend Englisch wie auch Farsi und Arabisch und verfügte außerdem über solide Grundkenntnisse in mehreren anderen Sprachen, allerdings gehörte Italienisch nicht dazu. Jeder, der ihm in der Werft begegnete, würde einen Landsmann in ihm vermuten. Falls jemand ihn ansprach, würde er behaupten, er sei von einer amerikanischen Firma engagiert worden, um den Bau eines der zahlreichen auf Kiel liegenden Schiffe zu beaufsichtigen.
Das Werftgelände war so weitläufig, dass es zwanzig Minuten dauerte, ehe er sein Ziel in einiger Entfernung ausmachen konnte. Es war ein relativ kleiner Frachter, knapp einhundertdreißig Meter lang, der die letzten Phasen des Fertigstellungsprozesses durchlief, bevor er am nächsten Tag zu seiner Jungfernfahrt in See stechen sollte. Auf den ersten Blick erschien der Neubau wie ein normales Transportschiff, nur dass es über zwei besondere Merkmale verfügte: eine ausladende weiße Satellitenschüssel auf dem Hauptdeck und vier spiralförmige Windturbinen, die wie auf dem Kopf stehende Schneebesen aussahen. Diese Turbinen erzeugten zusätzlichen elektrischen Strom, wenn sich das Schiff auf hoher See befand.
Als sich Torkan dem vermeintlichen Frachter weiter näherte, konnte er seinen Namen – Colossus 5 – entziffern, der in großen Lettern auf dem Bug prangte. Die anderen Colossus-Schiffe waren bereits auf See unterwegs und nur unter großen Schwierigkeiten zu erreichen, da ihre jeweiligen Positionen streng geheim gehalten wurden, daher musste er dieses Schiff unbedingt manövrierunfähig machen, ehe es seinen Liegeplatz am Werftkai verlassen konnte. Im Vergleich zu den riesigen Passagierkreuzern und Panamax-Containergiganten, die sich in der Nähe im Bau befanden, war das Schiff alles andere als kolossal, aber der Name bezog sich auch gar nicht auf seine Dimensionen. Er betraf eher die Nutzlast in seinem Innern.
Torkan verharrte, als er sich dem Schiff bis auf einhundert Meter genähert hatte, um seine Umgebung genauer zu inspizieren. Im Gegensatz zu den anderen Schiffen in der Werft wurde Colossus 5 von einer speziellen Barriere abgeschirmt, die weitaus wehrhafter erschien als der Zaun, der das Werftgelände vor Eindringlingen schützte. Wachtposten standen am Tor, waren mit Maschinenpistolen schwer bewaffnet und verrieten durch Haltung und Auftreten, dass sie ehemalige Angehörige des Militärs waren. Außerdem zählte Torkan mindestens ein Dutzend professionelle Sicherheitsspezialisten, die das Deck des Schiffes und den Kai rund um seinen Liegeplatz sicherten. Torkans Auftrag lautete, die Satellitenschüssel des Schiffes zu zerstören, sodass die Colossus 5 für einige Wochen im Werfthafen festlag, bis eine Ersatzschüssel installiert werden konnte.
Der Versuch, aufs Schiff zu gelangen, wäre reiner Selbstmord. Zum einen würde ein solches Unternehmen mit Sicherheit fehlschlagen, zum anderen kam es Torkan nicht in den Sinn, überhaupt ein solches Risiko einzugehen. Seit er aus dem Regierungsdienst ausgeschieden war, genoss er die Früchte seiner Zivilkarriere und hatte die Absicht, das auch so lange wie möglich zu tun. Daher kam ein direkter Frontalangriff auf das Schiff auf keinen Fall infrage.
Sein derzeitiges Ziel war nicht die Colossus 5 selbst. Es war der Ladekran, der auf dem Kai direkt neben dem Schiff in Betrieb war.
So hoch wie ein dreißigstöckiges Gebäude, wenn sein Ausleger senkrecht in die Luft ragte, stand der orangefarbene Kran auf vier Beinen und erschien wie die gigantische modernistische Skulptur einer Giraffe. Ein System aus Seilen, so dick wie ausgewachsene Pythonschlangen, und Umlenkrollen hielt den stählernen Gitterausleger in vertikaler Position, nachdem er sämtliche benötigten Bauteile auf das Schiff geladen hatte und einstweilen nicht mehr gebraucht wurde.
Torkan suchte sich eine Position, in der er von dem Kran vor eventuellen Beobachtern auf dem Schiff abgeschirmt wurde. Die Kranleitern waren für die Wachen auf der Colossus 5 nur teilweise zu überblicken, aber falls sie ihn bemerken sollten, hoffte er, dass sie ihn für einen regulären Angestellten der Werft hielten, der eine Inspektion des Krans durchführte.
Als er das Ende der Leiter erreichte, ging Torkan an der Steuerkabine des Krans vorbei und betrat den Maschinenraum dahinter, in dem sich – geschützt vor den Unbilden der Witterung – der Motor und die Antriebe für die Rollen und die Seilwinden befanden. Er öffnete den Reißverschluss des Seesacks und holte drei mit Fernzündern präparierte Sprengladungen heraus.
Er befestigte zwei Sprengladungen an den Kabeln, die den Ausleger anhoben und absenkten. Um sicherzugehen, dass der Zusammenbruch des Krans katastrophale Ausmaße haben würde, kletterte er außerdem aufs Dach der Krankabine und deponierte die dritte Sprengladung dort, wo das Gegengewicht des Auslegers mit dem Ausleger verbunden war und dem Kran zusätzliche Stabilität verlieh.
Torkan angelte außerdem eine SIG-Sauer-Pistole aus dem Seesack, schob sie sich unter sein Hemd und ließ den leeren Sack auf dem Dach der Krankabine liegen. Wenn er die Ladungen zündete, wäre er von der Schiffswerft weit entfernt.
Er stieg die Leitern hinunter. Am Fuß des Krans angekommen, wollte er in dem Labyrinth aus Containerstapeln verschwinden, als zwei Werftarbeiter auf ihn aufmerksam wurden. Sie verständigten sich durch einen kurzen Blick miteinander, dann kamen sie auf ihn zu.
»Ehi! Tu!«, rief ihm einer von ihnen zu. »Cosa stai facendo lassù?«
Torkan verstand den Italiener zwar nicht, aber er konnte sich denken, dass der Mann ihn fragte, was er auf dem Kran zu suchen hatte. Er machte ein verwirrtes Gesicht und deutete auf seine Brust.
»Meinst du mich?«
Der stämmige Werftarbeiter blieb vor ihm stehen. »Si, tu. Chi sei?«
»Tut mir leid«, erwiderte Torkan auf Englisch. »Ich spreche kein Italienisch.«
Der Werftarbeiter runzelte die Stirn. »Sag mal, wer bist du? Warum … du auf Kran? Das mein Job.«
»Oh! Ich wusste nicht, dass heute noch an der Colossus 5 gearbeitet wird.«
»Nein. Keine Arbeit. Ich bin heute auf einem anderen Kran.«
»Dann ist mir alles klar.«
Eine wortreiche Diskussion auf Italienisch entspann sich zwischen den Werftarbeitern, danach wandte sich der erste Mann wieder an Torkan. »Nichts ist klar. Wer bist du?«
Torkan lächelte sie an. »Ich arbeite für die Schiffseigner. Sie wollten, dass ich mich vergewissere, dass von dem Kran keine Gefahr ausgeht.«
»Gefahr?«
»Du weißt schon, ein Defekt im Motorgehäuse. Es gab während des Ladevorgangs einige Probleme mit den Seilrollen.«
»Gefahr? Defekt? Es gab keinen Defekt.« Er deutete auf den Kran und sagte etwas zu seinem Kollegen. Der junge Mann schwang sich sofort auf die Leiter und stieg auf ihr nach oben.
»Eine zweite Inspektion ist nicht nötig«, sagte Torkan. »Ich kann euch versichern, dass alles vollkommen in Ordnung und sicher ist.«
»Sehr seltsam.« Der Werftarbeiter holte sein Telefon aus der Tasche. »Ich rufe den Manager an.«
»Das ist wirklich nicht nötig«, sagte Torkan. Der junge Werftarbeiter hatte bereits die Hälfte des Weges bis zur Krankabine zurückgelegt.
»Doch, ist nötig. Ich dich hier noch nie gesehen.« Er begann zu wählen, aber Torkan hob eine Hand, um ihn zu stoppen.
»Warte! Du bringst mich in Schwierigkeiten. Lass mich meinen Boss anrufen, dann kannst du mit ihm reden. Er bestätigt dir, dass ich hierhergeschickt wurde, um alles zu kontrollieren.«
Der Werftarbeiter musterte ihn misstrauisch, nickte dann und steckte das Telefon in die Tasche.
Während Torkan sein eigenes Telefon hervorholte und die Nummer wählte, behielt er den Werftarbeiter im Auge, der zur Krankabine emporstieg. Als er die Tür des Motorgehäuses öffnete, drückte Torkan auf die CALL-Taste.
Die Zünder der Bomben empfingen gleichzeitig dasselbe Mobilfunksignal. Eine mächtige Explosion sprengte das Gehäuse und zerfetzte den Werftarbeiter. Die Seile, die den Kranausleger in der Waagerechten hielten, wurden augenblicklich gekappt, und der Ausleger gab nach und stürzte auf die Colossus 5 herab.
Der Ausleger war so lang, dass es schien, als erfolge sein Absturz im Zeitlupentempo. Die Wachtposten auf dem Schiff konnten das Geschehen nur entsetzt und tatenlos verfolgen und um ihr Leben rennen, als die Gitterkonstruktion des Auslegers zwischen zwei Masten, auf denen die Windgeneratoren rotierten, aufs Schiffsdeck krachte.
Der zentnerschwere Kranhaken erwischte die Satellitenschüssel voll. Sie zerschellte in einer Wolke aus Glasfasersplittern, die auf das Schiffsdeck herabregneten. Der Explosionsdruck riss den Ausleger aus seiner Verankerung, und die Reste des Gitterwerks mitsamt dem Ankerstück auf der gegenüberliegenden Seite des Kranturms prallten auf den Kai, zertrümmerten das Einlasstor und zerquetschten einen unglücklichen Wachtposten, der sich nicht rechtzeitig hatte retten können. Genau in der Schiffsmitte kam der Ausleger schließlich zur Ruhe.
Eine Alarmglocke ertönte, und Männer brüllten wild durcheinander, während sie vorwärtsstürzten, um mögliche Überlebende aus den Trümmern zu befreien.
Der Werftarbeiter, der mit Torkan gesprochen hatte, starrte fassungslos auf das Chaos, in dem sein Freund ums Leben gekommen war.
»Ich habe euch gewarnt, dass es gefährlich ist«, sagte Torkan und jagte zwei Kugeln in den Brustkorb des Mannes. Dieser brach auf dem Asphalt des Werftkais zusammen und blickte mit einem Ausdruck namenloser Überraschung zu Torkan hoch, ehe er starb. Auf dem Kai und dem Schiffsdeck herrschte ein derartiges Durcheinander, dass die beiden Pistolenschüsse niemandem auffielen und Torkan erlaubten, auch noch den letzten lebenden Zeugen seiner Mission zu beseitigen.
Inmitten des herrschenden Chaos und der allgemeinen Verwirrung tauchte er in den Schatten außerhalb der von den Scheinwerfern erhellten Zone unter und konnte seiner geplanten Fluchtroute über den Zaun des Werftgeländes folgen. Nachdem er das Werftgelände hinter sich gelassen hatte und zu seinem Wagen zurückgekehrt war, führte er ein zweites Telefongespräch.
»Ja?«, meldete sich sofort die Stimme eines Mannes.
»Es ist erledigt«, sagte Torkan. »Das Schiff ist vorläufig stillgelegt.«
»Hervorragende Arbeit. Das wird das Colossus-Projekt um zwei Wochen zurückwerfen. Wann schaffst du es, in Mumbai zu sein?«
Torkan sah auf die Uhr. Nur noch eine Minute bis zum Abschluss der Mission.
»Ich habe meine Bordkarte bereits in der Tasche«, sagte er. »Ich komme um zehn Uhr morgens an.«
»Gut. Ich lasse dich mit einem Hubschrauber zur Startplattform bringen, wenn du dort eintriffst. Aber verspäte dich nicht.«
»Wenn es dazu kommt, dann liegt es wohl kaum an mir, oder?«
»Wenn du meinst, dass sich der Flug bedeutend verzögert, würde ich an deiner Stelle nicht einsteigen«, warnte ihn der Mann am anderen Ende. »Wenn alles nach Plan abläuft, solltest du zusehen, dass du morgen Nachmittag nicht in einem Flugzeug sitzt.«
3
IM WESTLICHEN INDISCHEN OZEAN
Kapitän Keith Tao stieß einen Fluch aus, als er am Horizont die Rauchwolke entdeckte, die einen rötlich leuchtenden Saum hatte, wo sie von der Morgensonne von hinten angestrahlt wurde. Sie befand sich genau auf dem Kurs seines Schiffes, und sie hatten keine Zeit zu vergeuden. Er war gezwungen, sich an einen engen Zeitplan zu halten. Aber anzuhalten, um einem in Not geratenen Schiff Hilfe zu leisten, war laut Seevölkerrecht ein Gesetz, dem in jedem Fall Folge zu leisten war. Wenn sein Frachter dabei beobachtet würde, wie er ein sinkendes Schiff passierte und seinem Schicksal überließ, würden sich daraus Fragen ergeben, die er lieber nicht beantworten wollte.
»Sollen wir das Schiff umfahren?«, fragte der Erste Offizier.
Um zu vermeiden, von Bord des angeschlagenen Schiffes gesichtet zu werden, müssten sie einen Umweg von mindestens zwei Stunden machen, und sie befanden sich aufgrund ihrer verspäteten Abfahrt aus Mozambique längst schon weit außerhalb ihres Zeitplans.
Tao ergriff ein Fernglas und richtete es auf die Rauchwolke am Horizont. Die Umrisse eines Frachtschiffs kamen in Sicht. »Gibt es irgendwelche Hinweise, dass aus dieser Region ein SOS gesendet wurde?«
»Nein, Sir. Ich habe die MarineTraffic-Website aufgerufen, aber dort wurde in einem Umkreis von einhundert Meilen kein anderes Schiff angezeigt.«
Tao hatte eigentlich nichts anderes erwartet. Sie befanden sich mit Absicht weitab von allen bekannten Schifffahrtslinien, und hier, sozusagen mitten im Nirgendwo, einem anderen Schiff zu begegnen bedeutete gewiss nichts Gutes.
Tao ließ das Fernglas sinken. Um halbwegs im Zeitplan zu bleiben, musste er das Risiko eingehen, eventuell gesehen zu werden. »Bleiben Sie auf dem augenblicklichen Kurs.«
»Aye, Captain.«
Nach einer weiteren Stunde war das havarierte Schiff deutlicher zu erkennen, und angesichts seines allgemeinen Zustands war Tao überrascht, dass es sich überhaupt so lange hatte über Wasser halten können.
Der altersschwache Trampdampfer, mehr als einhundertfünfundsechzig Meter lang, sah aus wie eine Zerrspiegelversion seines eigenen Frachters, der Triton Star. Das Schiff hatte gut fünfzehn Grad Schlagseite nach Backbord und lag tief im Wasser. Rauchfäden kräuselten sich von mehreren Punkten des Rumpfs, der stellenweise von einem offenbar erst vor Kurzem gelöschten Feuer rußgeschwärzt war, senkrecht in die Luft.
Es lag sicher schon Jahrzehnte zurück, dass das Schiff mit seinen klaren Konturen und dem champagnerkelchförmigen Hecküberhang, ähnlich dem Heck der Titanic, durch die Ozeane pflügte. Nun hingegen – selbst wenn man über den Brandschaden hinwegsah – schien es ganz so, als befände es sich auf seiner letzten Fahrt. Die drei Kräne auf dem Vorderschiff und die beiden Kräne hinter den früher einmal weißen Deckaufbauten, die nun mit großen Rostflecken gezeichnet waren, befanden sich in einem derart ramponierten Zustand, als würden sie jeden Augenblick zusammenbrechen. Die Funkantennen waren abgeknickt, als wären sie bei einer Explosion von herumfliegenden Trümmern getroffen worden. Umgekippte Ölfässer und anderes Gerümpel lagen auf einem Deck herum, das von einer an mehreren Stellen geborstenen Kettenreling umgürtet wurde. Das Schiff sah wie eine schwimmende Katastrophe aus, und eine solche musste es während der letzten Stunden auch heimgesucht haben.
Tao hatte Mühe, die verblichenen Lettern seines Namenszugs unterhalb der iranischen Fahne, die an dem Flaggenstock am Schiffsheck flatterte, zu entziffern: Goreno.
Nun ergab der Zustand des Schiffes auch einen gewissen Sinn. Dass es unter iranischer Flagge fuhr, deutete auf einen Schwarzmarktschmuggler hin, der die verrufeneren Häfen der Welt ansteuerte, um seine Fracht aufzunehmen. Es erklärte außerdem, weshalb seine Kennung nicht in der Datenbank der MarineTraffic-Website gespeichert war.
»Captain«, sagte der Erste Offizier, »wir fangen einen Hilferuf auf. Er ist sehr schwach.«
»Von der Goreno?« Tao blickte zur Kommandobrücke des Havaristen hinüber, konnte jedoch durch die von Sprüngen und Schmutz nahezu vollständig blinden Fenster keine Einzelheiten erkennen.
»Nein, Sir. Sie sagen, sie hätten das Schiff aufgeben müssen.«
Ein Rettungsboot kam in Sicht, als sie den Bug der Goreno passierten. Es sah aus, als befände es sich in einem noch schlechteren Zustand als das Schiff, falls eine solche Steigerung überhaupt möglich war. Der gesamte Rumpf war schwarz von Ruß und Brandspuren, und ein Teil des Schutzdachs war eingedrückt. Außerdem lag es antriebslos im Wasser.
»Legen Sie den Ruf auf den Lautsprecher«, befahl Tao.
Eine verzweifelte Stimme flehte sie in spanisch gefärbtem Englisch aus dem Lautsprecher der Kommandobrücke an. »An das Schiff vor uns, hier spricht Eduardo Barbanegra, Kapitän der Goreno. Wir brauchen Ihre Hilfe. Unsere Maschinen sind ausgefallen. Seit drei Tagen sind meine Mannschaft und ich ohne Lebensmittel und Wasser.« Das Signal war schwach. Häufige atmosphärische Störungen machten die Worte stellenweise nur schwer verständlich. Da sie das Notsignal erst jetzt hörten, wurde es wahrscheinlich von einem schwachen Walkie-Talkie mit nur geringer Reichweite gesendet.
»Sollen wir antworten?«, fragte der XO.
Tao dachte einige Sekunden lang nach, dann schüttelte er den Kopf. »So wie es aussieht, sind sie längst nicht mehr am Leben, wenn ein anderes Schiff hier vorbeikommt. Bleiben Sie auf Kurs.«
»Bitte helfen Sie uns!«, rief Barbanegra, als die Triton Star ohne eine Reaktion an ihnen vorbeirauschte. »Wenn Sie uns retten, teilen wir mit Ihnen das Gold, das sich noch an Bord der Goreno befindet.«
Bei Barbanegras verzweifeltem Versuch, sich zu retten, verdrehte der XO die Augen. Mit einem spöttischen Grinsen richtete Tao sein Fernglas auf das Rettungsboot. Ein Mann mit strähnigem blondem Haar tauchte im Spalt des geborstenen Schutzdachs auf. Seine Kleider waren schmuddelig und teilweise zerfetzt, und sein Gesicht war mit Ruß verschmiert. Er sah erschöpft aus. Seine Lippen waren vom langen Wassermangel rissig, und sein rechtes Auge verschwand unter einer offenbar notdürftig zusammengeflickten schwarzen Klappe.
Aber Taos Blick wurde magisch von etwas angezogen, das er in der Hand hielt und über dem Kopf in die Luft reckte. Es war ein rechteckiger Goldbarren mit mindestens dreißig Zentimetern Kantenlänge.
»Was hat er gesagt? Wie viel Gold haben sie angeblich an Bord?«, fragte Tao, während er den Barren betrachtete, der in der Sonne funkelte.
»Fünfhundert Pfund«, erwiderte der Erste Offizier. »Aber, Sir …«
Tao kannte den aktuellen Goldpreis, da er seit Beginn ihrer Reise darüber nachdachte, wie er den Bonus, den er für diese Fahrt einstrich, am gewinnbringendsten anlegen sollte. Beim derzeitigen Kurs war eine Vierteltonne Gold deutlich über zehn Millionen Dollar wert.
Er legte das Fernglas beiseite und gab das Kommando: »Alle Maschinen stopp!«
Der Erste Offizier starrte ihn ungläubig an. »Captain?«
»Sie haben mich gehört.« Der XO führte den Befehl aus, und das Schiff wurde langsamer.
»Lassen Sie unser Rettungsboot ausbringen. Wir holen sie an Bord.«
»Captain«, sagte der Erste Offizier, nachdem er die Anweisungen weitergegeben hatte, »Sie können doch nicht ernsthaft glauben, dass sie auf der Goreno so viel Gold zurückgelassen haben.«
»Das werden wir schon bald genau wissen. Wenn dieser Barren, den er da in der Hand hält, eine Attrappe ist, beseitigen wir sie alle und werfen sie über Bord. Die Haie werden dann den Rest besorgen.«
»Und wenn er echt ist?«
»Dann lassen wir uns erklären, wo das Gold versteckt ist, und holen es von Bord, ehe das Schiff sinkt. Dann erst töten wir sie.«





























