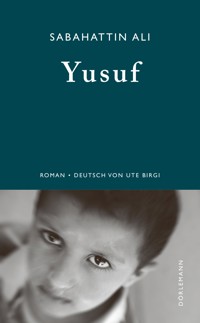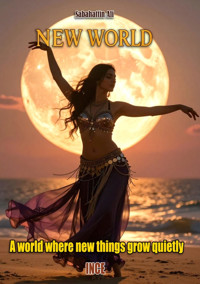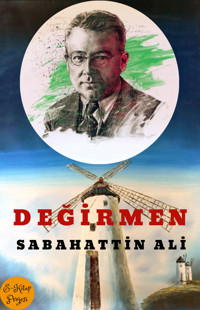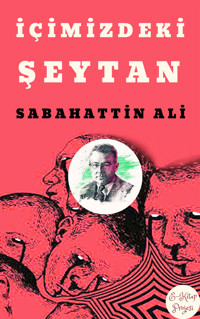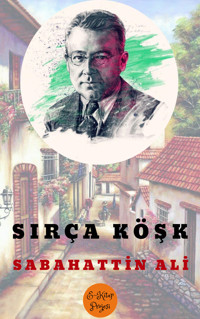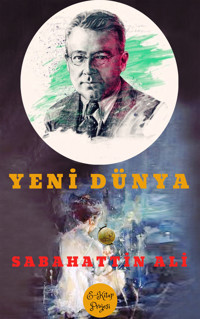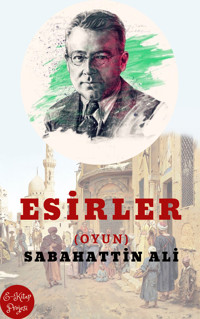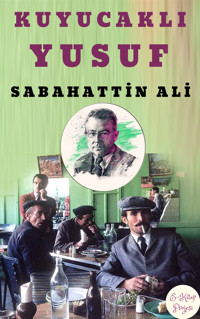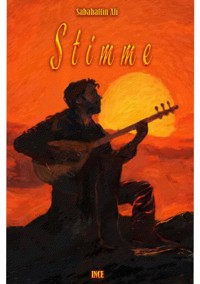16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Ömer bei einer Fahrt auf dem Bosporus Macide erblickt, durchfährt es ihn wie ein Blitz: Er kennt diese Frau bereits! Macide bricht alle Brücken hinter sich ab, verlässt ihre Familie und zieht zu ihm in seine Kammer. Eine Weile leben die beiden selig in ihrer eigenen Welt. Doch dann melden sich die Dämonen in Ömer: Zweifel, Unsicherheit, Verlockungen. Wirre Kaffeehaus-Intellektuelle ziehen ihn in gefährliche Abenteuer. Sabahattin Ali war ein Bahnbrecher der türkischen Literatur. Sein Roman ist eine Liebeserklärung an Istanbul und seine Bewohner. Die junge Republik hat das Oberste zuunterst gekehrt. In den Kneipen, Tanzsälen, Konzert-Cafés, Kinos, dunklen Werkstätten, Märkten und Straßen begegnen sich Luxus und Armut, Absteiger und Neureiche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Ein großer Istanbul-Roman über die ruhelose Generation der frühen Republikjahre: Ömer und Macide, beide heimatlos in der vibrierenden Großstadt, suchen ihr Glück und verlieren es wieder. Sabahattin Alis Roman ist eine Liebeserklärung an Istanbul und seine Bewohner, seine Kneipen, Tanzsäle, Cafés, Kinos, Märkte und Straßen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Sabahattin Ali (1907–1948) war Herausgeber von satirischen und literarischen Zeitschriften, wurde jedoch aufgrund seiner sozialkritischen Positionen immer wieder verhaftet. Beim Versuch, nach Bulgarien zu fliehen, wurde er ermordet. Die genauen Umstände seines Todes wurden nie aufgeklärt.
Zur Webseite von Sabahattin Ali.
Ute Birgi-Knellessen (*1938) verbrachte viele Jahre in Istanbul. Nach der Übersiedelung in die Schweiz 1980 studierte sie Islamwissenschaft und Vorderasiatische Archäologie in Bern und arbeitet seither als freie literarische Übersetzerin.
Zur Webseite von Ute Birgi-Knellessen.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Sabahattin Ali
Der Dämon in uns
Mit einem Nachwort von Erika Glassen
Roman
Aus dem Türkischen von Ute Birgi-Knellessen
Türkische Bibliothek
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1940 in Istanbul unter dem Titel İçimizdeki Şeytan beim Verlag Remzi Kitabevi.
Türkische Bibliothek im Unionsverlag, Zürich, herausgegeben von Erika Glassen und Jens Peter Laut
Eine Initiative der Robert Bosch Stiftung
Die Übersetzung folgt der beim Verlag Yapı Kredi 2003 erschienenen Ausgabe.
Originaltitel: Icimizdeki Șeytan (1940)
© by Sabahattin Ali 1940
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Refik Epikmann, At the Bar (1930)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30684-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 01:59h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER DÄMON IN UNS
1 – Auf dem Deck des Fährschiffes, das um elf …2 – Als Nihat in seiner Rede innehielt und aufstand …3 – Macide war nicht entgangen, dass man sie im …4 – Schon in der Grundschule hatte Macide sich mit …5 – Zu Hause angekommen, ging Macide sofort in ihr …6 – Die beiden jungen Männer hatten die Brücke hinter …7 – Es war fast Mitternacht, als Ömer bei Tante …8 – Ömer erwachte, noch bevor es hell wurde …9 – Wie im Flug eilte Ömer die steile Straße …10 – Als er vor dem Konservatorium stand, stellte er …11 – Am nächsten Morgen stand Macide früh auf und …12 – Draußen blieb sie einen Augenblick lang unschlüssig auf …13 – Als Ömer die Augen öffnete, sah er …14 – Ömer hatte nicht mehr als zwei Gläser getrunken …15 – Die folgenden Tage vergingen ohne wesentliche Vorkommnisse …16 – Zu Beginn des neuen Monats zeigte sich die …17 – Die nächsten Tage vergingen wieder ohne nennenswerte Ereignisse …18 – Wenn Macide später gelegentlich darüber nachdachte, wie schnell …19 – Macide blieb eine Zeit lang wie angewurzelt stehen …20 – Als Ömer zurückkehrte, hatte Macide zwar die Augen …21 – Die nächsten zehn Tage verliefen wieder ruhig …22 – Eines Tages wurden Ömer und Macide von Professor …23 – Alle Stühle in dem kleinen Saal waren besetzt …24 – Macide war einerseits froh, dass sie jetzt endlich …25 – Die beiden Automobile fuhren hintereinander her und hatten …26 – Als Macide am nächsten Morgen die Augen öffnete …27 – Die Tür flog auf, und Bedri stürzte herein …28 – Zweimal in der Woche besuchte Macide, stets begleitet …NachwortWorterklärungenZur Aussprache des TürkischenMehr über dieses Buch
Über Sabahattin Ali
Über Ute Birgi-Knellessen
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Türkei
Zum Thema Großstadt
1
Auf dem Deck des Fährschiffes, das um elf Uhr von Kadıköy abgelegt hatte und jetzt auf die Galata-Brücke Kurs nahm, saßen zwei junge Männer nebeneinander und unterhielten sich. Der an der Reling Sitzende war hellhäutig, dunkelblond und neigte zur Fülle. Er war kurzsichtig, seine braunen Augen, die hinter den dicken Gläsern der Hornbrille stets halb geschlossen wirkten, glitten träge über die Dinge hin. Abwechselnd ließ er seinen Blick mal auf seinem Freund und dann wieder auf dem Meer ruhen, das sich linker Hand im Sonnenlicht vor ihnen ausbreitete. Seinen Hut hatte er nach hinten geschoben, seine glatten und etwas zu langen Haare quollen darunter hervor und hingen ihm halb über das rechte Auge. Er sprach schnell und schürzte dabei leicht die Lippen, wodurch sein Mund hübsch und anziehend wirkte.
Sein Freund war schmächtig und bleichwangig; seine Arme waren ständig in nervöser Bewegung, und scharf musterte er seine Umgebung.
Beide waren von mittlerer Größe, und man gab ihnen höchstens fünfundzwanzig Jahre.
Ohne seine Augen vom Meer abzuwenden, erzählte der Fülligere: »Ich musste mich zusammenreißen, um nicht loszulachen. Während der Geschichtsprofessor eine Frage nach der anderen stellte, stand das Mädchen da und drehte Hilfe suchend den Kopf in alle Richtungen. Ich wusste ja, dass sie ihre Notizen nicht ein einziges Mal angesehen hatte, deshalb dachte ich, die fällt glatt durch. Doch was sehe ich da plötzlich? Ümit, die hinter ihr saß, warf dem Dozenten vielsagende Blicke zu. Und ich sage dir, sie hat es geschafft; der Kerl stellte noch ein, zwei simple Fragen, die er gleich selbst beantwortete, und ließ das Mädchen bestehen.«
»Der ist wohl schwer in Ümit verschossen?«
»Der ist doch in jede verknallt, wenn sie nur einigermaßen nach was aussieht …« Dann schlug er seinem Freund mit der Hand aufs Knie und sprach im gleichen Tonfall weiter, als ob er die eben erzählte Geschichte wieder aufnähme: »Das Leben langweilt mich, alles ödet mich an: die Uni, die Professoren, die Vorlesungen, die Freunde und diese Mädchen erst. Sie öden mich an, bis zum Erbrechen …«
Er schwieg kurz, rückte seine Brille zurecht und fuhr dann fort: »Zu nichts habe ich Lust, und eigentlich will ich auch gar nichts mehr. Ich merke, wie ich von Tag zu Tag gleichgültiger werde, und mir ist sogar wohl dabei. Vielleicht falle ich ja demnächst in eine solche Apathie, dass ich den Überdruss gar nicht mehr spüre. Etwas tun müsste man, etwas Bedeutendes … Oder doch eher alles sein lassen. Was können wir denn schon tun? Gar nichts! Das Älteste, was es auf dieser Millionen Jahre alten Welt gibt, ist gerade mal zwanzigtausend Jahre alt, und selbst diese Zahl ist aus der Luft gegriffen. Neulich unterhielt ich mich mit unserem Philosophieprofessor. Ich wollte es genau wissen und fragte ihn nach unserer ›Daseinsberechtigung‹. Was zum Teufel haben wir auf der Welt verloren? Er konnte mir auch keine Antwort geben. Er brabbelte etwas von Schaffensdrang und der Tatsache, dass das Leben in sich selbst seine Berechtigung finde, lauter so ungereimtes Zeug. Wie können wir denn schöpferisch tätig sein? Das heißt doch etwas aus dem Nichts hervorbringen. Dabei ist selbst der klügste Kopf nichts als ein Depot, in dem das Wissen und die Erfahrungen unserer Vorfahren gespeichert werden. Für uns bedeutet ›erschaffen‹ doch nur, dieses Gedankengut in eine neue Form zu bringen und es dann meistbietend auf den Markt zu werfen. Ich kann einfach nicht begreifen, wie Menschen sich mit dieser lächerlichen Aufgabe zufrieden geben können. Wenn es doch Himmelskörper gibt, deren Licht erst in fünftausend Jahren bei uns eintrifft, scheint es mir kein Zeichen von Intelligenz, wenn ein Prahlhans mit Werken unsterblich werden möchte, die bereits fünfzig Jahre später in den Bibliotheken vergammeln und die nach fünfhundert Jahren ganz vergessen sind; oder indem er sein Leben damit verbringt, Marmor zu meißeln und Ton zu kneten, damit sein Werk dreitausend Jahre später als Torso in einem Museum ausgestellt wird.«
Seine Stimme klang auf einmal bedeutungsvoll, als er ganz langsam sagte: »Ich glaube, das Einzige, was wir wirklich hinbekommen, ist, unserem Leben ein Ende zu setzen. Ja, dazu sind wir in der Lage, und nur in diesem Fall haben wir unsere eigene Willenskraft eingesetzt. Du wirst jetzt fragen, warum ich das dann nicht tue! Ich sagte es ja bereits, ich bin einfach zu apathisch. Alles ist mir zu viel, lediglich das Trägheitsgesetz zwingt mich zum Weiterleben.«
Er riss seinen Mund weit auf und gähnte, während er seine Füße von sich streckte. Ein älterer Herr, der ihm gegenübersaß und in eine armenische Zeitung vertieft war, zog angesichts dieser raumgreifenden Geste hastig seine Füße ein und warf dem sich räkelnden jungen Mann einen verdrießlichen Blick zu.
Sein Freund hatte jedoch diesen Ausführungen, die er nicht zum ersten Mal zu hören bekam, keine weitere Beachtung geschenkt. Stattdessen hatte er seine Augen umherschweifen lassen und mit hochgezogenen Augenbrauen – als sammle er dahinter wichtige Gedanken – dauernd vor sich hin gemurmelt.
Doch als die Ansprache zu Ende war, lächelte er plötzlich vielsagend: »Ömer! Hast du Geld? Wollen wir heute Abend Rakı trinken gehen?«
Ömer antwortete mit einem schlauen Grinsen, das zu seinen vorigen tiefsinnigen Worten so gar nicht passen wollte: »Nein, hab ich nicht. Aber wir werden es schon jemandem abluchsen. Am einfachsten wäre es, bei meiner Dienststelle vorbeizugehen, aber danach ist mir nun wirklich nicht zu Mute.«
Der hagere junge Mann schüttelte den Kopf: »Die werden dich demnächst rausschmeißen, wenn du nie auftauchst und dich so hängen lässt. Die staatlichen Büros suchen doch sowieso dauernd einen Vorwand, die Studenten unter ihren Angestellten loszuwerden. Und ihr auf der Post, wo die Zeit doch besonders kostbar sein sollte, seid da sicher als Erste dran.« Lachend fügte er kurz darauf hinzu: »Und dass ein Brief von Beyazıt nach Eminönü achtundvierzig Stunden braucht, ist bei so einem diensteifrigen Personal ja auch kein Wunder!«
Ömer antwortete seelenruhig: »Mit dem Briefversand hab ich nichts zu tun. Ich bin in der Buchhaltung, da schreibe ich von morgens bis abends Hefte voll. Manchmal helfe ich abends auch dem Kassierer. Geldzählen kann richtig Spaß machen, mein guter Nihat.«
Der andere lebte plötzlich auf: »Interessant, Geld ist immer interessant. Oft nehme ich einen Liraschein aus der Tasche, lege ihn vor mich hin und schaue ihn stundenlang an. Eigentlich ist da gar nichts Besonderes dran. Ein paar schwungvolle Schriftzüge, gerade wie bei den Kalligraphieübungen in der Schule. Na ja, vielleicht ein bisschen feiner und verschnörkelter … Dann eine Abbildung, etwas Kleingedrucktes und ein, zwei Unterschriften … Und wenn man sich noch etwas tiefer darüber beugt, steigt einem ein penetranter, ranziger Geruch in die Nase. Wie kann so ein dreckiges Stück Papier nur so mächtig sein!«
Er schloss für einen Moment die Augen. »Nimm beispielsweise mal einen Tag, an dem du vor innerer Leere fast erstickst. Das Leben scheint dir düster und sinnlos. An solchen Tagen erliegt der Mensch dann meistens, so wie du eben gerade, dem Hang zu philosophieren. Irgendwann ist dir sogar das zu viel, und du möchtest den Mund am liebsten gar nicht mehr aufmachen. Du bist sicher, dass niemand und nichts dich mehr retten kann. Auch das Wetter ist öde und erdrückt einen, ist entweder zu heiß oder zu kalt oder zu verregnet. Die Passanten schauen dich dumm an, und wie die Ziegen mit heraushängender Zunge hinter einem Büschel Gras herrennen, laufen auch sie irgendwelchen unsinnigen Dingen nach. Du versuchst dich zusammenzunehmen und diesen scheußlichen Zustand deiner Psyche zu analysieren. Die unentwirrbaren Knoten der menschlichen Seele liegen wie ein großes Rätsel vor dir. Und wie an einen Rettungsring klammerst du dich an das Wort ›Depression‹, das du aus irgendwelchen Büchern kennst. Denn aus unerfindlichen Gründen brauchen wir alle für unsere Sorgen, seien sie materieller oder seelischer Art, eine genaue Bezeichnung. Wenn wir etwas nicht benennen können, werden wir verrückt. Na ja, sonst würden die Ärzte ja am Hungertuch nagen … Du bist also kurz vor dem Ertrinken in diesem unendlichen Meer aus Langeweile und greifst nach dem Strohhalm Depression, da triffst du unerwartet einen alten Freund, den du schon lange nicht mehr gesehen hast. Seine gepflegte Erscheinung macht dir augenblicklich deine eigenen leeren Taschen bewusst; und wenn du Glück hast, kannst du den überrumpelten Freund um ein paar Lira erleichtern … Und dann reißt wie ein Wunder ein starker Windstoß eine dicke Nebelschicht von deiner Seele, dein Inneres hellt sich auf, und du verspürst eine Leichtigkeit und Weite. Die Schwermut ist wie weggeblasen, du schaust zufrieden in die Welt und suchst einen Bekannten, mit dem du plaudern kannst. So ist das, mein Lieber; was Bücherstapel und stundenlanges Brüten nicht zu Stande bringen, das schaffen zwei speckige Geldscheine. Vielleicht willst du es dir nicht eingestehen, dass unsere Seele sich so billig kaufen lässt, und du suchst nach edleren Gründen für diesen Sinneswandel, nach einer Wolke vielleicht, die hoch oben am Himmel schwebt, oder einer frischen Brise in deinem Nacken oder einem klugen Gedanken, der dir gerade in den Sinn gekommen ist. Doch eines sag ich dir: Es funktioniert genau umgekehrt! Nur wegen zweier Lirascheine, die den Weg in unsere Tasche gefunden haben, nehmen wir den Wetterumschwung überhaupt wahr, spüren die Kühle des Windes und können auf einmal einen klaren Gedanken fassen. Erheb dich, mein Lieber, wir legen gleich an. Eines Tages sind wir entweder verrückt oder regieren die Welt. Jetzt sollten wir jedoch zusehen, dass wir Geld für eine Flasche Rakı auftreiben, damit wir ein paar Gläser auf unsere glänzende Zukunft heben können.«
2
Als Nihat in seiner Rede innehielt und aufstand, bemerkte er, dass Ömer sich nicht von seinem Platz bewegte. Er tippte ihn an die Schulter. Ömer zuckte leicht zusammen, blieb aber weiter regungslos sitzen. Als Nihat sich über ihn beugte, um nachzuschauen, ob sein Freund vielleicht eingeschlafen war, sah er, dass der eine der gegenüberliegenden Bänke fixierte, als ob dort irgendetwas Außergewöhnliches seinen Blick gefangen hielte. Seine Umgebung nahm er überhaupt nicht wahr. Nihat schaute hinüber, konnte aber nichts Besonderes erkennen. Daraufhin legte er seine Hand wieder auf Ömers Schulter. »Nun komm schon, steh auf!«
Ömer antwortete nicht, verzog aber sein Gesicht zu einer Grimasse, die seinem Freund unmissverständlich zu verstehen gab, dass er in Ruhe gelassen werden wollte.
»Was gibts denn da, verdammt noch mal! Wohin schaust du denn?«
Endlich konnte Ömer sich entschließen, den Kopf zu wenden: »Halt den Mund und setz dich!« Nihat gehorchte.
Die übrigen Passagiere hatten sich nach und nach erhoben und schoben sich ohne Eile auf die Ausgangstüren zu. Ömer reckte und streckte seinen Kopf, um zwischen den Leuten hindurchzuschauen. Sein Freund stieß ihn an und fragte vorwurfsvoll: »Mensch, jetzt reichts aber! Nun sag schon, was siehst du denn da?«
Ömer drehte ganz langsam den Kopf und sagte, als verkünde er eine Hiobsbotschaft: »Da saß ein junges Mädchen, hast du es gesehen?«
»Nein, aber was ist mit ihr?«
»Ich hatte sie vorher auch nicht bemerkt.«
»Spinnst du?«
»Ich sage nur, dass auch ich ein solches Wesen noch nie gesehen habe!«
Nihat verzog gelangweilt das Gesicht und stand wieder auf: »Trotz all deiner großen Worte und deiner sprichwörtlichen Intelligenz kann man dich einfach nicht ernst nehmen!«
Der spöttische Zug spielte noch ein paar Sekunden um seine Mundwinkel, bevor sein Mund wieder einen gleichgültigen Ausdruck annahm. Auch Ömer hatte sich jetzt erhoben. Mit gerecktem Hals stand er auf den Zehenspitzen und sah sich suchend um. Dann drehte er sich zu Nihat. »Sie sitzt noch immer da.« Er sah seinen Freund scharf an. »Nun hör doch auf mit deinen ewigen Spötteleien! Ich erlebe in diesem Moment die wichtigsten Augenblicke meines Daseins. Mein Gefühl hat mich bisher noch nie getrogen. Etwas Unglaubliches ist geschehen oder wird geschehen. Dieses junge Mädchen, das ich dort drüben sehe, kommt mir so bekannt vor. Ich scheine sie schon aus der Zeit vor meiner Geburt, ja vor der Erschaffung der Welt, des Universums zu kennen. Wie soll ich dir das erklären? ›Als ich sie erblickte, war ich sogleich unsterblich verliebt‹, soll ich dir mit solchen Phrasen kommen? Eigenartig nur, dass ich keine anderen Worte finde. Wie kann ich überhaupt hier noch länger herumsitzen und mit dir reden? Von jetzt an bedeutet jede Minute meines Lebens, die ich fern von ihr verbringe, für mich den Tod. Und wundere dich nicht, dass der Tod, den ich eben noch über alles lobte, mir jetzt gar nicht mehr so erstrebenswert erscheint. Wieso? Ach, was weiß ich, ich muss dir das doch nicht erst erklären! Ich bitte dich nur, mir ohne deine übliche Besserwisserei einen Rat zu geben. Was soll ich tun? Ich bin in einer schrecklichen Lage! Wenn ich sie jetzt aus den Augen verliere, dann vertue ich mein ganzes Leben mit der Suche nach ihr, und lange werde ich das nicht aushalten. Ach Mensch, ich rede Unsinn. Und doch sage ich die Wahrheit. Dass ich sie nie wiedersehe, ist das Schlimmste und dabei doch das Wahrscheinlichste, was mir passieren kann. Stell dir vor, schon jetzt kann ich mich nicht mehr genau an ihr Gesicht erinnern, doch seit unvorstellbaren Urzeiten schlummert irgendwo tief in meinem Gedächtnis ihr wie aus Stein gemeißeltes genaues Abbild, das weiß ich. Und wenn ich mich jetzt hier mit geschlossenen Augen in diese Menschenmenge stürze, dann wird eine unsichtbare Macht mich zielsicher zu ihr hinführen.«
Nach diesen heftig hervorgestoßenen Worten machte Ömer tatsächlich mit geschlossenen Augen einen Schritt vorwärts. Mit seiner linken Hand griff er nach Nihats Handgelenk. Nihat schaute seinen Freund verwundert an, als er spürte, wie dessen Arm zitterte. Er war von ihm ja einiges gewohnt, doch diese heftige Gemütsbewegung befremdete ihn sehr. Da ihm nichts Gescheiteres einfiel, sagte er nur: »Was bist du nur für ein sonderbarer Kauz!«
Mit seiner verschwitzten Hand umklammerte Ömer noch fester das Handgelenk seines Freundes. »Schau doch, sie ist immer noch da … Siehst du sie denn nicht?«
Als Nihat dem Blick seines Freundes folgte, sah er auf einer der Bänke, die sich zunehmend leerten, ein dunkelhaariges junges Mädchen. Es unterhielt sich mit einer älteren, korpulenten Frau, die neben ihm saß. In einer Hand hielt es ein dickes Bündel mit Musiknoten, mit der anderen stützte es sich ab. Anmutig bewegte es seinen feinen Hals und den Lockenkopf. Am auffälligsten war jedoch das Kinn der jungen Frau, das eine starke Willenskraft ausdrückte. Zwischen ihren Worten, die Nihat von seinem Platz aus nicht hören konnte, hielt sie immer wieder inne, so als habe sie gerade ein unanfechtbares Urteil verkündet, um gleich darauf mit derselben Bestimmtheit in ihren Ausführungen fortzufahren. Ihre Augen blickten ein wenig düster, dabei aber völlig unbefangen, wie auch ihre Haltung und ihr Benehmen ungewöhnlich natürlich waren. Die Hand, mit der sie sich abstützte, nahm sie hin und wieder zur Betonung einer Geste hoch und legte sie dann langsam an ihren Platz auf die gepolsterte Bank zurück. Ihre feingliedrigen Finger waren bleich, die kurz geschnittenen Fingernägel schmal. Nachdem Nihat das Mädchen eingehend betrachtet hatte, drehte er sich zu Ömer um und sah ihn fragend an: »Na und, was gibts da Besonderes?«
Ömer stieß mit rauer Stimme, wie im Delirium, hervor: »Sei bloß still! Ich sehs dir doch an, was für Weisheiten du wieder ausbrütest. Mein Entschluss ist aber längst gefasst. Ich werde jetzt sofort hingehen, das Mädchen beim Arm nehmen und …«
Er hielt inne, dachte nach und murmelte: »Na ja, irgendetwas werd ich ihr schon sagen. Vielleicht spricht sie mich zuerst an. Ganz sicher wird sie mich erkennen, sobald sie mich sieht, ja, so wird es sein! Und sie wird sich nicht verstellen, wenn sie mich erkennt. Komm mit, wenn du willst, du kannst dich ein wenig hinter mir halten und uns zuhören. Dieses Gespräch mit einem Mädchen, mit dem ich mich in einer unbekannten Welt bereits getroffen habe, wird sicher außergewöhnlich.«
Und er griff nach Nihats Arm, der seine Hand aber zurückzog: »Hast du vor, hier auf dem Schiff einen Skandal heraufzubeschwören?«
»Wieso?«
»Das Mädchen wird doch sofort die Polizei rufen, die ihrerseits nicht zögern wird, einen Unruhestifter wie dich mit auf die Wache zu schleppen. Glaubst du wirklich, dass die Welt sich nach deinen unsinnigen Vorstellungen richtet? Kannst du nicht endlich mal dich und deine Umgebung mit offenen Augen betrachten? Willst du dein ganzes Leben wie Don Quichote hinter Hirngespinsten und fantastischen Zielen herrennen und dir vormachen, dass du in dieser gewöhnlichen Welt etwas ganz Außergewöhnliches anstellen musst? Eben sagtest du noch, der Mensch könne überhaupt nichts ausrichten, und jetzt willst du etwas so Leichtsinniges tun, wie es sich auf dieser Welt nur ganz wenige herausnehmen dürfen! Ich weiß nicht, was dich noch von einem gewöhnlichen Irren unterscheidet!«
Ömer reckte den Hals, als habe man ihn herausgefordert: »Du wirst schon sehen, was passiert. Dein Spatzenhirn kann ganz einfach nicht die dunklen, tiefen Verbindungen zwischen den Menschen begreifen. Warte hier.«
Mit diesen Worten ging er auf das junge Mädchen zu. Nihat drehte sich unwillkürlich zum Meer, stöhnte und wartete auf die ersten Anzeichen des losbrechenden Skandals.
Ömer schritt mit fest auf das Mädchen gerichtetem Blick langsam vorwärts, schüttelte aber plötzlich den Kopf, als ob er aus dem Schlaf erwachen würde. Denn als er fast schon vor dem Mädchen stand, drang eine Frauenstimme an sein Ohr: »Oh! Ömer, wie geht es dir? Du lässt dich ja gar nicht mehr bei uns blicken!«
Es war Emine Hanım, eine entfernte Verwandte, die neben dem jungen Mädchen saß. »Hör mal, ständig schaust du zu uns herüber, und ich warte die ganze Zeit darauf, dass du zu uns kommst. Aber du redest und redest und hörst gar nicht mehr auf. Nun kommt schon, sonst müssen wir noch auf dem Schiff bleiben.«
Die beiden Frauen standen auf und wandten sich dem Ausgang zu. Ömer hatte es die Sprache verschlagen, und er versuchte sich wieder zu fangen: »Wirklich, ich weiß nicht, Tantchen. Vor lauter Studieren und Arbeiten blieb mir einfach keine Zeit. Nun, Sie kennen mich ja, Sie werden mir das doch nicht übel nehmen, nicht wahr?«
Tante Emine lachte: »Herrje, wie soll man dir das übel nehmen? Was kann man schon erwarten von jemandem, der nicht einmal seinen Eltern einmal im Jahr einen Brief schreibt! Hauptsache aber, wir haben uns getroffen. Nun erzähl mal, wie es dir so geht!«
Ohne seine Augen von dem jungen Mädchen abzuwenden, antwortete Ömer: »Wie immer. Bei mir läuft alles wie gewohnt!«
Inzwischen waren sie bei der Brücke angelangt und gingen in Richtung Alt-Istanbul.
Ömers Augen glitten über den wulstigen Nacken seiner korpulenten Tante und trafen sich mit dem Blick des jungen Mädchens, das stumm neben ihnen herging. Sie sah ihn lange und tief aus ihren unverwandt auf ihn gerichteten Augen an, als wollte sie sich an etwas erinnern, dann schaute sie wieder geradeaus. Ömer betrachtete eine Zeit lang den Schatten, den ihre langen Wimpern unter ihre Augen warfen, bevor er sich mit einer fragenden Kopfbewegung an seine Tante wandte. »Wer ist sie?«
»Ah!«, rief Emine Hanım mit der typischen Höflichkeit der Provinzler aus Anatolien, die schon länger in Istanbul leben. »Hab ich euch einander nicht vorgestellt? Aber ihr kennt euch doch! Kannst du dich nicht an Macide erinnern? Die Enkelin des Großonkels deiner Mutter! Nun ja, als du von Balıkesir weggingst, war sie noch so klein. Seit sechs Monaten lebt sie bei uns. Sie studiert Klavier und besucht auch eine Schule.«
Sie schaute Macide an, die inzwischen Ömers Hand geschüttelt hatte. »Ich gehe aufs Konservatorium.« Dann sah sie wieder geradeaus. Ömer zerbrach sich den Kopf, um sich unter seinen mehr als hundert in Istanbul, Balıkesir und anderen Orten verstreuten Verwandten an den Großonkel seiner Mutter und dessen Enkelkind zu erinnern.
Als er Tante Emine wieder ansah, fiel ihm ihr trauriges und verwirrtes Gesicht auf. Doch als er nach dem Grund dafür fragte, winkte sie ab: »Nicht jetzt, hier vor ihr!«
Nun war Ömer erst recht neugierig geworden und neigte sich zu ihr. Sie aber flüsterte nur schnell: »Ach, frag nicht, was uns passiert ist! Komm mal vorbei, dann erzähl ichʼs dir!«
Und sie rollte vielsagend ihre Augen, die Anteilnahme an dem Mädchen andeuteten, das rechts neben ihr ging. Rasch warf sie Macide einen Blick zu und murmelte leise: »Die Ärmste ahnt es noch nicht. Und ich weiß nicht, wie ichʼs ihr sagen soll. Vor einer Woche ist ihr Vater gestorben, was soll ich bloß machen?«
Ömer verspürte plötzlich, wie es in seinem Innern frohlockte, doch fast im gleichen Augenblick schämte er sich schrecklich für dieses Gefühl. Den Tod als ein Ereignis zu begrüßen, das ihm bei seinem Vorhaben helfen könnte, kam ihm nicht sonderlich anständig vor. Aber wir haben ja alle so eine berechnende Seite in uns, die sich überhaupt nicht um unsere ethischen Vorstellungen kümmert und, wenn es darauf ankommt, stets den Sieg davonträgt.
Während Ömer diesen Gedanken nachhing, deutete Tante Emine sein Schweigen als Betroffenheit über den Tod eines Verwandten, und sie forderte ihn noch einmal auf, sie in den nächsten Tagen zu besuchen.
Inzwischen waren sie bei der Straßenbahnhaltestelle von Eminönü angelangt, wo sich ihre Wege trennten. Der junge Mann sah den beiden Frauen eine Weile nach und wartete darauf, dass Macide sich noch einmal nach ihm umschaute, obwohl er sich dies nicht eingestand. Er sah nur noch, wie ihre zierliche und hübsche Gestalt auf den flachen Schuhen davonschwebte und sich auf die gerade einfahrende Straßenbahn schwang und wie sie der Tante ihre Hand hinstreckte.
Während Ömer die beiden noch immer mit den Augen verfolgte, zuckte er plötzlich zusammen, als ihm jemand einen Schlag gab. Nihat erwartete streitlustig eine Erklärung. Als Ömer den Mund nicht auftat, rief er: »Du bist mir vielleicht einer! Ich hatte mich abgewendet, um nicht mit ansehen zu müssen, wie du dich auf dem Schiff vor allen blamierst. Und plötzlich wart ihr weg! Erst auf der Brücke habe ich euch wieder gesehen, wie du in eine Unterhaltung mit ihnen vertieft warst, als wärt ihr alte Freunde. Das Mädchen ist wohl von der leichteren Sorte, oder? Die Dicke sieht jedenfalls aus wie eine echte Kupplerin!«
Ömer lachte: »So was kannst nur du dir ausdenken! Alles muss nach einem bestimmten Muster in deinen sturen Quadratschädel passen! Ein Mann redet eine Unbekannte an, und wenn die nicht gleich die Polizei ruft, dann ist sie eine Hure! So einfach machst du es dir! Es gibt keine Ausnahmen im Leben, alles läuft immer gleich ab, das glaubst du doch, oder?« Er gab seinem Freund einen Klaps auf den Hinterkopf: »Bevor ich mich mit so einem platten Gehirn zufrieden gäbe, hätte ich lieber gar keins! Mann, nicht die Spur von Fantasie!«
Nihat störte sich nicht an diesen Beschimpfungen. »Na, dann erzähl doch mal, wie es war! Hat die Kleine, als sie dich erblickte, wirklich gerufen: ›Ach, da bist du ja, mein mir von den dunklen Welten des Universums bestimmter Partner‹ und ist dir um den Hals gefallen? Selbst wenn ich das glauben wollte, kann ich mir kaum vorstellen, dass die Dicke mit dieser metaphysischen Annäherung einverstanden gewesen wäre!«
Ömer tat, als gäbe er ein Geheimnis preis: »Nein, mein Lieber, wir sind miteinander verwandt, wie sich herausstellte. Während ich nämlich nur Augen für das Mädchen hatte, war mir ganz entgangen, dass neben ihm unsere berüchtigte Tante Emine saß. Und auch das Mädchen, Macide, ist eine nahe Verwandte. Sie geht zum Konservatorium. Vor einer Woche hat sie ihren Vater verloren, weiß es aber noch gar nicht.«
Nihat schüttelte den Kopf: »Gott schenke den Hinterbliebenen ein langes Leben!« Dann fragte er, seinen spöttischen Blick auf Ömer gerichtet: »Da haben wir sie also, die in keine Schablonen passende, außerordentliche Bekanntschaft! Hör zu, mein Freund, je mehr du dich um Originalität bemühst, desto öfter wird dir das Schicksal ganz gewöhnliche Dinge zuspielen. Ich fürchte, das wird dein ganzes Leben lang so bleiben, und noch bevor du die Welt in Staunen versetzen kannst, wirst du den Weg aller Gerechten gehen. Du verblüffst mich: Das junge, dir bereits während der Entstehung des Universums zugedachte Blut stellt sich als Verwandte heraus. Wer weiß, vielleicht habt ihr als Kinder miteinander gespielt, und du hast dich an ein paar Züge aus dem Kleinmädchengesicht erinnert. Und deine übereifrige Fantasie hat sofort dafür gesorgt, dass alles von einer geheimnisvollen Aura umgeben wird. Du bist wirklich ein komischer Kauz!«
»Ja, unsere Begegnung war in der Tat ziemlich gewöhnlich, aber meine Gefühle für sie sind es nicht. Eine Macht, die unseren Willen außer Kraft setzt, bindet uns aneinander, ich spüre es. Du wirst schon sehen, wie oft ich in nächster Zeit das Haus meiner Tante Emine aufsuchen werde!«
Nihat prustete los: »Und diese originelle Liebesgeschichte wird in einer Liebeshochzeit unter Verwandten enden, oder? Du wirst als einziger junger Mann, der eine Angehörige seiner Tante umgarnt, diesen Weltruhm erlangen. Was soll ich dazu noch sagen, viel Glück und Erfolg!«
Ömer antwortete nicht mehr. Während die beiden die Richtung nach Beyazıt einschlugen, wechselten sie das Thema und beratschlagten, wo sie am Abend ihr Trinkgelage abhalten wollten.
3
Macide war nicht entgangen, dass man sie im Haus ihrer Verwandten seit ein paar Tagen anders behandelte als gewöhnlich. Und sie spürte auch, dass dies nichts Gutes zu bedeuten hatte. Doch wen auch immer sie fragte, sie erhielt stets eine ausweichende Antwort. »Ach was, meine Liebe, was sollen wir dir schon verheimlichen, du bildest dir nur etwas ein!«
Tante Emine war zwar einige Male an sie herangetreten, als ob sie ihr etwas sagen wollte, doch nach ein paar belanglosen Worten hatte sie sich wieder davongeschlichen.
Mit Semiha, der Tochter des Hauses, hatte sie sowieso kein gutes Verhältnis. Genauer gesagt, Semiha fand Macide ziemlich eingebildet, weshalb sie sich ganz besonders indifferent und abweisend verhielt, um selbst nicht unterlegen zu wirken.
Und ihr Onkel Galip, der spätabends hundemüde von seinem Laden in der Nähe des Ölpiers am Goldenen Horn nach Hause kam, hatte es sich längst abgewöhnt, sich mit seiner Familie zu unterhalten. Nach dem Abendessen nahm er stets seine Zeitung zur Hand und begann geduldig die fetten Buchstaben zu entziffern. Seit die Zeitungen in lateinischer Schrift geschrieben wurden, hatte er sich in kurzer Zeit vom Analphabeten zum Lesekundigen gemausert.
Tante Emines Sohn Nuri hingegen, der die Unteroffiziersschule besuchte, kam höchstens einmal in der Woche nach Hause, sodass Macide auch von ihm nichts erfahren konnte.
Obwohl Macide seit sechs Monaten in dem Haus ihrer Verwandten lebte, hatte sie keinen näheren Zugang zu ihnen gefunden und konnte daher auch nicht weiter in sie dringen. Im Grunde lebte sie hier wie in einer Pension. Morgens nahm sie ihre Noten, verließ das Haus und kehrte abends, noch bevor es dunkel wurde, zurück, um gleich auf ihr Zimmer zu gehen. Vielleicht war gerade diese Zurückgezogenheit der Grund für Semihas Verstimmung. Und Tante Emine war ganz mit ihrer eigenen Welt beschäftigt, mit ihren Freundinnen und Vergnügungen, und kümmerte sich kaum um dieses stille Mädchen, das in ihrem Haus lebte. Zwar erzählte sie ihren Gästen, die meistens tagsüber vorbeikamen, gern von Macide und ihren Kenntnissen der europäischen klassischen Musik als leuchtendem Beispiel für den »Avantgardismus« ihrer Familie. Doch wenn an gewissen Abenden in ihrem Hause männliche und weibliche Gäste gemeinsam zur Saz ausgelassen nach hergebrachter türkischer Art feierten und sangen, war Macide nie dazu zu bewegen, sich zu ihnen zu setzen und auch nur ein kleines Beispiel ihrer Kunst zum Besten zu geben. Daher war die Tante auch gar nicht so recht überzeugt von ihren musikalischen Fähigkeiten.
Da der Laden am Ölpier in den letzten Jahren nicht viel einbrachte, musste die Familie sich sehr einschränken; und wenn sie es sich auch nicht anmerken ließ und die aus der Provinz kommenden Bekannten wochen-, ja monatelang unter ihrem Dach bewirtete, so wartete sie doch oft ungeduldig auf das Geld, das Macides Vater jeden Monat schickte.
Eigentlich war Macide ihrem Onkel Galip auch nur wegen dieser vierzig Lira willkommen gewesen. Doch die Ausgaben dieses an ein bequemes bürgerliches Leben gewöhnten Haushalts waren so beträchtlich, dass die vierzig bis fünfzig Lira nicht besonders ins Gewicht fielen. Die ständig wachsenden Schulden, die den armen Mann seit einiger Zeit drückten, lähmten seinen Tatendrang. Es fehlte ihm die Energie seiner Jugendjahre, und die Händler, mit denen er zu tun hatte, waren auch nicht mehr dieselben. Der Markt, besonders der Öl- und Seifenhandel, lag ganz in den Händen von schlauen, gut ausgebildeten, jungen und vor allen Dingen reichen Leuten. Wer sich wie Onkel Galip auf die Methoden der Händlergilde stützte, mit denen man sich vor dreißig Jahren vielleicht auf dem Markt hatte behaupten können, wurde heutzutage einfach zur Seite gedrängt. Während dieses nun etwa zehn Jahre andauernden Kampfes hatten sich nicht nur die paar Felder und etliche hundert Olivenbäume des Galip Efendi in nichts aufgelöst; auch von den drei Häusern, die in einer kleinen Straße von Şehzadebaşı nebeneinander standen, war nur das eine übrig geblieben, in dem sie jetzt wohnten. Von früher her gewohnt, sich schnell aus bedenklichen Situationen zu befreien, hatte Onkel Galip die Hoffnung jedoch noch nicht ganz aufgegeben.
Von Tante Emines Goldmünzen und Perlen hatte in der letzten Zeit ein guter Teil seinen Weg in die Versteigerungsbuden des Basars gefunden. Doch das Wehgeschrei der Tante, die bei jeder Erwähnung der schlechten Wirtschaftslage in Tränen ausbrach und bei jedem einzelnen versetzten Schmuckstück aus dem unerschöpflichen Vorrat der einst reichen Bürgerfrau Kopfschmerzen bekam und dann mit einem Stirnband herumlief, hielt nie länger als vierundzwanzig Stunden an; bald schon sammelte sie ihre Freunde – Istanbuler Lästermäuler und Speichellecker – wieder zu ausgelassenen und lauten Festen um sich.
Die alten Bekannten, die früher von der wohlhabenden Familie mit durchgefüttert worden waren und auch jetzt nicht von ihr lassen konnten, obwohl sie spürten, dass die Lage sich verschlechtert hatte, waren unschlüssig: Zum einen fanden sie es nicht richtig, ihre Wohltäter in kritischen Zeiten im Stich zu lassen, andererseits wollten sie nicht das Feld räumen, solange sie hoffen konnten, dass doch noch etwas für sie abfiel.
Und die von Zeit zu Zeit aus Balıkesir anreisenden alten Nachbarn, die hier in Istanbul wie immer weiterschnorrten und sich auf Kosten der Familie zu unterhalten pflegten, lasteten nicht minder schwer auf dem bereits stark gebeutelten Haushaltsbudget.
Macide sah zwar, was vor sich ging, fand das aber nicht außergewöhnlich. Denn soweit sie zurückdenken konnte, hatte sie im großen Hause ihres Vaters in Balıkesir Ähnliches gehört und gesehen. Wurde dort nicht ebenso von Engpässen geredet, von schlechter Ernte, von hypothekenbelasteten Feldern und verkauften Weinbergen? Auch ihre Mutter pflegte sich ein Tuch um die Stirn zu binden, wenn sie eine Goldmünze verkaufen musste; auch ihr Vater hatte sich, wenn er abends nach Hause kam, wortlos hingesetzt und im Kopf endlose Rechnungen durchgespielt, während er die Gebetskette durch seine Finger gleiten ließ.
Doch was sie seit ihrer Kindheit stets mehr verwundert hatte als diese nicht enden wollenden Klagen, war die Unerschöpflichkeit all der Felder, Weinberge, Häuser, Olivenhaine und Goldmünzen. Diese in Generationen angehäuften und mit den veränderten Zeitläuften allmählich dahinschmelzenden Güter schienen unendlich. Schulden wurden gemacht oder gewährt, Felder verkauft oder bestellt, und ganz wie früher wurden prächtige Verlobungen und Hochzeitsfeste ausgerichtet, für die man die letzten Perlenketten und Ohrgehänge hervorholte.
Macide war in diesen chaotischen Verhältnissen herangewachsen und hatte eher durch Zufall Unterricht erhalten. So wie es auch ein Zufall war, dass sie nicht schon während der Kindheit an einer der häufig im Haus auftretenden Krankheiten gestorben war, und es auch dem Zufall zu verdanken war, dass sie nach Beendigung der Grundschule nicht zu Hause bleiben musste, sondern auf die Mittelschule geschickt wurde. Wäre ihr Vater nicht so vollständig von seinen erfolglosen Unternehmungen absorbiert gewesen, hätte er sich von den Lehrern, die ihm rieten, seine Tochter weiter zur Schule zu schicken, nicht so leicht überreden lassen und sie – genau wie ihre ältere Schwester – mit fünfzehn Jahren verheiratet.
Doch als Macide in der zweiten Klasse der Mittelschule war, überließ sie ihr Leben nicht mehr länger dem Zufall. Da man sie etwas spät, erst mit neun Jahren, in die Schule gegeben hatte, war sie bereits recht weit entwickelt, als sie mit sechzehn in der siebten Klasse saß. Ihre Mitschüler hielten Abstand zu ihr, da sie als großbürgerlich und rechthaberisch galt. Sie hingegen kümmerte sich nur um ihre Aufgaben und lebte im Übrigen ein ganz eigenständiges Leben. Niemand kontrollierte sie oder schrieb ihr etwas vor. Hin und wieder glaubte ihre Mutter zwar, mit ihr darüber reden zu müssen, ob ein bestimmtes Kleid hochgeschlossen oder ausgeschnitten, eng oder weit sein sollte, doch meistens zuckte Macide nur mit den Schultern und zog sich zurück. Da auch die anderen Familien ihre Töchter weiter zur Schule schickten, hatte die Mutter nichts gegen Macides Schulbesuch einzuwenden. Doch sie musste sich eingestehen, dass sie es lieber gesehen hätte, wenn ihre Tochter gleich geheiratet hätte.
Das stattliche Bürgerhaus mit seinem düsteren, von ein paar Zimmern und Vorratsräumen umgebenen Entree im unteren und dem geräumigen Flur und den riesigen Zimmern im oberen Stockwerk nahm sich in Macides Augen zunehmend befremdlich aus. Vor fünfzig Jahren war es zu Stein erstarrt, seitdem hatte sich nichts mehr verändert, und mit der Wirklichkeit, mit ihrem Leben in der Schule, mit dem, was sie las und lernte, hatte das Haus nicht das Geringste zu tun.
Auch ihre wahllos im Zimmer verstreuten Kleider und die eng übereinander gestapelten Bücher in den Fächern des schweren Eichenschrankes mit den geschnitzten Türen passten überhaupt nicht in ihre Umgebung. Die vielen Romane und Erzählbände, die sie einen nach dem anderen verschlang, dann aber manchmal auch mit einem eigenartigen Verdruss fortschleuderte, ließen vor ihrem inneren Auge ein völlig anderes, sehr viel wirklicheres Leben entstehen, ohne dass sie genau wusste, ob es besser oder schlechter sei.
Sie selbst suchte kaum Kontakt zu ihren Mitschülern, weil sie einerseits lieber alleine war, andererseits aber auch deren Gespräche einfach abstoßend fand. Diese bunte Ansammlung von Mädchen im Alter von dreizehn bis sechzehn Jahren diskutierte über Themen, die selbst einem Erwachsenen die Röte ins Gesicht trieben; sie behandelten die Jungen in der Klasse zwar stets geringschätzig, gaben aber über sie äußerst sachkundige Meinungen zum Besten. Macide hörte diesen Gesprächen oft mit einer nicht zu bezwingenden Neugierde zu, empfand jedoch, sobald sie allein war, einen großen Ekel und beschloss, die Gesellschaft ihrer Mitschüler ganz zu meiden.
Am Anfang war dieser Widerwille gepaart mit Unverständnis, denn völlig fremd waren ihr die Gedankengänge ihrer Mitschülerinnen, die sich im Schulgarten zu Grüppchen zusammenfanden und tratschten; dass Ahmets Lippen dick und Mehmets Hände weiß und weich waren, dass jener Lehrer jenes Mädchen angelächelt hatte, dass die Handarbeitslehrerin nie einen Mann finden würde und dergleichen mehr – für sie war das völlig belangloses, unnötiges Geschwätz.
Später, als sich nach der Lektüre vieler Bücher in ihrem Kopf klarere Vorstellungen und ganz neue Traumwelten geformt hatten, nahm ihre Abscheu vor solchen Unterhaltungen noch zu. Alle Worte ihrer Mitschüler, ganz besonders solche, die allgemein ihre Zukunft betrafen, beschmutzten eine der schönen, aus ihrer reichen Einbildungskraft entstandenen Welten. Wenn vor ihrem eigenen inneren Auge auch ganz verschiedene Zukunftsentwürfe vorbeizogen, so behielt sie diese doch wie etwas ganz Wertvolles für sich, ja fürchtete sogar, sie zu zerstören, wenn sie zu oft daran dachte.
Ein Abenteuer, das genau in diese Zeit, etwa in die Mitte der siebten Klasse, fiel, sollte sie gänzlich von ihrer Umgebung absondern. Allerdings kann man diesen Vorfall, der so ganz und gar in ihr selbst seinen Ursprung hatte und sich nicht mit dem kleinsten Anzeichen nach außen verriet, eigentlich kaum als Abenteuer bezeichnen.
4
Schon in der Grundschule hatte Macide sich mit ihrer schönen Stimme und ihrer musikalischen Begabung hervorgetan. Ab der fünften Klasse war Necati Bey, ein älterer Mann, der so ziemlich in allen Schulen von Balıkesir unterrichtete, ihr Musiklehrer. Sobald er den Klassenraum betrat, holte er seine Klarinette aus dem Futteral hervor und spielte traurige Weisen, zu denen die Kinder mitsangen, so gut sie konnten.
Diesem einfachen Mann, der sich hin und wieder im Komponieren versuchte und die schlecht gereimten und inhaltlich auch nicht besonders überzeugenden Gedichte gewisser Direktoren und Lehrpersonen vertonte, war Macide aufgefallen. Der ein wenig weltfremde Necati Bey, dessen heimliche Leidenschaft für die Kunst jedoch wegen seiner mangelnden Begabung mit der Zeit erloschen war, machte es sich zur Aufgabe, Macide zu fördern. Er sprach mit ihrem Vater und begann, sie zusammen mit einigen anderen Privatschülern abends nach der Schule an dem verstimmten Klavier des Lehrervereins zu unterrichten. Macide machte in kürzester Zeit große Fortschritte, die selbst ihre Mitschüler verblüfften. Als die letzte Klasse der Grundschule mit einer Feier verabschiedet wurde, durfte sie auf dem Klavier ein Solostück spielen. Was sie bei dieser Aufführung als Anfängerin zum Besten gab, war wirklich erstaunlich. Da unter den Mitschülern, Eltern, Lehrern und kleineren Beamten im Saal nicht einer wirklich etwas von Musik verstand, wurde sie mit großem Beifall und ehrlicher Bewunderung überhäuft. Auch während der ersten Klasse der Mittelschule erhielt Macide weiterhin Klavierunterricht. Necati Bey spielte selbst nicht besonders gut Klavier, doch diese zweijährige Unterweisung endete nicht – wie bei den meisten anderen Schülern – damit, dass Macide mit einem mehr oder weniger stümperhaften musikalischen Grundwissen entlassen wurde, sondern wurde so fortgesetzt, dass sie später darauf aufbauen konnte.
Als Macide in die zweite Klasse der Mittelschule kam, wurde Necati Bey in eine andere Stadt versetzt. In den Ferien übte sie so gut wie gar nicht. Sie scheute sich, allein in den Lehrerverein zu gehen, und selbst wenn sie es gewollt hätte, wusste sie, dass ihre Umgebung dies mit Sicherheit nicht gebilligt hätte.
Nach den Ferien erfuhr sie, dass ein neuer Musiklehrer eingestellt worden war. Bedri hieß der hoch gewachsene junge Mann mit dem kurzen schwarzen Haar und dem vollen Gesicht, auf dem stets ein Lächeln lag – für die anderen Mädchen Grund genug, sich vom ersten Tag an über ihn lustig zu machen.
Am Anfang reagierte Bedri hierauf recht verärgert. Oft lief er während des Unterrichts dunkelrot an und biss sich minutenlang auf die Lippen, ohne etwas zu sagen. Doch nach kurzer Zeit schon lag das Lächeln wieder auf seinem Gesicht, er setzte sich ans Klavier und fuhr fort mit dem Unterricht, wobei er seine Augen immer wieder über die Mädchen schweifen ließ.
Der große und stets etwas kühle Musikraum war für die Schüler bestens geeignet, sich so richtig auszutoben. Hier konnten die Jungen die unflätigsten Gesten ausführen und die Mädchen stundenlang tratschen und dann mit vor den Mund gehaltenem Taschentuch in lautes Kichern ausbrechen. Der junge Lehrer, der hierauf höchstens mit einem »Ich bitte Sie, gehört sich das denn?« zu reagieren wusste, schlug dann umso heftiger auf die Tasten ein, um den Lärm zu übertönen, und forderte alle auf, gemeinsam ein Lied zu singen. Gelegentlich tauchte, wenn es wieder einmal so weit gekommen war, der Schuldirektor vor der Glastür des Musikzimmers auf und bedachte den unfähigen Lehrer mit einem verächtlichen Blick. Dann forderte er die Schüler mit einem falschen Lächeln und hochgezogenen Augenbrauen zur Ruhe auf.
Mit der Zeit gewöhnte Bedri sich daran. Die Schüler waren in den meisten Fällen so verwöhnt und schlecht erzogen, dass er sie nicht mit schönen Worten und Bitten zur Räson bringen konnte. Außer einem Geschichtslehrer, der großzügig Schläge verteilte, und einem äußerst strengen Sprachlehrer mit dem Spitznamen »Nullpunkt« gab es an der ganzen Schule keinen, dessen Unterricht ruhig verlaufen wäre. Sogar die Stunden des Rektors fanden unter Getöse statt. Als Bedri erfuhr, dass an den anderen Schulen der Stadt die gleichen Zustände herrschten, kümmerte er sich fortan nur noch um die wenigen, die seinem Unterricht ernsthaft folgten, und überließ den Rest seinem Treiben.
Macide gehörte zu den wenigen. Da sie sich zunächst still abseits gehalten hatte, war sie Bedri gar nicht aufgefallen; doch bald schon war sie diejenige, mit der Bedri sich am meisten abgab. Begeistert und aufgeregt, als ob er etwas entdeckt hätte, erzählte er dem Schuldirektor und den anderen Lehrern von der großen Begabung dieser Schülerin und meinte, dass man sie unbedingt fördern müsste. Die hörten ihn zwar ziemlich neugierig an und stimmten ihm zu, doch hinter seinem Rücken lächelten sie oder warfen sich vielsagende Blicke zu.
Macide hatte sich – genau wie früher bei Necati Bey – davor gehütet, ihren Lehrer auch nur ein einziges Mal mehr als flüchtig anzusehen. Wenn sie zusammen waren, richtete sie ihre Augen und ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Noten, auf Bedris Finger oder manchmal auch auf unbestimmte, in ihrem Innern vorbeiziehende Traumbilder. Ihr Gespräch ging so gut wie nie über das Musikstück hinaus, an dem sie gerade arbeiteten. Sie waren beide mit der gleichen Blindheit geschlagen, wie man sie bei Kunstbegeisterten findet oder bei denjenigen, die mehr oder weniger bewusst ein künstlerisches Ziel verfolgen. Dieser sorglose Umgang, den Lehrer und Schülerin miteinander pflegten und der nicht nur von ihrer Umgebung, sondern manchmal auch von ihnen selbst als naiv und töricht empfunden wurde, hätte sicher noch lange Zeit angedauert, wenn nicht der Rektor der Schule, Refik Bey, ihre Augen und Gedanken auf andere Dinge als die Musik gelenkt hätte.
Eines Abends, als seine Schüler sich auf den Heimweg machten, blieb Bedri im Lehrerzimmer zurück und schrieb einen Brief an seine Mutter in Istanbul. Als er im Flur nur noch vereinzelte Schritte hörte, steckte er den Brief schnell in einen Umschlag, adressierte ihn und rannte nach draußen.
Da er selbst in der Schule schlief und an jenem Abend nicht mehr vorhatte wegzugehen, wollte er den Brief einem der Schüler mitgeben, die auf ihrem Heimweg an der Post vorbeikamen.
Er war schon am Schultor angekommen, warf noch schnell einen Blick in den Garten, doch es war niemand mehr zu sehen. Als er sich umdrehte, um seinen Hut zu holen und selbst zur Post zu gehen, hörte er, dass im Musikzimmer Klavier gespielt wurde.
»Aha, Macide ist noch da, ich gebe ihr den Brief mit«, überlegte er kurz und ging auf das Musikzimmer zu. Als er die Tür öffnete, hatte Macide gerade den Klavierdeckel heruntergeklappt und ihre Tasche genommen.
»Ich habe noch ein wenig geübt«, sagte sie beim Gehen.
Bedri ließ sie an sich vorüber und bat: »Wirf diesen Brief doch bitte ein, wenn du bei der Post vorbeikommst!«
Das Mädchen steckte den Brief in ihre Tasche und machte einen leichten Knicks: »Auf Wiedersehen.«
»Vergiss den Brief nicht in deiner Tasche!«
»Den vergess ich nicht, Herr Lehrer.«
Macide lief schnell über den sandigen Weg durch den Schulgarten. Auf seinem Rückweg ins Lehrerzimmer sah Bedri, wie der Rektor auf einmal aus einer dunklen Ecke des Flurs hervorstürzte und eilig an ihm vorbei in den Garten rannte. Bedri wunderte sich zwar über Refik Beys Eile und die Tatsache, dass der Rektor ihn offenbar übersehen hatte, doch der Vorfall beschäftigte ihn nicht weiter.
Am nächsten Abend hatte Macide nach der Schule bei ihm Unterricht. Als Bedri das Musikzimmer betrat, sah er, dass die anderen sechs Schüler, denen er ebenfalls Privatunterricht gab, alle anwesend waren.
»Heute ist doch nicht euer Tag, warum seid ihr denn da?«, fragte er. Und freute sich schon insgeheim über das anscheinend zunehmende Interesse an seinem Unterricht.
Die vier Mädchen sahen sich vielsagend an. Macide stand mit gesenktem hochrotem Kopf neben Bedri.
Einer der beiden Jungen antwortete: »Das hat der Herr Rektor befohlen. Von jetzt an gibt es keine Einzelstunden mehr, wir sollen alle zusammen unterrichtet werden!«
Bedri sah die Schüler einen Augenblick an, ohne irgendetwas zu begreifen. Dann zuckte er bloß mit den Schultern, klappte seine Noten auf und hörte zunächst Macide, dann einige andere an. Zu den Übrigen sagte er: »Ihr kommt morgen Abend dran!« Dann verließ er den Raum und wollte den Rektor aufsuchen, um nach dem Grund für diese Anordnung zu fragen. Als er ihn nicht in seinem Zimmer antraf, ging er nach draußen, um ein wenig frische Luft zu schöpfen.
Seine Klavierschüler gingen mit ihren Schultaschen in der Hand ein paar Schritte vor ihm. Als er sie eingeholt hatte, liefen sie eine Zeit lang nebeneinander her. Anders als sonst waren an diesem Abend alle ungewöhnlich schweigsam.
»Wenn ihr gemeinsam in den Unterricht kommt, könnt ihr dabei natürlich mehr lernen. Allerdings nur, wenn ihr aufpasst und nicht ständig schwatzt.«
Die Kinder blieben stumm.
Bedri drehte sich zu Macide um und fragte leichthin: »Du hast den Brief doch nicht vergessen, oder?«
Das Mädchen errötete tief und war völlig verwirrt. Die anderen schauten immer noch still vor sich hin, wurden aber ebenfalls rot und bissen sich auf die Lippen, um nur ja nicht in Lachen auszubrechen.
Macide antwortete kaum vernehmbar: »Den Brief hat mir der Herr Rektor abgenommen.«
Bedri blieb verdutzt stehen: »Wieso denn das?«
»Das weiß ich nicht, Herr Lehrer! Ich war gestern kaum durch das Gartentor gegangen, da kam er hinter mir hergelaufen und wollte den Brief, den Sie mir gegeben hatten. Und als ich ihm den Umschlag reichte, fragte er: ›Was steht da drin?‹ Ich antwortete: ›Das weiß ich nicht. Bedri Bey hat mich gebeten, ihn einzuwerfen.‹ Dann las er die Adresse und sagte: ›Schon gut, schon gut. Geh ruhig weiter, aber nimm nie wieder solche Briefe an.‹ Er hat dann Enver aus der dritten Klasse damit zur Post geschickt.«
Bedri schwieg, sie waren inzwischen im Marktviertel angekommen. Er verabschiedete sich von seinen Schülern und trat in ein Kaffeehaus ein, das von den Lehrern der Stadt häufig besucht wurde.
Offenbar waren hier nicht nur die Lehrer der anderen Schulen, sondern auch seine eigenen Kollegen alle versammelt. Einige spielten Karten, andere Tavla, und wieder ein paar andere sahen den Spielern zu und gaben überall ihre Tipps zum Besten.
Bedri sah von weitem, wie der Rektor gerade die Spielkarten mischte. Er hatte seinen rechten Fuß unter sich gezogen und seinen Hut neben sich gelegt. Ab und zu kratzte er mit der linken Hand seinen kahlen Kopf, dann konzentrierte er sich wieder auf das Kartenspiel. Er erblickte Bedri von weitem, tat zunächst aber so, als habe er ihn nicht gesehen. Als er jedoch merkte, dass Bedri direkt auf ihn zusteuerte, rief er ihm entgegen: »Kommen Sie doch her, Herr Kollege! Was möchten Sie trinken?«
»Danke, ich trinke nichts. Aber ich möchte gleich etwas mit Ihnen besprechen.«
Die anderen Lehrer sahen den Eindringling, der sich normalerweise nicht in dem Kaffeehaus blicken ließ, missmutig an. Der Rektor erwiderte schnell: »Aber natürlich, Herr Kollege, ich würde nur gern diese Partie zu Ende spielen. Haben Sie es eilig? Nun, gut!«
Er wandte sich an einen der herumstehenden Zuschauer: »Los, übernimm du für eine Runde meinen Platz; aber pass ja auf, ich habe schon so gut wie gewonnen!«
Er stand auf, und die beiden zogen sich in eine etwas ruhigere Ecke zurück.
Bedri wusste nicht, wie er beginnen sollte. Der Rektor kam ihm zuvor: »Sie wollen mich sicher wegen dieser Sache mit dem Brief sprechen. Seit heute Morgen warte ich darauf, dass Sie zu mir kommen, und als Sie sich nicht blicken ließen, sagte ich mir, dass Sie inzwischen Ihren Fehler wohl selbst eingesehen haben. Mein Lieber, Sie mögen zwar viel herumgekommen sein, aber in Kleinstädten wie der unseren muss der Mensch sich jeden seiner Schritte genau überlegen, sonst kommt man ins Gerede. Hier ist nicht Deutschland, Sie waren doch in Deutschland, nicht wahr?«
»Nein, in Wien.«
»Nun, eins wie ʼs andere. Wir sind hier jedenfalls nicht in Europa. Wir wollen natürlich wie die Europäer werden, doch immer schön der Reihe nach …«
In einem sehr bestimmten und gereizten Ton schnitt Bedri dem Rektor das Wort ab: »Was wollen Sie damit sagen? Warum haben Sie den Brief eigentlich an sich genommen? Oder warum haben Sie ihn mir nicht vielmehr zurückgegeben, als Sie die Adresse gelesen hatten, sondern jemand anderen damit losgeschickt?«
Er war hergekommen, um sich mal so richtig mit dem Rektor zu streiten, jetzt war er beinahe so weit.
Doch der legte ihm beschwichtigend eine Hand auf die Schulter. »Ich habe das getan, um Sie nicht in eine schwierige Lage zu bringen, sonst wären Sie auf der Stelle Gegenstand eines ausufernden Klatsches geworden!«
»Halten Sie mich für dumm? Außer Ihnen hat doch niemand gesehen, dass ich dem Mädchen einen Brief mitgegeben habe. Und selbst wenn … ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand außer Ihnen auf einen so ungehörigen Gedanken kommt!« Bedri zitterte, er war aufgesprungen, sein Gesicht kreidebleich: »Ich finde es unerträglich, mit Ihnen darüber zu sprechen und Ihnen Erklärungen abgeben zu müssen. So ein gemeiner Verdacht!«
Der Rektor zog ihn am Arm auf seinen Stuhl zurück. Mit der gleichen ruhigen und freundlichen Stimme sagte er: »Vielleicht haben Sie ja Recht, sich so aufzuregen! Bedenken Sie aber, dass ich nur meine Pflicht getan habe. Und ich bin mir sicher, dass Sie auch nur die besten Absichten haben. Aber unsere Umwelt sieht das anders, und ich muss davon ausgehen, dass die Mehrheit Ihnen schlechte Beweggründe unterstellt.«
»Sie haben mich meiner Schülerin gegenüber in eine peinliche Situation gebracht!«
»Hätte ich das nicht getan, wäre Ihre Situation jetzt um einiges schlimmer!«
»Wie soll ich ihr jemals wieder ins Gesicht sehen?«
»Ach was, übertreiben Sie doch nicht! Sie sollten allerdings ein bisschen vorsichtiger sein.«
Der Rektor stand auf. Das Kartenspiel, das er mit den Augen verfolgt hatte, war zu Ende, sein Stellvertreter hatte die Partie verloren. »Morgen in der Schule können wir uns weiter unterhalten. Irgendwann werden Sie mir Recht geben.« Dann fügte er, als sei es ihm gerade erst eingefallen, noch an: »Übrigens, ich fand es auch nicht in Ordnung, dass Sie den Kindern abends Einzelunterricht geben. Mir ist da einiges zu Ohren gekommen. Sie wissen ja, die üblichen Verdächtigungen in einer gemischten Schule. Man darf nicht zulassen, dass die Eltern das Vertrauen verlieren. Mit Ihrer Erlaubnis …«, und damit beendete er das Gespräch.
Als der Rektor sich wieder dem Spiel zuwandte, sagte er zu seinen Freunden, die ihn fragend ansahen: »Ach, nichts. Glaubt der etwa, alle außer ihm seien blöd? Da haben wir schon ganz andere zur Räson gebracht. Man kann doch nicht solche Wölfe auf junge Mädchen loslassen! Wir müssen ihnen einfach ab und zu klar machen, dass wir nicht blind sind.« Er nahm die Karten auf, mischte und verteilte sie. »Nun wollen wir mal sehen, diesmal leg ich euch aber rein!« Und etwas später murmelte er wie zu sich selbst: »So viele Jahre bin ich nun schon Rektor, und nie ist an meiner Schule etwas vorgekommen. Ich werde mich in meinem Alter doch nicht von so einem Gecken in Schwierigkeiten bringen lassen!«
Bedri hatte sich nicht vom Platz gerührt. All die bösen Sätze, die er unterwegs vorbereitet hatte, die schweren Vorwürfe, und vor allem der Streit, den er vom Zaune hatte brechen wollen, waren in sich zusammengebrochen. Gegen eine solch unvorstellbare Gemeinheit, gegen diesen Verdacht, der ihm allein bei dem Gedanken daran die Schamröte ins Gesicht trieb, konnte er sich einfach nicht verteidigen; nicht einmal verfluchen konnte er den Menschen, der ihm dies mit einer solchen Selbstverständlichkeit unterstellte. Jedes seiner Worte wäre sofort mit unschlagbaren Argumenten außer Kraft gesetzt worden. Er konnte sich einfach nicht gegen jemanden wehren, der stets eine schlechte Absicht voraussetzte und nicht glauben wollte, dass der Mensch auch aufrichtig und ehrenhaft handeln kann. Schnell verließ er das Kaffeehaus und kehrte zur Schule zurück. Er hatte keine Lust mehr zu musizieren. Stattdessen wühlte er in seinem Koffer, zog das erstbeste Buch hervor und versuchte zu lesen.
5
Zu Hause angekommen, ging Macide sofort in ihr Zimmer hinauf. Ganz langsam legte sie ihre Tasche an den gewohnten Platz, nahm bedächtig ihre Schulschürze ab und wusch sich das Gesicht. Dann nahm sie ein Geografiebuch aus ihrer Tasche und setzte sich auf ein Kissen, um zu lernen.
Unaufhörlich schweiften ihre Gedanken ab. Sie musste die gleiche Seite zweimal lesen und begriff noch immer nicht, wovon die Rede war. Sie biss sich auf die Lippen und runzelte die Stirn, als ob sie gegen etwas ankämpfte. Rasch hob und senkte sich ihre Brust, und ihre Fäuste zitterten. Schließlich schleuderte sie das Buch in eine Ecke, warf sich auf das Kissen und schluchzte heftig.
Damit niemand sie hörte, vergrub sie ihre Zähne voller Zorn in dem Strohkissen. Diese Selbstbeherrschung verstärkte ihren Wutanfall nur noch, und bald verspürte sie starke Kopfschmerzen.
Sie weinte aus Wut, nur aus Wut. Sie war wütend auf alle, ganz besonders auf Bedri, aber auch auf den Rektor, ihre Mitschüler, ihre ganze Umgebung und auf sich selbst.
Was gab den anderen das Recht, sie zu erniedrigen, sich über sie lustig zu machen und sie in all diese widerlichen Vorfälle zu verwickeln? Der Gedanke, wieder in die Schule gehen zu müssen, schien ihr ganz schrecklich; noch schlimmer aber fand sie die Vorstellung, nicht hinzugehen und dann darüber Rechenschaft ablegen zu müssen. Und wenn erst über die Beweggründe getuschelt wurde, was dann?
Nach dem eigenartigen Betragen des Rektors am Abend zuvor hatte sie sich bemüht, ruhig zu bleiben, und es war ihr auch gelungen; doch heute war ihr nicht entgangen, dass ihre Mitschüler sich ihr gegenüber anders verhielten als sonst. Die Nachricht von dem Vorfall, die sich wie ein Lauffeuer in der Schule verbreitete, führte dazu, dass diejenigen, die Macide wegen ihrer Zurückgezogenheit für eingebildet hielten oder einfach wegen ihrer Begabung nicht leiden konnten, das Mädchen jetzt offen beschimpften. Sie musste sich Bemerkungen anhören wie: »Wer hätte das gedacht! Gut, dass unser Herr Rektor für Ordnung sorgt!« Und die vielsagenden Blicke wurden noch bedeutungsvoller.
Dabei war sie weder stolz noch eingebildet. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, ihr Selbstvertrauen war eigentlich noch schwach entwickelt. Trotzdem konnte sie nicht verstehen, weshalb diese Kinder jemand anders so viel Beachtung schenkten. Sollte ein Mensch sich nicht erst einmal um sich selbst kümmern und über seine eigenen Sorgen, Ängste und Unzulänglichkeiten nachdenken? Ihr kam es vor, als ob ihre Mitschüler alle eine Zauberbrille trügen, die verhinderte, dass sie sich selbst wirklich sahen. Wie sonst ließe sich eine derart dumme Blindheit deuten? Oder sollte es vielleicht doch mehr als albernes Geschwätz oder Gedankenlosigkeit sein, wenn ein Mädchen, das sich mit Mutters Schminke und Lippenstift zurechtgemacht hatte, in der Schule ihrer Freundin vorwarf, ihre Fingernägel seien zu spitz gefeilt, oder wenn ein anderes, selbst erst vor ein paar Tagen vom Disziplinarausschuss für eine Woche von der Schule ausgeschlossenes Mädchen – es war am Sonntag in Begleitung von Jungen durch schlechtes Benehmen aufgefallen – ohne zu erröten ausrief: »Du lieber Gott, seht euch das an, wie schamlos Ayşe und Ahmet miteinander flirten!«
Immer wenn Macide bei den anderen ein solches Betragen auffiel, fragte sie sich selbstkritisch: »Bin ich vielleicht auch so?« Doch sicherlich kam nicht einer einzigen Mitschülerin eine solche Frage überhaupt je in den Sinn. Sie verspürte für alle eine tiefe Geringschätzung.