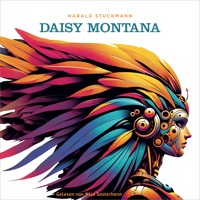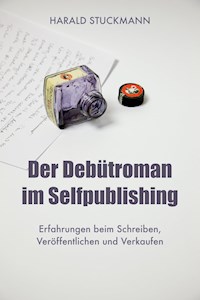
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie haben Lust, ein Buch zu schreiben, aber Sie trauen es sich nicht zu? Vielleicht haben Sie schon ein Manuskript, wissen aber nicht, wie es jetzt weitergeht? Diese Momente kenne ich nur zu gut. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Es gibt jede Menge Ratgeber, gute und weniger gute. Und es gibt jede Menge Werkzeuge, brauchbare und weniger brauchbare. Ich habe mich da durchgearbeitet und endete schließlich mit meinem ersten Roman als eBook und Taschenbuch. Beides in einer Form, die den Vergleich mit Verlagsproduktionen nicht scheuen muss. Meine Erfahrungen mit Schreiben, Veröffentlichen und Verkaufen eines Debütroman im Selfpublishing beschreibe ich in diesem Buch „Der Debütroman im Selfpublishing“. Basis waren detaillierte Aufzeichnungen, die ich regelmäßig machte, wenn etwas Bemerkenswertes oder mir wichtig Erscheinendes im Lauf des Buchprojekts passierte. Es beginnt mit der Entscheidung, einen Roman zu schreiben, und geht bis heute, ein gutes halbes Jahr nach Veröffentlichung meines Romans Chicago-Chevy-Charleston. Diese ursprünglich chronologischen Niederschriften habe ich gegliedert in die Kapitel Schreiben, Überarbeiten, Verlag oder Selfpublishing, Herstellung und Verkaufsvorbereitung, Vertrieb und Marketing. In diesen Kapiteln gehe ich jeweils auf alle wichtigen Themen ein wie bspw. Stil und Textanalyse, auf Testleser, Lektorat und Korrektorat sowie auf meine Erfahrungen mit Verlagen und Literaturagenturen. Im Anschluss teile ich meine Erfahrungen, wie man erfolgreich die technischen Hürden bei der Vorbereitung eines Buchs für die Veröffentlichung als eBook und als Taschenbuch bewältigt. Natürlich bleiben auch die Erfahrungen mit verschiedenen Vertriebsplattformen wie Amazon KDP, aber auch Books on Demand oder Tolino Media nicht unerwähnt. Den Abschluss macht ein intensiver Blick aufs Marketing, das so lange eine Aufgabe bleibt, wie ein Buch am Markt ist. Und in meinem Fazit spreche ich über ganz persönlichen Eindrücke und Einschätzungen eines solchen eigenen Buchprojekts im Selfpublishing. Es gibt viele, die meinen zu wissen, wie es geht - mündlich und schriftlich, im Buch und im Netz. Erfahrungsberichte aus erster Hand, was wirklich funktioniert und was nicht, sind mir auf meinem Weg nicht untergekommen. Hier ist einer!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Um was es geht
In den folgenden Kapiteln gebe ich die Erfahrungen weiter, die sich im Verlauf meines ersten eigenen Buchprojekts angesammelt haben. Ich mache das nicht zuletzt, um mir mehr Klarheit über das zu verschaffen, was ich da in den letzten eineinhalb Jahren angerichtet habe. Wichtiger ist mir, anderen Debütautoren ein paar Frustrationen zu ersparen und die Vorfreude auf mögliche Erfolge zu erhöhen.
Ein Buch zu schreiben und auf eigene Faust zu veröffentlichen, ist etwas anderes, als einen Tisch zu bauen oder einen Segelschein zu machen. Tisch bauen heißt meistens, eine waagrechte Platte auf vier Füße zu stellen, und wenn es nicht wackelt, war man funktional schon ganz gut. Den Segelschein kann man mehrere Male wiederholen. Keinen interessiert die Vorgeschichte, sobald er bestanden ist. Aber ein Buch zu schreiben und zu vermarkten, heißt, eine Geschichte oder eine spezielle Betrachtung in kreative Worte zu fassen und anschließend einer ziemlich schonungslosen Öffentlichkeit preiszugeben – vorausgesetzt, man findet diese, was schwierig genug ist. Diese Preisgabe bezieht sich oft auch auf die eigene Person. In Zeiten von Social Media meinen viele Leser, sie hätten nicht nur Anspruch auf den Text, sondern auch zu erfahren, was der Autor frühstückt oder wie seine Katze heißt und alles über den Rest der Familie sowieso.
Genug des Lästerns: Dieses eBook ist meine sehr individuelle Erfahrung mit dem Schreiben und Veröffentlichen eines ersten Romans. Es unterscheidet sich von all den vielen auf dieses Thema bezogenen Lehrbüchern, Schreibwerkstätten, YouTubern und Alleswissern insofern, als ich nicht sage, wie es richtig gemacht wird, sondern wie ich versucht habe, meinen Weg durch den Dschungel des Nichtwissens und vieler notwendiger Entscheidungen zu finden. Über ein paar begleitende Gefühle und über das, was bis jetzt herausgekommen ist, rede ich natürlich auch.
Schreiben, Herstellen und Vermarkten sind die drei großen Abschnitte auf dem Weg eines selbstverlegten Buchs von der Idee im Kopf des Autors in den Bücherschrank beim Leser.
Sie alle haben mit Kreativität und Verkaufsgeschick zu tun, wobei Letzteres auch eine Form von Kreativität ist, die Marketing heißt. Dessen unterschwelliger Einfluss auf den Buchkonsumenten sollte nicht unterschätzt werden.
Das Schreiben, also eine Geschichte oder Gedanken in Worte fassen, stellt zweifellos den Abschnitt dar, welcher der Originalität und Kreativität am meisten verpflichtet ist. Aber auch hier werden – bewusst oder unbewusst – Entscheidungen getroffen, die auf das Wohlwollen und die Zahl der Leser Einfluss haben. Die Erfahrung sagt, dass sich ein Thriller oder ein Liebesroman besser verkauft als eine elegische Familiensaga über mehrere Jahrhunderte. Und wer die eigene Schwäche für lange und komplizierte Sätze kennt, tut gut daran, sich zu verständlicher Sprache zu zwingen. Oder er kalkuliert von vornherein ein Lektorat mit ein, was sowieso kein Fehler ist.
Wenn wir den Herstellungsprozess als das bezeichnen, was aus einem Manuskript ein fertiges Produkt, also ein Buch oder ein eBook macht, unterteilt er sich in die Festlegung des Schriftbilds, die Cover-Gestaltung und die Wahl des Buchtitels. Bei allen drei Aspekten verbinden sich Kreativität und Verkaufsüberlegungen.
Schriftbild oder Seitenlayout klingt zunächst weder nach Kreativität noch nach Marketing, hat aber mit beidem zu tun. Eine gute Formatierung und Druckvorbereitung ist – wie wir später sehen werden – eine Form von maschineller Schönschrift und insofern ein kreativer Akt. Das Gegenteil, nicht vorhandene oder schlechte Formatierung, weist deutlich auf mangelnde Professionalität hin und ist damit ein Verkaufshindernis.
Enormen Einfluss haben Cover und Buchtitel. Es sind die ersten Signale, die das Buch aussendet, sobald es in den Blick des Betrachters gelangt. Da entscheidet sich, ob ein potenzieller Leser zugreift und sein erwachendes Interesse vom Klappentext weiter gefördert wird oder ob er das Buch links liegen lässt. Konflikte zwischen dem kreativen Willen des Autors und verkaufsorientiertem Denken eines Marketingmenschen sind hier vorprogrammiert – oft genug beides in einer Person.
Was will dieses eBook?
In diesem eBook will ich erzählen, mit welchen Problemen ich mich konfrontiert sah, aber auch, was erstaunlich positiv lief. Es sind meine eigenen individuellen Erfahrungen. Ich habe versucht, sie so zu verallgemeinern, dass sie für jeden Leser, der selbst schreibt oder schreiben will, einen Nutzen haben.
Dieses eBook will kein Leitfaden fürs Schreiben sein und keiner fürs Veröffentlichen. Der Fokus liegt auf einer Reihe allgemeiner oder auch spezieller Widerstände, die bei beidem auftreten können. Dabei gehe ich auf Punkte ein, die nach meiner Erfahrung in anderen Büchern schwer zu finden sind. Wichtig ist, im Auge zu behalten, dass das Selfpublishing als schnell wachsender Markt stetigen Veränderungen unterliegt. Gerade was Distributoren und Verkaufsplattformen wie bspw. Amazon angeht, können sich Details, um die es hier geht, in ein paar Monaten schon wieder ganz anders darstellen.
Die Form
Wie die meisten Schreibdebütanten habe ich mir im Vorfeld meines Buchprojekts und während des Schreibens bei den üblichen Verdächtigen Rat gesucht: auf Webseiten und YouTube, bei Schreibcoaches und in Büchern. Insofern dürfte dieses eBook den größten Teil aller relevanten Themen abdecken – vom Schreiben über die Agentur- bzw. Verlagssuche, die Formatierung der Druckdateien, das Marketing, die Rezensionsbeschaffung und manches mehr.
Als Grundlage diente mir eine Art Tagebuch, in welchem ich alle Ereignisse und Erkenntnisse beim Schreiben und Veröffentlichen des Buchs in chronologischer Reihenfolge festgehalten hatte.
Es sind subjektive und fragmentarische Aufzeichnungen, die einen Schaffensprozess begleitet haben. Gerade die Subjektivität macht manche Probleme im Detail sichtbar. Daraus ergibt sich auch unterschiedliche Ausführlichkeit der nachfolgenden Kapitel. Für das eBook habe ich diese Notizen unter logischen Gliederungspunkten zusammengestellt und neu formuliert.
Die Anfänge
Ein Exposé taucht auf
Eines Tages im Herbst 2019 stand ich auf dem Dachboden und wühlte in einer Archivkiste nach alten Unterlagen. Mit dem ungeöffneten Karton war ich bereits mehrere Male umgezogen, und ich hatte nur noch vage Vorstellungen über den Inhalt. Das Gefühl, auf einer Schatzsuche zu sein, kennt wohl jeder: Die Goldstücke, die man zu finden hofft, gibt es nicht. Dafür tauchen Dinge auf, die einem komplett aus dem Gedächtnis gefallen sind und die man nie mehr vermisst hätte, selbst wenn das Haus abgebrannt wäre.
So auch hier. Jede Menge altes Papier: Ausgaben der twen und des Spiegel, Autozeitschriften aus den 60ern in Hochglanz, dazwischen Briefe mit 20 Pfennig Marken, Gratulationen zur Konfirmation und Hotelprospekte. Aber dann kam ein Stapel Film-Exposés zum Vorschein, und der saugte mich schlagartig zurück in die 80er Jahre.
Damals arbeitete ich in München für eine Filmproduktion, die im Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen vor allem Dokumentationen, Features und Porträts von mehr oder weniger bekannten Kulturschaffenden drehte. Die Produktionsfirma gehörte dem leider viel zu früh gestorbenen Filmemacher Christian Bauer, der ursprünglich Gymnasiallehrer für Englisch war und unter anderem Amerikanistik studiert hatte. Dieses Faible für Land, Leute, Sprache und Kultur der USA prägte auch sein filmisches Schaffen. Mein Platz als Produktionsleiter war eigentlich der Schreibtisch in München. Aber wie so oft beim Film und gerade bei kleineren Firmen arbeitet man auch auf Nebengleisen, und ich ergriff jede sich bietende Gelegenheit, bei Dreharbeiten in den USA dabei zu sein.
Wir drehten so ziemlich überall in den Staaten. An der Ostküste, der Westküste, den kompletten Mississippi runter von Minnesota bis in den Golf von Mexiko. Aber eine Stadt holte uns immer wieder ein: Chicago. Das hatte zwei Gründe. Zum einen war eines der ersten großen Projekte ein 90 Minuten Porträt dieser Stadt. Dabei haben wir die „Windy City“ nicht nur intensiv kennen und lieben gelernt, sondern Ideen für eine ganze Reihe von weiteren Filmen gefunden: den Chicago-Blues, die Schlachthöfe in Upton Sinclairs legendärem Buch Der Dschungel, Al Capone und so manches mehr.
Der zweite Grund hieß Allen. Der war ein genialer Kameramann und ein formidabler Kenner seiner Heimatstadt Chicago. Mit einer Empfehlung des Film Centers am Art Institute of Chicago stellte er sich Christian Bauer vor. Allen verstand sofort, welche Form der Bildsprache von ihm gewünscht wurde und entwickelte sich bereits im Lauf des ersten Projekts zu einem unersetzlichen Teil der Crew. Er blieb das viele Jahre lang.
Allen lebte mit seiner Freundin in South Chicago an der Halsted Street in einem Loft mit gigantischen Ausmaßen. Hier fand alles statt, was Allens Leben und das seiner Partnerin definierte. Hier wurde gewohnt, aber vor allem gearbeitet. Hier war Studio, Schneideraum, Kino und Konferenzsaal, Kantine und Lager.
Allen arbeitete als Kameramann, war aber selbst Filmkünstler. Große Teile seiner Gage wanderten in eigene Projekte, die so gut wie nie irgendwelchen kommerziellen Aspekten folgten. Diese Wohn- und Arbeitsstätte hätte er sich nicht leisten können, wäre nicht das Gebäude zum Abriss freigegeben gewesen. Der verzögerte sich immer wieder, aber irgendwann würde es so weit sein.
Bemerkenswert, weil unübersehbar, war Allens Auto, ein 64er Chevrolet Bel Air. Dieses Fahrzeug flößte schon von außen Furcht ein. Es war verbeult mit großen grau gespachtelten Flächen. Der Lack zeigte sich in einem mäandernden stumpfen Blaugrau, und das Ausstellfenster auf der Beifahrerseite war mit Gaffertape abgeklebt, weil es bei einem versuchten Einbruch abhandengekommen war. Spätestens im Inneren des Wagens kam einem der Gedanke, hier sein Leben aufs Spiel zu setzen. Die Sitze zerschlissen und durchhängend, jede Feder war einzeln im Rücken zu spüren. Die Lenkradschaltung ausgelutscht mit einem Hebel, der im parkinsonschen Endstadium zitterte. Am beängstigenden war aber der Dachhimmel, der sich in großflächigen Fetzen gelöst hatte und den Passagieren teilweise direkt vor den Augen hing. Dieses Gefährt nutzten wir als Produktionsfahrzeug für diverse Filme in Chicago.
Allen war oft ein stiller, in sich gekehrter Mensch. Andererseits konnte er extrem witzig und unterhaltend sein, wobei er nicht unbedingt erkennen ließ, welche Geschichten er gerade erfand oder was wirklich den Tatsachen entsprach. Bis heute ist nicht geklärt, ob er dieses Auto von seinem Großvater geerbt oder für 100 Dollar an einer Straßenecke erstanden hatte.
Warum ich das alles erzähle? Nun, weil das der reale Bestandteil des einzigen Exposés mit einer ansonsten erfundenen Geschichte ist. Alle anderen in der Kiste wiedergefundenen Exposés behandelten dokumentarische Themen.
Ich saß zwischen all diesen staubigen Kisten und las, wie sich Steve, Kameramann aus Chicago, nach einem Streit mit seiner Freundin Linda spontan in Richtung Süden aufmacht. Dort will er den alten von seinem Opa geerbten Chevy Bel Air in der Nähe eben dieses Großvaters beerdigen. Auf der Fahrt nach South Carolina passieren alle möglichen Dinge. Steve trifft die merkwürdigsten Leute und – logisch – auch eine Frau, die vieles noch komplizierter macht.
Das Exposé hatte einen Umfang von 22 computergeschriebenen Seiten, und mein Rechner datierte es auf 1990. Es war also knapp 30 Jahre alt. Trotzdem erinnerte ich mich in diesem Moment nicht an den Plot. Klar, die Anleihen bei Allen und seiner persönlichen Situation waren sofort erkennbar und eindeutig. Außerdem endete die Geschichte in Murrells Inlet, South Carolina, wo wir ebenfalls im Jahr 1990 ein Porträt von Mickey Spillane gedreht hatten – dem großen amerikanischen Krimi-Autor und Erfinder von „Mike Hammer“.
Tage nach dem Dachbodenfund kam mir die Vermutung, dass das Ganze eine schnell heruntergeschriebene Rohfassung war. Es fehlten Übergänge, ein paar Szenen waren mit dem Vermerk „Ausarbeiten!“ versehen. Wahrscheinlich hatte ich den Text als Übung oder aus Spaß an der Freude geschrieben. Irgendwann verschwand das Exposé bzw. die Rohfassung davon erst in einem Stapel unerledigter Dinge und dann in der Archivkiste, wo sich ein Mantel des Vergessens darüberlegte.
Erfreulicherweise endete es nicht im Papierkorb! Denn dieser Fund setzte etwas in Bewegung. 30 vergangene Jahre lassen eine Distanz entstehen, die den Blick auf das Wesentliche schärft, und sie erhöhen deutlich die Objektivität gegenüber dem eigenen damaligen Schaffen. Die Geschichte zeigte Qualitäten, und die Frage nach der Aktualität stellt sich nicht, wenn Personen und Abläufe in dem gegebenen zeitlichen Umfeld stimmig herüberkommen.
In dem Exposé gab es Szenen und Abschnitte, die nicht überzeugten. Sie waren trivial oder brachten die Geschichte keinen Meter voran. Aber der Plot hatte einen Spannungsbogen. Er transportierte Witziges, Nachdenkliches und Emotionen, und die Entwicklung der Geschehnisse hatte eine geschlossene Logik. Mich frustrieren Bücher, in denen der Schluss mit der Brechstange des Zufalls und des Unglaublichen passend geschrieben wurde.
Und so wanderte das Exposé wieder vom Dachboden in einen Stapel Papier auf meinem Schreibtisch.
Auf der Titelseite des Exposés war ein Foto des Chevys zu sehen, des Wagens, der eine „tragende“ Rolle in der Geschichte spielt. Die Kiste zog mich jedes Mal in Bann, wenn ich auf dem Schreibtisch – meistens suchend – unterwegs war. Ich ertappte mich häufig, ein paar Seiten erneut zu lesen, und irgendwann fing ich an, Notizen an den Rand der Blätter zu schreiben. Es dauerte nicht mehr lang, bis ich die erste Szene in einer ausführlichen Fassung neu anlegte. Ohne dass es mir bewusst wurde, hatte ich damit den Anfang eines Buchprojekts gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war ich allerdings noch weit entfernt von der Entscheidung, ein Buch schreiben zu wollen.
Das Ausformulieren von Szenen machte mir Freude, den Figuren Wörter und Sätze in den Mund legen zu können genauso. Aber das alles war mehr ein Vortasten, ein Ausprobieren, um zu sehen, ob das Geschriebene auch noch Tage später meine Zustimmung finden würde.
Der letzte Satz verrät eine meiner Vorgehensweisen: Ich drucke Texte auf Papier aus, um Korrekturen, Ergänzungen und Anmerkungen zwischen die Zeilen, an den Rand und gerne auch auf die Rückseite des Blatts schreiben zu können.
Irgendwann war es so weit. Zwei Kapitel hatte ich in einer ersten neuen Rohfassung geschrieben, und sie erfüllten meinen eigenen Anspruch. Der nächste entscheidende Punkt kam, als ich beschloss auszuprobieren, ob ich ein ganzes Buch stemmen könnte. Das habe ich wohlweislich für mich behalten, weil ich ein potenzielles Scheitern nicht ausschloss und dieses lieber mit mir allein ausmachen wollte. Ich sah das Ganze als ein persönliches Experiment.
So wurde aus einem Jahrzehnte alten Exposé auf meinem Schreibtisch das Projekt für einen Roman. In Analogie zu „Ruhe in Frieden“ nannte ich den Arbeitstitel Ruhe im Süden. Ich hatte keinen Druck und dementsprechend keinen Zeitplan. Trotzdem wollte ich das alles ab sofort kontinuierlich wachsen sehen. Schreiben war angesagt!
Das Schreiben
Sieht man sich Literatur über den Prozess des Schreibens an, wird schnell klar, dass es dafür kein Patentrezept gibt. Die einen schreiben morgens zwischen fünf und sieben Uhr, andere erst nach dem dritten Whisky. Geschrieben wird im Bett, im Zug, nahezu an allen möglichen Orten zu beliebigen Uhrzeiten. Der Akt des Schreibens ist so vielfältig wie die Menschen selbst und die Texte, die dabei entstehen.
Ich selbst schreibe gerne abends, wenn es draußen dunkel ist und Ruhe herrscht. Das hilft mir, meine Vorstellungen zu visualisieren und eine Szene auszugestalten. Das schließt nicht aus, zu früher Stunde im Bett gute Ideen zu entwickeln. Im Folgenden ein paar Punkte, die für meine Schreibroutine gut funktionieren und die ich daher empfehlen kann.
Das erste Buch zu schreiben, ist ein Prozess, der mich an die Geschichte mit dem Frosch erinnert. Nachdem dieser in einen Bottich Sahne gefallen war, rettete er sich, indem er so lange schwamm, bis er schließlich auf einem Berg Butter saß. Der Debütautor befindet sich in einer ähnlichen Situation: Er springt in ein Becken voller Ungewissheiten, und die Chance auf festen Boden unter den Füßen steigt nur, indem er zusammenhängende Sätze schreibt. Es gibt zwar die Notleiter in Form des Ausstiegs oder der Aufgabe, aber mit der ist meist auch die Aufgabe aller schriftstellerischen Ambitionen verbunden.
Ein kreativer Prozess
Wie schreibe ich? Wo kommen die Sätze her? Es gibt dieses klischeebehaftete Bild des Schriftstellers, der Stunden vor einem leeren Blatt sitzt und kein Wort aufs Papier bringt. „Schreibblockade“, tönt es aus dem Hintergrund. Nein, das ist es eher nicht. Ich vermute, eine echte Schreibblockade erfordert lange Jahre des Schreibens, bis der Kopf sich wehrt, weil eigentlich alles gesagt ist. Bei einem Debütroman dagegen produziert man meist mehr Ideen, als dem Manuskript guttut.
Das anfängliche Zögern hat nach meiner Erfahrung eher damit zu tun, die eigenen Einfälle gleich mit gelungener Formulierung und in der richtigen Reihenfolge niederschreiben zu wollen. Irgendwann hat man gelernt, dass die erste Fassung eines Texts nicht umsonst Rohfassung heißt, auf die noch Überarbeitungen folgen. Daher ist es besser, einfach loszuschreiben und den stetigen Fluss von Gedanken durch die Hand aufs Papier zu bringen.
Es gibt ein paar Techniken, die helfen. Eine meiner wichtigsten: Lebe mit der Szene, die du schreibst! Oder besser: Erlebe sie. Konkret heißt das: Wenn du den Eindruck hast, dass das, was du erzählen oder darstellen willst, nicht anschaulich genug rüberkommt, lehne dich zurück, pack den Füller weg, koch dir einen Tee, mach ein Bier auf oder schenk dir ein Glas Wein ein.