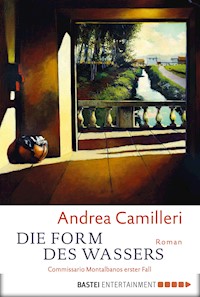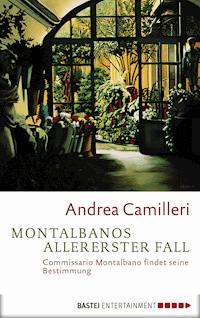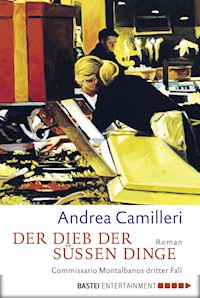
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
Commissario Montalbano kann sich über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Denn in Vigàta, dem malerischen Städtchen an der sizilianischen Küste, geschehen gleich zwei Morde: Auf einem Fischerboot wird während einer nächtlichen Ausfahrt ein Tunesier erschossen, und der sizilianische Geschäftsmann Lapecora wird im Aufzug seines Wohnhauses erstochen aufgefunden. Die beiden Opfer haben, außer der Tatsache, daß sie tot sind, offensichtlich nichts gemeinsam. So scheint es zumindest. Bis Commissario Montalbano ein drittes "Verbrechen" aufklärt: Bei einer überraschenden Polizeiaktion ertappt er auf frischer Tat einen Dieb, der seit ein paar Tagen im Ort für Aufregung sorgt. Der geheimnisvolle Übeltäter bringt den Commissario auf die Spur der schönen Tunesierin Karima. Und eben diese, wie sich herausstellt in Vigàta nicht unbekannte Schöne, ist das was die beiden Morde miteinander verbindet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Anmerkung des Autors
Anmerkungen der Übersetzerin
Im Text erwähnte kulinarische Köstlichkeiten
Zur Übersetzung
Über den Autor
Andrea Camilleri, 1925 in dem sizilianischen Küstenstädtchen Porto Empedocle geboren, ist Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und lehrt seit über zwanzig Jahren an der Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico in Rom. Mit seinem vielfach ausgezeichneten literarischen Werk löste er in Italien eine Begeisterung aus, die DIE WELT treffend als »Camillerimania« bezeichnete. Vor allem die Kriminalromane um Commissario Salvo Montalbano haben Andrea Camilleri mittlerweile auch in Deutschland eine große Fangemeinde beschert.
Andrea Camilleri
Der Dieb der süßen Dinge
Commissario Montalbanosdritter Fall
Aus dem Italienischen vonChristiane von Bechtolsheim
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der italienischen Originalausgabe:
IL LADRO DI MERENDINE,
erschienen bei Sellerio Editore, Via Siracusa 50, Palermo
© 1996 by Sellerio Editore
© für die deutschsprachige Ausgabe 2000 by:
Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
Copyright Cover © corbis/A. Belov
Umschlaggestaltung: Marina Boda
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0325-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Eins
Schlecht gelaunt und schweißgebadet wachte Montalbano auf: Wegen der anderthalb Kilo sarde a beccafico, die er am Abend zuvor vertilgt hatte, hatte er unruhig geschlafen, und jetzt war das Bettlaken so eng um seinen Körper gewickelt, dass er sich wie eine Mumie vorkam. Er stand auf, ging in die Küche, öffnete den Kühlschrank und stürzte eine halbe Flasche eiskaltes Wasser hinunter. Während er trank, sah er aus dem weit geöffneten Fenster. Das Licht der Morgendämmerung versprach einen schönen Tag, das Meer war spiegelglatt, der Himmel klar und wolkenlos. Montalbano brauchte sich, wetterfühlig wie er war, um seine Laune in den nächsten Stunden nicht zu sorgen. Es war noch früh; er legte sich wieder hin, zog sich das Laken über den Kopf und richtete sich auf zwei weitere Stunden Schlaf ein.
Wie immer vor dem Einschlafen dachte er an Livia in ihrem Bett in Boccadasse, Genua: An sie zu denken tat ihm gut bei jeder langen oder kurzen Reise in »the -country sleep«, wie es in einem Gedicht von Dylan Thomas hieß, das er sehr mochte.
Kaum hatte er die Reise angetreten, als sie auch schon vom Klingeln des Telefons unterbrochen wurde. Wie ein Bohrer schien sich der Ton durch sein Gehirn zu schrauben, bei einem Ohr hinein und beim anderen hinaus.
»Pronto!«
»Wer ist denn da?«
»Sag erst, wer du bist!«
»Catarella.«
»Was ist denn los?«
»Mi scusasse, entschuldigen Sie, aber jetzt hab ich Ihre Stimme gar nicht erkannt, Dottori. Es hätte ja auch sein können, dass Sie noch schlafen.«
»Das hätte allerdings sein können, um fünf Uhr morgens! Und jetzt sag endlich, was los ist, und nerv mich nicht länger!«
»In Mazàra del Vallo ist einer erschossen worden.«
»Das ist mir scheißegal, ich bin hier in Vigàta!«
»Aber der Tote, Dottori …«
Montalbano legte auf und zog den Telefonstecker aus der Wand. Bevor er die Augen schloss, dachte er, dass ihn vielleicht sein Freund Valente, Vicequestore von Mazàra, sprechen wollte. Er würde ihn später vom Büro aus anrufen.
Der Fensterladen schlug krachend gegen die Hausmauer; Montalbano fuhr hoch und setzte sich halb im Bett auf, die Augen vor Schreck weit aufgerissen, weil er in der Dunstglocke des Schlafes, die ihn noch umhüllte, glaubte, jemand hätte auf ihn geschossen. Unversehens war das Wetter umgeschlagen, ein kalter, feuchter Wind ließ die Wellen gelblich schäumen, der Himmel war mit regenschweren Wolken verhangen.
Fluchend stand er auf, ging ins Bad, drehte die Dusche auf und seifte sich ein. Plötzlich versiegte das Wasser. In Vigàta, und damit auch in Marinella, wo er wohnte, gab es ungefähr alle drei Tage Wasser. Ungefähr, denn es war nicht gesagt, dass es nicht schon am nächsten Tag oder erst eine Woche später wieder Wasser gab. Deshalb hatte Montalbano vorgesorgt und auf dem Dach seines Hauses große Tanks installieren lassen, aber diesmal gab es schon seit über acht Tagen kein Wasser mehr, und länger war er nicht autark. Er rannte in die Küche, stellte einen Topf unter den Hahn, um den dünnen Wasserstrahl aufzufangen, am Waschbecken machte er es ebenso. Mit dem bisschen Wasser gelang es ihm einigermaßen, sich den Seifenschaum abzuwaschen, aber seiner Laune bekam das alles überhaupt nicht.
Auf dem Weg nach Vigàta beschimpfte er sämtliche Autofahrer, denen er begegnete und die die Straßenverkehrsordnung offenbar nur dazu benutzten, um sich den Hintern damit abzuwischen; er dachte an Catarellas Anruf und die Erklärung, die er sich zusammengereimt hatte. Sie war nicht haltbar, denn wenn Valente ihn wegen eines Mordes brauchte, der in Mazàra passiert war, dann hätte er ihn um fünf Uhr morgens zu Hause und nicht im Büro angerufen. Seine Erklärung hatte er sich aus Bequemlichkeit zurechtgebastelt, um ohne schlechtes Gewissen noch zwei Stunden ungestört schlafen zu können.
»Es ist überhaupt niemand da!«, teilte Catarella dem Commissario sofort mit, als er ihn sah, und erhob sich respektvoll von seinem Stuhl in der Telefonvermittlung. Montalbano und sein Kollege Fazio hatten ihn dahin verbannt, denn dort richtete er, selbst wenn er merkwürdige und wenig glaubhafte Anrufe meldete, bestimmt weniger Schaden an als an jeder anderen Stelle.
»Aber heute ist doch kein Feiertag!«
»Nonsi, Dottori, kein Feiertag, aber sie sind alle am Hafen wegen der Geschichte mit dem Toten aus Mazàra, wegen dem ich Sie angerufen hab, heut ganz früh, wissen Sie noch?«
»Aber wenn der Tote in Mazàra ist, was wollen sie dann am Hafen?«
»Nonsi, Dottori, der Tote ist hier.«
»Aber wenn der Tote hier ist, Herrgott noch mal, warum erzählst du mir dann, dass er in Mazàra umgebracht wurde?«
»Weil der Tote aus Mazàra war, da hat er gearbeitet.«
»Catarè, jetzt überleg mal, soweit man das bei dir überhaupt so sagen kann – wenn hier in Vigàta ein Tourist aus Bergamo umgebracht wird, was sagst du dann? Dass es einen Toten in Bergamo gibt?«
»Dottori, es ist so, dass der Tote hier nämlich ein Toter auf Durchreise ist. Er wurde erschossen, als er an Bord eines Fischerbootes aus Mazàra war.«
»Und wer hat auf ihn geschossen?«
»Die Tunesier, Dottori.«
Entnervt verzichtete der Commissario darauf, mehr zu erfahren.
»Ist Dottor Augello auch am Hafen?«
»Sissignori.«
Montalbanos Vice, Mimì Augello, war bestimmt froh, wenn er sich am Hafen nicht blicken ließ.
»Hör zu, Catarè, ich muss einen Bericht schreiben. Ich bin für niemanden zu sprechen.«
»Pronti, Dottori! Da wäre Signorina Livia, die aus Genua anruft. Was soll ich jetzt machen, Dottori? Soll ich sie Ihnen geben oder nicht?«
»Gib sie mir.«
»Weil Sie doch vor zehn Minuten gesagt haben, dass Sie für niemanden da sind …«
»Catarè, ich habe gesagt, gib sie mir!«
»Pronto, Livia? Ciao.«
»Du kannst dir dein ciao an den Hut stecken! Den ganzen Vormittag versuche ich schon, dich zu erreichen. Bei dir zu Hause klingelt das Telefon stundenlang, und keiner hebt ab.«
»Wirklich? Ich hab vergessen, den Stecker wieder reinzutun. Ich muss dir was Lustiges erzählen. Stell dir vor, heut früh um fünf wurde ich angerufen, weil …«
»Mir ist nicht nach Lachen. Ich habe es um halb acht versucht, um viertel nach acht, ich habe es um …«
»Livia, ich hab doch schon gesagt, dass ich vergessen …« »Du hast schlicht und einfach mich vergessen. Gestern haben wir ausgemacht, dass ich dich heute um halb acht anrufe, um zu entscheiden …«
»Livia, ich warne dich. Es ist windig, und gleich fängt’s an zu regnen.«
»Na und?«
»Das weißt du doch. Bei diesem Wetter bin ich schlecht aufgelegt. Ich will nicht, dass ein Wort das andere gibt …« »Ich verstehe schon. Ich rufe dich nicht mehr an. Du kannst ja anrufen, wenn du willst.«
»Montalbano? Wie geht’s? Dottor Augello hat mir alles berichtet. Dieser Vorfall wird sicher internationale Verwicklungen nach sich ziehen. Meinen Sie nicht?«
Der Commissario verstand nur Bahnhof, er hatte keine Ahnung, wovon der Questore sprach. Er entschied, ganz generell zuzustimmen.
»In der Tat, in der Tat.«
Internationale Verwicklungen?!
»Jedenfalls habe ich angeordnet, dass Dottor Augello mit dem Prefetto spricht. Die Angelegenheit liegt sozusagen außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches.«
»In der Tat.«
»Montalbano, ist alles in Ordnung?«
»Absolut, warum?«
»Sie wirken nur so …«
»Ein bisschen Kopfweh, das ist alles.«
»Was ist heute für ein Tag?«
»Donnerstag, Signor Questore.«
»Möchten Sie Samstagabend zum Essen zu uns kommen? Meine Frau kocht spaghetti al nero di seppia. Eine Delikatesse.«
La pasta al nìvuro di sìccia, Spaghetti mit Sepiatinte. Mit seiner Laune hätte er kohlrabenschwarzen Sugo für einen ganzen Zentner Spaghetti liefern können. Internationale Verwicklungen?
Fazio trat ein, und Montalbano raunzte ihn gleich an.
»Könnte vielleicht jemand so liebenswürdig sein und mir erklären, was, zum Teufel, eigentlich los ist?«
»Duttù, Sie brauchen nicht sauer auf mich zu sein, nur weil es ein bisschen windig ist. Ich hab bei Ihnen anrufen lassen, bevor ich Dottor Augello Bescheid gesagt hab.«
»Du hast Catarella anrufen lassen! Es war gemein von dir, in so einer wichtigen Sache Catarella bei mir anrufen zu lassen. Du weißt doch genau, dass der nur wirres Zeug redet. Was ist denn eigentlich passiert?«
»Ein Motorfischerboot aus Mazàra, das nach Aussage des Kapitäns in internationalen Gewässern fischte, wurde von einem tunesischen Patrouillenboot angegriffen und mit einem Maschinengewehr beschossen. Der Fischkutter gab seine Position einem unserer Patrouillenboote, der Fulmine, durch und ist entkommen.«
»Gut gemacht«, sagte Montalbano.
»Wen meinen Sie?«, fragte Fazio.
»Den Kapitän des Fischkutters, der sich nicht ergibt, sondern den Mut hat, seine Fahrt unvermindert fortzusetzen. Und dann?«
»In dem Gewehrfeuer ist einer von der Crew umgekommen.«
»Aus Mazàra?«
»Ja und nein.«
»Drück dich ein bisschen genauer aus!«
»Er war Tunesier. Seine Papiere waren angeblich in Ordnung. Fast alle Crews sind gemischt. Erstens, weil die Tunesier gute Arbeiter sind, und zweitens, weil sie wissen, wie sie mit den Tunesiern auf den Patrouillenbooten reden müssen, wenn sie aufgehalten werden.«
»Glaubst du, dass der Fischkutter in internationalen Gewässern unterwegs war?«
»Ich? Für wie blöd halten Sie mich?«
»Pronto, Dottor Montalbano? Hier ist Marniti vom Hafenamt.«
»Worum geht es, Maggiore?«
»Um die böse Sache mit dem Tunesier, der auf dem Fischkutter erschossen wurde. Ich vernehme gerade den Kapitän, um herauszufinden, wo sich das Boot im Augenblick des Angriffs befand, und die Vorgänge nachzuvollziehen. Danach kommt er zu Ihnen ins Büro.«
»Wozu? Hat ihn mein Vice nicht schon vernommen?«
»Doch.«
»Dann muss er eigentlich nicht herkommen. Aber ich danke Ihnen trotzdem.«
Sie wollten ihm die Geschichte offenbar unbedingt aufs Auge drücken.
Die Tür wurde so heftig aufgerissen, dass der Commissario von seinem Stuhl aufsprang. Catarella kam ganz aufgelöst herein.
»Ich bitte um Verzeihung wegen dem Krach, aber die Tür ist mir ausgerutscht.«
»Wenn du noch mal so reinkommst, erschieße ich dich. Was ist denn los?«
»Gerade ist angerufen worden, dass da einer ist, der in einem Fahrstuhl steckt.«
Der Tintenfisch, ein Zierstück aus Bronze, verfehlte Catarellas Stirn, aber es klang wie ein Kanonenschuss, als er gegen die Holztür knallte. Catarella kauerte sich zusammen und schützte seinen Kopf mit den Armen. Montalbano bearbeitete seinen Schreibtisch mit Fußtritten. Fazio stürzte ins Zimmer, die Hand an der offenen Pistolentasche.
»Was ist denn hier los?«
»Lass dir von diesem Vollidioten die Geschichte mit dem Fahrstuhl erklären, in dem einer stecken geblieben ist. Sie sollen sich an die Feuerwehr wenden. Aber schaff ihn mir vom Hals, ich will kein Wort mehr von ihm hören!«
Fazio war im Nu wieder da.
»Ein Toter in einem Fahrstuhl, ermordet«, sagte Fazio, kurz und knapp, um weiteren fliegenden Tintenfischen vorzubeugen.
»Cosentino, Giuseppe, vereidigter Nachtwächter«, stellte sich der Mann vor, der neben der offenen Fahrstuhltür stand. »Ich habe Signor Lapecora tot aufgefunden.«
»Wo sind die Schaulustigen?«, fragte Fazio verwundert.
»Ich habe alle in ihre Wohnungen geschickt. Die Leute hier tun, was ich sage. Ich wohne im sechsten Stock«, sagte der Nachtwächter stolz und zupfte sich die Uniformjacke zurecht.
Montalbano fragte sich, wie es wohl um die Macht von Giuseppe Cosentino stünde, wenn er im Kellergeschoss wohnte.
Der tote Signor Lapecora saß auf dem Boden des Fahrstuhls, den Rücken an die hintere Wand gelehnt. Neben seiner rechten Hand lag eine Flasche Corvo bianco, die noch mit Stanniol verschlossen war. Neben der Linken ein hellgrauer Hut. Der verstorbene Signor Lapecora, inklusive Krawatte elegant gekleidet, war ein vornehmer Herr um die sechzig. Seine Augen waren weit geöffnet, der Blick erstaunt, vielleicht weil er in die Hose gepinkelt hatte. Montalbano bückte sich und berührte mit der Fingerspitze den dunklen Fleck zwischen den Beinen des Toten: Es war keine Pisse, sondern Blut. Der Fahrstuhl lief in einem gemauerten Schacht. Der Rücken des Toten war nicht zu sehen, und man konnte nicht feststellen, ob er erstochen oder erschossen worden war. Montalbano schnupperte und nahm keinen Geruch von Schießpulver wahr, aber der konnte sich auch verflüchtigt haben.
Er musste dem Gerichtsmediziner Bescheid geben.
»Was meinst du, ist Dottor Pasquano noch am Hafen oder schon wieder in Montelusa?«, fragte er Fazio.
»Er müsste noch am Hafen sein.«
»Ruf ihn an. Und wenn Jacomuzzi mit seiner Bande vom Erkennungsdienst da ist, dann schick ihn auch her.«
Fazio eilte hinaus. Montalbano wandte sich an den Nachtwächter, der, weil er befragt werden sollte, respektvoll strammstand.
»Stehen Sie bequem!«, sagte Montalbano genervt.
Der Commissario erfuhr, dass das Gebäude aus sechs Stockwerken bestand und es in jedem Stockwerk drei Wohnungen gab, die alle bewohnt waren.
»Ich wohne im sechsten Stock, ganz oben.« Cosentino, Giuseppe legte Wert darauf, das zu wiederholen.
»War Signor Lapecora verheiratet?«
»Sissignore. Mit Palmisano, Antonietta.«
»Haben Sie die Witwe auch in ihre Wohnung geschickt?« »Nossignore. Die Witwe weiß noch nicht, dass sie Witwe ist. Sie ist heute ganz früh zu ihrer Schwester nach Fiacca gefahren, weil es der gesundheitlich nicht besonders gut geht. Sie hat um halb sieben den Bus genommen.«
»Sagen Sie mal, woher wissen Sie das alles?«
Ob ihm der sechste Stock die Macht verlieh, von allen Leuten Rechenschaft über ihr Tun und Lassen zu fordern?
»Weil Signora Palmisano Lapecora«, erklärte der Nachtwächter, »es gestern meiner Frau erzählt hat, die beiden ratschen nämlich oft miteinander.«
»Haben die Lapecoras Kinder?«
»Einen Sohn. Er ist Arzt. Aber er lebt nicht in Vigàta.«
»Was machte Lapecora beruflich?«
»Er war Geschäftsmann. Er hat ein Büro in der Salita Granet Nummer 28. Aber in den letzten Jahren ging er nur dreimal die Woche hin, montags, mittwochs und freitags, er hatte nämlich keine Lust mehr zu arbeiten. Er hatte ein bisschen Geld auf die hohe Kante gelegt und war auf niemanden angewiesen.«
»Sie sind eine wahre Fundgrube, Signor Cosentino.«
Der Nachtwächter stand noch mal stramm.
In diesem Augenblick kam eine etwa fünfzigjährige Frau, die Beine wie Baumstämme hatte. Sie trug in beiden Händen vollgestopfte Plastiktüten.
»Ich war einkaufen!«, rief sie und sah den Commissario und den Nachtwächter schief an.
»Das freut mich«, sagte Montalbano.
»Mich aber nicht, vabbeni ! Weil ich jetzt sechs Stockwerke zu Fuß gehen muss. Wann kommt der Tote endlich weg?« Sie blitzte die beiden noch mal an und machte sich an den mühsamen Aufstieg. Wie ein wütender Stier schnaubte sie durch ihre platte Nase.
»Die ist eine grässliche Person, Signor Commissario. Sie heißt Pinna Gaetana. Sie wohnt neben mir, und es vergeht kein Tag, an dem sie nicht mit meiner Frau Streit anfängt, aber meine Frau ist eine Dame und geht nicht darauf ein, und dann fängt diese Person erst richtig an und hört überhaupt nicht mehr auf zu schimpfen, vor allem wenn ich nach dem Dienst meinen Schlaf nachholen muss.«
Der Griff des Messers, das zwischen den Schulterblättern von Signor Lapecora steckte, war abgenutzt – ein ganz gewöhnliches Küchenutensil.
»Wann, glauben Sie, wurde er ermordet?«, fragte der Commissario Dottor Pasquano.
»Über den Daumen gepeilt, zwischen sechs und sieben heute Morgen. Später kann ich Genaueres sagen.«
Jacomuzzi und seine Leute vom Erkennungsdienst trafen ein und begannen, den Tatort unter die Lupe zu nehmen. Montalbano verließ das Haus, es war windig, aber der Himmel blieb trotzdem wolkenverhangen. In der kurzen Straße gab es nur zwei Geschäfte, die einander gegenüberlagen. Linker Hand war ein Obst- und Gemüseladen. Hinter der Theke stand ein spindeldürrer Mann; eines seiner dicken Brillengläser hatte einen Sprung.
»Buongiorno, ich bin Commissario Montalbano. Haben Sie heute Morgen zufällig gesehen, ob Signor Lapecora das Haus betreten oder verlassen hat?«
Der Spindeldürre kicherte und gab keine Antwort.
»Haben Sie meine Frage gehört?«, fragte der Commissario leicht gereizt.
»Hören kann ich schon«, sagte der Obsthändler. »Aber meine Augen … Auch wenn ein Panzer durch die Tür gefahren wäre, hätte ich ihn nicht sehen können.«
Rechter Hand war ein Fischhändler, der zwei Kunden bediente. Der Commissario wartete, bis die beiden draußen waren, und trat dann ein.
»Buongiorno, Lollo.«
»Buongiorno, Commissario. Ich habe fangfrische Meerbrassen.«
»Lollo, ich bin nicht gekommen, um Fisch zu kaufen.«
»Sie sind wegen dem Toten da.«
»Ja.«
»Wie ist Lapecora gestorben?«
»Ein Messerstich in den Rücken.«
Lollo starrte ihn mit offenem Mund an.
»Lapecora ermordet?!«
»Warum wundert dich das so?«
»Wer konnte Signor Lapecora denn Böses wollen? Er war wirklich ein galantuomo. So was Verrücktes.«
»Hast du ihn heute Morgen gesehen?«
»Nein.«
»Um wie viel Uhr machst du den Laden auf ?«
»Um halb sieben. Ach ja, vorne an der Ecke bin ich seiner Frau begegnet, Signora Antonietta. Sie hatte es sehr eilig.« »Sie wollte zum Bus nach Fiacca.«
Montalbano kam zu dem Schluss, dass Lapecora vermutlich ermordet worden war, als er den Fahrstuhl betrat, um das Haus zu verlassen. Er hatte im vierten Stock gewohnt.
Dottor Pasquano nahm die Leiche zur Obduktion mit nach Montelusa, Jacomuzzi brauchte noch eine Weile, um einen Zigarettenstummel, ein bisschen Staub und ein winziges Stückchen Holz in drei Plastiktütchen zu stecken.
»Du hörst von mir.«
Montalbano betrat den Fahrstuhl und bedeutete dem Nachtwächter, der sich die ganze Zeit über keinen Millimeter von der Stelle gerührt hatte, ebenfalls hineinzugehen. Cosentino zögerte.
»Was ist los?«
»Da ist noch Blut am Boden.«
»Na und? Dann passen Sie eben auf, dass Sie sich die Schuhe nicht schmutzig machen. Oder wollen Sie sechs Stockwerke zu Fuß gehen?«
Zwei
»Setzen Sie sich, setzen Sie sich!«, rief Signora Cosentino überschwänglich; sie war eine schnurrbärtige Kugel und unwiderstehlich sympathisch.
Montalbano betrat ein Eßzimmer mit anschließendem Salon. Die Signora wandte sich besorgt an ihren Mann.
»Du hast dich gar nicht ausruhen können, Pepè.«
»Il dovìri … Pflicht ist Pflicht.«
»Sind Sie heute Morgen aus dem Haus gegangen, Signora?«
»Ich gehe nie weg, bevor Pepè nicht zurück ist.«
»Kennen Sie Signora Lapecora?«
»Sissi. Wenn wir auf den Fahrstuhl warten müssen, dann plaudern wir immer eine Weile.«
»Haben Sie auch mit ihrem Mann geplaudert?«
»Nonsi. Ich mochte ihn nicht. Eine untadelige Person, da kann man nichts sagen, aber er war mir nicht sympathisch. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick …«
Sie ging hinaus. Montalbano wandte sich an den Nachtwächter.
»Wo tun Sie eigentlich Dienst?«
»Im Salzdepot. Von acht Uhr abends bis acht Uhr morgens.«
»Sie haben doch die Leiche gefunden, nicht wahr?«
»Sissignore. Es war höchstens zehn nach acht, das Depot ist ganz nah. Ich habe den Fahrstuhl geholt …«
»War er nicht im Erdgeschoss?«
»Nein. Ich weiß noch genau, dass ich ihn geholt habe.«
»In welchem Stock er war, wissen Sie wahrscheinlich nicht.«
»Ich habe darüber nachgedacht, Commissario. Von der Zeit her, die er brauchte, um unten anzukommen, muss er im fünften Stock gewesen sein. Ich glaube, ich habe richtig geschätzt.«
Das passte nicht. Signor Lapecora hatte sich doch in Schale geworfen, war aber …
»Wie hieß er eigentlich mit Vornamen?«
»Aurelio, genannt Arelio.«
… anstatt hinunter ein Stockwerk nach oben gefahren. Der graue Hut bewies, dass er nicht jemanden im Haus besuchen, sondern auf die Straße hinaus wollte.
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Nichts. Das heißt, dann ist der Fahrstuhl gekommen, und ich habe die Tür aufgemacht und den Toten gesehen.«
»Haben Sie ihn angefasst?«
»Sie scherzen wohl, Commissario! Ich habe da meine Erfahrungen.«
»Woher wussten Sie, dass er tot ist?«
»Ich habe doch gesagt, dass ich mich da auskenne. Ich bin schnell zum Obsthändler rüber und habe im Kommissariat angerufen. Dann habe ich vor dem Fahrstuhl Wache bezogen.«
Signora Cosentino kam mit einer dampfenden Tasse herein.
»Wäre Ihnen ein Tässchen Kaffee genehm?«
Dem Commissario war es genehm. Dann erhob er sich und wollte gehen.
»Einen Augenblick noch«, sagte der Nachtwächter, öffnete eine Schublade und reichte ihm einen kleinen Block und einen Kugelschreiber.
»Sie müssen sich doch Notizen machen«, erklärte er auf den fragenden Blick des Commissario hin.
»Wir sind hier doch nicht in der Schule!«, gab Montalbano grob zurück.
Er hasste Polizisten, die sich Notizen machten. Wenn er im Fernsehen einen sah, der dies tat, schaltete er sofort um.
In der Wohnung nebenan befand sich Signora Gaetana Pinna mit den Baumstammbeinen. Sie fuhr Montalbano an, kaum dass er hereingekommen war.
»Ist der Tote endlich weg?«
»Ja, Signora. Sie können den Fahrstuhl wieder benutzen. Nein, machen Sie die Tür nicht zu. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.«
»A mia?! Ich habe nichts zu sagen.«
Von drinnen war eine Stimme zu hören, aber es war weniger eine Stimme als eine Art tiefes Grollen.
»Tanina! Sei doch nicht so unhöflich! Lass den Signore rein!«
Der Commissario betrat das übliche Esswohnzimmer. In einem Sessel saß, mit einem Bettlaken auf den Beinen, ein Elefant im Unterhemd, ein Mann von gewaltigen Ausmaßen. Seine nackten Füße, die unter dem Laken herausschauten, sahen aus wie Elefantenfüße, und die lange, herabhängende Nase ähnelte einem Rüssel.
»Setzen Sie sich«, sagte der Mann, der offensichtlich gern plaudern wollte, und wies auf einen Stuhl. »Wenn meine Frau so grantig ist, könnte ich …«
»Trompeten?« entfuhr es Montalbano.
Zum Glück hatte der andere es nicht verstanden.
»… könnte ich ihr den Kopf abreißen. Was kann ich für Sie tun?«
»Kannten Sie Signor Aurelio Lapecora?«
»Ich kenne niemanden in diesem Haus. Ich wohne hier seit fünf Jahren und kenne nicht mal einen Hund. In fünf Jahren war ich noch nie im Erdgeschoss. Ich kann meine Beine nicht bewegen, es ist zu anstrengend. Weil ich in den Fahrstuhl nicht reingepasst habe, mussten mich vier Hafenarbeiter hier raufschleppen. Sie haben mich mit Gurten getragen, wie ein Klavier.«
Er lachte, und es klang wie grollender Donner.
»Aber ich kannte Signor Lapecora«, mischte sich seine Frau ein. »Er war unsympathisch. Er brachte kaum einen Gruß über die Lippen.«
»Wie haben Sie erfahren, dass er tot ist, Signora?«
»Wie ich es erfahren habe? Ich musste zum Einkaufen und rief den Fahrstuhl. Aber der kam nicht. Ich dachte, jemand hätte die Tür offengelassen, die Leute, die hier im Haus wohnen, haben ja keine Manieren. Ich ging zu Fuß runter und sah den Nachtwächter, der die Leiche bewachte. Und nach dem Einkaufen musste ich die Treppen zu Fuß hochgehen, ich bin immer noch ganz außer Atem.«
»E menu mali, dann quasselst du wenigstens nicht so viel«, sagte der Elefant.
FAM. CRISTOFOLETTI stand an der Tür der dritten Wohnung, aber so laut der Commissario auch klopfte, es öffnete niemand. Er ging wieder zur Wohnung der Cosentinos und klopfte dort.
»Sie wünschen, Commissario?«
»Wissen Sie, ob die Familie Cristofoletti …«
Der Nachtwächter schlug sich mit der Hand an die Stirn. »Ich habe ganz vergessen, es Ihnen zu sagen! Über dieser Geschichte mit dem Toten ist es mir entfallen. Die Cristofolettis sind beide in Montelusa. Signora Romilda ist operiert worden, irgendeine Frauensache. Morgen müssten sie zurück sein.«
»Danke.«
»Keine Ursache.«
Montalbano ging ein paar Schritte auf die Treppe zu, machte dann aber kehrt und klopfte noch mal.
»Sie wünschen, Commissario?«
»Sie haben doch vorhin gesagt, Sie hätten Erfahrung mit Toten. Woher?«
»Ich war ein paar Jahre lang Krankenpfleger.«
»Danke.«
»Keine Ursache.«
Er ging in den fünften Stock hinunter, wo nach Meinung des Nachtwächters der Fahrstuhl mit dem bereits ermordeten Aurelio Lapecora stehen geblieben war. War er hinaufgefahren, um sich mit jemandem zu treffen, und hatte dieser Jemand ihn erstochen?
»Entschuldigen Sie, Signora, ich bin Commissario Montalbano.«
Die junge Frau, die ihm geöffnet hatte, war etwa dreißig Jahre alt und bildhübsch, aber ungepflegt. Sie sah ihn komplizenhaft an und forderte ihn auf, leise zu sein, indem sie den Zeigefinger an die Lippen legte.
Montalbano wurde nervös. Was hatte diese Geste zu bedeuten? Er verfluchte seine Angewohnheit, immer ohne Waffe herumzulaufen. Vorsichtig machte die junge Frau einen Schritt zur Seite, und der Commissario war auf der Hut, als er ein kleines Arbeitszimmer voller Bücher betrat und sich umsah.
»Bitte sprechen Sie ganz leise, es ist furchtbar, wenn der Kleine aufwacht, dann können wir uns nicht unterhalten, weil er nur noch schreit.«
Montalbano seufzte erleichtert auf.
»Signora, Sie wissen schon Bescheid, nicht wahr?«
»Ja, Signora Gullotta hat es mir gesagt, sie wohnt hier nebenan«, flüsterte die junge Frau ihm ins Ohr. Der Commissario fand die Situation sehr aufregend.
»Sie haben Signor Lapecora heute Morgen also nicht gesehen?«
»Ich war noch nicht draußen.«
»Wo ist Ihr Mann?«
»In Fela. Er unterrichtet dort am Gymnasium. Er fährt Punkt viertel nach sechs mit dem Auto los.«
Montalbano bedauerte es, dass die Begegnung nur so kurz währte: Je länger er Signora Gulisano – dieser Name stand auf dem Türschild – ansah, umso besser gefiel sie ihm, was die junge Frau dank weiblicher Intuition sogleich begriff. Sie lächelte.
»Kann ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten?«
»Aber gern«, sagte Montalbano.
Der Junge, der ihm in der Wohnung nebenan die Tür öffnete, war höchstens vier Jahre alt und schielte boshaft.
»Wer bist du, Fremder?«, fragte er.
»Ich bin Polizist«, antwortete Montalbano und lächelte; er wollte kein Spielverderber sein.
»Du kriegst mich nicht lebendig«, rief der Kleine und schoss ihm mit einer Wasserpistole mitten auf die Stirn.
Es folgte ein kurzes Handgemenge, und als der entwaffnete Junge zu weinen anfing, schoss Montalbano ihm eiskalt wie ein Killer ins Gesicht und machte ihn pitschnass.
»Was ist los? Wer ist denn da?«
Die Mama des kleinen Engels, Signora Gullotta, hatte mit der reizenden Mama von nebenan nichts gemein. Zuerst knallte sie ihrem Sohn eine, dann hob sie die Pistole auf, die der Commissario hatte fallen lassen, und warf sie kurzerhand aus dem Fenster.
»Schluss jetzt mit dem Krach!«
Der Kleine schrie wie am Spieß und rannte in ein anderes Zimmer.
»Sein Vater ist schuld, der kauft ihm solches Spielzeug! Er ist den ganzen Tag außer Haus, er schert sich einen Dreck, und ich muss mich um diesen Teufel kümmern! Was wollen Sie?«
»Ich bin Commissario Montalbano. War Signor Lapecora heute Morgen zufällig bei Ihnen?«
»Lapecora? Bei uns? Was sollte er denn hier?«
»Sagen Sie es mir.«
»Ich kannte Lapecora schon, aber nur so vom Sehen, bongiorno und bonasira, mehr nicht.«
»Vielleicht hat Ihr Mann …«
»Mein Mann hatte mit Lapecora nichts zu tun. Wann hätte er denn schon mit ihm reden sollen? Der ist ja nie da, dem ist alles scheißegal!«
»Wo ist Ihr Mann?«
»Sie sehen doch, dass er nicht da ist.«
»Schon, aber wo arbeitet er?«
»Am Hafen. Auf dem Fischmarkt. Er steht morgens um halb fünf auf und kommt abends um acht nach Hause. Man kann von Glück reden, wenn man ihn überhaupt zu Gesicht bekommt.«
Signora Gullotta war eine sehr verständnisvolle Gattin.
An der Tür der dritten und letzten Wohnung im fünften Stock stand PICCIRILLO. Eine elegante Frau Anfang fünfzig öffnete ihm; sie war in heller Aufregung.
»Was wollen Sie denn?«
»Ich bin Commissario Montalbano.«
Die Frau wandte den Blick ab.
»Wir wissen überhaupt nichts.«
Montalbano wurde sofort hellhörig. War Lapecora vielleicht wegen dieser Frau ein Stockwerk weiter hinaufgefahren?
»Ich muss Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen. Lassen Sie mich rein.«
Signora Piccirillo trat unwillig beiseite und führte ihn in ein hübsches kleines Wohnzimmer.
»Ist Ihr Mann zu Hause?«
»Ich bin Witwe. Ich lebe hier mit meiner Tochter Luigina, sie ist nicht verheiratet.«
»Sie soll kommen, falls sie da ist.«
»Luigina!«
Ein Mädchen in Jeans, Anfang zwanzig, erschien. Sie war hübsch, aber leichenblass, buchstäblich in Panik.
Der Commissario wurde noch misstrauischer und beschloss, sich die beiden richtig vorzuknöpfen.
»Lapecora war heute Morgen bei Ihnen. Was wollte er?«
»Nein!«, Luigina schrie beinahe.
»Ich schwör’s!«, rief die Mutter.
»Welche Beziehung hatten Sie zu Signor Lapecora?«
»Wir kannten ihn vom Sehen«, sagte Signora Piccirillo.
»Wir haben nichts Unrechtes getan«, wimmerte Luigina. »Hören Sie gut zu: Wenn Sie nichts Unrechtes getan haben, brauchen Sie keine Angst zu haben. Es gibt einen Zeugen, der aussagt, Signor Lapecora sei im fünften Stock gewesen, als …«
»Aber was haben Sie denn gegen uns? In diesem Stockwerk wohnen noch zwei weitere Familien, die …«
»Hör auf«, rief Luigina, einem hysterischen Anfall nahe. »Hör auf, Mama! Sag ihm alles! Sag’s ihm!«
»Also gut. Meine Tochter musste heute Morgen ganz früh zum Friseur. Sie rief den Fahrstuhl, der sofort da war. Er muss einen Stock weiter unten, im vierten, gewesen sein.«
»Um wie viel Uhr?«
»Um acht, fünf nach acht. Sie machte die Tür auf und sah Signor Lapecora auf dem Boden sitzen. Ich hatte sie begleitet, schaute in den Fahrstuhl und hielt ihn für betrunken. Eine volle Flasche Wein lag neben ihm, und … und er hatte anscheinend in die Hose gemacht. Meine Tochter ekelte sich. Sie schloss den Fahrstuhl wieder und wollte zu Fuß gehen. In diesem Moment setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung, jemand hatte ihn von unten gerufen. Meine Tochter hat einen empfindlichen Magen, bei dem Anblick ist uns beiden ganz schlecht geworden. Luigina ging in die Wohnung zurück, um sich frisch zu machen, und ich auch. Es vergingen keine fünf Minuten, da kam Signora Gullotta und sagte, Signor Lapecora sei nicht betrunken, sondern tot! Das ist alles.«
»Nein«, sagte Montalbano. »Das ist nicht alles.«
»Was sagen Sie da? Es ist die Wahrheit!«, erwiderte Signora Piccirillo verärgert und beleidigt.
»Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus und ist unangenehmer. Ihnen beiden war sofort klar, dass dieser Mann tot war. Aber Sie haben nichts unternommen, Sie haben so getan, als hätten Sie ihn gar nicht gesehen. Warum?«
»Wir wollten nicht, dass alle über uns reden«, räumte Signora Piccirillo ein. Sie war am Boden zerstört. Aber augenblicklich kehrte ihre Kraft zurück, und sie schrie hysterisch:
»Wir sind schließlich anständige Leute!«
Und diese beiden anständigen Leute hatten es zugelassen, dass die Leiche von jemand anderem entdeckt wurde, der vielleicht nicht so anständig war? Und wenn Lapecora im Sterben gelegen hätte? Sie hatten sich einen feuchten Dreck um ihn gekümmert, um … ja, um was eigentlich zu retten?
Montalbano verließ die Wohnung, schlug die Tür zu und stand Fazio gegenüber, der gekommen war, um ihm Gesellschaft zu leisten.
»Da bin ich, Commissario. Wenn Sie was brauchen …«
Montalbano hatte eine Idee.
»Ja, ich brauche was. Klopf an die Tür hier, da wohnen zwei Frauen, Mutter und Tochter. Unterlassene Hilfeleistung. Bring sie ins Büro, und mach möglichst viel Lärm darum. Alle im Haus sollen glauben, wir hätten sie verhaftet. Wenn ich komme, lassen wir sie wieder frei.«
Ragionier Culicchia, der Buchhalter, der in der ersten Wohnung im vierten Stock lebte, schubste den Commissario weg, kaum dass er die Tür geöffnet hatte.
»Meine Frau darf uns nicht hören«, sagte er und lehnte die Tür an.
»Ich bin Commissario …«
»Ich weiß schon. Haben Sie meine Flasche dabei?«
»Welche Flasche?« Montalbano sah den hageren Sechzigjährigen, der ein verschwörerisches Gesicht machte, erstaunt an.
»Die neben dem Toten, die Flasche Corvo bianco.«
»Gehörte sie nicht Signor Lapecora?«
»Von wegen! Das ist meine Flasche!«
»Ich verstehe nicht recht, das müssen Sie mir erklären.«
»Heute früh war ich einkaufen, und als ich zurückkam, habe ich den Fahrstuhl aufgemacht. Da lag Lapecora, tot. Das war mir sofort klar.«
»Haben Sie den Fahrstuhl geholt?«
»Wozu? Er war ja schon im Erdgeschoss.«
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Was wohl, mein Sohn? Mein linkes Bein und mein rechter Arm sind beschädigt. Die Amerikaner haben auf mich geschossen. Ich hatte vier Einkaufstüten in jeder Hand, hätte ich die ganzen Treppen vielleicht zu Fuß raufgehen sollen?«
»Heißt das, dass Sie mit dem Toten raufgefahren sind?«
»Was denn sonst! Aber als der Fahrstuhl in meinem Stock hielt, in dem auch der Tote gewohnt hat, ist die Weinflasche aus der Tüte gerutscht. Dann habe ich Folgendes gemacht: Ich habe meine Wohnung aufgeschlossen und die Tüten reingetragen und bin dann zurückgegangen, um die Flasche zu holen. Aber ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, weil jemand im Stockwerk über mir den Fahrstuhl gerufen hat.«
»Wie ist das möglich? Die Tür stand doch offen!«
»Nossignore! Ich hatte sie versehentlich geschlossen. Na ja, der Kopf. In meinem Alter hat man seine Sinne nicht mehr recht beieinander. Ich wusste nicht, was ich tun sollte; wenn meine Frau erfahren hätte, dass die Flasche weg war, hätte sie mir den Hals umgedreht. Sie müssen mir glauben, Commissario. Die Frau ist zu allem fähig.«
»Und was war dann?«
»Der Fahrstuhl ist an mir vorbeigefahren, ins Erdgeschoss. Da bin ich dann zu Fuß runtergegangen. Als ich mit meinem beschädigten Bein endlich ankam, stand da der Nachtwächter, der niemanden näher kommen ließ. Ich habe ihm das mit der Flasche gesagt, und er hat mir versprochen, es an höherer Stelle zu melden. Sind Sie die höhere Stelle?« »Gewissermaßen.«
»Hat der Nachtwächter das mit der Flasche gemeldet?«
»Nein.«
»Und was soll ich jetzt tun? Was soll ich machen? Die rechnet doch jede Lira mit mir ab!«, jammerte der Ragioniere und rang die Hände.
Ein Stockwerk weiter oben hörte man das verzweifelte Geheul von Mutter und Tochter Piccirillo und die scharfe Stimme Fazios:
»Gehen Sie zu Fuß runter! Ruhe! Zu Fuß!«
Türen gingen auf, laute Fragen flogen von Stockwerk zu Stockwerk:
»Wer ist da verhaftet worden? Die Piccirillos sind verhaftet? Nehmen sie sie mit? Kommen sie ins Gefängnis?«
Als Fazio an ihm vorbeiging, drückte Montalbano ihm zehntausend Lire in die Hand:
»Wenn du die beiden ins Büro gebracht hast, kaufst du eine Flasche Corvo bianco und gibst sie dem Signore da.« Bei der Befragung der übrigen Mieter erfuhr Montalbano nichts von Bedeutung. Der Einzige, der etwas Nennenswertes zu sagen hatte, war der Grundschullehrer Bonavia aus dem dritten Stock. Er erklärte dem Commissario, dass sein achtjähriger Sohn Matteo hingefallen war und sich die Nase blutig geschlagen hatte, als er sich auf den Weg zur Schule machen wollte. Weil das Nasenbluten nicht aufhörte, hatte er ihn in die Notaufnahme gebracht. Das war um halb acht, und im Fahrstuhl war keine Spur von Signor Lapecora gewesen, weder lebendig noch tot.
Lapecora war als Leiche Aufzug gefahren, so viel stand fest. Außerdem glaubte Montalbano zu wissen, dass der Verstorbene ein anständiger, aber grundunsympathischer Mensch gewesen und offensichtlich zwischen sieben Uhr fünfunddreißig und acht in dem Fahrstuhl umgebracht worden war.
Wenn der Mörder das Risiko eingegangen war, von einem Hausbewohner mit dem Toten im Fahrstuhl überrascht zu werden, dann bedeutete dies, dass er nicht vorsätzlich, sondern im Affekt gehandelt hatte.
Das war nicht viel, und der Commissario dachte eine Weile über diese Erkenntnisse nach. Dann sah er auf die Uhr. Es war schon zwei! Kein Wunder, dass er einen solchen Hunger hatte. Er rief Fazio an.
»Ich geh zu Calogero zum Essen. Wenn Augello inzwischen kommt, schick ihn zu mir. Ach ja, noch was: Stell einen zur Wache vor der Wohnung des Toten ab. Er soll sie nicht reinlassen, bevor ich nicht zurück bin.«
»Wen?«
»Die Witwe, Signora Lapecora. Sind die beiden Piccirillos noch da?«
»Sissi, Dottore.«
»Schick sie nach Hause.«
»Und was soll ich ihnen sagen?«
»Dass wir weiter ermitteln. Die sollen ruhig ein bisschen Schiss haben, diese anständigen Leute.«
Drei
»Was darf ich Ihnen heute bringen?«
»Was gibt’s denn?«
»Als ersten Gang was Sie wollen.«
»Als ersten Gang gar nichts, ich muss auf meine Linie achten.«
»Als zweiten hätte ich alalonga in agrodolce und nasello in sarsa d’acciughi.«
»Hast du’s jetzt mit der Haute Cuisine, Calò?«
»Manchmal überkommt es mich.«
»Bring mir eine ordentliche Portion nasello. Ach ja, und bis der fertig ist, nehme ich noch einen großen Teller antipasto di mare.«
Ihm kamen Zweifel. Handelte es sich bei einem antipasto di mare um leichte Kost? Er überging die Antwort und warf einen Blick in die Zeitung. Die kleine Haushaltskorrektur, die die Regierung mal wieder vornehmen wollte, sollte sich nicht auf fünfzehn, sondern auf zwanzig Billionen belaufen. Bestimmt würde manches teurer werden, unter anderem Benzin und Zigaretten. Die Arbeitslosigkeit im Süden hatte eine Quote erreicht, die man besser nicht publik machte. Die Lega Nord hatte nach dem Steuerstreik beschlossen, als ersten Schritt auf dem Weg zur Spaltung die Prefetti abzusetzen. Dreißig Jungen aus einem Dorf bei Neapel hatten ein äthiopisches Mädchen vergewaltigt, das ganze Dorf verteidigte die Jugendlichen, die Negerin sei nicht nur eine Negerin, sondern auch eine Hure. Ein achtjähriger Junge hatte sich erhängt. Drei Dealer, im Durchschnitt zwölf Jahre alt, waren verhaftet worden. Eine Zwanzigjährige hatte Russisches Roulette gespielt und sich das Gehirn zerfetzt. Ein Achtzigjähriger hatte aus Eifersucht …
»Bitte sehr, Ihr antipasto.«