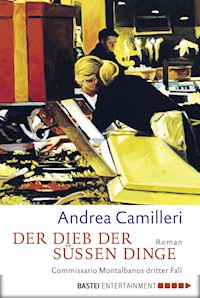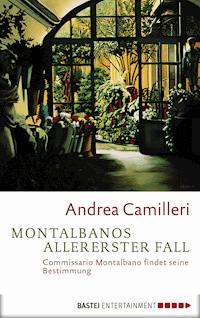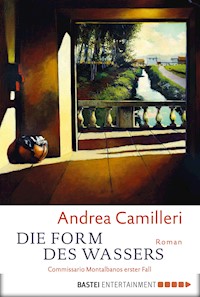
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
Commissario Salvo Montalbano aus Sizilien ist der Star unter den Mordkommissaren der internationalen Krimiliteratur: ein liebenswerter Eigenbrötler mit einer Vorliebe für schöne Frauen und gutes Essen. Aber auch jemand, der "seine" Sizilianer kennt und mit südlicher Nonchalance und nüchternem Realitätssinn die vertracktesten Fälle löst - und deshalb schon bald das raffiniert inszenierte Spiel um den Fall Luparello durchschaut ... Commissario Montalbano löst seinen ersten Fall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Anmerkung des Autors
Anmerkungen der Übersetzerin
Über den Autor
Andrea Camilleri, geboren 1925 in dem sizilianischen Küstenstädtchen Porto Empedocle, ist Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und lehrt seit über zwanzig Jahren an der Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico in Rom. Mit seinem vielfach ausgezeichneten literarischen Werk löste er in Italien eine Begeisterung aus, die DIE WELT treffend als »Camillerimania« bezeichnete.
Neben seinen historischen Romanen waren es vor allem die Kriminalromane um Commissario Salvo Montalbano, die ihn zum gefeierten Bestsellerautor machten.
Andrea Camilleri
Die Form des Wassers
Commissario Montalbano löstseinen ersten Fall
Aus dem Italienischen vonSchahrzad Assemi
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der italienischen Originalausgabe:
LA FORMA DELL’ACQUA,
erschienen bei Sellerio Editore, Palermo
© 1994 by Sellerio Editore, Palermo
© für die deutschsprachige Ausgabe 1999 by:
Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright Cover © corbis/A. Belov
Umschlaggestaltung: Marina Boda
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0327-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Eins
Noch drang kein Schimmer heraufdämmernden Morgens in den Hof der Firma »Splendor«, die für die Müllabfuhr von Vigàta zuständig war. Eine tiefhängende, dichte Wolkendecke überzog lückenlos den Himmel, als hätte man von einem Dachgesims zum anderen eine graue Plane gespannt. Kein Blatt regte sich. Der Schirokko wollte nicht aus seinem bleiernen Schlaf erwachen. Schon das geringste Wort strengte an. Bevor der Fuhrmeister die Arbeit einteilte, gab er bekannt, daß an diesem und an allen weiteren Tagen Peppe Schèmmari und Caluzzo Brucculeri entschuldigt fehlen würden. Ihre Abwesenheit war in der Tat entschuldigt: Die beiden waren am Abend zuvor bei einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt verhaftet worden. Die verwaiste Stelle, die Peppe und Caluzzo hinterließen, wies der Fuhrmeister Pino Catalano und Saro Montaperto zu, zwei jungen Landvermessern, die als solche, wie es sich gehörte, arbeitslos waren, dank der herzigen Fürsprache des Abgeordneten Cusumano aber als Hilfsumweltpfleger eingestellt worden waren. Dessen Wahlkampagne hatten die beiden mit Leib und Seele unterstützt (und zwar genau in dieser Reihenfolge, da der Leib weitaus mehr tat, als der Seele lieb war). Ihnen wurde das als Mànnara bezeichnete Gebiet zugeteilt, so genannt, weil dort vor undenklichen Zeiten angeblich ein Hirte seine Ziegen gehütet hatte. Die Mànnara war ein breiter Streifen mediterraner Macchia am Rande des Städtchens, zwischen dem Meeresstrand und den baulichen Überresten einer großen Chemiefabrik, die der allgegenwärtige Abgeordnete Cusumano eingeweiht hatte, als ein neuer, frischer Wind wehte, der eine glänzende und vielversprechende Zukunft zu verheißen schien. Aber jener Wind war schnell zu einer leichten Brise abgeflaut und schließlich gänzlich abgeklungen: Allerdings hatte er größere Schäden angerichtet als ein Tornado, indem er ein Heer von Kurzarbeitern und Arbeitslosen hinterließ. Um zu verhindern, daß die im Ort umherstreichenden Scharen von Schwarzen und weniger Schwarzen, von Senegalesen und Algeriern, Tunesiern und Libyern sich in der Fabrik einnisteten, hatte man rundherum eine hohe Mauer gezogen, hinter der die von Unwettern, Meeressalz und allgemeiner Vernachlässigung angefressenen Bauten weiterhin emporragten und dabei mehr und mehr aussahen wie die Architektur eines Gaudí im Drogenrausch.
Die Mànnara hatte bis vor kurzer Zeit bei allen, die sich vormals schlicht und einfach als Müllmänner bezeichneten, als ausgesprochen ruhiger Posten gegolten: Inmitten von Papierfetzen, Plastiktüten, Bier- und Coca-Cola-Dosen, unzureichend zugedeckter oder einfach im Wind stehengelassener Scheißhaufen tauchte hin und wieder ein verirrtes Präservativ auf. Dazu konnte sich dann einer, wenn er Lust und Phantasie hatte, seine Gedanken machen und sich das entsprechende Schäferstündchen in allen Einzelheiten ausmalen. Seit einem Jahr jedoch lagen hier die Präservative herum wie der Sand am Meer. Angefangen hatte es, als ein Minister mit einem finsteren und verschlossenen Gesicht, das Lombroso alle Ehre gemacht hätte, aus Überlegungen heraus, die noch finsterer und verschlossener waren als sein Gesicht, eine Idee gebar, die ihm als die Lösung der Probleme der öffentlichen Ordnung im Süden erschien. Diese Idee teilte er seinem Kollegen mit, der der Armee angehörte und aussah, als wäre er einer Illustration aus Carlo Collodis Pinocchio entsprungen. Schließlich und endlich entschieden die beiden, zur »Kontrolle des Territoriums« einige Militäreinheiten nach Sizilien zu entsenden. Diese sollten als Unterstützung dienen für Carabinieri, Polizisten, Informationsdienste, Sonderkommandos, für Steuerfahnder, Straßenpolizei, Bahnpolizei, Hafenpolizei, für Angehörige der Sonderstaatsanwaltschaft, Antimafia- und Antiterrorgruppen, für das Drogen- und Raubdezernat, das Anti-Entführungskommando und für weitere Organe, die sich ganz anderen Tätigkeiten verschrieben hatten. Als Folge dieses großartigen Einfalls der beiden herausragenden Staatsmänner mußten sich Söhne piemontesischer Mütter, flaumbärtige Rekruten aus dem Friaul, die sich tags zuvor noch an der frischen und rauhen Luft ihrer Berge gelabt hatten, über Nacht an klimatische Bedingungen gewöhnen, in denen es sich nur mühsam atmete. Sie richteten sich in ihren prov isorischen Unterkünften ein, in Ortschaften, die, wenn überhaupt, einen Meter über dem Meeresspiegel lagen, inmitten von Leuten, die einen unverständlichen Dialekt sprachen, der mehr aus Schweigen denn aus Worten bestand, mehr aus einem schwer entzifferbaren Runzeln der Augenbrauen und einer unmerklichen Kräuselung der Gesichtsfalten. Dank ihrer Jugend paßten die Soldaten sich an, so gut sie eben konnten. Unterstützung bekamen sie im wesentlichen von den Einwohnern Vigàtas selbst, die von der Hilflosigkeit und Verwirrtheit in den Gesichtern der fremden Jünglinge gerührt waren. Daß ihr unfreiwilliges Exil jedoch ein wenig erträglich wurde, dafür sorgte Gegè Gulotta, ein Mann von schöpferischem Geist, der bis dahin seine natürliche Begabung zum Kuppler hatte unterdrücken müssen und sich als kleiner Dealer weicher Drogen verdingt hatte. Nachdem er über ebenso krumme wie amtliche Wege von der bevorstehenden Ankunft der Soldaten erfahren hatte, durchzuckte Gegè ein Geistesblitz.
Um seine geniale Idee in die Tat umzusetzen, empfahl er sich umgehend dem Wohlwollen des Zuständigen, um die unzähligen und komplizierten, aber unumgänglichen Genehmigungen zu erhalten. Dem Zuständigen, das heißt demjenigen, der das Gebiet tatsächlich kontrollierte und nicht einmal im Traum daran dachte, Bewilligungen auf Stempelpapier zu erteilen. Kurz, Gegè konnte an der Mànnara seinen auf frisches Fleisch und eine reiche Auswahl an weichen Drogen spezialisierten Markt eröffnen. Das Frischfleisch kam zum größten Teil aus osteuropäischen Ländern, nun endlich vom kommunistischen Joch befreit, das, wie jeder weiß, dem menschlichen Wesen jegliche Würde absprach, und zwischen den Sträuchern und am Sandstrand der Mànnara strahlte die zurückeroberte Würde in neuem Glanze. Allerdings fehlte es auch nicht an Evas aus der Dritten Welt, an Transvestiten, Transsexuellen, neapolitanischen Schwuchteln und brasilianischen Viados – für jeden Geschmack war etwas dabei, eine einzige Pracht, ein riesiges Fest. Und der Handel blühte, zur großen Befriedigung der Soldaten, Gegès und desjenigen, der sich mit Gegè über die Formalitäten geeinigt hatte und als Gegenleistung die gerechte prozentuale Beteiligung am Gewinn forderte.
Pino und Saro machten sich auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Jeder schob seinen Karren vor sich her. Bis zur Mànnara brauchte man eine knappe halbe Stunde, wenn man so langsam ging wie die beiden. Die erste Viertelstunde verbrachten sie stumm. Schon waren sie vollkommen verschwitzt und verklebt. Dann brach Saro das Schweigen.
»Dieser Pecorilla ist ein Drecksack«, verkündete er.
»Ein elender Drecksack«, bekräftigte Pino.
Pecorilla war der Fuhrmeister, der für die Zuteilung der zu reinigenden Bezirke zuständig war und unübersehbar einen tiefen Haß gegen jeden nährte, der studiert hatte. Ihm selbst hatte man erst mit vierzig Jahren seinen Schulabschluß bescheinigt, und das auch nur, weil Cusumano mit dem Lehrer ein ernstes Wort gesprochen hatte. Deswegen drehte er es so, daß die erniedrigendste und schwerste Arbeit immer auf den Schultern der drei Diplomierten lastete, die er in seiner Truppe hatte. An diesem Morgen hatte er Ciccu Loreto den Abschnitt der Mole zugewiesen, an dem das Postschiff zur Insel Lampedusa ablegte. Das hieß im Klartext, daß Ciccu, seines Zeichens Buchhalter, mit Zentnern von Abfällen würde rechnen müssen, die lärmende Touristenschwärme, getrennt durch verschiedene Sprachen, aber vereint in der totalen Verachtung persönlicher und öffentlicher Sauberkeit, in Erwartung der Einschiffung am Samstag und Sonntag zurückgelassen hatten. Und Pino und Saro würden an der Mànnara das ganze Durcheinander vorfinden, das die Soldaten während ihres zweitägigen Ausgangs veranstaltet hatten.
Als sie an die Kreuzung der Via Lincoln mit der Viale Kennedy kamen (in Vigàta gibt es auch einen Eisenhower-Hof und eine Roosevelt-Gasse), blieb Saro stehen. »Ich geh’ schnell auf einen Sprung nach Hause, um zu sehen, wie’s dem Kleinen geht«, sagte er zu seinem Freund. »Wart auf mich, dauert nur eine Minute.«
Ohne Pinos Antwort abzuwarten, schlüpfte er durch die Haustür in einen jener zwergenhaften Wolkenkratzer, die, allerhöchstens zwölf Stockwerke hoch, zur gleichen Zeit wie die Chemiefabrik entstanden waren und ebenso wie diese alsbald völlig heruntergekommen, wenn nicht gar verlassen dastanden. Wer vom Meer her nach Vigàta kam, dem präsentierte sich das Städtchen wie eine Parodie von Manhattan im verkleinerten Maßstab. Der kleine Nenè war wach. Er schlief, wenn überhaupt, nur zwei Stunden pro Nacht, die restliche Zeit lag er mit weitaufgerissenen Augen in seinem Bettchen, ohne auch nur ein einziges Mal zu weinen. Aber wer hätte je von Babies gehört, die niemals schreien? Tag auf Tag verzehrte ihn eine Krankheit, von der man weder die Ursache noch die Behandlungsmethode kannte. Die Ärzte von Vigàta wußten sich keinen Rat, man hätte den Kleinen woanders hinbringen müssen, zu irgendeinem berühmten Spezialisten, aber es fehlte an Geld. Kaum kreuzte sein Blick den des Vaters, verfinsterte sich Nenès Gesicht, legte sich eine Falte quer über seine Stirn. Er konnte nicht sprechen, aber der stumme Vorwurf an denjenigen, der ihm jene Fessel angelegt hatte, war als Aussage deutlich genug.
»Es geht ihm ein bißchen besser, das Fieber geht zurück«, sagte Tana, seine Frau, nur um Saro ein wenig aufzuheitern.
Der Himmel hatte sich aufgeklärt, die Sonne brannte erbarmungslos, nun herrschte eine Gluthitze. Saro hatte seine Karre schon ein dutzendmal auf der Müllkippe entladen, die auf eine Privatinitiative hin am früheren Hinterausgang der Fabrik entstanden war. Der Rücken tat ihm höllisch weh. Als er in Reichweite eines Feldweges kam, der an der Schutzmauer entlanglief und in die Landstraße einmündete, sah er etwas hell Glitzerndes auf dem Boden liegen. Er bückte sich, um genauer hinzuschauen. Es war ein Anhänger in Herzform, riesig, mit Brillanten besetzt. In der Mitte prangte ein auffallend großer Diamant. Er hing noch an der Halskette aus Massivgold, die an einer Stelle gerissen war. Blitzartig schnellte Saros Rechte nach vorn, ergriff die Kette und ließ sie in der Hosentasche verschwinden. Die rechte Hand: die, so meinte Saro, wie aus eigenen Stücken gehandelt hatte, ohne daß das Gehirn, von dem überraschenden Fund noch völlig benommen, ihr irgendeinen Befehl gegeben hätte. Schweißgebadet richtete er sich wieder auf und blickte sich um, aber es war keine Menschenseele zu sehen.
Pino, der sich das näher am Sandstrand gelegene Stück der Mànnara ausgesucht hatte, bemerkte plötzlich die Schnauze eines Autos, die in etwa zwanzig Metern Entfernung aus den Sträuchern herausragte, wo die Macchia dichter war als andernorts. Er blieb wie angewurzelt stehen. Es konnte doch unmöglich sein, daß jemand um diese Uhrzeit, morgens um sieben, immer noch mit einer Nutte zugange war. Er pirschte sich vorsichtig an, setzte zaghaft einen Fuß vor den anderen, den Oberkörper vornübergebeugt. Als er auf der Höhe der Scheinwerfer angekommen war, richtete er sich auf. Es geschah nichts, niemand, der ihm zugerufen hätte, er solle sich gefälligst um seinen eigenen Kram kümmern. Das Auto wirkte verlassen. Er wagte sich noch näher heran, und schließlich erblickte er die Gestalt eines Mannes, der reglos auf dem Beifahrersitz saß, den Kopf nach hinten gelehnt. Man hätte glauben können, er schliefe tief und fest. Aber Pino hatte den dunklen Verdacht, ja, spürte es plötzlich körperlich, daß da irgend etwas nicht stimmte. Er drehte sich um und rief aufgeregt nach Saro. Dieser kam keuchend und mit schreckgeweiteten Augen herbeigeeilt.
»Was is’n los? Was zum Teufel hast du? Was ist denn in dich gefahren?«
Pino glaubte eine gewisse Aggressivität aus den Fragen des Freundes herauszuhören, schrieb dies aber der Hast zu, mit der jener herbeigerannt war.
»Schau mal da hin.«
Pino nahm all seinen Mut zusammen, näherte sich der Fahrerseite und versuchte, die Wagentür zu öffnen, was ihm aber nicht gelang, da der Sicherheitsknopf hinuntergedrückt war. Mit Saros Hilfe, der sich einigermaßen beruhigt zu haben schien, versuchte er die Tür auf der Beifahrerseite zu erreichen, an der der Körper des Mannes seitlich lehnte. Aber er schaffte es nicht, weil das Auto, ein großer grüner BMW, so nah am Gestrüpp stand, daß sich von dieser Seite her niemand hätte nähern können. Als die beiden sich jedoch über die Brombeersträucher hinweg nach vorn beugten, wobei sie sich gehörig zerkratzten, konnten sie das Gesicht des Mannes besser sehen. Er schlief nicht. Er hielt die Augen offen, den Blick ins Leere gerichtet. Im selben Moment, in dem ihnen klar wurde, daß der Mann tot war, blieben Pino und Saro vor Schreck wie versteinert stehen – nicht wegen der Leiche, der sie gegenüberstanden, sondern weil sie den Toten erkannt hatten.
»Ich komm’ mir vor wie in einer Sauna«, stöhnte Saro, während er mit Pino die Landstraße entlang zu einer Telefonzelle lief. »Einmal ist mir kalt, dann ist mir wieder heiß.«
Kaum hatten sie sich von dem Schreck erholt, der ihnen in die Glieder gefahren war, nachdem sie den Toten erkannt hatten, einigten sie sich über das weitere Vorgehen: Bevor sie la liggi, das Gesetz in Gestalt der Polizei, verständigen wollten, galt es noch einen anderen Anruf zu tätigen. Die Nummer des Abgeordneten Cusumano wußten sie auswendig. Saro wählte, doch Pino fuhr dazwischen, ehe es auch nur einmal geläutet hatte.
»Leg sofort wieder auf«, sagte er bestimmt.
Saro folgte aufs Wort.
»Hast du etwas dagegen, daß wir ihm Bescheid geben?« »Laß uns noch mal kurz nachdenken, die Sache ist wichtig. Also, du weißt genausogut wie ich, daß der Abgeordnete nichts als ein pupo ist.«
»Und was heißt das im Klartext?«
»Daß er eine Marionette des Ingegnere Luparello ist, der alle Fäden in der Hand hält, oder besser gesagt, hielt. Mit Luparellos Tod ist Cusumano ein Nichts, eine Niete.«
»Ja und?«
»Nichts und.«
Sie machten sich auf nach Vigàta, aber nach ein paar Schritten hielt Pino seinen Freund mit einer brüsken Armbewegung an.
»Rizzo«, stieß er hervor.
»Den ruf ’ ich nicht an, da hab’ ich Schiß, den kenn’ ich nicht.«
»Ich auch nicht, aber ich ruf ’ ihn trotzdem an.«
Pino ließ sich die Telefonnummer von der Auskunft geben. Es war erst Viertel vor acht, aber Rizzo antwortete gleich nach dem ersten Läuten.
»Avvocato Rizzo?«
»Am Apparat.«
»Entschuldigen Sie, Avvocato, daß ich Sie um diese Uhrzeit störe, wo … aber wir haben den Ingegnere Luparello gefunden … sieht aus, als wäre er tot.«
Es trat eine Pause ein. Dann sprach Rizzo.
»Und warum erzählen Sie mir das?«
Pino runzelte die Stirn. Mit allem hatte er gerechnet, nur nicht mit dieser Antwort. Sie kam ihm höchst eigenartig vor.
»Wie? Sind Sie denn nicht … sein bester Freund? Wir haben es für unsere Pflicht gehalten …«
»Ich danke euch. Aber zuallererst solltet ihr eurer Pflicht als ordentliche Bürger nachkommen. Guten Tag.«
Wange an Wange mit Pino hatte Saro das Gespräch mitgehört. Die beiden sahen sich erstaunt an. Rizzo hatte reagiert, als hätten sie ihm von der Leiche irgendeines Unbekannten erzählt.
»Also, so ’n Idiot, schließlich war er doch mit ihm befreundet, oder etwa nicht?« raunzte Saro.
»Woher wollen wir das wissen? Wäre doch möglich, daß sie sich in letzter Zeit zerstritten haben«, tröstete sich Pino.
»Und was machen wir jetzt?«
»Jetzt tun wir unsere Pflicht als ordentliche Bürger, wie der Avvocato es nennt«, schloß Pino.
Sie gingen auf das Städtchen zu, in Richtung Kommissariat. Sich an die Carabinieri zu wenden wäre ihnen nicht einmal im Traum eingefallen. Dort führte ein Mailänder Oberleutnant das Regiment. Der Kommissar hingegen stammte aus Catania und hieß Salvo Montalbano. Und wenn der etwas verstehen wollte, dann verstand er es auch.
Zwei
»Noch mal.«
»Nein«, sagte Livia und sah ihn mit leidenschaftlich glühenden Augen an.
»Ich bitte dich!«
»Nein, ich habe nein gesagt.«
»Ich mag es gerne, wenn ich ein wenig gezwungen werde«, so hatte sie ihm, erinnerte er sich, einmal ins Ohr geflüstert.
Damals hatte er in seiner Erregung sein Knie zwischen ihre geschlossenen Schenkel gezwängt, während er mit eisernem Griff ihre Handgelenke umfaßt hielt und ihre Arme auseinanderriß, bis sie wie eine Gekreuzigte dalag.
Sie sahen einander kurz in die Augen, atemlos, dann erlag sie ihm plötzlich.
»Ja«, hauchte sie. »Ja! Jetzt!«
Und genau in diesem Moment klingelte das Telefon. Ohne die Augen zu öffnen, streckte Montalbano einen Arm aus, weniger um nach dem Hörer zu greifen als nach den wallenden Enden des Traumes, der erbarmungslos dahinschwand.
»Pronto!« Er war wütend auf den Störenfried.
»Commissario, wir haben einen Kunden.« Er erkannte die Stimme des Brigadiere Fazio; sein ranggleicher Kollege, Tortorella, lag noch im Krankenhaus wegen eines scheußlichen Bauchschusses, den ihm einer verpaßt hatte, der sich als Mafioso aufspielen wollte, in Wirklichkeit aber nur ein miserabler Dreckskerl war, keinen Pfifferling wert. In ihrem Jargon war ein Kunde ein Toter, um den sie sich kümmern mußten.
»Wer ist es?«
»Das wissen wir noch nicht.«
»Wie haben sie ihn umgebracht?«
»Wissen wir nicht. Besser gesagt, wir wissen nicht mal, ob er überhaupt umgebracht wurde.«
»Brigadiere, ich glaub’, ich hör’ nicht recht. Du weckst mich hier in aller Herrgottsfrühe, ohne auch nur den leisesten Schimmer von irgendwas zu haben?«
Er atmete tief durch, um seine Wut zu bezähmen, die sinnlos war und die der andere mit Engelsgeduld ertrug. »Wer hat ihn gefunden?«
»Zwei Müllmänner, an der Mànnara, in einem Auto.«
»Bin gleich da. Ruf du inzwischen in Montelusa an, laß den Erkennungsdienst kommen und sag dem Richter Lo Bianco Bescheid.«
Während er unter der Dusche stand, kam er zu dem Schluß, daß der Tote ein Angehöriger des Cuffaro-Clans aus Vigàta sein mußte. Vor acht Monaten hatte sich, wahrscheinlich wegen irgendwelcher Revierstreitigkeiten, ein grausamer Krieg zwischen den Cuffaros und den Sinagras aus Fela entzündet; ein Toter pro Monat, abwechselnd und in schöner Folge: einer in Vigàta und einer in Fela. Der letzte, ein gewisser Mario Salino, war in Fela von den Vigàtesern erschossen worden. Infolgedessen mußte es diesmal einen Cuffaro erwischt haben. Bevor Montalbano sich auf den Weg machte – er wohnte in einem kleinen Haus am Strand auf der anderen Seite der Mànnara –, hatte er auf einmal Lust, Livia in Genua anzurufen. Sie war gleich am Apparat, noch ganz schlaftrunken.
»Entschuldige, aber ich wollte deine Stimme hören.«
»Ich habe gerade von dir geträumt«, sagte sie träge und fügte hinzu: »Du warst bei mir.«
Montalbano wollte sagen, daß auch er von ihr geträumt hatte, aber ein absurdes Schamgefühl hielt ihn zurück. Statt dessen fragte er: »Und was haben wir gemacht?«
»Das, was wir schon allzulange nicht mehr gemacht haben.«
Im Kommissariat traf Montalbano außer dem Brigadiere nur drei Beamte an. Die anderen waren hinter dem Besitzer eines Bekleidungsgeschäftes her, der wegen einer Erbschaftsangelegenheit auf seine Schwester geschossen hatte und dann abgehauen war.
Er öffnete die Tür der Arrestzelle. Die beiden Müllmänner saßen dicht nebeneinander auf der Bank. Trotz der Hitze hatten sie blasse Gesichter.
»Kleinen Moment noch, ich komm’ gleich wieder.« Die beiden enthielten sich jeden Kommentars und blickten gottergeben drein. Schließlich war bekannt, daß sich die Sache in die Länge zog, wenn man es, warum auch immer, mit dem Gesetz zu tun hatte.
»Hat irgendeiner von euch die Reporter informiert?« fragte der Commissario seine Leute. Sie winkten verneinend ab.
»Ich warne euch: Daß mir ja keiner von diesen Schmierfinken unter die Augen kommt.«
Schüchtern wagte sich Galluzzo nach vorne, hob zwei Finger, als wolle er um Erlaubnis bitten, austreten zu dürfen. »Nicht mal mein Schwager?«
Galluzzos Schwager war Journalist bei »Televigàta« und befaßte sich mit der Skandalchronik. Montalbano stellte sich schon den Familienstreit vor, wenn Galluzzo ihm nichts sagen würde. Galluzzo hatte tatsächlich einen herzerweichenden Hundeblick aufgesetzt.
»Na gut. Er soll aber erst kommen, wenn die Leiche weg ist. Und keine Fotografen.«
Sie fuhren mit dem Streifenwagen los. Giallombardo ließen sie als Wachtposten zurück. Am Steuer saß Gallo, ein Typ wie Galluzzo, der immer zu Späßen aufgelegt war, in der Art: »Na, Commissario, was gibt’s Neues im Hühnerstall?« Montalbano, der ihn nur zu gut kannte, verpaßte ihm einen Rüffel.
»Ras aber nicht wieder so, wir haben’s nicht eilig.«
In der Kurve nahe der Kirche des heiligen Karmel konnte Peppe Gallo sich nicht mehr zurückhalten und trat aufs Gas, daß die Reifen quietschten. Plötzlich gab es einen harten Knall wie ein Pistolenschuß, und der Wagen kam schleudernd zum Stehen.
Sie stiegen aus. Der rechte Hinterreifen hing zerfetzt an den Felgen. Er war sorgfältig mit einer scharfen Klinge aufgeschlitzt worden, die Schnitte waren noch deutlich zu erkennen.
»Diese Dreckskerle! Diese lausigen Hurensöhne!« explodierte der Brigadiere.
Montalbano kochte vor Wut.
»Ihr wißt doch ganz genau, daß sie uns alle zwei Wochen die Reifen aufschlitzen! Herrgott noch mal! Und jeden Morgen sage ich euch: Schaut sie euch an, bevor ihr losfahrt! Aber ihr schert euch ja einen Dreck darum, ihr Scheißer! Bis sich einer von uns irgendwann mal das Genick bricht!«
Nach einigem Hin und Her dauerte es letztlich gut zehn Minuten, bis der Reifen gewechselt war, und als sie die Mànnara erreichten, war der Erkennungsdienst von Montelusa bereits dort. Er befand sich in der, wie Montalbano es nannte, Meditationsphase. Das bedeutete, daß fünf oder sechs Beamte rund um die Stelle spazierten, wo das Auto stand, den Kopf leicht nach unten geneigt, die Hände in den Taschen vergraben oder auf dem Rücken verschränkt. Sie wirkten wie Philosophen, die in tiefgründige Gedanken versunken waren. In Wahrheit jedoch liefen sie mit wachen Augen umher, suchten den Boden nach einem Indiz, einer Spur, einem Fußabdruck ab. Kaum hatte Jacomuzzi, der Chef des Erkennungsdienstes, Montalbano entdeckt, eilte er ihm entgegen.
»Wieso sind eigentlich keine Reporter hier?«
»Dafür habe ich gesorgt.«
»Dieses Mal bringen sie dich ganz bestimmt um! Wie konntest du ihnen einen solchen Knüller vorenthalten?« Er war sichtlich nervös. »Weißt du, wer der Tote ist?«
»Nein. Aber du wirst es mir gleich sagen.«
»Es ist der Ingegnere Silvio Luparello.«
»Scheiße!« stieß Montalbano hervor. Es war seine einzige Bemerkung.
»Und weißt du, wie er ums Leben kam?«
»Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Ich schau’ mir das lieber selber an.«
Jacomuzzi kehrte beleidigt zu seinen Leuten zurück. Der Fotograf des Erkennungsdienstes war bereits fertig. Jetzt war Dottor Pasquano an der Reihe. Montalbano sah, daß der Arzt in einer unbequemen Position arbeiten mußte. Er steckte zur Hälfte im Auto und machte sich zwischen Beifahrer- und Fahrersitz zu schaffen, wo man eine dunkle Gestalt erkennen konnte. Fazio und die Beamten von Vigàta gingen den Kollegen von Montelusa zur Hand.
Der Commissario zündete sich eine Zigarette an, dann wandte er sich um und betrachtete die Chemiefabrik. Sie faszinierte ihn, diese Ruine. Er nahm sich vor, eines Tages zurückzukehren, um Fotos zu machen, die er dann Livia schicken würde. Er wollte ihr mit diesen Bildern ein paar Dinge von sich und seiner Heimat nahebringen, die sie noch nicht zu begreifen vermochte. Ihr fehlte der sizilianische Geist.
Indessen traf der Richter Lo Bianco ein. Aufgeregt stieg er aus dem Wagen.
»Stimmt es tatsächlich, daß der Tote der Ingegnere Luparello ist?«
Offensichtlich hatte Jacomuzzi keine Zeit verloren.
»Sieht ganz so aus.«
Der Richter gesellte sich zu den Leuten vom Erkennungsdienst, begann erregt mit Jacomuzzi und Dottor Pasquano zu sprechen, der eine Flasche Alkohol aus seiner Tasche gezogen hatte und sich die Hände desinfizierte. Nach einer Weile, die genügte, um Montalbano unter der Sonne garzukochen, stiegen die Männer vom Erkennungsdienst ins Auto und fuhren davon. Jacomuzzi fuhr grußlos an ihm vorbei. Montalbano hörte, wie die Sirene des Krankenwagens hinter ihm verstummte. Jetzt war er an der Reihe, er mußte zur Tat schreiten, da half kein Gott. Er schüttelte die Trägheit von sich ab, in der er sich schwitzend geräkelt hatte, und ging auf das Auto zu, in dem der Tote lag. Auf halber Strecke trat ihm der Richter entgegen.
»Die Leiche kann weggebracht werden, und angesichts des Bekanntheitsgrades des armen Ingegnere, je eher, desto besser. In jedem Fall halten Sie mich täglich auf dem laufenden, was den Fortgang der Ermittlungen anbelangt.«
Er hielt inne und fügte dann einschränkend hinzu: »Rufen Sie mich an, wann immer Sie es für erforderlich halten.«
Eine weitere Pause. Schließlich: »Natürlich zu den Bürozeiten, daß das klar ist.«
Montalbano ging davon. Zu den Bürozeiten, nicht daheim. Zu Hause, das war allbekannt, widmete sich der Richter Lo Bianco der Abfassung eines umfangreichen und aufwendigen Werkes: Leben und Unternehmungen Rinaldo und Antonio Lo Biancos, vereidigte Lehrmeister an der Universität von Girgenti zur Zeit König Martins des Jüngeren (1402–1409). Er hielt die beiden für seine, wenn auch recht nebulösen, Ahnen.
»Wie ist er gestorben?« erkundigte Montalbano sich beim Dottore.
»Sehen Sie selbst«, antwortete Pasquano und trat zur Seite.
Montalbano steckte den Kopf ins Auto, in dem die Gluthitze eines Ofens herrschte, erblickte zum ersten Mal die Leiche und mußte sogleich an den Polizeipräsidenten denken.
Der Polizeipräsident fiel ihm nicht etwa deswegen ein, weil es seine Gewohnheit gewesen wäre, an den Beginn seiner Ermittlung den Gedanken an den Dienstobersten zu stellen. Vielmehr hatte er mit dem alten Polizeipräsidenten Burlando, mit dem er befreundet war, vor etwa zehn Tagen über ein Buch von Philippe Ariès, Geschichte des Todes, gesprochen. Sie hatten es beide gelesen. Der Präsident war der Meinung gewesen, daß sich jeder Tod, selbst der elendeste, eine gewisse Heiligkeit bewahre. Montalbano hatte erwidert, und er hatte es ehrlich gemeint, daß er in keinem Tod, nicht einmal in dem eines Papstes, etwas Heiliges entdecken könne.
Er hätte ihn jetzt gerne an seiner Seite gehabt, den Herrn Polizeipräsidenten, damit dieser sehen könnte, was er, Montalbano, sah. Der Ingenieur Luparello war immer ein eleganter Mann gewesen, ausgesprochen gepflegt, was sein Äußeres anbelangte. Jetzt aber war er ohne Krawatte, das Hemd zerknittert, die Brille hing ihm schief auf der Nase, der Kragen des Jacketts war unziemlich hochgestellt, die Socken heruntergeschoben und so lose, daß sie über die Mokassins fielen. Was den Commissario aber am meisten schockierte, war die bis zu den Knien hinuntergelassene Hose, der Slip, der aus dem Innern der Hosen weiß herausleuchtete, und das zusammen mit dem Unterhemd bis zur Brust aufgerollte Hemd.