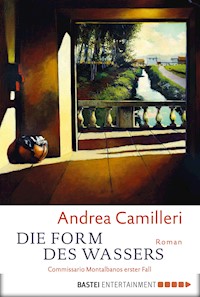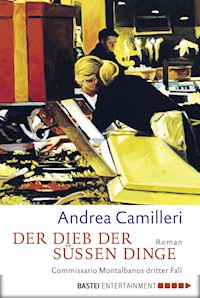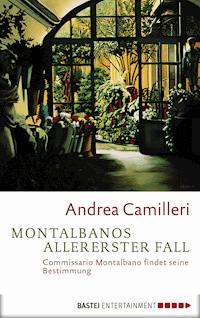4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
Commissario Montalbanos erster und zweiter Fall in einem E-Book!
Commissario Salvo Montalbano ist der neue Star unter den Mordkommissaren auf Sizilien - ein liebenswerter Eigenbrötler mit einer Vorliebe für schöne Frauen und gutes Essen. Aber auch jemand, der "seine" Sizilianer kennt und mit südlicher Nonchalance und nüchternem Realitätssinn die vertracktesten Fälle löst.
In "Die Form des Wassers" durchschaut der Commissario das raffiniert inszenierte Spiel um den Tod des Politikers Luparello und deckt ein Netz aus politischen, geschäftlichen und kriminellen Verbindungen auf.
"Der Hund aus Terracotta" ist der zweite Fall des Commissario in dem er einem Mord auf die Spur geht, der zunächst nur wie ein typisches Verbrechen der Mafia aussieht, sich aber zu einem komplizierten Fall entwickelt und ein fünfzig Jahre altes Verbrechen aufdeckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Die Form des Wassers
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Anmerkung des Autors
Anmerkungen der Übersetzerin
Der Hund aus Terracotta
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Anmerkung des Autors
Anmerkungen der Übersetzerin
Im Text erwähnte kulinarische Köstlichkeiten
Über dieses Buch
Commissario Salvo Montalbano ist der neue Star unter den Mordkommissaren auf Sizilien – ein liebenswerter Eigenbrötler mit einer Vorliebe für schöne Frauen und gutes Essen. Aber auch jemand, der "seine" Sizilianer kennt und mit südlicher Nonchalance und nüchternem Realitätssinn die vertracktesten Fälle löst.
In »Die Form des Wassers« durchschaut der Commissario das raffiniert inszenierte Spiel um den Tod des Politikers Luparello und deckt ein Netz aus politischen, geschäftlichen und kriminellen Verbindungen auf.
»Der Hund aus Terracotta« ist der zweite Fall des Commissario in dem er einem Mord auf die Spur geht, der zunächst nur wie ein typisches Verbrechen der Mafia aussieht, sich aber zu einem komplizierten Fall entwickelt und ein fünfzig Jahre altes Verbrechen aufdeckt.
Über den Autor
Andrea Camilleri, 1925 in dem sizilianischen Küstenstädtchen Porto Empedocle (Provinz Agrigento) geboren, arbeitete lange Jahre als Essayist, Drehbuchautor und Regisseur sowie als Dozent an der Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico in Rom. Dort lebt er mit seiner Frau Rosetta in dem Stadtteil Trastevere im Obergeschoss eines schmucken Palazzo, wobei er seinen Zweitwohnsitz in Porto Empedocle in Sizilien nie aufgegeben hat. Sein literarisches Werk, in dem er sich vornehmlich mit seiner Heimat Sizilien auseinandersetzt, umfasst mehrere historische Romane, darunter »La stagione della caccia«, 1992, »Il birraio di Preston«, 1995, und »La concessione del telefono«, 1998, sowie Kriminalromane. In seinem Heimatland Italien bricht er seit Jahren alle Verkaufsrekorde und hat auch bei uns ein begeistertes Publikum gefunden. Mit den Romanen um den Commissario Salvo Montalbano eroberte er auch die deutschen Leser im Sturm, und seine Hauptfigur gilt inzwischen weltweit als Inbegriff für sizilianische Lebensart, einfallsreiche Kriminalistik und südländischen Charme und Humor.
Andrea Camilleri
Die Form des WassersDer Hund aus Terracotta
Zwei Commissario Montalbano-Fälle in einem E-Book
Aus dem Italienischen von Schahrzad Assemi (»Die Form des Wassers«) und Christiane von Bechtolsheim (»Der Hund aus Terracotta«)
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
der in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werke »Die Form des Wassers« (© 1999) und »Der Hund aus Terracotta« (© 1999)
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgaben:
© 1994/1996 by Sellerio Editore, Palermo
Titel der italienischen Originalausgaben: »La forma dell'acqua« und »Il cane di terracotta«
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Projektmanagement: Nils Neumeier
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
unter Verwendung von Motiven von © Getty Images: Matthew Fidelibus | EyeEm ; © Shutterstock
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-1618-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Andrea Camilleri
Die Form des Wassers
Commissario Montalbano löstseinen ersten Fall
Aus dem Italienischen vonSchahrzad Assemi
Eins
Noch drang kein Schimmer heraufdämmernden Morgens in den Hof der Firma »Splendor«, die für die Müllabfuhr von Vigàta zuständig war. Eine tiefhängende, dichte Wolkendecke überzog lückenlos den Himmel, als hätte man von einem Dachgesims zum anderen eine graue Plane gespannt. Kein Blatt regte sich. Der Schirokko wollte nicht aus seinem bleiernen Schlaf erwachen. Schon das geringste Wort strengte an. Bevor der Fuhrmeister die Arbeit einteilte, gab er bekannt, daß an diesem und an allen weiteren Tagen Peppe Schèmmari und Caluzzo Brucculeri entschuldigt fehlen würden. Ihre Abwesenheit war in der Tat entschuldigt: Die beiden waren am Abend zuvor bei einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt verhaftet worden. Die verwaiste Stelle, die Peppe und Caluzzo hinterließen, wies der Fuhrmeister Pino Catalano und Saro Montaperto zu, zwei jungen Landvermessern, die als solche, wie es sich gehörte, arbeitslos waren, dank der herzigen Fürsprache des Abgeordneten Cusumano aber als Hilfsumweltpfleger eingestellt worden waren. Dessen Wahlkampagne hatten die beiden mit Leib und Seele unterstützt (und zwar genau in dieser Reihenfolge, da der Leib weitaus mehr tat, als der Seele lieb war). Ihnen wurde das als Mànnara bezeichnete Gebiet zugeteilt, so genannt, weil dort vor undenklichen Zeiten angeblich ein Hirte seine Ziegen gehütet hatte. Die Mànnara war ein breiter Streifen mediterraner Macchia am Rande des Städtchens, zwischen dem Meeresstrand und den baulichen Überresten einer großen Chemiefabrik, die der allgegenwärtige Abgeordnete Cusumano eingeweiht hatte, als ein neuer, frischer Wind wehte, der eine glänzende und vielversprechende Zukunft zu verheißen schien. Aber jener Wind war schnell zu einer leichten Brise abgeflaut und schließlich gänzlich abgeklungen: Allerdings hatte er größere Schäden angerichtet als ein Tornado, indem er ein Heer von Kurzarbeitern und Arbeitslosen hinterließ. Um zu verhindern, daß die im Ort umherstreichenden Scharen von Schwarzen und weniger Schwarzen, von Senegalesen und Algeriern, Tunesiern und Libyern sich in der Fabrik einnisteten, hatte man rundherum eine hohe Mauer gezogen, hinter der die von Unwettern, Meeressalz und allgemeiner Vernachlässigung angefressenen Bauten weiterhin emporragten und dabei mehr und mehr aussahen wie die Architektur eines Gaudí im Drogenrausch.
Die Mànnara hatte bis vor kurzer Zeit bei allen, die sich vormals schlicht und einfach als Müllmänner bezeichneten, als ausgesprochen ruhiger Posten gegolten: Inmitten von Papierfetzen, Plastiktüten, Bier- und Coca-Cola-Dosen, unzureichend zugedeckter oder einfach im Wind stehengelassener Scheißhaufen tauchte hin und wieder ein verirrtes Präservativ auf. Dazu konnte sich dann einer, wenn er Lust und Phantasie hatte, seine Gedanken machen und sich das entsprechende Schäferstündchen in allen Einzelheiten ausmalen. Seit einem Jahr jedoch lagen hier die Präservative herum wie der Sand am Meer. Angefangen hatte es, als ein Minister mit einem finsteren und verschlossenen Gesicht, das Lombroso alle Ehre gemacht hätte, aus Überlegungen heraus, die noch finsterer und verschlossener waren als sein Gesicht, eine Idee gebar, die ihm als die Lösung der Probleme der öffentlichen Ordnung im Süden erschien. Diese Idee teilte er seinem Kollegen mit, der der Armee angehörte und aussah, als wäre er einer Illustration aus Carlo Collodis Pinocchio entsprungen. Schließlich und endlich entschieden die beiden, zur »Kontrolle des Territoriums« einige Militäreinheiten nach Sizilien zu entsenden. Diese sollten als Unterstützung dienen für Carabinieri, Polizisten, Informationsdienste, Sonderkommandos, für Steuerfahnder, Straßenpolizei, Bahnpolizei, Hafenpolizei, für Angehörige der Sonderstaatsanwaltschaft, Antimafia- und Antiterrorgruppen, für das Drogen- und Raubdezernat, das Anti-Entführungskommando und für weitere Organe, die sich ganz anderen Tätigkeiten verschrieben hatten. Als Folge dieses großartigen Einfalls der beiden herausragenden Staatsmänner mußten sich Söhne piemontesischer Mütter, flaumbärtige Rekruten aus dem Friaul, die sich tags zuvor noch an der frischen und rauhen Luft ihrer Berge gelabt hatten, über Nacht an klimatische Bedingungen gewöhnen, in denen es sich nur mühsam atmete. Sie richteten sich in ihren prov isorischen Unterkünften ein, in Ortschaften, die, wenn überhaupt, einen Meter über dem Meeresspiegel lagen, inmitten von Leuten, die einen unverständlichen Dialekt sprachen, der mehr aus Schweigen denn aus Worten bestand, mehr aus einem schwer entzifferbaren Runzeln der Augenbrauen und einer unmerklichen Kräuselung der Gesichtsfalten. Dank ihrer Jugend paßten die Soldaten sich an, so gut sie eben konnten. Unterstützung bekamen sie im wesentlichen von den Einwohnern Vigàtas selbst, die von der Hilflosigkeit und Verwirrtheit in den Gesichtern der fremden Jünglinge gerührt waren. Daß ihr unfreiwilliges Exil jedoch ein wenig erträglich wurde, dafür sorgte Gegè Gulotta, ein Mann von schöpferischem Geist, der bis dahin seine natürliche Begabung zum Kuppler hatte unterdrücken müssen und sich als kleiner Dealer weicher Drogen verdingt hatte. Nachdem er über ebenso krumme wie amtliche Wege von der bevorstehenden Ankunft der Soldaten erfahren hatte, durchzuckte Gegè ein Geistesblitz.
Um seine geniale Idee in die Tat umzusetzen, empfahl er sich umgehend dem Wohlwollen des Zuständigen, um die unzähligen und komplizierten, aber unumgänglichen Genehmigungen zu erhalten. Dem Zuständigen, das heißt demjenigen, der das Gebiet tatsächlich kontrollierte und nicht einmal im Traum daran dachte, Bewilligungen auf Stempelpapier zu erteilen. Kurz, Gegè konnte an der Mànnara seinen auf frisches Fleisch und eine reiche Auswahl an weichen Drogen spezialisierten Markt eröffnen. Das Frischfleisch kam zum größten Teil aus osteuropäischen Ländern, nun endlich vom kommunistischen Joch befreit, das, wie jeder weiß, dem menschlichen Wesen jegliche Würde absprach, und zwischen den Sträuchern und am Sandstrand der Mànnara strahlte die zurückeroberte Würde in neuem Glanze. Allerdings fehlte es auch nicht an Evas aus der Dritten Welt, an Transvestiten, Transsexuellen, neapolitanischen Schwuchteln und brasilianischen Viados – für jeden Geschmack war etwas dabei, eine einzige Pracht, ein riesiges Fest. Und der Handel blühte, zur großen Befriedigung der Soldaten, Gegès und desjenigen, der sich mit Gegè über die Formalitäten geeinigt hatte und als Gegenleistung die gerechte prozentuale Beteiligung am Gewinn forderte.
Pino und Saro machten sich auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Jeder schob seinen Karren vor sich her. Bis zur Mànnara brauchte man eine knappe halbe Stunde, wenn man so langsam ging wie die beiden. Die erste Viertelstunde verbrachten sie stumm. Schon waren sie vollkommen verschwitzt und verklebt. Dann brach Saro das Schweigen.
»Dieser Pecorilla ist ein Drecksack«, verkündete er.
»Ein elender Drecksack«, bekräftigte Pino.
Pecorilla war der Fuhrmeister, der für die Zuteilung der zu reinigenden Bezirke zuständig war und unübersehbar einen tiefen Haß gegen jeden nährte, der studiert hatte. Ihm selbst hatte man erst mit vierzig Jahren seinen Schulabschluß bescheinigt, und das auch nur, weil Cusumano mit dem Lehrer ein ernstes Wort gesprochen hatte. Deswegen drehte er es so, daß die erniedrigendste und schwerste Arbeit immer auf den Schultern der drei Diplomierten lastete, die er in seiner Truppe hatte. An diesem Morgen hatte er Ciccu Loreto den Abschnitt der Mole zugewiesen, an dem das Postschiff zur Insel Lampedusa ablegte. Das hieß im Klartext, daß Ciccu, seines Zeichens Buchhalter, mit Zentnern von Abfällen würde rechnen müssen, die lärmende Touristenschwärme, getrennt durch verschiedene Sprachen, aber vereint in der totalen Verachtung persönlicher und öffentlicher Sauberkeit, in Erwartung der Einschiffung am Samstag und Sonntag zurückgelassen hatten. Und Pino und Saro würden an der Mànnara das ganze Durcheinander vorfinden, das die Soldaten während ihres zweitägigen Ausgangs veranstaltet hatten.
Als sie an die Kreuzung der Via Lincoln mit der Viale Kennedy kamen (in Vigàta gibt es auch einen Eisenhower-Hof und eine Roosevelt-Gasse), blieb Saro stehen. »Ich geh’ schnell auf einen Sprung nach Hause, um zu sehen, wie’s dem Kleinen geht«, sagte er zu seinem Freund. »Wart auf mich, dauert nur eine Minute.«
Ohne Pinos Antwort abzuwarten, schlüpfte er durch die Haustür in einen jener zwergenhaften Wolkenkratzer, die, allerhöchstens zwölf Stockwerke hoch, zur gleichen Zeit wie die Chemiefabrik entstanden waren und ebenso wie diese alsbald völlig heruntergekommen, wenn nicht gar verlassen dastanden. Wer vom Meer her nach Vigàta kam, dem präsentierte sich das Städtchen wie eine Parodie von Manhattan im verkleinerten Maßstab. Der kleine Nenè war wach. Er schlief, wenn überhaupt, nur zwei Stunden pro Nacht, die restliche Zeit lag er mit weitaufgerissenen Augen in seinem Bettchen, ohne auch nur ein einziges Mal zu weinen. Aber wer hätte je von Babies gehört, die niemals schreien? Tag auf Tag verzehrte ihn eine Krankheit, von der man weder die Ursache noch die Behandlungsmethode kannte. Die Ärzte von Vigàta wußten sich keinen Rat, man hätte den Kleinen woanders hinbringen müssen, zu irgendeinem berühmten Spezialisten, aber es fehlte an Geld. Kaum kreuzte sein Blick den des Vaters, verfinsterte sich Nenès Gesicht, legte sich eine Falte quer über seine Stirn. Er konnte nicht sprechen, aber der stumme Vorwurf an denjenigen, der ihm jene Fessel angelegt hatte, war als Aussage deutlich genug.
»Es geht ihm ein bißchen besser, das Fieber geht zurück«, sagte Tana, seine Frau, nur um Saro ein wenig aufzuheitern.
Der Himmel hatte sich aufgeklärt, die Sonne brannte erbarmungslos, nun herrschte eine Gluthitze. Saro hatte seine Karre schon ein dutzendmal auf der Müllkippe entladen, die auf eine Privatinitiative hin am früheren Hinterausgang der Fabrik entstanden war. Der Rücken tat ihm höllisch weh. Als er in Reichweite eines Feldweges kam, der an der Schutzmauer entlanglief und in die Landstraße einmündete, sah er etwas hell Glitzerndes auf dem Boden liegen. Er bückte sich, um genauer hinzuschauen. Es war ein Anhänger in Herzform, riesig, mit Brillanten besetzt. In der Mitte prangte ein auffallend großer Diamant. Er hing noch an der Halskette aus Massivgold, die an einer Stelle gerissen war. Blitzartig schnellte Saros Rechte nach vorn, ergriff die Kette und ließ sie in der Hosentasche verschwinden. Die rechte Hand: die, so meinte Saro, wie aus eigenen Stücken gehandelt hatte, ohne daß das Gehirn, von dem überraschenden Fund noch völlig benommen, ihr irgendeinen Befehl gegeben hätte. Schweißgebadet richtete er sich wieder auf und blickte sich um, aber es war keine Menschenseele zu sehen.
Pino, der sich das näher am Sandstrand gelegene Stück der Mànnara ausgesucht hatte, bemerkte plötzlich die Schnauze eines Autos, die in etwa zwanzig Metern Entfernung aus den Sträuchern herausragte, wo die Macchia dichter war als andernorts. Er blieb wie angewurzelt stehen. Es konnte doch unmöglich sein, daß jemand um diese Uhrzeit, morgens um sieben, immer noch mit einer Nutte zugange war. Er pirschte sich vorsichtig an, setzte zaghaft einen Fuß vor den anderen, den Oberkörper vornübergebeugt. Als er auf der Höhe der Scheinwerfer angekommen war, richtete er sich auf. Es geschah nichts, niemand, der ihm zugerufen hätte, er solle sich gefälligst um seinen eigenen Kram kümmern. Das Auto wirkte verlassen. Er wagte sich noch näher heran, und schließlich erblickte er die Gestalt eines Mannes, der reglos auf dem Beifahrersitz saß, den Kopf nach hinten gelehnt. Man hätte glauben können, er schliefe tief und fest. Aber Pino hatte den dunklen Verdacht, ja, spürte es plötzlich körperlich, daß da irgend etwas nicht stimmte. Er drehte sich um und rief aufgeregt nach Saro. Dieser kam keuchend und mit schreckgeweiteten Augen herbeigeeilt.
»Was is’n los? Was zum Teufel hast du? Was ist denn in dich gefahren?«
Pino glaubte eine gewisse Aggressivität aus den Fragen des Freundes herauszuhören, schrieb dies aber der Hast zu, mit der jener herbeigerannt war.
»Schau mal da hin.«
Pino nahm all seinen Mut zusammen, näherte sich der Fahrerseite und versuchte, die Wagentür zu öffnen, was ihm aber nicht gelang, da der Sicherheitsknopf hinuntergedrückt war. Mit Saros Hilfe, der sich einigermaßen beruhigt zu haben schien, versuchte er die Tür auf der Beifahrerseite zu erreichen, an der der Körper des Mannes seitlich lehnte. Aber er schaffte es nicht, weil das Auto, ein großer grüner BMW, so nah am Gestrüpp stand, daß sich von dieser Seite her niemand hätte nähern können. Als die beiden sich jedoch über die Brombeersträucher hinweg nach vorn beugten, wobei sie sich gehörig zerkratzten, konnten sie das Gesicht des Mannes besser sehen. Er schlief nicht. Er hielt die Augen offen, den Blick ins Leere gerichtet. Im selben Moment, in dem ihnen klar wurde, daß der Mann tot war, blieben Pino und Saro vor Schreck wie versteinert stehen – nicht wegen der Leiche, der sie gegenüberstanden, sondern weil sie den Toten erkannt hatten.
»Ich komm’ mir vor wie in einer Sauna«, stöhnte Saro, während er mit Pino die Landstraße entlang zu einer Telefonzelle lief. »Einmal ist mir kalt, dann ist mir wieder heiß.«
Kaum hatten sie sich von dem Schreck erholt, der ihnen in die Glieder gefahren war, nachdem sie den Toten erkannt hatten, einigten sie sich über das weitere Vorgehen: Bevor sie la liggi, das Gesetz in Gestalt der Polizei, verständigen wollten, galt es noch einen anderen Anruf zu tätigen. Die Nummer des Abgeordneten Cusumano wußten sie auswendig. Saro wählte, doch Pino fuhr dazwischen, ehe es auch nur einmal geläutet hatte.
»Leg sofort wieder auf«, sagte er bestimmt.
Saro folgte aufs Wort.
»Hast du etwas dagegen, daß wir ihm Bescheid geben?« »Laß uns noch mal kurz nachdenken, die Sache ist wichtig. Also, du weißt genausogut wie ich, daß der Abgeordnete nichts als ein pupo ist.«
»Und was heißt das im Klartext?«
»Daß er eine Marionette des Ingegnere Luparello ist, der alle Fäden in der Hand hält, oder besser gesagt, hielt. Mit Luparellos Tod ist Cusumano ein Nichts, eine Niete.«
»Ja und?«
»Nichts und.«
Sie machten sich auf nach Vigàta, aber nach ein paar Schritten hielt Pino seinen Freund mit einer brüsken Armbewegung an.
»Rizzo«, stieß er hervor.
»Den ruf ’ ich nicht an, da hab’ ich Schiß, den kenn’ ich nicht.«
»Ich auch nicht, aber ich ruf ’ ihn trotzdem an.«
Pino ließ sich die Telefonnummer von der Auskunft geben. Es war erst Viertel vor acht, aber Rizzo antwortete gleich nach dem ersten Läuten.
»Avvocato Rizzo?«
»Am Apparat.«
»Entschuldigen Sie, Avvocato, daß ich Sie um diese Uhrzeit störe, wo … aber wir haben den Ingegnere Luparello gefunden … sieht aus, als wäre er tot.«
Es trat eine Pause ein. Dann sprach Rizzo.
»Und warum erzählen Sie mir das?«
Pino runzelte die Stirn. Mit allem hatte er gerechnet, nur nicht mit dieser Antwort. Sie kam ihm höchst eigenartig vor.
»Wie? Sind Sie denn nicht … sein bester Freund? Wir haben es für unsere Pflicht gehalten …«
»Ich danke euch. Aber zuallererst solltet ihr eurer Pflicht als ordentliche Bürger nachkommen. Guten Tag.«
Wange an Wange mit Pino hatte Saro das Gespräch mitgehört. Die beiden sahen sich erstaunt an. Rizzo hatte reagiert, als hätten sie ihm von der Leiche irgendeines Unbekannten erzählt.
»Also, so ’n Idiot, schließlich war er doch mit ihm befreundet, oder etwa nicht?« raunzte Saro.
»Woher wollen wir das wissen? Wäre doch möglich, daß sie sich in letzter Zeit zerstritten haben«, tröstete sich Pino.
»Und was machen wir jetzt?«
»Jetzt tun wir unsere Pflicht als ordentliche Bürger, wie der Avvocato es nennt«, schloß Pino.
Sie gingen auf das Städtchen zu, in Richtung Kommissariat. Sich an die Carabinieri zu wenden wäre ihnen nicht einmal im Traum eingefallen. Dort führte ein Mailänder Oberleutnant das Regiment. Der Kommissar hingegen stammte aus Catania und hieß Salvo Montalbano. Und wenn der etwas verstehen wollte, dann verstand er es auch.
Zwei
»Noch mal.«
»Nein«, sagte Livia und sah ihn mit leidenschaftlich glühenden Augen an.
»Ich bitte dich!«
»Nein, ich habe nein gesagt.«
»Ich mag es gerne, wenn ich ein wenig gezwungen werde«, so hatte sie ihm, erinnerte er sich, einmal ins Ohr geflüstert.
Damals hatte er in seiner Erregung sein Knie zwischen ihre geschlossenen Schenkel gezwängt, während er mit eisernem Griff ihre Handgelenke umfaßt hielt und ihre Arme auseinanderriß, bis sie wie eine Gekreuzigte dalag.
Sie sahen einander kurz in die Augen, atemlos, dann erlag sie ihm plötzlich.
»Ja«, hauchte sie. »Ja! Jetzt!«
Und genau in diesem Moment klingelte das Telefon. Ohne die Augen zu öffnen, streckte Montalbano einen Arm aus, weniger um nach dem Hörer zu greifen als nach den wallenden Enden des Traumes, der erbarmungslos dahinschwand.
»Pronto!« Er war wütend auf den Störenfried.
»Commissario, wir haben einen Kunden.« Er erkannte die Stimme des Brigadiere Fazio; sein ranggleicher Kollege, Tortorella, lag noch im Krankenhaus wegen eines scheußlichen Bauchschusses, den ihm einer verpaßt hatte, der sich als Mafioso aufspielen wollte, in Wirklichkeit aber nur ein miserabler Dreckskerl war, keinen Pfifferling wert. In ihrem Jargon war ein Kunde ein Toter, um den sie sich kümmern mußten.
»Wer ist es?«
»Das wissen wir noch nicht.«
»Wie haben sie ihn umgebracht?«
»Wissen wir nicht. Besser gesagt, wir wissen nicht mal, ob er überhaupt umgebracht wurde.«
»Brigadiere, ich glaub’, ich hör’ nicht recht. Du weckst mich hier in aller Herrgottsfrühe, ohne auch nur den leisesten Schimmer von irgendwas zu haben?«
Er atmete tief durch, um seine Wut zu bezähmen, die sinnlos war und die der andere mit Engelsgeduld ertrug. »Wer hat ihn gefunden?«
»Zwei Müllmänner, an der Mànnara, in einem Auto.«
»Bin gleich da. Ruf du inzwischen in Montelusa an, laß den Erkennungsdienst kommen und sag dem Richter Lo Bianco Bescheid.«
Während er unter der Dusche stand, kam er zu dem Schluß, daß der Tote ein Angehöriger des Cuffaro-Clans aus Vigàta sein mußte. Vor acht Monaten hatte sich, wahrscheinlich wegen irgendwelcher Revierstreitigkeiten, ein grausamer Krieg zwischen den Cuffaros und den Sinagras aus Fela entzündet; ein Toter pro Monat, abwechselnd und in schöner Folge: einer in Vigàta und einer in Fela. Der letzte, ein gewisser Mario Salino, war in Fela von den Vigàtesern erschossen worden. Infolgedessen mußte es diesmal einen Cuffaro erwischt haben. Bevor Montalbano sich auf den Weg machte – er wohnte in einem kleinen Haus am Strand auf der anderen Seite der Mànnara –, hatte er auf einmal Lust, Livia in Genua anzurufen. Sie war gleich am Apparat, noch ganz schlaftrunken.
»Entschuldige, aber ich wollte deine Stimme hören.«
»Ich habe gerade von dir geträumt«, sagte sie träge und fügte hinzu: »Du warst bei mir.«
Montalbano wollte sagen, daß auch er von ihr geträumt hatte, aber ein absurdes Schamgefühl hielt ihn zurück. Statt dessen fragte er: »Und was haben wir gemacht?«
»Das, was wir schon allzulange nicht mehr gemacht haben.«
Im Kommissariat traf Montalbano außer dem Brigadiere nur drei Beamte an. Die anderen waren hinter dem Besitzer eines Bekleidungsgeschäftes her, der wegen einer Erbschaftsangelegenheit auf seine Schwester geschossen hatte und dann abgehauen war.
Er öffnete die Tür der Arrestzelle. Die beiden Müllmänner saßen dicht nebeneinander auf der Bank. Trotz der Hitze hatten sie blasse Gesichter.
»Kleinen Moment noch, ich komm’ gleich wieder.« Die beiden enthielten sich jeden Kommentars und blickten gottergeben drein. Schließlich war bekannt, daß sich die Sache in die Länge zog, wenn man es, warum auch immer, mit dem Gesetz zu tun hatte.
»Hat irgendeiner von euch die Reporter informiert?« fragte der Commissario seine Leute. Sie winkten verneinend ab.
»Ich warne euch: Daß mir ja keiner von diesen Schmierfinken unter die Augen kommt.«
Schüchtern wagte sich Galluzzo nach vorne, hob zwei Finger, als wolle er um Erlaubnis bitten, austreten zu dürfen. »Nicht mal mein Schwager?«
Galluzzos Schwager war Journalist bei »Televigàta« und befaßte sich mit der Skandalchronik. Montalbano stellte sich schon den Familienstreit vor, wenn Galluzzo ihm nichts sagen würde. Galluzzo hatte tatsächlich einen herzerweichenden Hundeblick aufgesetzt.
»Na gut. Er soll aber erst kommen, wenn die Leiche weg ist. Und keine Fotografen.«
Sie fuhren mit dem Streifenwagen los. Giallombardo ließen sie als Wachtposten zurück. Am Steuer saß Gallo, ein Typ wie Galluzzo, der immer zu Späßen aufgelegt war, in der Art: »Na, Commissario, was gibt’s Neues im Hühnerstall?« Montalbano, der ihn nur zu gut kannte, verpaßte ihm einen Rüffel.
»Ras aber nicht wieder so, wir haben’s nicht eilig.«
In der Kurve nahe der Kirche des heiligen Karmel konnte Peppe Gallo sich nicht mehr zurückhalten und trat aufs Gas, daß die Reifen quietschten. Plötzlich gab es einen harten Knall wie ein Pistolenschuß, und der Wagen kam schleudernd zum Stehen.
Sie stiegen aus. Der rechte Hinterreifen hing zerfetzt an den Felgen. Er war sorgfältig mit einer scharfen Klinge aufgeschlitzt worden, die Schnitte waren noch deutlich zu erkennen.
»Diese Dreckskerle! Diese lausigen Hurensöhne!« explodierte der Brigadiere.
Montalbano kochte vor Wut.
»Ihr wißt doch ganz genau, daß sie uns alle zwei Wochen die Reifen aufschlitzen! Herrgott noch mal! Und jeden Morgen sage ich euch: Schaut sie euch an, bevor ihr losfahrt! Aber ihr schert euch ja einen Dreck darum, ihr Scheißer! Bis sich einer von uns irgendwann mal das Genick bricht!«
Nach einigem Hin und Her dauerte es letztlich gut zehn Minuten, bis der Reifen gewechselt war, und als sie die Mànnara erreichten, war der Erkennungsdienst von Montelusa bereits dort. Er befand sich in der, wie Montalbano es nannte, Meditationsphase. Das bedeutete, daß fünf oder sechs Beamte rund um die Stelle spazierten, wo das Auto stand, den Kopf leicht nach unten geneigt, die Hände in den Taschen vergraben oder auf dem Rücken verschränkt. Sie wirkten wie Philosophen, die in tiefgründige Gedanken versunken waren. In Wahrheit jedoch liefen sie mit wachen Augen umher, suchten den Boden nach einem Indiz, einer Spur, einem Fußabdruck ab. Kaum hatte Jacomuzzi, der Chef des Erkennungsdienstes, Montalbano entdeckt, eilte er ihm entgegen.
»Wieso sind eigentlich keine Reporter hier?«
»Dafür habe ich gesorgt.«
»Dieses Mal bringen sie dich ganz bestimmt um! Wie konntest du ihnen einen solchen Knüller vorenthalten?« Er war sichtlich nervös. »Weißt du, wer der Tote ist?«
»Nein. Aber du wirst es mir gleich sagen.«
»Es ist der Ingegnere Silvio Luparello.«
»Scheiße!« stieß Montalbano hervor. Es war seine einzige Bemerkung.
»Und weißt du, wie er ums Leben kam?«
»Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Ich schau’ mir das lieber selber an.«
Jacomuzzi kehrte beleidigt zu seinen Leuten zurück. Der Fotograf des Erkennungsdienstes war bereits fertig. Jetzt war Dottor Pasquano an der Reihe. Montalbano sah, daß der Arzt in einer unbequemen Position arbeiten mußte. Er steckte zur Hälfte im Auto und machte sich zwischen Beifahrer- und Fahrersitz zu schaffen, wo man eine dunkle Gestalt erkennen konnte. Fazio und die Beamten von Vigàta gingen den Kollegen von Montelusa zur Hand.
Der Commissario zündete sich eine Zigarette an, dann wandte er sich um und betrachtete die Chemiefabrik. Sie faszinierte ihn, diese Ruine. Er nahm sich vor, eines Tages zurückzukehren, um Fotos zu machen, die er dann Livia schicken würde. Er wollte ihr mit diesen Bildern ein paar Dinge von sich und seiner Heimat nahebringen, die sie noch nicht zu begreifen vermochte. Ihr fehlte der sizilianische Geist.
Indessen traf der Richter Lo Bianco ein. Aufgeregt stieg er aus dem Wagen.
»Stimmt es tatsächlich, daß der Tote der Ingegnere Luparello ist?«
Offensichtlich hatte Jacomuzzi keine Zeit verloren.
»Sieht ganz so aus.«
Der Richter gesellte sich zu den Leuten vom Erkennungsdienst, begann erregt mit Jacomuzzi und Dottor Pasquano zu sprechen, der eine Flasche Alkohol aus seiner Tasche gezogen hatte und sich die Hände desinfizierte. Nach einer Weile, die genügte, um Montalbano unter der Sonne garzukochen, stiegen die Männer vom Erkennungsdienst ins Auto und fuhren davon. Jacomuzzi fuhr grußlos an ihm vorbei. Montalbano hörte, wie die Sirene des Krankenwagens hinter ihm verstummte. Jetzt war er an der Reihe, er mußte zur Tat schreiten, da half kein Gott. Er schüttelte die Trägheit von sich ab, in der er sich schwitzend geräkelt hatte, und ging auf das Auto zu, in dem der Tote lag. Auf halber Strecke trat ihm der Richter entgegen.
»Die Leiche kann weggebracht werden, und angesichts des Bekanntheitsgrades des armen Ingegnere, je eher, desto besser. In jedem Fall halten Sie mich täglich auf dem laufenden, was den Fortgang der Ermittlungen anbelangt.«
Er hielt inne und fügte dann einschränkend hinzu: »Rufen Sie mich an, wann immer Sie es für erforderlich halten.«
Eine weitere Pause. Schließlich: »Natürlich zu den Bürozeiten, daß das klar ist.«
Montalbano ging davon. Zu den Bürozeiten, nicht daheim. Zu Hause, das war allbekannt, widmete sich der Richter Lo Bianco der Abfassung eines umfangreichen und aufwendigen Werkes: Leben und Unternehmungen Rinaldo und Antonio Lo Biancos, vereidigte Lehrmeister an der Universität von Girgenti zur Zeit König Martins des Jüngeren (1402–1409). Er hielt die beiden für seine, wenn auch recht nebulösen, Ahnen.
»Wie ist er gestorben?« erkundigte Montalbano sich beim Dottore.
»Sehen Sie selbst«, antwortete Pasquano und trat zur Seite.
Montalbano steckte den Kopf ins Auto, in dem die Gluthitze eines Ofens herrschte, erblickte zum ersten Mal die Leiche und mußte sogleich an den Polizeipräsidenten denken.
Der Polizeipräsident fiel ihm nicht etwa deswegen ein, weil es seine Gewohnheit gewesen wäre, an den Beginn seiner Ermittlung den Gedanken an den Dienstobersten zu stellen. Vielmehr hatte er mit dem alten Polizeipräsidenten Burlando, mit dem er befreundet war, vor etwa zehn Tagen über ein Buch von Philippe Ariès, Geschichte des Todes, gesprochen. Sie hatten es beide gelesen. Der Präsident war der Meinung gewesen, daß sich jeder Tod, selbst der elendeste, eine gewisse Heiligkeit bewahre. Montalbano hatte erwidert, und er hatte es ehrlich gemeint, daß er in keinem Tod, nicht einmal in dem eines Papstes, etwas Heiliges entdecken könne.
Er hätte ihn jetzt gerne an seiner Seite gehabt, den Herrn Polizeipräsidenten, damit dieser sehen könnte, was er, Montalbano, sah. Der Ingenieur Luparello war immer ein eleganter Mann gewesen, ausgesprochen gepflegt, was sein Äußeres anbelangte. Jetzt aber war er ohne Krawatte, das Hemd zerknittert, die Brille hing ihm schief auf der Nase, der Kragen des Jacketts war unziemlich hochgestellt, die Socken heruntergeschoben und so lose, daß sie über die Mokassins fielen. Was den Commissario aber am meisten schockierte, war die bis zu den Knien hinuntergelassene Hose, der Slip, der aus dem Innern der Hosen weiß herausleuchtete, und das zusammen mit dem Unterhemd bis zur Brust aufgerollte Hemd.
Und das Geschlecht: schamlos, anstößig zur Schau gestellt, groß, behaart und in scharfem Kontrast zu dem feingliedrigen Bau des restlichen Körpers.
»Wie ist er gestorben?« wiederholte er seine Frage an den Dottore und zog den Kopf wieder aus dem Auto.
»Da gibt es ja wohl überhaupt keinen Zweifel, oder?« antwortete Pasquano schroff. »Wußten Sie denn nicht, daß der arme Ingegnere in London von einem weltbekannten Kardiologen am Herzen operiert worden ist?«
»Ehrlich gesagt, nein. Ich habe ihn am vergangenen Mittwoch im Fernsehen gesehen, und da machte er einen völlig gesunden Eindruck auf mich.«
»Schien so, war aber nicht so. Wissen Sie, in der Politik sind sie alle wie die Hunde. Kaum haben sie herausgefunden, daß du dich nicht wehren kannst, zerfleischen sie dich. Offenbar hat man ihm in London zwei Bypässe gelegt. Es heißt, es sei eine komplizierte Operation gewesen.«
»Und bei wem war er in Montelusa in Behandlung?«
»Bei meinem Kollegen Capuano. Er ließ sich wöchentlich untersuchen, achtete auf seine Gesundheit, wollte immer topfit wirken.«
»Was meinen Sie: Soll ich mit Capuano sprechen?«
»Vollkommen überflüssig. Was hier geschehen ist, liegt doch auf der Hand. Der arme Ingegnere hatte Lust auf einen guten Fick, vielleicht mit einer von diesen exotischen Nutten, hat seinen Spaß gehabt und ist dabei draufgegangen.«
Er bemerkte, daß Montalbano abwesend ins Leere starrte.
»Überzeugt Sie das nicht?«
»Nein.«
»Und warum nicht?«
»Tja, das weiß ich selber nicht. Schicken Sie mir morgen die Ergebnisse der Autopsie rüber?«
»Morgen? Sie sind ja verrückt! Vor dem Ingegnere habe ich noch die zwanzigjährige Kleine, die in einem verlassenen Bauernhaus vergewaltigt wurde. Zehn Tage später hat man sie dann gefunden, halb aufgefressen von den Hunden. Dann ist Fofò Greco an der Reihe, dem sie die Zunge und die Eier abgeschnitten haben, um ihn anschließend an einem Baum zum Sterben aufzuhängen. Danach kommt …«
Montalbano unterbrach die makabre Aufzählung.
»Pasquano, ohne langes Hin und Her, wann bekomme ich die Ergebnisse?«
»Übermorgen, wenn sie mich in der Zwischenzeit nicht weiter durch die Gegend hetzen, um Tote zu begutachten.«
Sie verabschiedeten sich. Montalbano rief den Brigadiere und seine Leute zusammen, gab die nötigen Anweisungen und sagte ihnen, wann sie die Leiche in den Krankenwagen laden konnten. Dann ließ er sich von Gallo zum Kommissariat bringen.
»Du fährst anschließend zurück und holst die anderen ab. Aber ich warne dich, wenn du rast, hau’ ich dir die Fresse ein.«
Pino und Saro unterschrieben die Aussage. Darin war feinsäuberlich jede ihrer Bewegungen festgehalten, vor und nach dem Fund der Leiche. Im Protokoll fehlten allerdings zwei wichtige Details, weil die Müllmänner sich gehütet hatten, sie der Polizei auf die Nase zu binden: erstens, daß sie den Toten gleich erkannt hatten, und zweitens, daß sie unverzüglich den Advokaten angerufen hatten, um ihm von ihrer Entdeckung zu berichten. Nun gingen sie nach Hause, Pino, der mit seinen Gedanken offensichtlich woanders war, und Saro, der ab und zu die Hosentasche befühlte, in der er die Halskette hatte verschwinden lassen.
Zumindest innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden würde nichts geschehen. Am Nachmittag ging Montalbano nach Hause, warf sich aufs Bett und schlief drei volle Stunden lang. Dann stand er auf, und weil das Meer jetzt, mitten im September, glatt wie ein Spiegel war, schwamm er eine gute Runde. Wieder daheim, bereitete er sich einen Teller Spaghetti mit Seeigelfleisch zu und schaltete den Fernseher ein. Alle lokalen Nachrichten sprachen natürlich vom Tod des Ingenieurs und ergingen sich in Lobreden. Hin und wieder erschien ein Politiker auf der Bildfläche, mit einem dem Anlaß angemessenen Gesichtsausdruck, und erinnerte an die Verdienste des Verstorbenen und an die Probleme, die sein Dahinscheiden mit sich bringe. Aber keiner, kein einziger, nicht einmal der einzige Fernsehkanal der Opposition, wagte bekanntzugeben, wo und auf welche Weise der tief betrauerte Ingenieur Luparello ums Leben gekommen war.
Drei
Saro und Tana verbrachten eine unruhige Nacht. Zweifellos hatte Saro einen Schatz entdeckt wie in den Märchen, in denen bettelarme Schäfer auf Krüge voller Dukaten oder edelsteinbesetzte goldene Lämmlein stießen.
Und doch war die Situation hier ganz anders als in den alten Geschichten: Die Kette, eine moderne Juwelierarbeit, war am Tag zuvor verloren worden, daran bestand kein Zweifel, und allem Anschein nach war das Schmuckstück ein Vermögen wert. War es denn möglich, daß niemand den Verlust gemeldet hatte?
Sie saßen am Küchentisch, den Fernseher laut aufgedreht und das Fenster wie jeden Abend sperrangelweit offen, um zu verhindern, daß die Nachbarn durch eine winzige Veränderung der Routine aufmerksam wurden und zu reden anfingen. Den Vorschlag ihres Mannes lehnte Tana kategorisch ab. Er wollte die Kette gleich am nächsten Tag verkaufen, sobald das Juweliergeschäft der Gebrüder Siracusa öffnete.
»Vor allem«, begann sie, »sind wir beide ehrliche Leute. Und deswegen können wir nicht etwas verkaufen, was uns nicht gehört.«
»Aber was sollen wir denn deiner Meinung nach tun? Soll ich etwa zum Fuhrmeister gehen und ihm sagen, daß ich die Kette gefunden habe? Sie ihm übergeben, damit er sie dann dem Besitzer zurückgibt, sollte der sie zurückverlangen? Du kannst darauf wetten, daß es nicht mal zehn Minuten dauert, bis dieser verdammte Dreckskerl von Pecorilla sie selber verkauft.«
»Es gibt noch eine Möglichkeit. Wir behalten die Kette hier bei uns und sagen inzwischen Pecorilla Bescheid. Wenn jemand kommt, um sie abzuholen, geben wir sie ihm.«
»Und was springt dabei für uns raus?«
»Der übliche Finderlohn. Der steht uns doch zu, oder? Wieviel ist die Kette deiner Meinung nach wert?«
»Um die zwanzig Millionen Lire«, antwortete Saro wichtigtuerisch, hatte aber gleichzeitig das Gefühl, mit der Summe etwas zu hoch gegriffen zu haben. »Gehen wir mal davon aus, daß uns zwei Millionen zustehen. Kannst du mir erklären, wie wir mit zwei Millionen die ganzen Behandlungen für Nenè bezahlen sollen?«
Sie diskutierten bis zum Sonnenaufgang und hörten auch nur deshalb auf, weil Saro zur Arbeit mußte. Aber sie waren zu einer provisorischen Übereinkunft gelangt, die ihnen ihre Ehrbarkeit wenigstens zum Teil bewahrte: Sie wollten die Kette behalten, ohne irgend jemandem etwas davon zu sagen, eine Woche verstreichen lassen und sie dann, falls sich bis dahin niemand als ihr Besitzer zu erkennen gegeben hätte, verpfänden. Als Saro, erleichtert und guten Mutes, zu seinem Söhnchen ging, um ihn zum Abschied zu küssen, erwartete ihn eine Überraschung: Nenè schlief tief und fest, als ahnte er, daß sein Vater einen Weg gefunden hatte, ihn wieder gesund zu machen.
Auch Pino fand in dieser Nacht keinen Schlaf. Er war ein nachdenklicher Mensch und hatte eine Schwäche fürs Theater. Als Schauspieler war er auf den engagierten, aber immer selteneren Laienbühnen von Vigàta und Umgebung aufgetreten. Und er las Theaterstücke. Sobald sein karger Verdienst es zuließ, eilte er in den einzigen Buchladen von Montelusa, um sich Komödien und Dramen zu kaufen. Er lebte mit seiner Mutter zusammen, die eine kleine Rente bezog, am Hungertuch hatten sie also nicht zu nagen. Die Mutter hatte sich die Entdeckung des Toten dreimal berichten lassen und Pino gezwungen, die eine oder andere Einzelheit oder Besonderheit noch näher zu beschreiben. Sie wollte die Geschichte am nächsten Tag ihren Freundinnen in der Kirche und auf dem Markt weitererzählen und sich damit brüsten, daß sie all diese Dinge wußte und ihr Sohn so tüchtig war, zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen zu sein. Gegen Mitternacht war sie endlich ins Bett gegangen, und kurz darauf hatte sich auch Pino hingelegt. Aber an Schlafen war nicht zu denken, da war etwas, das ihn beschäftigte. Unruhig wälzte er sich unter der Bettdecke hin und her. Er war ein nachdenklicher Mensch, hieß es, und deswegen war er nach zwei Stunden, in denen er vergeblich versucht hatte, Schlaf zu finden, zu der vernünftigen Überzeugung gelangt, daß es einfach keinen Sinn hatte.
Er war aufgestanden, hatte sich flüchtig gewaschen und sich dann an den kleinen Schreibtisch gesetzt, der in seinem Schlafzimmer stand. Im stillen wiederholte er die Worte, mit denen er seiner Mutter das Ganze erzählt hatte, und alles paßte, das Glöckchen in seinem Kopf schrillte bloß leise im Hintergrund. Es war wie das Spiel mit »heiß und kalt«. Solange er all das wiederholte, was er erzählt hatte, schien das Glöckchen ihm zu sagen: kalt, kalt. Folglich mußte das ungute Gefühl, das er verspürte, von etwas herrühren, das er seiner Mutter nicht gesagt hatte. Und tatsächlich hatte er ihr dieselben Dinge verschwiegen, die er auch, im Einverständnis mit Saro, Montalbano gegenüber unerwähnt gelassen hatte: daß sie den Toten sofort erkannt und den Advokaten Rizzo angerufen hatten. Und da wurde das Glöckchen sehr laut, tönte hell: heiß, heiß! Er nahm Papier und Bleistift und schrieb das Gespräch, das er mit dem Advokaten geführt hatte, Wort für Wort nieder. Er las es noch einmal durch und machte Korrekturen, wobei er sein Gedächtnis derart anstrengte, daß er schließlich, wie in einem Drehbuch, sogar die Pausen eintrug. Schließlich ging er die endgültige Version noch einmal durch. Irgend etwas stimmte immer noch nicht mit diesem Dialog. Aber nun war es zu spät, er mußte zur Arbeit in die »Splendor«.
Um zehn Uhr morgens wurde Montalbano in der Lektüre der beiden sizilianischen Tageszeitungen – eine erschien in Palermo, die andere in Catania – von einem Anruf des Polizeipräsidenten gestört.
»Ich darf Ihnen Lob und Dank übermitteln«, setzte der Polizeipräsident an.
»Ach ja? Und von wem, bitte?«
»Vom Bischof und von unserem Minister. Monsignor Teruzzi hat sich sehr zufrieden über die christliche Nächstenliebe geäußert, genauso hat er sich ausgedrückt, die Sie, wie sagt man noch, bewiesen haben, indem Sie verhinderten, daß skrupellose Journalisten und Fotografen anstößige Bilder von der Leiche machen und veröffentlichen konnten.«
»Aber ich habe diese Anordnung erteilt, als ich noch gar nicht wußte, wer der Tote ist! Das hätte ich für jeden getan.«
»Weiß ich, Jacomuzzi hat mir alles berichtet. Aber warum hätte ich den hochwürdigen Prälaten auf diese Nebensächlichkeit hinweisen sollen? Um ihn hinsichtlich Ihrer christlichen Nächstenliebe zu enttäuschen? Die Nächstenliebe, mein Liebster, ist um so wertvoller, je höher die Stellung des von der Nächstenliebe betroffenen Wesens ist, verstehen Sie? Stellen Sie sich vor, der Bischof hat sogar Pirandello zitiert.«
»Was Sie nicht sagen!«
»Doch, doch. Er hat dessen Stück Sechs Personen suchen einen Autor angeführt, die Stelle, an der der Vater sagt, daß man jemandem, der alles in allem ein rechtschaffenes Leben geführt hat, eine einzelne frevelhafte Tat, einen Fehltritt sozusagen, nicht auf ewig nachtragen sollte. Mit anderen Worten: Man darf der Nachwelt von unserem teuren Ingegnere nicht das Bild mit den heruntergelassenen Hosen überliefern.«
»Und der Minister?«
»Der hat Pirandello nicht zitiert. Der weiß nicht einmal, wie man den Namen schreibt. Aber der Gedanke war letztlich derselbe. Und da er zur gleichen Partei gehört wie Luparello, hat er sich erlaubt, noch ein Wort hinzuzufügen.«
»Welches?«
»Vorsicht.«
»Was hat denn die Vorsicht mit dieser Geschichte zu tun?«
»Keine Ahnung, ich gebe Ihnen das Wort so weiter, wie er es mir gesagt hat.«
»Und die Autopsie? Gibt es da etwas Neues?«
»Noch nicht. Pasquano wollte ihn bis morgen im Kühlschrank lassen. Ich habe ihn jedoch gebeten, ihn heute entweder am späten Vormittag oder am frühen Nachmittag zu untersuchen. Aber ich glaube nicht, daß von dieser Seite neue Erkenntnisse zu erwarten sind.«
»Das glaube ich auch nicht«, schloß der Commissario.
Nachdem er seine Zeitungslektüre wieder aufgenommen hatte, erfuhr Montalbano aus den Artikeln wesentlich weniger, als er über das Leben, die Wundertaten und den Tod des Ingenieurs Luparello ohnehin schon wußte. Sie halfen ihm nur, seine Erinnerungen etwas aufzufrischen. Erbe einer Dynastie von Bauunternehmern aus Montelusa (der Großvater hatte den alten Bahnhof entworfen und gebaut, der Vater den Justizpalast), war der junge Silvio, nachdem er sein Studium am Polytechnikum in Mailand mit einer glänzenden Promotion abgeschlossen hatte, nach Hause zurückgekehrt, um das Familienunternehmen weiterzuführen und auszubauen. Als praktizierender Katholik war er in der Politik den Ideen des Großvaters verhaftet geblieben, der ein glühender Anhänger Sturzos gewesen war. (Was die Überzeugungen des Vaters betraf, Mitglied der faschistischen Sturmabteilungen und beim »Marsch auf Rom« dabei, so hüllte man sich in gebührendes Schweigen.) Bei der FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), welche die jungen katholischen Studenten vereinigte und so ein tragfähiges Netz von Freundschaften knüpfte, sammelte er die ersten Erfahrungen. Von da an erschien Silvio Luparello, ob auf Veranstaltungen, Feierlichkeiten oder Versammlungen, stets Seite an Seite mit den maßgebenden Persönlichkeiten der Partei. Aber immer einen Schritt hinter ihnen, mit einem halben Lächeln auf den Lippen, welches besagen sollte, daß er aus freien Stücken heraus an jenem Platz stand und nicht etwa infolge einer hierarchischen Rangordnung. Mehrfach aufgefordert, bei den Parlaments- oder Kommunalwahlen zu kandidieren, hatte er sich der Verantwortung jedesmal mit höchst ehrenwerten Begründungen entzogen, die er ebenso regelmäßig öffentlich bekanntgab. In diesen Verlautbarungen berief er sich auf jene Demut und jenen Dienst am Nächsten, welche, wie es dem Wesen des wahren Katholiken entspreche, im verborgenen und im stillen blühten. Und im verborgenen und im stillen hatte er zwanzig Jahre lang gedient. Bis er sich eines Tages, gewachsen an und gestärkt von allem, was er mit seinen scharfen Augen im verborgenen gesehen hatte, selbst treue Diener angeschafft hatte, allen voran den Abgeordneten Cusumano. Dann legte er dem Senator Portolano und dem Abgeordneten Tricomi die Livree an (die Zeitungen nannten sie »brüderliche Freunde«, »ergebene Jünger«), hatte binnen kurzer Zeit die ganze Partei in Montelusa und Umgebung unter Kontrolle und dazu achtzig Prozent aller öffentlichen und privaten Ausschreibungen. Das Erdbeben, das ein paar Mailänder Richter ausgelöst hatten und das die seit fünfzig Jahren an der Macht befindliche politische Klasse ins Wanken brachte, vermochte ihn nicht im geringsten zu erschüttern. Im Gegenteil. Da er immer hinter den Linien gestanden hatte, konnte er jetzt aus der Deckung treten, sich hervortun, gegen die Bestechlichkeit seiner Parteigenossen wettern. Im Laufe eines knappen Jahres war er als Vorkämpfer der Erneuerung auf Betreiben der Parteimitglieder segretario provinciale, Provinzsekretär, geworden. Leider waren zwischen diesem triumphalen Erfolg und seinem Tod nur drei Tage vergangen. Eine der beiden Zeitungen bedauerte, daß einer Persönlichkeit von so hohem und herausragendem Rang durch ein unerbittliches Schicksal nicht die Zeit beschieden gewesen sei, die Partei zu altem Glanz zurückzuführen. Beide Blätter erinnerten in ihren Nachrufen einstimmig an die grenzenlose Großzügigkeit und Herzensgüte Luparellos, die stete Bereitschaft, in jeder schmerzlichen Situation Freund wie Feind die Hand zu reichen. Mit einem Frösteln fiel Montalbano ein kurzer Filmbeitrag ein, den er im vergangenen Jahr in einem lokalen Fernsehsender gesehen hatte. Der Ingenieur Luparello weihte eine kleines Waisenhaus in Belfi ein, dem Geburtsort seines Großvaters, das zudem auf den Namen des Großvaters getauft wurde. An die zwanzig Kinder, alle gleich gekleidet, sangen ein Dankesliedchen auf den Namensgeber, der ihnen gerührt zuhörte. Der Text dieses Liedchens hatte sich unauslöschlich ins Gedächtnis des Commissario eingebrannt: »Quant’è buono, quant’è bello / l’ingegnere Luparello.«
Nicht nur über die Umstände seines Todes sahen die Zeitungen hinweg. Ebenso schwiegen sie über die Gerüchte, die seit Jahren über die weitaus weniger öffentlichen Geschäfte kursierten, in die der Ingenieur verwickelt war. Man sprach von gefälschten öffentlichen Ausschreibungen, von Schmiergeldern in Millionenhöhe, von Nötigungen, die bis zur Erpressung reichten. Und immer wieder tauchte in dem Zusammenhang der Name des Advokaten Rizzo auf, zunächst als Lauf bursche, dann Vertrauensmann und zuletzt alter ego Luparellos. Aber es handelte sich stets nur um Gerüchte, um Behauptungen, die weder Hand noch Fuß hatten. Es hieß auch, daß Rizzo als Mittelsmann zwischen dem Ingenieur und der Mafia agierte. Zumindest was das betraf, war es dem Commissario unter der Hand möglich gewesen, einen geheimen Bericht einzusehen, der von Devisenhandel und Geldwäscherei sprach. Reine Verdächtigungen natürlich, nichts weiter, denn diese Verdächtigungen konnten niemals bewiesen werden. Jeder Antrag auf Erlaubnis zu Nachforschungen hatte sich im Labyrinth desselben Justizpalasts verloren, den der Vater des Ingenieurs entworfen und gebaut hatte.
Um die Mittagszeit rief Montalbano bei der Mordkommission von Montelusa an und fragte nach der Inspektorin Ferrara. Sie war die Tochter eines ehemaligen Schulkameraden, der sich sehr jung verheiratet hatte. Ein sympathisches und intelligentes Mädchen, das es, weiß der Himmel, warum, hin und wieder bei ihm probierte. »Anna? Ich brauche dich.«
»Was du nicht sagst!«
»Kannst du dich am Nachmittag für ein paar Stunden freimachen?«
»Ich werde es möglich machen, Commissario. Immer zu deinen Diensten, Tag und Nacht. Zu Befehl, oder wenn du möchtest, zu Willen.«
»Dann hole ich dich also gegen drei bei dir zu Hause in Montelusa ab.«
»Du läßt mein Herz höher schlagen.«
»Ach, noch was, Anna: Zieh dich weiblich an.«
»Hohe Absätze, Schlitz bis über die Schenkel?«
»Ich meinte lediglich, daß du nicht in Uniform kommen sollst.«
Beim zweiten Hupen trat Anna in Rock und Bluse aus der Haustür. Sie stellte keine Fragen, sondern beschränkte sich darauf, Montalbano auf die Wange zu küssen. Erst als das Auto in den ersten der drei Wege eingebogen war, die von der Landstraße zur Mànnara führten, begann sie zu sprechen.
»Wenn du mich abschleppen willst, bring mich zu dir nach Hause. Hier gefällt es mir nicht.«
An der Mànnara standen nur zwei oder drei Autos, aber die Insassen gehörten ganz offenbar nicht zum nächtlichen Kreis von Gegè Culotta. Es waren Studenten und Studentinnen, ganz normale Paare, die keinen besseren Platz gefunden hatten. Montalbano fuhr weiter bis ans Ende des Weges und bremste erst, als die Vorderreifen bereits im Sand steckten. Der große Strauch, neben dem Luparellos BMW gefunden worden war, befand sich ihnen gegenüber auf der linken Seite und war über den Weg, den sie gekommen waren, unmöglich zu erreichen.
»Ist das die Stelle, an der sie ihn gefunden haben?« fragte Anna.
»Ja.«
»Und was suchst du?«
»Das weiß ich selbst noch nicht. Komm, laß uns aussteigen.«
Sie gingen in Richtung Strand, Montalbano faßte sie um die Taille, zog sie eng an sich, und sie legte lächelnd den Kopf an seine Schulter. Jetzt verstand sie, warum der Commissario sie abgeholt hatte. Sie spielten nur Theater, zu zweit waren sie nichts weiter als ein Liebespaar, das an die Mànnara gekommen war, um alleine zu sein. Anonym, sie würden keinerlei Aufsehen erregen.
So ein Hurensohn, dachte sie im stillen. Es ist ihm scheißegal, was ich für ihn empfinde.
Plötzlich blieb Montalbano stehen, den Rücken zum Meer gewandt. Die Macchia lag vor ihnen, war in Luftlinie etwa hundert Meter entfernt. Es gab keinen Zweifel: Der BMW war nicht über die kleinen Feldwege gekommen, sondern seitlich vom Strand her. Nachdem er in Richtung Macchia gedreht hatte, parkte er mit der Schnauze auf die alte Fabrik zu, genau in der entgegengesetzten Richtung also, in der alle anderen Autos, die von der Landstraße herkamen, notgedrungen stehen mußten, da es keinen Platz zum Wenden gab. Wer wieder auf die Landstraße wollte, mußte die Strecke wohl oder übel im Rückwärtsgang zurückfahren.
Montalbano ging noch ein Stück, den Arm um Anna gelegt, mit gesenktem Kopf: Weit und breit keine Reifenspuren, das Meer hatte alles weggespült.
»Und was machen wir jetzt?«
»Zuerst rufe ich Fazio an, und dann fahre ich dich nach Hause.«
»Commissario, darf ich dir ganz ehrlich etwas sagen?«
»Natürlich.«
»Du bist ein Scheißkerl.«
Vier
»Commissario? Pasquano am Apparat. Würden Sie mir freundlicherweise mitteilen, wo zum Teufel Sie gesteckt haben? Ich such’ Sie seit drei Stunden, im Kommissariat hatten sie keine Ahnung.«
»Dottore, sind Sie sauer auf mich?«
»Auf Sie? Auf die ganze Welt.«
»Was hat man Ihnen angetan?«
»Man hat mich gezwungen, Luparello den Vorrang zu geben, genau wie früher, als er noch unter den Lebenden weilte. Muß dieser Mensch auch als Toter vor allen anderen drankommen? Wahrscheinlich kriegt er auch noch auf dem Friedhof einen Platz in der ersten Reihe.«
»Wollten Sie mir etwas sagen?«
»Ich sage Ihnen schon mal im voraus, was Sie dann schriftlich von mir bekommen. Absolut nichts, der Selige ist eines natürlichen Todes gestorben.«
»Und das heißt?«
»Ihm ist, um es mal volkstümlich auszudrücken, im wahrsten Sinne des Wortes das Herz geplatzt. Ansonsten war er gut beieinander. Nur die Pumpe funktionierte nicht, und eben die hat ihm den Garaus gemacht, wenn man auch auf vortreffliche Art und Weise versucht hat, sie zu reparieren.«
»Sonstige Merkmale am Körper?«
»Welcher Art?«
»Na ja, was weiß ich, Ekchymosen, Nadeleinstiche.«
»Ich hab’s Ihnen doch gesagt: nichts. Ich bin schließlich nicht von gestern, wissen Sie? Und zusätzlich habe ich beantragt und genehmigt bekommen, daß mir mein Kollege Capuano, sein Hausarzt, bei der Autopsie assistiert.«
»Sie haben sich Rückendeckung geholt, was, Dottore?«
»Was haben Sie gesagt?«
»Das war nur Blödsinn, entschuldigen Sie. Hatte er andere Krankheiten?«
»Warum fangen Sie noch mal von vorne an? Er hatte nichts, abgesehen von einem leicht erhöhten Blutdruck. Er wurde mit einem Diuretikum behandelt, nahm jeweils eine Tablette am Donnerstag und am Sonntag früh.«
»Folglich hat er am Sonntag, als er gestorben ist, eine genommen?«
»Ja, und? Worauf zum Teufel wollen Sie hinaus? Daß die Tablette vergiftet war? Meinen Sie etwa, wir leben noch im Jahrhundert der Borgia? Oder lesen Sie seit neuestem schlechte Krimis? Wenn er vergiftet worden wäre, hätte ich das schon gemerkt.«
»Hatte er zu Abend gegessen?«
»Er hatte nicht zu Abend gegessen.«
»Können Sie mir sagen, um wieviel Uhr der Tod eingetreten ist?«
»Ihr macht mich noch ganz verrückt mit dieser Frage. Ihr laßt euch von diesen amerikanischen Filmen beeindrucken, in denen, kaum hat der Polizist gefragt, um wieviel Uhr das Verbrechen begangen wurde, der Gerichtsarzt antwortet, daß der Mörder sein Werk vor sechsunddreißig Tagen um achtzehn Uhr zweiunddreißig beendet hat, eine Sekunde hin, eine Sekunde her. Sie haben doch selber gesehen, daß die Leiche noch nicht starr war, oder? Sie haben doch selber die Hitze gespürt, die in dem Auto herrschte, oder?«
»Ja, und?«
»Wie, ja und? Die arme Seele ist am Tag bevor man ihn gefunden hat, zwischen neunzehn und zweiundzwanzig Uhr, dahingegangen.«
»Sonst nichts?«
»Sonst nichts. Ach, beinahe hätte ich’s vergessen: Der teure Ingegnere ist zwar tot, aber seinen Spaß hat er noch gehabt. Wir haben Spermareste an seinem Unterleib gefunden.«
»Herr Polizeipräsident? Montalbano hier. Ich möchte Ihnen mitteilen, daß Dottor Pasquano mich soeben angerufen hat. Er hat die Autopsie durchgeführt.«
»Montalbano, sparen Sie sich die Mühe! Ich weiß alles, Jacomuzzi hat mich gegen vierzehn Uhr angerufen. Er war dabei und hat mich über alles informiert. Ist ja schön!«
»Entschuldigung, ich verstehe nicht ganz.«
»Ich finde es schön, daß sich in unserer herrlichen Provinz ausnahmsweise einmal jemand dazu entschieden hat, eines natürlichen Todes zu sterben, also mit gutem Beispiel vorangeht. Finden Sie nicht? Noch zwei oder drei Tote wie der Ingegnere, und wir stehen wieder in einer Reihe mit dem übrigen Italien. Haben Sie auch mit Lo Bianco gesprochen?«
»Noch nicht.«
»Tun Sie das gleich! Sagen Sie ihm, daß es von unserer Seite keinerlei Probleme mehr gibt. Sie können die Beerdigung ansetzen, wann immer sie wollen, vorausgesetzt, der Richter erteilt die Genehmigung. Aber der wartet ja nur darauf. Hören Sie, Montalbano, heute morgen habe ich es ganz vergessen: Meine Frau hat ein umwerfendes Rezept für diese kleinen Tintenfische kreiert. Würde es Ihnen am Freitag abend passen?«
»Montalbano? Hier spricht Lo Bianco. Ich wollte Sie über den neuesten Stand der Dinge informieren. Heute am frühen Nachmittag hat Dottor Jacomuzzi bei mir angerufen.«
Was für ein vergeudetes Talent! dachte Montalbano. In früheren Zeiten wäre Jacomuzzi ein wunderbarer öffentlicher Ausrufer gewesen, einer von denen, die mit der Trommel herumliefen.
»Er hat mir mitgeteilt, daß die Autopsie nichts Ungewöhnliches ergeben hat«, fuhr der Richter fort. »Und folglich habe ich die Leiche zur Bestattung freigegeben. Sie haben doch nichts dagegen?«
»Nicht das geringste.«
»Kann ich den Fall also als abgeschlossen betrachten?«
»Können Sie mir noch zwei Tage Zeit geben?«
Er hörte, ja, er hörte regelrecht die Alarmglocken im Kopf seines Gesprächspartners läuten.
»Warum, Montalbano, was gibt’s denn?«
»Nichts, Herr Richter, überhaupt nichts.«
»Ja, weshalb denn dann die zwei Tage, allmächtiger Gott? Ich gebe offen zu, Commissario, daß sowohl ich als auch der Oberstaatsanwalt und der Präfekt sowie der Polizeipräsident die dringende Aufforderung erhalten haben, die Angelegenheit so schnell wie möglich abzuschließen. Nichts Illegales, versteht sich. Verständliche Bitten von Familienangehörigen und Parteifreunden, die diese schreckliche Geschichte so schnell wie möglich vergessen und in Vergessenheit geraten lassen möchten. Und mit allem Recht, meiner Ansicht nach.«
»Verstehe, Herr Richter. Aber ich würde nicht mehr als zwei Tage benötigen.«
»Aber wozu? Nennen Sie mir einen triftigen Grund!«
Montalbano erfand eine Antwort, eine Ausrede. Er konnte dem Richter schließlich nicht erzählen, daß sich sein Verdacht auf nichts gründete, oder besser gesagt, nur auf das dumpfe Gefühl, von jemandem – und er wußte weder wie noch warum – hereingelegt worden zu sein, der sich momentan als ihm überlegen erwies.
»Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, ich tue es, um dem Gerede der Leute vorzubeugen. Ich möchte nicht, daß nachher jemand das Gerücht verbreitet, wir hätten den Fall eiligst zu den Akten gelegt, nur weil wir der Sache nicht auf den Grund gehen wollten.«
»Wenn das so ist, bin ich einverstanden. Ich gebe Ihnen diese achtundvierzig Stunden. Aber nicht eine Minute länger. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür.«
»Gegè? Wie geht’s dir, mein Lieber? Entschuldige, wenn ich dich um halb sieben abends aufwecke.«
»Arschgeige, verfluchte!«
»Aber Gegè, spricht man so mit einem Vertreter des Gesetzes, gerade du? Bei dem bloßen Gedanken an das Gesetz müßte dir doch das Herz in die Hosen rutschen. Apropos Arschgeige, stimmt es, daß du’s mit einem Neger von vierzig treibst?«
»Vierzig was?«
»Rohrlänge.«
»Jetzt red keinen Scheiß. Was willst du?«
»Mit dir reden.«
»Wann?«
»Heute am späteren Abend. Du darfst auch die Uhrzeit bestimmen.«
»Sagen wir Mitternacht.«
»Wo?«
»Am üblichen Ort, an der Puntasecca.«
»Küß’ das zarte Händchen, Gegè.«
»Dottor Montalbano? Hier ist der Präfekt Squatrìto. Richter Lo Bianco hat mir persönlich mitgeteilt, daß Sie weitere vierundzwanzig oder achtundvierzig Stunden, ich erinnere mich nicht genau, verlangt haben, um den Fall des armen Ingegnere abzuschließen. Dottor Jacomuzzi, der mich freundlicherweise über die Vorgänge auf dem laufenden hielt, hat mir mitgeteilt, die Autopsie habe zweifelsfrei ergeben, daß Luparello eines natürlichen Todes gestorben ist. Jeder Gedanke, ach, was sage ich, noch viel weniger, jede Andeutung einer Einmischung, für die es zudem keinerlei Grund gäbe, liegt mir völlig fern. Ich möchte Ihnen nur eine Frage stellen: Warum dieses Ansuchen?«
»Mein Ansuchen, Herr Präfekt, wie ich es schon Dottor Lo Bianco erläutert habe und Ihnen gegenüber nun bekräftigen möchte, entspricht dem Wunsch nach Transparenz, um jede bösartige Vermutung über eine mögliche Absicht der Polizei, die Angelegenheit nicht restlos aufzudecken und den Fall ohne erschöpfende Ermittlungen zu den Akten legen zu wollen, im Keim zu ersticken. Das ist alles.«
Der Präfekt gab sich mit der Antwort zufrieden. Im übrigen hatte Montalbano mit Sorgfalt zwei Verben (aufdecken und bekräftigen) und ein Substantiv (Transparenz) gewählt, die seit jeher zum bevorzugten Wortschatz des Präfekten gehörten.
»Anna hier, entschuldige, wenn ich dich störe.«
»Warum sprichst du so komisch? Bist du erkältet?«
»Nein, ich bin im Büro und will nicht, daß man mich hört.«
»Also, was ist?«
»Jacomuzzi hat meinen Chef angerufen, um ihm zu sagen, daß du mit Luparello noch nicht fertig bist. Mein Chef meint, du wärst mal wieder der übliche Scheißkerl, eine Ansicht, die ich im übrigen teile und dir ja vor ein paar Stunden persönlich darlegen durfte.«
»Und deswegen rufst du mich an? Danke für die Bestätigung.«
»Commissario, ich muß dir noch etwas anderes sagen, was ich nach unserem Treffen erfahren habe, als ich wieder ins Büro kam.«
»Ich stecke bis über beide Ohren in der Scheiße, Anna. Morgen.«
»Da ist keine Zeit zu verlieren. Könnte interessant für dich sein.«
»Ich sag’ dir gleich, bis eins, halb zwei heute nacht bin ich belegt. Es sei denn, du könntest jetzt sofort vorbeikommen.«
»Jetzt schaffe ich es nicht. Ich komm’ um zwei Uhr zu dir nach Hause.«
»Heute nacht?«
»Ja, und wenn du nicht da bist, warte ich eben.«
»Hallo, Liebling? Ich bin’s, Livia. Tut mir leid, wenn ich dich im Büro anrufe, aber …«
»Du kannst mich anrufen, wann und wo du willst. Was gibt’s?«
»Nichts Wichtiges. Ich habe eben in einer Zeitung vom Tod eines Politikers in deiner Gegend gelesen. Nur eine kleine Pressenotiz, in der es heißt, daß Commissario Salvo Montalbano eingehende Untersuchungen zur Todesursache anstellt.«
»Ja, und weiter?«
»Macht dir dieser Tote Schwierigkeiten?«
»Nicht sehr viele.«
»Es bleibt also dabei? Du kommst mich am nächsten Samstag besuchen? Du wirst mir doch nicht irgendeine böse Überraschung bereiten?«
»Zum Beispiel?«
»Der verlegene kurze Anruf, in dem du mir sagst, daß die Untersuchung eine unerwartete Wendung genommen habe und ich noch ein wenig Geduld haben müsse, aber du wüßtest nicht, wie lange, und daß es vielleicht besser sei, unser Treffen um eine Woche zu verschieben. Das soll schon vorgekommen sein, und nicht nur einmal.«
»Mach dir keine Sorgen, dieses Mal schaffe ich es.«
»Dottor Montalbano? Ich bin Pater Arcangelo Baldovino, der Sekretär Seiner Exzellenz des Bischofs.«
»Angenehm. Was haben Sie auf dem Herzen, Pater?«
»Der Bischof hat mit einer gewissen Verwunderung, wir geben es zu, die Nachricht entgegengenommen, daß Sie eine Verlängerung der Ermittlungen hinsichtlich des schmerzlichen und unglücklichen Ablebens des Ingegnere Luparello für angebracht halten. Entspricht diese Nachricht der Wahrheit?«
Das tue sie in der Tat, bestätigte Montalbano, und zum dritten Mal legte er die Gründe für sein Handeln dar. Pater Baldovino wirkte überzeugt, bat den Commissario aber inständig, sich zu beeilen, »um niederträchtige Spekulationen zu verhindern und der leidgeprüften Familie weitere Qualen zu ersparen«.
»Commissario Montalbano? Ingegnere Luparello am Apparat.«
Ach du Scheiße, warst du nicht eben noch tot?
Die unpassende Bemerkung wäre Montalbano beinahe herausgerutscht, doch er konnte sie gerade noch rechtzeitig zurückhalten.
»Ich bin der Sohn«, fuhr der andere fort, eine wohlerzogene Stimme, höchst kultiviert, keine Dialektfärbung. »Mein Name ist Stefano. Ich möchte Sie gütigst um einen Gefallen bitten, der Ihnen vielleicht ungewöhnlich vorkommen wird. Ich rufe im Auftrag meiner Mutter an.«
»Ich werde mein Möglichstes tun.«
»Mama möchte gerne mit Ihnen reden.«
»Was sollte daran ungewöhnlich sein, Ingegnere? Auch ich hatte mir vorgenommen, die Signora dieser Tage um ein Treffen zu bitten.«
»Das Problem ist nur, Commissario, daß Mama Sie spätestens morgen treffen möchte.«
»Ach du lieber Gott, Ingegnere, zur Zeit habe ich nicht eine Minute frei, glauben Sie mir. Und bei Ihnen ist es bestimmt auch nicht viel anders, könnte ich mir vorstellen.«
»Zehn Minuten finden sich immer, machen Sie sich da keine Gedanken. Paßt es Ihnen morgen nachmittag um Punkt siebzehn Uhr?«
»Montalbano, ich weiß, daß ich dich habe warten lassen, aber ich war gerade …«
»… im Scheißhaus, in deinem Reich.«
»Jetzt hör auf, was willst du?«
»Ich wollte dich über eine schwerwiegende Sache unterrichten. Mich hat soeben der Papst vom Vatikan aus angerufen. Ist stinksauer auf dich.«
»Was soll denn der Blödsinn?«
»Doch, doch, er ist völlig außer sich, weil er der einzige Mensch auf der Welt ist, der deinen Bericht mit den Ergebnissen der Autopsie nicht bekommen hat. Er fühlt sich übergangen und hat die Absicht – das hat er mir deutlich zu verstehen gegeben –, dich zu exkommunizieren. Jetzt hast du verschissen.«
»Montalbano, hast du völlig den Verstand verloren?«
»Würdest du netterweise meine Neugier befriedigen?« »Aber selbstverständlich.«
»Kriechst du den Leuten aus Ehrgeiz oder aus natürlicher Veranlagung in den Arsch?«
Die Ehrlichkeit der Antwort seines Gegenübers verblüffte ihn.
»Aus natürlicher Veranlagung, glaube ich.«
»Hör zu, habt ihr die Kleider, die der Ingegnere trug, schon untersucht? Habt ihr was gefunden?«
»Wir haben das gefunden, was in gewisser Weise vorhersehbar war. Spuren von Sperma im Slip und an den Hosen.«
»Und im Auto?«
»Das untersuchen wir gerade noch.«
»Danke. Geh wieder ins Scheißhaus.«
»Commissario? Ich rufe aus einer Telefonzelle an der Landstraße an, in der Nähe der alten Fabrik. Ich habe getan, was Sie mir aufgetragen haben.«
»Erzähl, Fazio.«
»Sie hatten vollkommen recht. Luparellos BMW ist von Montelusa gekommen und nicht von Vigàta.«
»Bist du da sicher?«
»Auf der Seite von Vigàta ist der Strand durch Zementblöcke versperrt, da kommt man nicht durch, da hätte er schon fliegen müssen.«
»Hast du den Weg ausfindig gemacht, den er gefahren ist?«
»Ja, aber das ist der helle Wahnsinn.«
»Drück dich mal klarer aus. Wieso?«
»Obwohl von Montelusa Dutzende von Straßen und Wegen nach Vigàta führen, die einer nehmen kann, wenn er nicht gesehen werden will, ist der Wagen des Ingegnere ausgerechnet durch das ausgetrocknete Flußbett des Canneto zur Mànnara hinuntergefahren.«
»Den Canneto hinunter? Aber der ist doch unbefahrbar?«
»Eben nicht, ich bin den Weg selbst gefahren, und folglich kann es auch jemand anderes geschafft haben. Das Flußbett ist vollkommen trocken. Nur daß bei meinem Wagen jetzt die Stoßdämpfer im Eimer sind. Und da Sie ja nicht wollten, daß ich den Dienstwagen nehme, muß ich jetzt …«