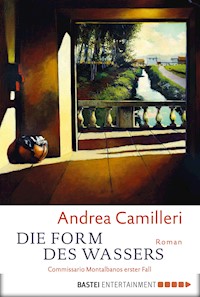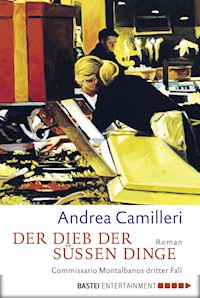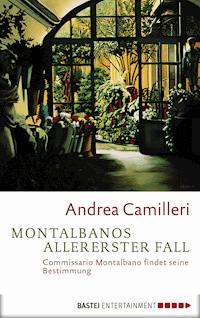9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Montalbano
- Sprache: Deutsch
Nachdem Commissario Montalbano eine Schussverletzung auskuriert hat, kann er es kaum erwarten, sein gewohntes Leben wieder aufzunehmen. Sein nächster Fall, die mysteriöse Entführung einer jungen Studentin, gibt ihm jedoch so manches Rätsel auf: Zu viele Details passen nicht zusammen, die Aussagen der Zeugen widersprechen sich. Doch das Netz der Verwirrungen, das hier ausgelegt wurde, scheint undurchdringbar und der stille Rächer geduldig genug, um in aller Ruhe abzuwarten, bis sein Opfer in die verhängnisvolle Falle tappt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Letztes Kapitel
Anmerkung
Über den Autor
Andrea Camilleri, »der Superstar der italienischen Krimiszene«; (BRIGITTE), hat mit seinen Werken Millionen Menschen zu begeisterten Sizilienfans gemacht. Ob er seine Leser mit den unkonventionellen Ermittlungen seines unwiderstehlichen Helden Salvo Montalbano in den Bann zieht, ihnen mit kulinarischen Köstlichkeiten den Mund wässrig macht oder ihnen unvergessliche Einblicke in die mediterrane Seele gewährt: Dem verführerischen Charme der Welt Camilleris vermag sich niemand zu entziehen.
Andrea Camilleri
Die Passiondes stillen Rächers
Ein Sizilien-Krimi
Aus dem Italienischen vonChristiane von Bechtolsheim
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der italienischen Originalausgabe:
LA PAZIENZA DEL RAGNO,
erschienen bei Sellerio Editore, Palermo
© 2004 by Sellerio Editore di Elvira Giorgianni, Palermo/Italy
© für die deutschsprachige Ausgabe 2006/2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
ZERO Werbeagentur GmbH, München unter Verwendung von Motiven von © poludziber / shutterstock; zero_werbeagentur / Midjourney
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1253-6
luebbe.de
lesejury.de
Eins
Verschwitzt und schwer atmend fuhr er aus dem Schlaf hoch. Ein paar Sekunden wusste er nicht, wo er war, dann holte ihn der leichte, regelmäßige Atem Livias, die neben ihm schlief, in die beruhigende Wirklichkeit zurück. Er lag in seinem Bett in Marinella. Aus dem Schlaf gerissen hatte ihn ein Stich wie von einer eiskalten Klinge in der Wunde an der linken Schulter. Dass es halb vier Uhr morgens war, genauer gesagt drei Uhr siebenundzwanzig und vierzig Sekunden, wusste er auch ohne einen Blick auf seinen Wecker auf dem Nachttisch. Das ging jetzt schon seit zwanzig Tagen so, seit Jamil Zarzis, ein Menschenhändler, der Immigrantenkinder verkaufte, ihn angeschossen hatte und er, Montalbano, ihn daraufhin getötet hatte. Zwanzig Tage war es her, dass die Zeit exakt in dieser Sekunde jede Nacht aufs Neue irgendwie klemmte. Klick hatte das Räderwerk in dem Teil seines Hirns gemacht, in dem die Stunden und Tage gezählt wurden, klick, und seitdem wachte er um diese Uhrzeit auf, oder er sah, wenn er bereits wach war, die Dinge um sich herum wie auf einem merkwürdig verschwommenen Standfoto. Natürlich wusste er, dass ihm bei dem blitzschnellen Schusswechsel nicht im Traum eingefallen wäre, auf die Uhr zu sehen. Und trotzdem, daran erinnerte er sich genau, hatte im selben Augenblick, als sich die Kugel aus Jamil Zarzis’ Pistole in sein Fleisch bohrte, in seinem Kopf eine unpersönliche Stimme, eine leicht metallische Frauenstimme wie im Bahnhof oder im Supermarkt, gesagt: »Es ist drei Uhr siebenundzwanzig und vierzig Sekunden.«
»Waren Sie mit dem Commissario zusammen?«
»Ja, Dottore.«
»Wie heißen Sie?«
»Fazio.«
»Wann wurde er verletzt?«
»Na ja, der Schusswechsel war so gegen halb vier, also vor einer guten halben Stunde. Dottore …«
»Ja?«
»Ist es sehr schlimm?«
Er hatte reglos dagelegen, mit geschlossenen Augen, daher dachten alle, er sei nicht bei Bewusstsein und sie könnten offen sprechen. Dabei hörte und verstand er alles, er war verwirrt und klar zugleich, doch er hatte er keine Lust, den Mund aufzumachen und die Fragen des Arztes selbst zu beantworten. Anscheinend wirkten die Spritzen, die sie ihm gegen die Schmerzen gegeben hatten, überall im Körper.
»Ach was! Wir müssen nur die Kugel entfernen, die steckt noch drin.«
»Heilige Muttergottes!«
»Regen Sie sich doch nicht gleich so auf! Das ist eine Lappalie. Ich glaube nicht, dass sie großen Schaden angerichtet hat, nach ein paar Reha-Übungen kann er den Arm wieder hundertprozentig gebrauchen. Darf ich fragen, warum Sie sich solche Sorgen machen?«
»Wissen Sie, Dottore, vor ein paar Tagen ist der Commissario allein losgegangen, um einen Tatort zu inspizieren …«
Auch jetzt liegt er mit geschlossenen Augen da. Aber er hört niemanden mehr, die laute Brandung verschluckt die Wörter. Es muss windig sein, der Fensterladen klappert bei jedem Windstoß und gibt einen Jammerlaut von sich. Zum Glück ist er noch krankgeschrieben und kann im Bett bleiben, solange er will. Bei dem Gedanken ist er ganz erleichtert und beschließt, die Augen einen Spaltbreit zu öffnen.
Warum hörte er Fazio nicht mehr? Er öffnete die Augen einen Spaltbreit. Die beiden standen nicht mehr am Bett, sondern waren ans Fenster getreten, Fazio redete, und der Doktor im weißen Kittel hörte sehr ernst zu. Und mit einem Mal wusste er, dass er gar nichts zu hören brauchte, er verstand auch so, was Fazio zu dem Arzt sagte. Sein Freund Fazio, der Kollege, auf den er sich immer hatte verlassen können, verriet ihn wie Judas, offensichtlich erzählte er dem Arzt gerade, dass er im Wasser die schlimmen Schmerzen in der Brust bekommen hatte und dann am Strand zusammengebrochen war … Welch schöne Neuigkeit für die Ärzte! Bevor sie ihm diese blöde Kugel entfernten, würden sie ihn durchwalken, innen und außen begutachten, ihn durchlöchern, ihm Stück für Stück die Haut abziehen und nachsehen, was darunter war …
Sein Schlafzimmer ist wie immer. Nein, das stimmt nicht. Es ist anders und doch wie immer. Anders, weil jetzt Livias Sachen auf der Kommode sind, ihre Handtasche, Haarnadeln, zwei Flakons. Und über dem Stuhl an der Wand gegenüber hängen eine Bluse und ein Rock. Und auch wenn er sie nicht sieht, weiß er, dass irgendwo neben dem Bett ein Paar rosa Pantoffeln steht. Ihm wird warm ums Herz, in seinem tiefsten Innern schmilzt er dahin. Seit zwanzig Tagen hat er diese wiederkehrenden Zustände, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Beim kleinsten Anlass bricht er fast in Tränen aus. Er schämt sich für seine Dünnhäutigkeit, sie ist ihm peinlich, und er muss komplizierte Schutzmaßnahmen austüfteln, damit die anderen nichts merken. Aber bei Livia schafft er es nicht. Livia hat beschlossen, ihm zu helfen, ihn ein bisschen hart anzufassen, damit er keinen Grund hat, sich gehen zu lassen. Doch das nutzt alles nichts, denn Livias Mitgefühl ruft bei ihm eine Mischung aus Rührung und Glück hervor. Er freut sich, dass sie ihren ganzen Urlaub geopfert hat, um ihn zu versorgen, und er weiß, dass auch das Haus in Marinella sich freut, dass Livia da ist. Bei Licht betrachtet, wirkt sein Schlafzimmer seitdem, als hätte es Farbe bekommen, als wären die Wände strahlend weiß getüncht. Da ihn niemand sieht, wischt er sich mit dem Zipfel des Lakens eine Träne ab.
Alles weiß und in diesem Weiß nur das Braun seiner nackten Haut. (War sie mal rosa? Vor wie viel hundert Jahren?) Weiß auch der Raum, in dem das EKG gemacht wird. Der Arzt betrachtet den langen Papierstreifen und schüttelt skeptisch den Kopf. Erschrocken stellt Montalbano sich vor, dass die Kurven aussehen wie die Aufzeichnung des Seismographen beim Erdbeben von Messina 1908. Die hat er mal in einer historischen Fachzeitschrift gesehen: ein verzweifelter, sinnloser Wirrwarr, wie von einer vor Angst wahnsinnigen Hand gezeichnet.
Jetzt haben sie mich erwischt!, denkt er. Sie haben gemerkt, dass mein Herz mit Wechselstrom funktioniert, nach Lust und Laune, und dass ich mindestens drei Infarkte hinter mir habe!
Später kommt ein weiterer Arzt zu ihm ins Zimmer, ebenfalls im weißen Kittel. Er sieht den Streifen an, er sieht Montalbano an, er sieht den Kollegen an.
»Wir machen noch mal eins«, sagt er.
Vielleicht trauen sie ihren Augen nicht, vielleicht können sie sich nicht vorstellen, dass ein Mann mit einem solchen EKG noch in einem Klinikbett liegt und nicht auf einem Marmortisch der Gerichtsmedizin. Sie stecken die Köpfe zusammen und sehen sich den neuen Streifen an.
»Wir machen eine Computertomographie des Herzens, entscheiden sie, immer noch reichlich verwirrt.
Montalbano würde ihnen am liebsten sagen, dass sie, wenn es so um ihn steht, die Kugel gleich drinlassen können. Dass sie ihn in Ruhe sterben lassen sollen. Aber verflucht, er hat kein Testament gemacht. Das Haus in Marinella zum Beispiel muss natürlich Livia bekommen, bevor irgendein Cousin vierten Grades irgendwelche Ansprüche anmeldet.
Das Haus in Marinella gehört nämlich seit ein paar Jahren ihm. Er hätte nie im Leben gedacht, dass er es sich einmal würde leisten können, es war zu teuer, bei seinem Gehalt konnte er nicht viel zurücklegen. Dann schrieb ihm eines Tages der Geschäftspartner seines Vaters, er könne ihm den väterlichen Anteil an der gemeinsamen Weinkellerei auszahlen, eine beachtliche Summe. So bekam er genug Geld, um das Haus zu kaufen, und konnte noch eine ganze Menge auf die Bank tragen. Als Altersversorgung. Er musste sein Testament machen, schließlich war er ohne sein Zutun ein vermögender Mann geworden. Doch seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hatte er sich noch nicht aufraffen können, zum Notar zu gehen. Aber wenn es so weit war, sollte Livia das Haus bekommen, das stand außer Frage. Was er François … Was er seinem Sohn, der nicht sein Sohn war, aber es hätte sein können, hinterließ, wusste er genau. Geld für ein tolles Auto. Er sah schon Livias verärgertes Gesicht. Wie bitte? Du willst ihn so verwöhnen? Ja, das will ich. Ein Kind, das kein eigenes ist, aber das eigene hätte sein können (sollen?), sollte man viel mehr verwöhnen als ein eigenes Kind. Der Gedanke war zwar etwas schräg, aber da war schon was dran. Und Catarella? Denn Catarella musste er in seinem Testament natürlich auch bedenken. Und was konnte er ihm hinterlassen? Bücher bestimmt nicht. Er versuchte sich an ein altes Gebirgsjägerlied zu erinnern, Das Testament des Hauptmanns oder so ähnlich, aber er wusste nicht mehr, wie es ging. Die Uhr! Ja, Catarella würde er die Uhr seines Vaters vererben, die dessen Partner ihm geschickt hatte. Dann fühlte er sich zur Familie gehörig. Die Uhr war das einzig Richtige.
Die Uhr in dem Raum, in dem sein Herz untersucht wird, kann er nicht richtig lesen, weil er einen milchigen Schleier vor den Augen hat. Die beiden Ärzte schauen wie gebannt auf einen Bildschirm und schieben ab und zu eine Maus herum.
Einer der beiden – der ihn operieren soll – heißt Strazzera, Amedeo Strazzera. Diesmal kommt kein Papierstreifen aus dem Apparat, sondern eine Fotoserie oder etwas in der Art. Die beiden Ärzte sehen sie sich immer wieder an, und am Ende stöhnen sie, wie erschöpft von einer langen Wanderung. Strazzera tritt zu ihm, während sich der Kollege auf einen – natürlich weißen – Stuhl setzt, und schaut ihn ernst an. Dann beugt er sich vor. Montalbano wartet darauf, dass er gleich sagt: »Tun Sie doch nicht so, als wären Sie lebendig! Schämen Sie sich!«
Wie hieß es in dem Gedicht noch mal?
Eh der Soldat sich’s recht versah / die Kugel flog, der Tod war da.
Doch der Arzt sagt gar nichts und hört ihn mit dem Stethoskop ab. Als ob er das nicht schon zwanzigmal getan hätte! Schließlich richtet er sich auf, sieht seinen Kollegen an und fragt:
»Und wie geht’s jetzt weiter?«
»Ich würde ihn Di Bartolo zeigen.«
Di Bartolo! Eine Legende. Montalbano hat ihn vor einiger Zeit kennen gelernt. Ein hagerer Mann in den Siebzigern, der mit seinem weißen Bärtchen wie eine Ziege aussieht und auf gesellschaftliche Umgangsformen und gute Manieren pfeift. Einmal soll er einen Mann, der als gnadenloser Wucherer bekannt war, auf seine Weise untersucht und ihm erklärt haben, er könne nichts sagen, da er sein Herz nicht finde. Und zu einem anderen, der in der Bar einen Kaffee trank und den er noch nie gesehen hatte, sagte er: »Sie kriegen gleich einen Herzinfarkt.« Und das Beste: Der Mann erlitt auf der Stelle einen Infarkt, wahrscheinlich weil ihm das eine Koryphäe wie Di Bartolo eröffnet hatte. Aber warum wollen die zwei Di Bartolo hinzuziehen, wo doch sowieso nichts mehr zu machen ist? Vielleicht wollen sie dem alten Meister ein Phänomen vorführen: einen, der mit einem Herzen, kaputt wie das bombardierte Dresden, immer noch lebt.
Bis es so weit ist, beschließen sie, ihn erst mal wieder auf sein Zimmer zu bringen. Als sie die Tür öffnen, um die Liege reinzuschieben, hört Montalbano Livias verzweifelte Stimme: »Salvo! Salvo!«
Er hat keine Lust zu antworten. Arme Livia! Sie war nach Vigàta gekommen, um ein paar Tage mit ihm zu verbringen, und dann diese böse Überraschung.
»Das war wirklich eine böse Überraschung!«, hatte Livia tags zuvor gesagt, als er von einer Nachuntersuchung im Krankenhaus in Montelusa mit einem dicken Strauß Rosen zurückkam. Sie war in Tränen ausgebrochen.
»Komm, hör auf.«
Er heulte selber fast.
»Warum denn?«
»Das hast du doch noch nie gemacht!«
»Und hast du mir schon mal Rosen geschenkt?«
Behutsam, damit sie nicht aufwacht, legt er ihr die Hand auf die Hüfte.
Er hat vergessen oder vielleicht bei der ersten Begegnung nicht darauf geachtet, dass Professor Di Bartolo nicht nur wie eine Ziege aussieht, sondern auch eine Ziegenstimme hat.
»Guten Morgen allerseits«, meckert er, als er hereinkommt, gefolgt von einem Dutzend Weißkitteln, die sich in den Raum drängen.
»Guten Morgen«, antwortet lediglich Montalbano, denn er ist der einzige Patient im Zimmer.
Der Professor tritt an sein Bett und mustert ihn interessiert. »Freut mich zu sehen, dass Sie trotz meiner Kollegen noch zurechnungsfähig sind.«
Auf einen Wink tritt Strazzera zu ihm und reicht ihm die Untersuchungsergebnisse. Der Professor sieht das erste Blatt kurz an und wirft es dann aufs Bett, ebenso das zweite, dann das dritte und auch das vierte. Montalbanos Kopf und Oberkörper sind bald unter Papieren verschwunden. Schließlich hört Montalbano die Stimme des Professors, sehen kann er ihn nicht, weil die Aufnahmen genau auf seinen Augen liegen: »Wozu haben Sie mich eigentlich geholt?«
Das Meckern klingt gereizt, die Ziege wird offensichtlich langsam wütend.
»Nun, Professore«, lässt Strazzera sich zögernd vernehmen, »einer unserer Assistenzärzte hat von einer Episode erzählt, und zwar hatte der Commissario vor ein paar Tagen einen ernsten …«
Was? Er kann Strazzera nicht hören. Vielleicht flüstert er dem Professor die Zusammenfassung der Folge ins Ohr. Folge? Was hat das mit Folgen zu tun? Das ist doch keine Romanverfilmung. Strazzera hat etwas von einer Episode gesagt. Aber die Folgen einer Romanverfilmung nennt man auch Episoden, oder?
»Setzen Sie ihn auf«, befiehlt der Professor.
Sie sammeln die Blätter ein und setzen ihn behutsam auf. In andächtigem Schweigen umzingeln die Doktoren sein Bett. Di Bartolo legt das Stethoskop an, versetzt es um ein paar Zentimeter, versetzt es erneut und hält inne. Als der Commissario das Gesicht des Professors so nah vor sich hat, merkt er, dass dieser immerfort den Unterkiefer bewegt, als kaue er Kaugummi. Doch plötzlich begreift er: Der Professor käut wieder. Di Bartolo ist wirklich eine Ziege. Die sich schon seit geraumer Zeit nicht bewegt. Reglos lauscht. Was hören seine Ohren wohl in meinem Herzen?, fragt sich Montalbano. Einstürzende Häuser? Spalten, die sich plötzlich auftun? Unterirdisches Dröhnen? Di Bartolo lauscht ewig, keinen Millimeter rückt er von der Stelle ab, die er ausgemacht hat. Tut ihm denn nicht der Rücken weh, wenn er so gebeugt dasteht? Dem Commissario bricht der Angstschweiß aus. Dann richtet sich der Professor auf.
»Das genügt.«
Sie legen Montalbano wieder hin.
»Meines Erachtens«, lautet die Schlussfolgerung der Koryphäe, »könnte man noch drei- oder viermal auf ihn schießen und dann die Kugeln ohne Narkose rausholen. Sein Herz würde das locker wegstecken.«
Grußlos verlässt er das Zimmer.
Zehn Minuten später liegt Montalbano im hell erleuchteten OP. Ein Mann legt ihm eine Art Maske aufs Gesicht.
»Tief einatmen«, sagt er.
Montalbano gehorcht. Und dann kann er sich an nichts mehr erinnern.
Warum hat eigentlich noch niemand ein Spray erfunden, fragt er sich, das man sich einfach in die Nase sprüht, wenn man nicht schlafen kann, es kommt Gas oder sonst was heraus, und auf der Stelle schläft man ein.
Das wäre doch praktisch, eine Narkose bei Schlaflosigkeit. Durst quält ihn. Er steigt vorsichtig aus dem Bett, damit Livia nicht aufwacht, geht in die Küche und schenkt sich aus einer angebrochenen Flasche Mineralwasser ein Glas ein. Und jetzt? Er macht mit dem Arm ein paar Übungen, die ihm die Krankengymnastin gezeigt hat. Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Der Arm lässt sich so gut bewegen, dass er unbesorgt Auto fahren kann.
Strazzera hat ganz Recht gehabt. Bloß schläft der Arm manchmal ein, wie wenn die Beine zu lange in derselben Position sind, und das fühlt sich dann an wie tausend Nadelstiche. Oder wie ein Ameisenhaufen. Montalbano trinkt noch ein Glas Wasser und legt sich wieder hin. Als Livia merkt, dass er unter die Decke schlüpft, murmelt sie irgendwas und kehrt ihm den Rücken zu.
»Wasser«, stöhnt er und schlägt die Augen auf.
Livia gießt ihm ein Glas ein und stützt seinen Kopf mit einer Hand im Nacken, damit er trinken kann. Dann stellt sie das Glas auf den Nachttisch und verschwindet aus Montalbanos Blickfeld. Er schafft es, sich ein bisschen aufzurichten. Livia steht am Fenster, und neben ihr Dottor Strazzera, der auf sie einredet. Montalbano hört Livia kichern. Wie witzig Dottor Strazzera ist! Und warum ist er Livia so nah auf die Pelle gerückt? Und warum findet Livia nicht, dass sie ein bisschen Abstand halten sollte? Euch werd ich’s zeigen.
»Wasser!«, schreit er wütend.
Livia fährt erschrocken zusammen.
»Warum trinkt er denn so viel?«, fragt sie.
»Das kommt von der Narkose«, erklärt Strazzera. Und fügt hinzu: »Die Operation war übrigens eine Bagatelle, Livia. Ich habe dafür gesorgt, dass man die Narbe kaum sehen wird.«
Livia lächelt ihn dankbar an, was den Commissario noch mehr in Rage bringt.
Eine unsichtbare Narbe! Dann wird der nächste Muskelmann-Schönheitswettbewerb ja ein Kinderspiel.
Apropos Muskel oder was das sonst ist. Montalbano rutscht lautlos zu Livia hinüber und schmiegt sich an ihren Rücken. Sie scheint die Berührung als angenehm zu empfinden, denn sie grunzt leise im Schlaf.
Montalbano legt die hohle Hand auf eine ihrer Brüste. Automatisch legt Livia ihre Hand auf seine. Mehr läuft nicht. Montalbano weiß nämlich genau, dass Livia weiteren Unternehmungen seinerseits sofort Einhalt gebieten würde. Das ist schon in der ersten Nacht so gewesen, als sie wieder in Marinella waren.
»Nein, Salvo. Kommt nicht in Frage. Es könnte dir wehtun.«
»Komm schon, Livia, ich bin an der Schulter verletzt, und nicht am …«
»Sei nicht so ordinär. Verstehst du das nicht? Mir wäre einfach nicht wohl dabei, ich hätte Angst, dir …«
Aber der Muskel, oder was das sonst ist, versteht die Befürchtungen nicht. Er hat kein Hirn, er ist es nicht gewohnt nachzudenken. Er lässt sich nichts sagen. Er steht einfach nur da, geschwollen vor Wut und Lust.
Angst. Furcht. Das ist es, was er zwei Tage nach der Operation empfindet, als gegen neun Uhr morgens die Wunde heftig zu schmerzen beginnt. Warum tut sie so weh? Wurde, was gar nicht so selten vorkommt, etwa ein Tupfer drin vergessen? Oder, wenn es kein Tupfer ist, vielleicht ein dreißig Zentimeter langes Skalpell? Livia merkt es sofort und ruft Strazzera. Der kommt gleich angelaufen, wahrscheinlich hat er eine Operation am offenen Herzen stehen und liegen lassen. Aber so ist es mittlerweile: Livia ruft, Strazzera rennt. Der Arzt sagt, die Schmerzen seien ganz normal und Livia brauche sich keine Sorgen zu machen. Er jagt Montalbano eine Spritze rein. Keine zehn Minuten später geschieht zweierlei. Erstens lassen die Schmerzen nach, zweitens sagt Livia:
»Der Polizeipräsident ist da.«
Sie geht hinaus. Herein kommen Questore Bonetti-Alderighi und Dottor Lattes, der Chef des Stabes, der die Hände zum Gebet gefaltet hat, als trete er ans Bett eines Sterbenden.
»Wie geht es Ihnen?«, fragt der Questore.
»Wie geht es Ihnen?«, leiert Lattes hinterdrein.
Und der Questore redet. Montalbano hört ihn allerdings nur bruchstückhaft, als risse ein böiger Wind die Wörter mit sich fort.
»… und deshalb wollte ich gerne Ihnen zu Ehren eine kleine Feier …«
» … Feier …«, echot Lattes.
»Frau Wirtin langt ihm an die Eier«, reimt eine Stimme in Montalbanos Kopf.
Windbö.
»… Dottor Augello übernimmt bis zu Ihrer Rückkehr …«
»Das freut ihn sehr, das freut ihn sehr«, ertönt wieder die innere Stimme.
Windbö.
Montalbanos Augenlider werden bleischwer und klappen einfach zu.
Jetzt sind seine Augenlider bleischwer. Vielleicht kann er endlich einschlafen. Neben Livias warmem Körper. Aber dieser blöde Fensterladen jault bei jedem Windstoß.
Was tun? Das Fenster öffnen und den Laden ordentlich schließen? Niemals, sonst wacht Livia bestimmt auf. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit. Einen Versuch ist es allemal wert. Nämlich sich nicht über das Gejaule aufregen, sondern es dem eigenen Atemrhythmus anpassen.
»Iiiih!«, macht der Laden.
»Iiih!«, macht Montalbano ganz leise.
»Eeeeh!«, macht der Laden.
»Eeeeh!«, echot er.
Doch diesmal hat er sich in der Lautstärke vertan. Schon öffnet Livia die Augen und richtet sich halb auf.
»Salvo! Hast du Schmerzen?«
»Warum?«
»Du jammerst!«
»Das war im Schlaf, entschuldige. Schlaf weiter.«
Verdammtes Fenster!
Zwei
Durch das weit geöffnete Fenster dringt eiskalte Luft herein. So ist das im Krankenhaus: Sie nehmen dir den Blinddarm raus und lassen dich an Lungenentzündung krepieren. Montalbano sitzt auf einem Stuhl, noch zwei Tage, dann darf er endlich nach Hause. Aber seit sechs Uhr morgens sind ganze Kolonnen von Putzfrauen unterwegs, die alles sauber machen, Flure, Zimmer, Abstellkammern, und alles auf Hochglanz bringen, Fenster, Türgriffe, Betten, Stühle. Nichts entgeht dem Putzwahn, Betten werden frisch bezogen, das Bad ist so blendend sauber, dass man es nur mit Sonnenbrille betreten kann.
»Was ist eigentlich los?«, fragt er eine Krankenschwester, die ihm wieder ins Bett hilft.
»Es kommt ein hohes Tier.«
»Wer denn?«
»Keine Ahnung.«
»Kann ich nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben?«
»Nein.«
Nach einer Weile taucht Strazzera auf, er ist enttäuscht, dass er Livia nicht antrifft.
»Vielleicht schaut sie später mal vorbei«, beruhigt Montalbano ihn.
Doch er hat aus purer Gemeinheit »vielleicht« gesagt, um den Doktor zappeln zu lassen. Livia hat fest versprochen zu kommen, aber erst ein bisschen später.
»Wer wird denn erwartet?«
»Petrotto. Der Staatssekretär.«
»Und was will er hier?«
»Ihnen gratulieren.«
Scheiße! Das hat ihm gerade noch gefehlt! Der Abgeordnete Gianfranco Petrotto, Rechtsanwalt und jetzt Staatssekretär im Innenministerium, aber auch schon verurteilt wegen Korruption, ein andermal wegen Erpressung im Amt, ein drittes Mal war die Tat verjährt. Exkommunist, Exsozialist und dann mit triumphalem Erfolg für die Mehrheitspartei ins Parlament gewählt.
»Könnten Sie mir nicht eine Spritze geben, die mich für drei Stunden bewusstlos macht?«, fleht er Strazzera an.
Der breitet die Arme aus und geht.
Bevor der Abgeordnete und Anwalt Gianfranco Petrotto bei Montalbano erscheint, dröhnt tosender Applaus durch den Flur. Doch Petrotto nimmt nur den Präfekten, den Polizeipräsidenten, den Chefarzt und einen Abgeordneten aus seinem Gefolge mit ins Zimmer.
»Die anderen warten draußen!«, brüllt er.
Dann beginnt er zu reden, klappt den Mund auf und zu. Er redet und redet und redet. Er weiß nicht, dass Montalbano sich die Ohren mit Watte voll gestopft hat. Und den Mist, den der Kerl verzapft, nicht hören kann.
Seit einer Weile hört er den Fensterladen nicht mehr jaulen. Er sieht gerade noch, dass es Viertel vor fünf ist, dann schläft er endlich ein.
Im Schlaf drang das unaufhörliche Klingeln des Telefons sehr gedämpft an sein Ohr.
Er öffnete ein Auge und sah auf die Uhr. Es war sechs. Er hatte erst eineinviertel Stunden geschlafen. Hastig stand er auf, um das Klingeln zu stoppen, bevor es Livia aus dem Tiefschlaf holte.
»Dottori, hab ich Sie vielleicht geweckt?«
»Catarè, es ist Punkt sechs!«
»Auf meiner Uhr ist es aber drei nach sechs.«
»Dann geht deine Uhr eben ein bisschen vor.«
»Echt, Dottori?«
»Ganz echt.«
»Dann stell ich sie drei Minuten zurück. Danke, Dottori.« »Bitte.«
Beide legten auf, und Montalbano wollte ins Schlafzimmer zurück. Nach ein paar Schritten blieb er fluchend stehen. Was war denn das für ein bescheuertes Gespräch? Rief Catarella in aller Herrgottsfrühe an, um festzustellen, ob seine Uhr richtig ging? Da läutete es wieder, der Commissario machte kehrt und nahm noch beim ersten Klingeln ab.
»Dottori, bitte verzeihen Sie, aber bei der Uhrzeit hab ich vergessen, dass ich ja angerufen hab, weil ich Sie wegen was anrufen wollte.«
»Worum geht’s denn?«
»Einem Mädchen sein Motorroller ist weg.«
»Wie weg – abgenommen oder geklaut?«
»Ich weiß nicht, Dottori, abgenommen, glaub ich.«
Montalbano wurde wütend. Er hätte Catarella am liebsten angeschrien, riss sich aber zusammen. »Und du weckst mich um sechs Uhr morgens, um mir zu sagen, dass die Steuerfahnder oder die Carabinieri einen Roller konfisziert haben? Ausgerechnet mir erzählst du das? Mir ist das scheißegal, wenn du erlaubst.«
»Dottori, Sie brauchen doch von mir keine Erlaubnis, dass Ihnen was scheißegal ist«, sagte Catarella respektvoll.
»Außerdem bin ich noch nicht wieder im Dienst, ich bin krankgeschrieben!«
»Ich weiß, Dottori, aber ich glaub, das mit dem Roller war nicht die Finanzpolizei und die Carrabbinera.«
»Die heißen Carabinieri, Catarella. Wer war es dann?«
»Das ist ja der Haken, Dottori. Das weiß keiner, den kennt keiner. Und deshalb sollte ich ja bei Ihnen ganz persönlich selber anrufen.«
»Sag mal, ist Fazio da?«
»Nein, der ist dort.«
»Und Dottor Augello?«
»Der auch.«
»Und wer ist im Kommissariat?«
»Ich pass proffisorisch auf. Der Dottori Augello hat gesagt, ich tu ihn vertreten.«
Matre santa! Das war riskant und musste sofort geändert werden, Catarella brachte es fertig, nach dem Diebstahl einer Handtasche einen Atomkrieg auszulösen. Hatten sich Fazio und Augello tatsächlich auf den Weg gemacht, nur um einen Motorroller sicherzustellen? Und warum ließen sie bei ihm anrufen?
»Hör zu, du rufst jetzt Fazio an und sagst ihm, er soll sich sofort bei mir in Marinella melden.«
Er legte auf.
»Hier geht’s ja zu wie auf dem Marktplatz!«, sagte eine Stimme hinter ihm.
Er drehte sich um. Es war Livia, und ihre Augen glitzerten vor Wut. Sie hatte nicht den Morgenmantel angezogen, sondern war in sein Hemd vom Vortag geschlüpft. Als Montalbano sie so sah, spürte er ein großes Verlangen, sie zu umarmen. Doch er beherrschte sich, Fazio konnte jeden Moment anrufen.
»Livia, bitte, meine Arbeit …«
»Deine Arbeit solltest du im Kommissariat erledigen. Und nur, wenn du im Dienst bist.«
»Du hat ja Recht, Livia. Bitte, geh wieder ins Bett.«
»Was soll ich denn im Bett! Ich bin längst wach! Ich mache jetzt Kaffee«, sagte Livia.
Das Telefon klingelte.
»Fazio, hättest du die Güte, mir zu erklären, was diese Scheiße soll?«, fragte Montalbano laut. Er brauchte keine Rücksicht mehr zu nehmen, schließlich war Livia nicht nur aufgewacht, sondern sowieso schon sauer.
»Sei bitte nicht so ordinär!«, rief Livia prompt aus der Küche.
»Hat Catarella Ihnen nichts gesagt?«
»Catarella hat mir einen Scheiß gesagt …«
»Würdest du bitte aufhören?«, rief Livia.
»… er hat was von einem konfiszierten Roller gefaselt, mit dem aber weder die Finanzpolizei noch die Carabinieri zu tun haben. Und warum, verdammt noch mal …«
»Hör auf, habe ich gesagt!«
»… belämmert ihr mich damit? Vielleicht war es ja die Verkehrspolizei!«
»Nein, Dottore. Es geht nicht um einen konfiszierten Roller, sondern um die entführte Halterin dieses Rollers.«
»Wie bitte?«
»Es geht um Freiheitsberaubung, Dottore.«
Um Freiheitsberaubung?! In Vigàta?!
»Wo seid ihr denn? Ich komme sofort«, sagte er, ohne nachzudenken.
»Der Weg ist ziemlich kompliziert. Wenn es Ihnen recht ist, lasse ich Sie in spätestens einer Stunde abholen. Dann brauchen Sie nicht selbst zu fahren.«
»In Ordnung.«
Er ging in die Küche. Livia hatte die Kaffeemaschine aufs Gas gestellt. Und jetzt breitete sie eine Tischdecke über den Küchentisch. Als sie sich vorbeugte, um sie glatt zu streichen, rutschte ihr das Hemd hoch.
Das war zu viel für Montalbano. Er trat zwei Schritte auf sie zu und schlang von hinten die Arme um sie.
»Spinnst du?«, sagte Livia. »Lass mich los! Was willst du denn?«
»Rate mal.«
»Aber du tust dir …«
Der Kaffee stieg hoch. Niemand drehte die Flamme ab. Der Kaffee gurgelte. Die Flamme brannte weiter. Der Kaffee fing an zu kochen. Niemand kümmerte sich darum. Der Kaffee lief über und löschte die Flamme. Das Gas strömte weiter aus.
»Riecht es nicht irgendwie komisch nach Gas?«, fragte Livia nach einer Weile matt und löste sich aus Montalbanos Umarmung.
»Ich rieche nichts«, sagte er, denn er nahm nur den Duft ihrer Haut wahr.
»Oh Gott!«, rief Livia und drehte rasch das Gas ab.
Montalbano blieben knapp zwanzig Minuten zum Duschen und Rasieren. Den frisch zubereiteten Kaffee trank er im Stehen, denn es klingelte bereits an der Tür. Livia fragte nicht mal, warum und wohin er ginge. Sie hatte das Fenster geöffnet und räkelte sich mit erhobenen Armen in einem Sonnenstrahl.
Unterwegs berichtete Gallo, was er von der Geschichte wusste. Die entführte junge Frau – denn an einer Entführung schien kein Zweifel mehr zu bestehen – hieß Susanna Mistretta, war sehr hübsch, studierte in Palermo und stand kurz vor ihrer ersten Prüfung. Sie lebte mit ihren Eltern fünf Kilometer außerhalb der Stadt in einer Villa. Dorthin fuhren sie jetzt. Susanna bereitete sich seit etwa einem Monat zusammen mit einer Freundin in Vigàta auf ihre Prüfung vor, und gegen acht Uhr abends fuhr sie immer mit ihrem Roller nach Hause.
Als sie am Vorabend nicht nach Hause kam, hatte der Vater noch eine Stunde gewartet und dann die Freundin seiner Tochter angerufen. Susanna sei wie immer um acht losgefahren, plus/minus ein paar Minuten, sagte die Freundin. Daraufhin hatte er den jungen Mann angerufen, den seine Tochter als ihren Freund bezeichnete, doch der reagierte überrascht, denn er hatte sich mit Susanna nachmittags, bevor sie zu der Freundin fuhr, in Vigàta getroffen, und sie hatte gesagt, sie könne an dem Abend nicht mit ihm ins Kino, weil sie zu Hause noch lernen müsse.
Da machte sich der Vater Sorgen. Er hatte schon mehrmals versucht, seine Tochter auf dem Handy zu erreichen, aber es war ausgeschaltet. Als dann bei ihm zu Hause das Telefon klingelte, ging er sofort dran, weil er dachte, Susanna riefe an. Aber es war der Bruder.
»Susanna hat einen Bruder?«
»Nein, sie ist Einzelkind.«
»Wessen Bruder dann?«, fragte Montalbano ärgerlich, denn Gallo fuhr rasant und die Straße war so voller Schlaglöcher, dass nicht nur sein Kopf dröhnte, sondern auch die Wunde ziemlich schmerzte.
Der fragliche Bruder war der Bruder des Vaters des entführten Mädchens.
»Haben alle diese Leute auch einen Namen?«, fragte der Commissario ungeduldig und hoffte, dem Bericht besser folgen zu können, wenn er die Namen kannte.
»Doch, natürlich, aber ich weiß sie nicht«, antwortete Gallo. Und fuhr fort:
»Der Bruder des Vaters der Entführten ist Arzt und …«
»Nenn ihn Onkel Doktor«, schlug Montalbano vor.
Der Onkel Doktor hatte sich telefonisch nach der Schwägerin erkundigt. Also nach der Mutter der Entführten.
»Wieso das? Ist sie krank?«
»Ja, Dottore, sehr krank.«
Der Vater hatte dem Onkel Doktor dann erzählt …
»Nein, in dem Fall musst du ›Bruder‹ sagen.«
Der Vater hatte seinem Bruder von Susannas Verschwinden erzählt und ihn gebeten, zu kommen und sich um die Kranke zu kümmern, damit er nach seiner Tochter suchen konnte. Der Arzt hatte viel zu tun, und so kam er erst nach elf Uhr.