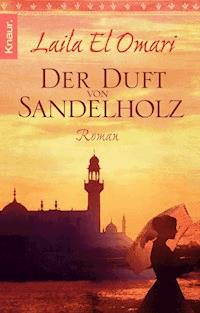
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bombay 1753: Die lebenslustige Elisha Legrant begehrt immer wieder gegen die Konventionen der englischen Kolonialgesellschaft auf. Statt gepflegte Konversation zu betreiben, erkundet sie lieber das bunte Treiben am Hafen, die Vielfalt von Farben und Gerüchen auf dem Basar oder die traditionelle Kunst der Kalligraphie. Als Elisha dem Arzt Damien Catrall begegnet, ist sie fasziniert von seinem medizinischen Wissen und bittet ihn, sie zu unterrichten. Schon bald wird aus den fachlichen Gesprächen mehr – das Paar kommt sich immer näher. Doch Damien ist auf Drängen seines Vaters bereits mit einer reichen Erbin verlobt, eine gemeinsame Zukunft scheint damit unmöglich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 860
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Laila El Omari
Der Duft von Sandelholz
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Bombay 1753: Die lebenslustige Elisha Legrant begehrt gegen alle Konventionen der englischen Kolonialgesellschaft auf. Statt gepflegte Konversation zu betreiben, erkundet sie lieber das bunte Treiben am Hafen, die Vielfalt von Farben und Gerüchen auf dem Basar oder die traditionelle Kunst der Kalligraphie. Als Elisha dem Arzt Damien Catrall begegnet, ist sie fasziniert von seinem medizinischen Wissen und bittet ihn, sie zu unterrichten. Schon bald wird aus den fachlichen Gesprächen mehr – das Paar kommt sich immer näher. Doch Damien ist auf Drängen seines Vaters bereits mit einer reichen Erbin verlobt, eine gemeinsame Zukunft scheint damit unmöglich ...
Ein Roman, der in die exotische Welt Indiens entführt und mit historischem Flair bezaubert.
Inhaltsübersicht
1
Bombay, Mai 1753
Wenn Papa dich so sieht, dann gibt es Ärger«, prophezeite May, »richtig Ärger.« Sie saß in ausreichend großem Abstand zum Seeufer im Gras und hatte die Füße unter ihr Kleid gezogen. Im Wasser stand ihre ältere Schwester Elisha, den Rock schockierend hoch über die Knie gerafft, und bückte sich nach einem Stein. Schuhe und Strümpfe lagen nachlässig hingeworfen am Seeufer, ein Strumpf halb im Wasser. Elisha besah kritisch den Stein, der von weitem so faszinierend gewirkt hatte, und fragte sich, ob sie anderen Menschen mit elf Jahren auch so penetrant auf die Nerven gegangen war wie May. Glaubte man ihrer älteren Schwester Charlotte, dann war sie weitaus schlimmer gewesen, aber Charlotte hatte ohnehin immer etwas auszusetzen, so dass ihre Aussagen mit einiger Skepsis zu betrachten waren.
Elisha ließ den Stein wieder fallen und sah über den See, der wie eine silbrige Scheibe vor ihr lag, auf der sich das Sonnenlicht funkelnd brach. Sie hatte den unbändigen Wunsch, ihr Kleid auszuziehen und sich in das Wasser sinken zu lassen. Das Verlangen wurde für einen Moment lang so stark, dass sie es kaum ertragen konnte, ihm nicht nachzugeben. Den Rock in beiden Händen haltend, stand sie unbeweglich da und schloss die Augen. Einen verstörenden Augenblick lang hielt das Gefühl an. Wasser spielte samtweich um ihre Beine und lockte unwiderstehlich. Mays Aufkeuchen riss sie aus ihren Gedanken. Sie öffnete die Augen, und in ihrem Entsetzen, einen Reiter am Seeufer zu sehen, ließ sie instinktiv ihren hochgerafften Rock los, dessen schwerer Reifrock sofort sank, so dass das Überkleid wie ein weites Zelt um sie herum auf dem Wasser lag.
Lamont Montaury, ehemaliger Angestellter der französischen Compagnie des Indes, zügelte schweigend sein Pferd und sah sie an, wobei Elisha nicht sagen konnte, ob auf seinem Gesicht Verwunderung oder einfach nur Belustigung stand. Elisha widerstand dem Drang, ihrem Ärger laut Luft zu machen, und schleppte sich mit dem schweren Rock zum Ufer. Vergeblich versuchte sie, den Reifrock anzuheben, während May, das dumme Ding, mit riesigen Augen unter einem Küstenbaum mit dunkelgrünem Laub und weißen Blütenrispen stand und Lamont verängstigt anstarrte, anstatt ihr zu Hilfe zu kommen. Lamont stieg vom Pferd und trat ans Ufer.
»Sie erlauben?« Er streckte ihr eine Hand entgegen, die sie, mit so viel Würde, wie ihr möglich war, ergriff und sich ans Ufer ziehen ließ.
»Vielen Dank.« Sie drückte mit den Händen das Wasser aus dem Stoff, wobei sie kein nennenswertes Ergebnis erzielte. Der Rock würde unter keinen Umständen trocknen, ehe sie zu Hause war – wenn es überhaupt möglich war, ihn zu retten. Vermutlich könnte sie das Kleid nur noch wegwerfen. Ihre Mutter würde außer sich sein. Etwas mühsam schleppte Elisha sich mit dem schweren Rock den Weg hoch. Kaum einen Schritt konnte sie gehen, ohne das Gefühl zu haben zu schwanken.
Lamont führte sein Pferd am Zügel hinter sich her. »Ich bringe Sie nach Hause«, bot er an. Sein Englisch war weich, so als moduliere er die Worte bewusst, um seinen Akzent zu verdecken, der dennoch immer unterschwellig mitschwang. Er strich mit der Hand über die Nüstern des Pferdes und lächelte. »Ihnen zuliebe einigen wir uns vielleicht besser auf die Version, dass Sie ins Wasser gefallen sind und ich Sie herausgezogen habe. Das würde Ihnen einiges ersparen.«
Elisha zog ihre Unterlippe zwischen die Zähne, während sie in Gedanken überschlug, was schlimmer war – sich mit dem schweren Rock mühsam nach Hause zu schleppen oder sich von Lamont Montaury heimbringen zu lassen. Sie sah ihn an und nickte. »Wenn es Ihnen keine Umstände macht, nehme ich das Angebot gerne an.«
Mit einem Blick auf ihre Schuhe und Strümpfe fügte sie hinzu: »Wären Sie so freundlich …« Sie zögerte, plötzlich verlegen geworden, und spürte zu ihrem Ärger, dass sie errötete. Ohne ein Wort zu sagen, drehte Lamont sich um, und Elisha beeilte sich, so gut es in dem vollgesogenen Rock ging, die Strümpfe überzustreifen, was dadurch erschwert wurde, dass einer der Strümpfe nass war.
»Einen Moment noch«, sagte sie, in der Annahme, Lamont könne ungeduldig werden und weil sie das amüsierte Zucken seiner Mundwinkel noch vor Augen hatte, mit dem er ihre Verlegenheit bedachte.
May stand schockiert schweigend neben ihnen und schien nichts anderes denken zu können, als dass ihre Schwester den Verstand verloren haben musste. Als Elisha so weit war, wandte Lamont sich wieder zu ihr um. Elisha trat neben das Pferd, und ehe Lamont ihr hinaufhelfen konnte, mischte sich May ein: »Das ist ein Herrensattel.«
»Im Damensattel hätte er wohl auch einen reichlich komischen Anblick geboten«, entgegnete Elisha gereizt. Es war schwierig, in dem Sattel Halt zu finden, wenn beide Beine an einer Seite herunterhingen und der wasserschwere Rock sie unweigerlich nach unten zu ziehen versuchte. Sie wollte die Zügel nehmen, woran Lamont sie hinderte.
»Sie sitzen da ohnehin etwas wacklig. Es ist besser, wenn ich das Pferd führe.«
»Aber ich kann reiten«, protestierte sie.
»Das glaube ich gerne«, entgegnete Lamont und zog die Zügel über den Pferdehals nach vorn zu sich, so dass Elisha keine andere Wahl blieb, als sich an der Mähne festzuhalten. Sie hatte das Gefühl, dass sie in höchstem Maße lächerlich aussehen musste, wie sie sich leicht vornübergebeugt an dem Pferd festhielt, der Rock ihres sommerlichen Seidenkleides bis über die Knie dunkel vor Nässe, eine Spur von Tropfen auf dem Sandweg hinterlassend. Dazu kam das leise Knarren des Fischbeinkorsetts, sobald sie versuchte, sich ein wenig aufzurichten.
Sie sah hinunter auf Lamonts weizenblondes Haar, das in der Sonne glänzte und im Nacken mit einem grünen Band passend zu seiner eleganten Kleidung zusammengebunden war. Es gab Mädchen in ihrem Bekanntenkreis, die für solches Haar gemordet hätten. Ihr Blick fiel auf Mays hellbraunen Schopf, und sofort wurde sie wieder gereizter Stimmung, als sie sah, wie schüchtern diese sich am Wegrand hielt, so als fürchte sie, Lamont versehentlich zu berühren. Aber so auffallend ängstlich war May immer mit Fremden, man konnte es ihr einfach nicht abgewöhnen. Dass dieser Mann noch dazu einer der Männer war, in deren Begleitung sich anständige Mädchen englischer Familien nicht aufhalten sollten, trug nicht unbedingt dazu bei, May entspannter werden zu lassen. Dabei brauchte sie sich doch keine Sorgen zu machen, dachte Elisha. Wenn jemand den Vorfall auszubaden hatte, dann sie selbst wegen ihrer Unvorsichtigkeit. Von der kleinen May hätte niemand verlangen können, allein zurückzubleiben, während ihre Schwester von Lamont heimgebracht wurde. Ihr Vater wäre ohnehin ungehalten, wenn er wüsste, dass sie sich ein wenig weiter vom Haus entfernt hatte, als ihr erlaubt war. Sie durfte den See lediglich auf der Gartenseite des Hauses aufsuchen, nicht außerhalb.
Der Weg führte an den Häusern englischer Händler vorbei, mehrstöckige Prachtbauten inmitten üppiger Rasenflächen, die von einheimischen Dienern bewässert wurden. Veranden zogen sich um die Häuser herum, teilweise mit aufwendig geschnitzten Balustraden. Die Häuser der Engländer standen im Südteil von Bombay, während die Einheimischen den Norden bewohnten, die sogenannte bazaar zone, die schwarze Stadt. Tropenhitze hing wie eine Glocke über Bombay, ließ die Luft flimmern und barg die Vorboten des Monsuns. Lamont führte das Pferd auf das weiße weitläufige Haus der Legrants zu. Das Eingangstor stand tagsüber offen und wurde erst am Abend geschlossen. Der Dienstbote, dem die Wache am Tor oblag, musterte Lamont argwöhnisch, ließ ihn aber anstandslos passieren, weil Elisha in seiner Begleitung war. Über drei Stockwerke verliefen Veranden aus dunklem Holz um das Haus, die Brüstung in den oberen beiden Etagen war mit geschnitzten Ornamenten verziert, die untere Veranda war umgeben von einer Balustrade. Das Haus selbst vermittelte den Eindruck von englischer Eleganz gepaart mit indischem Baustil, der durch große Fenster mit fein ziselierten Gittern aufgelockert und weniger massiv wirkte. May lief voraus, kaum dass das Haus in Sicht war, rannte über den mit Marmorplatten bedeckten Innenhof, der gleißend hell in der Sonne lag, und verschwand durch die Eingangstür.
»Ihre kleine Schwester scheint mich für einen dem See entstiegenen Wassergeist zu halten«, bemerkte Lamont.
»Umso schlimmer, dass sie mich dann mit Ihnen allein lässt«, antwortete Elisha trocken. Sie hatten den Weg hoch zum Haus kaum zur Hälfte zurückgelegt, als sich die Haustür erneut öffnete und ihnen ein hochgewachsener Mann entgegenkam, das helle Haar im Nacken zusammengebunden, elegant gekleidet, die Mimik sichtlich schwankend zwischen Besorgnis und Erregung.
Er grüßte Lamont kurz angebunden, ehe sein Blick an seiner Tochter hängen blieb, deren nasse Kleidung er erst jetzt bemerkte.
»May sagte nichts von einem Unfall, Montaury.«
»Es ist nicht der Rede wert, Papa«, beeilte sich Elisha zu versichern.
»Wie ist das denn geschehen?«, wollte Jack Legrant wissen.
Elisha ließ sich vom Pferderücken rutschen, wobei sie Lamonts hilfreich entgegengestreckte Hand nach kurzem Zögern ergriff, den forschenden Blick ihres Vaters spürend. »Eine Unachtsamkeit«, entgegnete sie. »Ich hatte mich einfach erschrocken.«
Jack zog Elisha sanft am Arm neben sich. »Einen schönen Tag noch«, sagte er zu Lamont und drehte sich um, seine Tochter mit einer Hand am Ellbogen mit sich führend. Auch wenn sie sich sagte, dass ihr Vater sicher gute Gründe für sein Verhalten hatte, war Elisha seine Unhöflichkeit peinlich, vielleicht gerade, weil es ein Zug an ihm war, der ihr wenig vertraut war. Sie wandte sich noch einmal kurz zu Lamont um, um ihm zu danken, aber dieser war bereits wieder auf sein Pferd gestiegen und im Begriff, in die entgegengesetzte Richtung davonzureiten.
»Worauf wartest du?«, fragte Jack, der das Zögern seiner Tochter bemerkte.
»Ich dachte, ich sollte ihm noch einmal danken.«
»Schleichhändler«, sagte er verächtlich und sah aus, als würde er am liebsten auf den Boden spucken, woran ihn allein die Anwesenheit seiner Tochter hinderte.
»Er wollte mir gegenüber nur hilfsbereit sein.« Elisha ging am Arm ihres Vaters, der seine Schritte den ihren anpasste.
»Etwas anderes hätte ich ihm auch nicht raten wollen. Was hattest du überhaupt so nahe am Seeufer zu suchen, dass du hineinfallen konntest?« Jack sah zu seiner Tochter hinunter und bemerkte den leichten Anflug von Röte auf ihren Wangen.
»Ich wollte einen Stein aus dem Wasser holen.«
»Und dann bist du ausgeglitten und mit den Beinen voran in den See gefallen, ohne dabei mit dem Kleid den Boden zu berühren? Oder wie darf ich den Mangel jeglicher Schlammspuren deuten? Davon abgesehen, dass du dich offenbar nicht im Garten aufgehalten hast.« Er wartete kurz, dann meinte er: »Aber ehrlich gesagt, will ich es, glaube ich, so genau gar nicht wissen. Sorg nur in Zukunft dafür, dass kein Lamont Montaury deinen Retter spielen darf.«
Elisha senkte leicht den Kopf. »Er stand plötzlich am Seeufer, ich konnte ihn nicht einmal kommen hören. Für einen kurzen Moment war ich wirklich erschrocken.«
Jack atmete schnaubend aus. »Er ist Franzose.« Das sagte alles.
Eilig, ehe ihre Mutter ihren Aufzug bemerken konnte, lief Elisha – kaum dass sie das Haus betreten hatte – die Treppe hoch, um sich umzukleiden. May stand am obersten Absatz und drücke sich am Treppengeländer herum.
»Warum bist du einfach fortgelaufen?«, fragte Elisha. »Merkst du nicht, wie albern das wirkt?«
»Ich bin nicht gerne allein mit Fremden.«
»Er war kein Fremder«, wies Elisha ihre Schwester zurecht. »Und selbst wenn er ein Fremder wäre, warst du nicht mit ihm allein, ich hingegen schon, nachdem du einfach weggerannt bist wie ein unverständiges Kind.«
»Worum geht es?«, fragte Charlotte, die unbemerkt in den Korridor getreten war. Sie ging ans Fenster und schob einen der Holzläden auf. »Das war Lamont Montaury.« Es hörte sich an, als spreche sie mit sich selbst, während sie auf den leeren Weg vor dem Haus sah. »Ich habe euch von meinem Fenster aus gesehen.« Den Fensterladen wieder schließend, drehte sie sich um und musterte Elisha. »Und du hast dich mal wieder lächerlich gemacht, oder wie darf ich den Aufzug deuten?«
»Elisha hat ohne ihre Strümpfe im Bach gestanden, als Monsieur Montaury gekommen ist«, sagte May.
Charlotte zog die Augenbrauen hoch. »Nicht zu fassen. Woher hast du denn dieses Gespür für weibliche Taktik bekommen? Wie wunderbar zufällig. Hast du ihm wenigstens einen Blick auf deine Beine gewährt, ehe du deinen Rock eingeweicht hast?«
»Charlotte!« May blies entsetzt die Wangen auf.
Elisha versuchte, ungerührt zu wirken, was mit hochroten Wangen nicht ganz einfach war. »Ich denke, er war Gentleman genug, nicht darauf zu achten.«
»Oh, aber natürlich doch.« Charlotte raffte ihr helles Kleid und ging zur Treppe.
In Elishas Zimmer schien die Luft zu stehen. Die Punkah, ein an der Decke angebrachter Fächer, den ein Hindu-Junge, der Punkahwallah, mit einem an seinem Fuß festgebundenen Band bewegte, sorgte mitnichten für Abkühlung. Fest verschlossene Fensterläden sollten die Sonne und vor allem das Ungeziefer draußen halten. Später am Nachmittag, wenn die Sonne weitergewandert war, würde man die Fensterläden öffnen und nasse Laken vor die glaslosen Fenster spannen, um für Abkühlung zu sorgen. Ungeziefer fand zu Elishas Kummer trotz aller Vorsicht stets einen Zugang zum Zimmer. Mehrmals war es vorgekommen, dass, obschon ein Baldachin ihr Bett umgab, Insekten dorthin vorgedrungen waren. Elisha erinnerte sich mit Schaudern an eine Nacht, in der ein großer Käfer auf ihre Brust gefallen war.
Manjula, ihre Ayah, war ihres und Charlottes ehemaliges und Mays derzeitiges Kindermädchen und fungierte nun als Zofe für die beiden älteren Schwestern. Elisha wusch sich und ließ sich in ihr Kleid helfen, ein Gebilde aus smaragdgrüner Seide mit Silberfäden.
Ihr Teint war nicht so hell, wie es der herrschenden Mode entsprach, ein Erbe ihrer spanischen Großmutter, von der es hieß, sie sei eine wahre Schönheit gewesen. Die Schönheit hatte Charlotte geerbt und sie selbst den Teint und die grauen Augen in der Farbe von Kieseln mit einem dunkleren Ring um die Iris. Irgendjemand hatte mal gesagt, dass ihre Augen irritierend hell wirkten, weil sie selbst so dunkel sei. Der Sprecher hatte nicht gewusst, dass Elisha ihn gehört hatte, war aber sichtlich befremdet gewesen, als sie ihn danach keines Wortes mehr gewürdigt hatte.
Etwas zerstreut strich Elisha über ihr Kleid und überlegte einen Augenblick, ob es nicht ein wenig zu aufwendig war für einen Nachmittagstee. Lustlos beobachtete sie im Spiegel, wie Manjula ihr Haar hochsteckte, es zu einer Frisur auftürmte, es kritisch betrachtete, wieder löste und auf kleine Elfenbeinnadeln rollte, um es erneut festzustecken.
Besucher hatten sich angekündigt – Ehefrauen der Freunde ihres Vaters. Elisha kam dem Wunsch ihrer Mutter, bei derartigen Teegesellschaften anwesend zu sein, meist nur widerwillig nach, ließ sich ihren Unwillen aber für gewöhnlich nicht anmerken. Ihre Mutter hing der irrigen Annahme an, darüber entscheiden zu können, wie Elisha ihre Zeit zu verbringen hatte. So schien sie der Auffassung zu sein, dass allein die ständigen Besuche von Frauen, deren Söhne im Dienst der Kompanie oder der britischen Marine standen, Elisha bestrebt sein ließen, dem Weg ihrer Mutter zu folgen. Langsam neigte Elisha den Kopf, und ein kurzer Anflug von Traurigkeit überkam sie, wie sooft in letzter Zeit, wenn sie daran dachte, dass sie die schützende Hülle ihrer Kindheit allmählich von sich streifte und ihren Eltern die Verantwortung für ihr eigenes Leben aus der Hand nahm. Ihr Vater merkte es wohl, und manchmal sah sie in seinen Augen, dass auch er eine Art von Verlust verspürte. Aber er verstand sie und schien zu wissen, dass ihr die Veränderungen in ihrem Wesen, die neue Art, ihre Umwelt wahrzunehmen und sich für ihren eigenen Weg zu entscheiden, nicht immer leicht fiel. So fand sie neben dem Verlustgefühl in seinen Blicken immer die unverbrüchliche Zusicherung seines Beistandes. Ihre Mutter hingegen hatte ihr gesagt, erwachsen werden sei kein Recht, sondern eine Pflicht. Das war im März gewesen, kurz vor ihrem achtzehnten Geburtstag.
Archibald Stonewall war ein kleiner Angestellter der Kompanie, der sich aber gerne mit dem Status seines Großonkels schmückte – eines Admirals der britischen Flotte, der im letzten Seekrieg gefallen war. Mit seinen blassen Augen und seinen etwas wulstigen Lippen, ließ er Elisha immer an einen Karpfen denken. Wie jeden Montag war er zum Abendessen gekommen und gab das von sich, was er geistreiche Konversation nannte und von Charlotte stets als gepflegte Langeweile bezeichnet wurde. Elisha saß ihm gegenüber und stellte sich vor, sie könne seine Worte lautlos werden lassen und nur sehen, wie der Mund sich immer wieder öffnete und schloss wie bei einem Fisch auf dem Trockenen. Eine Zeit lang faszinierte sie diese Vorstellung.
Kerzen in Kandelabern verbreiteten warmes Licht, Teppiche lagen auf dem polierten Holzboden, indische Dienstboten standen um den Tisch herum, hielten Ungeziefer vom Essen fern, während weitere Diener auftrugen. Für jede Aufgabe im Haus gab es eigene Dienstboten. So würde der Diener, der das Essen auftrug, niemals Essen zubereiten, die Diener, die das Geschirr aufräumten, kein Essen abtragen, der Diener, der das Silber reinigte, niemals den Boden putzen. Es war eine komplizierte Struktur, auf die sorgsam geachtet werden musste. Der Khansana verwaltete das Haus und stand den Dienstboten vor, ein englischer Haushalt war ohne ihn außerstande, zu funktionieren.
Beeindruckt von seiner eigenen Stimme, erzählte Archibald von einer Gruppe irischer Schleichhändler, die während eines Gefechtes von ihren Nachschubplätzen abgeschnitten waren und somit nicht mehr die Möglichkeit hatten, sich mit Trinkwasser zu versorgen. Eine belustigende Vorstellung, so meinte er, wie dieses Pack mitten im Wasser verdurstete. Elisha fand diese Vorstellung nicht komisch, sondern tragisch und tieftraurig und sagte das auch. Archibald lächelte daraufhin und löste seine Blicke gerade lange genug von Charlottes Gesicht, um sich bei Elisha zu entschuldigen, eine derartige Geschichte bei Tisch erwähnt zu haben. Während seine Blicke wieder über den Tisch zu Charlotte schwenkten, beeilte er sich, hinzuzufügen, wie hinreißend er ihr empfindsames weibliches Gemüt fand.
Elisha war an derartige Verhaltensweisen der Männer längst gewöhnt und dachte sich, wenn ihr Gemüt wirklich so empfindsam wäre, wie Archibald glaubte, hätte sie sich vermutlich längst im Garten erhängt. Weil der fischmundige Archibald aber ohnehin von vornherein nicht im Rennen um ihre Gunst war, überließ sie ihn nur zu gerne ihrer schönen Schwester. Nicht dass Charlotte an ihm interessiert gewesen wäre, aber sie nahm derartige Gunstbezeugungen als ihr naturgegebenes Recht hin und wäre zutiefst erstaunt gewesen, wenn diese ihr einmal versagt würden.
Der Aufmarsch heiratswilliger Galane im Haus von Jack Legrant beschränkte sich auf das Abendessen, der Nachmittagstee war ihren Müttern vorbehalten. Es waren beinahe immer dieselben jungen Männer, die Besuche abstatteten, und lediglich einer von ihnen, Jamie Truitt, war Elisha sympathisch. Zwar war sie nicht an ihm als Ehepartner interessiert – und er an ihr wohl ebenso wenig –, aber er war lustig und unterhaltsam und im Gegensatz zu Archibald wenigstens keine Beleidigung für Augen und Intelligenz.
Das Gespräch befasste sich mit der in Bombay herrschenden Angst vor den Marathen, die einen überwiegenden Teil der Waldgebiete an den Hängen der West-Ghats beherrschten, von wo die Schiffswerften große Bestände an Teakholz bezogen. Dann kam man auf den Schleichhandel und die oftmals komplizierten Kontakte zu den Herrschern zu sprechen.
»Wir sehen uns zwei grundlegenden Problemen gegenüber«, sagte Archibald, wobei er sich mühelos in den Stab derjenigen, die die Kompanie vertraten, einreihte. »Zum einen die Kontrolle über den Privathandel unserer eigenen Angestellten, und zum anderen die Gefährdung unserer Beziehungen mit den indischen Herrschern, in denen ich ohnehin eine ständige Bedrohung sehe. Man müsste den Status der Kompanie ändern, ihre Einflussnahme ausweiten und notfalls gegen Drohungen militärisch vorgehen.«
Jack Legrant legte sein Besteck hin und schob den leeren Teller ein Stück weit von sich. »Wie stellen Sie sich das vor, Archibald? Es ging uns nie darum, uns territoriale Macht anzueignen.«
»Aber unter manchen Umständen ist friedlicher Handel nicht möglich«, beharrte Archibald. »Sehen Sie nur, was wir aus Bombay gemacht haben. Selbst die Inder zieht es in die Stadt, weil sie sich dort sicherer fühlen als im Hinterland. Und als Belohnung dafür sollen wir ständig möglichen Übergriffen ausgesetzt sein?«
»Die Direktoren sind bestrebt, den Frieden mit den Herrschern zu erhalten, von Übergriffen kann also nicht die Rede sein.«
»Das nützt uns aber nichts, wenn diese Herrscher selbst sich ständig uneins sind. Meines Erachtens ist es für uns am sichersten, wenn sie lernen, uns zu fürchten.«
Jack runzelte die Stirn. »Das ist nicht unser Land, Archibald.« Das Machtbestreben der Europäer in einem Land, das durch seine eigenen Landesherren ständig politischen Unruhen ausgesetzt war, empfand er als besorgniserregend. Die Kompanie war auf die Bündnisse mit den indischen Fürsten angewiesen, und es war fraglich, inwieweit sie sich an diese gebunden fühlen würden, sollte es den Engländern plötzlich einfallen, Herrschaftsansprüche geltend zu machen. Andererseits hatten die durchschlagenden Erfolge der Franzosen während des letzten Krieges den Engländern die Augen geöffnet.
»Aber wir verhelfen dem Land zu Wohlstand«, bekräftigte Archibald seinen Standpunkt.
»Wem verhelfen wir zu Wohlstand?«, mischte sich Elisha ein. »Dem Land oder uns selbst?«
Archibald verzog seine Lippen zu einem nachsichtigen Lächeln. »Meine liebe Miss Legrant, ich muss mich erneut bei Ihnen entschuldigen, derartige Themen bei Tisch anzuschneiden. Ich kann verstehen, dass Sie das langweilen muss.«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich mich langweile, sondern eine Frage gestellt.«
»Elisha«, mahnte ihre Mutter leise.
»Lassen Sie nur«, sagte Archibald lachend. Selbst sein Lachen klang blubbernd, fand Elisha. »Auf Ihre Fragen«, fuhr Archibald fort, »gibt es nur die Antwort, dass der Wohlstand, den wir uns erarbeiten, auch dem Land guttun wird. Wir erschließen Märkte, von denen die Wilden hier keine Ahnung hatten, geschweige denn überhaupt imstande wären, sie zu nutzen.«
»Die Wilden?«, fragte Elisha. »Haben Sie jemals einen der Paläste von innen gesehen oder mal verglichen, wie unsere Architektur neben ihrer wirkt?«
»Aber nur die Häuser – ich bitte Sie«, schnappte Archibald. »Dieser Rajputenfürst, den wir vor einigen Tagen zu Besuch hatten, hatte fünf Frauen.«
Elisha zuckte die Schultern. »Eine Landessitte, über die wir uns kein Urteil erlauben sollten. Vermutlich kommen wir ihnen auch ziemlich rückständig und barbarisch vor, wenn man ihren Reichtum und ihre Art zu leben betrachtet.«
»Rückständig und barbarisch«, ereiferte sich Archibald. »Inmitten ihres Reichtums und ihrer schönen Paläste leben sie nicht anders als Tiere. Essen mit den Fingern und sind promiskuitiv …«
Jack schlug mit der Hand auf den Tisch, was seinen Gast umgehend zum Schweigen brachte. »Meine unverheirateten Töchter sitzen an diesem Tisch«, sagte er ruhig.
Archibald wurde blutrot im Gesicht und sah so unglücklich aus, dass er Elisha beinahe leidtat. Sie beugte sich vor, sah ihm in die Augen und lächelte. »Erzählte ich schon«, sagte sie im freundlichen Plauderton, »dass meine beste Freundin Rajputenfürstin ist?«
Die Präsidentschaft Bombay war der wichtigste Stützpunkt der Westküste, das Handelszentrum, die einzige von England voll annektierte Niederlassung, von der aus die East India Company die Handelsniederlassungen an der Malabarküste und in Surat überwachte. Etwas mehr als ein Jahrzehnt zuvor war der Haupthandelssitz von Surat nach Bombay verlegt worden. In Bombay war man nicht den Willkürmaßnahmen der Beamten indischer Feudalherren ausgesetzt und konnte bessere Vorkehrungen zur Verteidigung treffen. Die Stadt erfuhr eine immer größere Zuwanderung aus dem Hinterland, parsische Schiffsbauer hatten sich nach und nach in Bombay niedergelassen, der Handel blühte.
Während Jack Legrant am Hafen stand und dem Verladen von Gewürzen zusah, dachte er, dass Archibald in Bezug auf die Probleme des Landes nicht ganz Unrecht gehabt hatte. Infolge der Ausweitung der Kompanietätigkeiten bot sich die Möglichkeit zu persönlicher Bereicherung der Kompaniebediensteten, was zwar verboten war, sich jedoch kaum unterbinden lassen würde. In stetig wachsendem Umfang wurden eigene Geschäfte unter Missachtung des Monopols getätigt. Oftmals hatten die Mitarbeiter der East India Company, die ihren eigenen Handel unter der Hand vollzogen, einflussreiche Freunde, und Eingriffe in ihre Tätigkeiten konnten weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Ein weiteres Problem war der politische Zerfall des Mogulreichs, beschleunigt durch die von den Marathen regelmäßig durchgeführten Raubzüge. Die Gebiete entglitten langsam dem Griff der Mogulherrschaft, wodurch die politische Situation in ganz Indien aufgrund der Unübersichtlichkeit zunehmend gefährlicher wurde. Somit wurden gute Beziehungen zu einem Herrscher, ohne gleichzeitig einen anderen zu verstimmen, immer schwieriger.
Man hätte annehmen können, der Ausgang des letzten Krieges – nachdem das von den Franzosen eroberte Madras den Engländern zurückgegeben worden war – hätte beide Fronten ausreichend ermüdet, um den vereinbarten Frieden einzuhalten. Aber die Rivalität flammte immer wieder von Neuem auf, wenn auch die Mutterländer Frankreich und England offiziell im Frieden lebten und der seit 1751 im Karnatik schwelende Krieg von Truppen geführt wurde, die allein der East India Company und der Compagnie des Indes unterstanden. Hinzu kam ein Punkt, der geradezu grotesk anmutete: Der Frieden hatte dafür gesorgt, dass ganze Kriegsflotten nun unbeschäftigt waren, deren Wartung Unsummen verschlang, die man aber nicht so ohne weiteres nach Europa zurückschicken konnte. Warum also nicht nutzen, wenn sie schon mal da waren?
Als er Schritte hörte, drehte Jack sich um und musste in der Sonne blinzeln. »Ah, Damien«, grüßte er. »Wie sieht es aus? Haben Sie sich mein Angebot überlegt?«
Damien Catrall nickte. »Ja, und ich nehme es gerne an, wenn es Ihnen wirklich keine Umstände macht.«
»Nichts, was man für die eigene Familie tut, bereitet Umstände«, entgegnete Jack. Dieser junge Mann gefiel ihm außerordentlich gut, er war anständig und bestrebt, das Beste aus seinem Leben zu machen. Sie hatten sich in London bei einem von Jacks Cousins kennen gelernt. Damien war seinerzeit noch Student der Medizin gewesen. Kaum hatte Jack gehört, dass sein junger – wenn auch sehr entfernter – Anverwandter sich eine Zeit lang in Bombay niederlassen würde, hatte er ihm angeboten, das Sommerhaus im Garten hinter dem Haus der Legrants zu bewohnen. Anfangs hatte Damien abgelehnt.
»Ich sagte doch«, fuhr Jack fort, »dass Sie sich nach einer Woche in Ihrer jetzigen Unterkunft nach einem richtigen Bett und gutem Essen sehnen werden.«
»Ich muss gestehen, dass diese Dinge einen völlig neuen Klang bekommen haben«, sagte Damien lachend und sah aufs Wasser, das in kleinen Wellen an den breiten natürlichen Hafen schwappte. Die Luft war heiß und schwer, gesättigt von Feuchtigkeit. Man konnte die Handelsschiffe der Kompanie vor Anker liegen sehen, die näher gelegenen in ihrer ganzen Pracht mit den gerefften Segeln und den aufragenden Masten, die weiter entfernt liegenden als schwarze Silhouetten vor dem blauen Himmel. Einen kurzen Moment lang schloss Damien die Augen und nahm neben dem Geräusch der Wellen den Geruch des Landes in allen Facetten intensiv wahr, und das Gefühl, das er bei seiner Heimkehr verspürt hatte, erneuerte sich.
Jemand rief Jack vom Landesteg aus. »Warten Sie heute Abend am Hauptgebäude auf mich«, sagte er zu Damien, ehe er zu dem Mann eilte. Offensichtlich gab es Probleme, denn Jack war sichtlich wütend und unterstrich seine Worte mit knappen Gesten, während vereinzelt Wortfetzen so laut waren, dass sie zu Damien getragen wurden.
Sich mit einer Hand den Nacken massierend, wandte Damien sich wieder zum Meer. Ein Gemisch aus verschiedenen Dialekten ertönte vom Hafen her, einheimische Diener eilten über die Mole, am Zollhaus herrschte reger Verkehr. Damien war das erste Mal in Bombay, jener auf sieben Inseln erbauten Stadt, mit palmengesäumten Ufern, Tamarindenbäumen, üppiger Vegetation, den Malabar Hills im Westen, die aus der Ferne neblig blau erschienen. Buon Bahia hatten die Portugiesen die Stadt genannt, der gute Hafen, und in der Tat war der natürliche Hafen Bombays einzigartig in Indien.
Schon vom Schiff aus hatte Damien das alte portugiesische Kastell bewundert, das im Südosten der Stadt lag und noch aus der Zeit vor der englischen Übernahme der Stadt stammte. Eine Bucht östlich des Kastells bot einen guten Ankerplatz und mochte seinerzeit ausschlaggebend gewesen sein bei der Wahl des Standorts. Eine unbebaute Grünfläche, Bombay Green genannt, lag westlich des Kastells, begrenzt durch einige Gebäude, unter anderem der St.Thomas Cathedral, der ersten anglikanischen Kirche Bombays, von der aus das Church Gate aus der Stadt hinausführte. Um die Stadtmauer herum zog sich ein breiter Wassergraben.
Damien war noch nicht lange wieder in Indien. Im Alter von siebzehn Jahren war er zum Medizin-Studium nach England gegangen, hatte nach dem Studium noch eine Zeit lang in London gelebt und war dann nach Madras zu seiner Familie zurückgekehrt. Neun Jahre war Damien insgesamt von daheim fort gewesen und hatte sich in Madras erst wieder eingewöhnen müssen, auch die Hitze war ihm fremd geworden, aber er hatte die Stadt schon wieder in Richtung Bombay verlassen, kaum dass sich Vertrautheit eingestellt hatte. In der ersten Woche seines Aufenthaltes in Bombay hatte er nicht viel mehr zu tun gehabt, als seine medizinische Ausrüstung in dem Raum, der ihm als Behandlungszimmer zugestanden wurde, zu verstauen und seinen Vorrat an Medikamenten zu überprüfen. Der Kasten aus poliertem Holz mit den neuesten medizinischen Instrumenten war das Wertvollste, das er aus London mitgebracht hatte. Er hatte die Instrumente eigens mit Hilfe seines Professors und Mentors zusammenstellen lassen. Anfangs hatte er in der unbändigen Freude, diese wunderbaren Errungenschaften der Medizin sein Eigen nennen zu dürfen, den Kasten immer wieder aufgeklappt, um über die kühlen Messinginstrumente zu streichen und jedes einzelne herauszunehmen und im Licht zu drehen.
Nachdenklich sah Damien zu den Schiffen hinaus und überlegte, dass es ihm mit Sicherheit auf Dauer nicht an Arbeit mangeln würde. Die Sterblichkeit unter den Europäern war in Indien sehr hoch, insbesondere in Städten wie Bombay, wo zu dem ungesunden tropischen Klima noch die schlechte Hygiene hinzukam. Krankheiten wie Wassersucht, Cholera, Malaria und Fleckfieber überfielen die Stadt immer wieder in Epidemien. Hinzu kam, dass bei jedem Einlaufen eines Schiffes dieses nicht nur Waren, sondern auch grassierende Krankheiten an Land brachte. Weil es oftmals so schwierig war, Schiffe trocken zu halten, häuften sich die Krankheitsfälle durch nasse Kleidung und feuchte Schlafstellen. Gerade bei schlechtem Wetter gestaltete es sich als überaus schwierig, ein Feuer lange genug in Gang zu halten, um Mahlzeiten zu kochen oder gar für etwas Wärme zu sorgen, wenn auch die neueren Schiffe in dieser Hinsicht etwas besser ausgestattet waren und oftmals über Öfen verfügten, die zwischen den Decks für Wärme sorgten. Damien hatte oft den Eindruck gehabt, dass die Menschen in den Schiffsbäuchen mit der Zeit ebenso verrotteten wie die Schiffe selbst. Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber wüteten regelmäßig auf den Schiffen, vor allem, wenn tropische Gewässer angelaufen wurden. Die meisten Todesopfer forderte jedoch der Skorbut, und Damien hatte oft darüber nachgedacht, wodurch genau er ausgelöst wurde und was man dagegen tun konnte.
Jack kam in Damiens Begleitung nach Hause und traf seine Frau im Salon an, der zum Garten hinausführte. Er hatte ihr eine kurze Nachricht geschickt, damit sie sich auf die Ankunft des ihr noch unbekannten Verwandten einstellen konnte. Jetzt saß sie über eine Handarbeit gebeugt, und ihr hellbraunes Haar fing den Lichtschein der Lampe ein. Als sie sie kommen hörte, sah sie auf und musterte Damien aufmerksam, ohne etwas zu sagen.
»Meine Frau Claire«, machte Jack sie bekannt, »Damien Catrall, der Sohn von Elizabeth Plant.«
»Ah, Elizabeth«, sagte Claire nur, ehe sie am Klingelstrang zog, um das Abendessen servieren zu lassen. Damien wusste nicht, was er von der kurzen Erwähnung des Namens seiner Mutter halten sollte, zog es aber vor, dem keine weitere Beachtung zu schenken. Als er gemeinsam mit Jack das Speisezimmer betrat, saß außer einem Kind noch niemand am Tisch. »May«, stellte Jack sie vor, »meine jüngste Tochter.«
»Guten Abend, May«, begrüßte Damien sie. May grüßte so leise zurück, dass er ihre Worte eher erahnen als hören konnte, während sie ihn ansah, als hoffe sie, dass er sich nicht ausgerechnet neben sie setzen würde. Jack wies Damien einen Platz an seiner Seite zu, gegenüber dem Kind, was dieses sichtlich erleichtert zur Kenntnis nahm.
»Charlotte«, sagte Jack und sah zur Tür. Damien wandte sich nun ebenfalls um, und für einen Moment lang verschlug es ihm den Atem. Wenn er jemals die Bezeichnung schön auf eine Frau anwenden wollte, dann bezweifelte er, dass sie jemandem in höherem Maße gerecht werden könnte als dem Mädchen, das eben von Jack angesprochen wurde. Beherrscht wurde ihr Gesicht von dunklen Mandelaugen, die zusammen mit den dunkelbraunen Locken einen reizvollen Kontrast zu der hellen Haut bildeten. Das grüne Kleid betonte ihre schlanke Figur und ihren schönen Wuchs. Charlotte sah Damien an, und in ihrem Blick sah er das Aufblitzen von Zufriedenheit, als sie das fand, was sie in jedem Blick eines Mannes zu erwarten schien. Einen kurzen Augenblick lang flammte Mitleid in Damien auf.
Die Begrüßung fiel distanziert höflich aus, ehe Charlotte sich neben ihre Mutter setzte – auf den Platz neben dem, der Damien zugewiesen war und neben dem dieser noch stand und das letzte Mitglied der Familie begrüßte. Elisha Legrant sah recht hübsch aus, verblasste neben ihrer Schwester jedoch zur Durchschnittlichkeit. Sie grüßte lebhaft und aufrichtig freundlich, ehe sie neben May Platz nahm.
Kerzenlicht flackerte, während die Punkah sich über dem Tisch bewegte. Diener trugen das Essen auf. Es gab Lammfleisch in einer scharf gewürzten Soße, Reis mit Pinienkernen und Mandeln, erfrischende Milchspeisen, Gemüse in Currysoßen und knusprig gebackenes Brot. Jack beherrschte die Unterhaltung bei Tisch und plauderte über allgemeine Themen, ehe er auf seinen Aufenthalt in London zu sprechen kam und Damien ermunterte, seinen Töchtern von England zu erzählen.
Elisha hörte den Ausführungen nur mit halbem Ohr zu. England übte keinen Reiz auf sie aus, und sie hatte sich bereits als Kind vorgenommen, Indien nie zu verlassen. In einem Albtraum, den sie vor Jahren gehabt hatte, war sie nach England gereist, und man hatte ihr den Rückweg verwehrt. Auch jetzt noch jagte ihr diese Vorstellung eine Heidenangst ein, selbst wenn sie wusste, dass ihr Vater sie niemals irgendwo zurücklassen würde, wo sie nicht sein wollte.
»Warum wollten Sie Arzt werden, Dr. Catrall?« Elisha nutzte eine Pause im Gespräch und dachte sich, wenn er jetzt sagt, um Menschen zu helfen, nimmt er mich nicht ernst.
Damien dachte kurz über die Antwort nach. »Vielleicht, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben sonst hätte anfangen sollen«, sagte er, wobei Elisha seinem Ton nicht entnehmen konnte, ob er es ernst meinte oder nur scherzte.
»Gibt es bestimmte Krankheiten, auf die Sie Ihr Augenmerk richten wollen?«, fragte Elisha interessiert.
»Ich bitte dich«, ging Charlotte dazwischen. »Wer will denn bei Tisch über Krankheiten reden?«
»Wenn du mir zugehört hättest, wüsstest du, dass ich nicht über Krankheiten im Einzelnen, sondern über die Tätigkeit als Arzt gesprochen habe.«
»Es wird wohl kaum ausbleiben, dass die Antwort Angaben zu bestimmten Krankheiten enthält«, entgegnete Charlotte, »was als Tischgespräch in höchstem Maße unpassend ist.« Sie wandte sich an Damien und lächelte bezaubernd. »Sie müssen das Verhalten meiner Schwester entschuldigen. Was Sie über die Kultur Londons erzählten, fanden sowohl ich als auch meine Familie überaus fesselnd. Leider verschließen sich derartige Dinge oft vor Elisha, so dass sie sich als Ausgleich in die etwas … profane Welt der Männer vorwagt.«
Jack lag bereits eine Zurechtweisung auf der Zunge, als Elisha ihm zuvorkam. »Nun, Charlotte, profan oder nicht, zumindest ist ja gerade das eine Welt, in der du keine Fremde bist.«
»Ich denke, nun ist eine Entschuldigung angebracht«, mischte Claire sich ein. »Diesen Ton dulde ich nicht.«
Elisha murmelte eine Entschuldigung, während ihre Wangen brannten. Sie warf einen flüchtigen Blick auf ihren Gast und dann auf ihren Vater. Zwar hatte Jack eine Unterhaltung mit Damien begonnen, aber er sah dennoch kurz zu ihr hinüber, und Elisha ahnte, dass es mit einer Entschuldigung nicht getan sein würde.
Das Sommerhaus im Garten hinter dem Legrant-Haus war eine exakte Kopie des Haupthauses, eine Miniatur, die ursprünglich wohl für ungestörte Aufenthalte für Paare gedacht war, die dem Haus für einige Tage entfliehen wollten. Wildrosen blühten an Spalieren, säumten den Weg, der von der Veranda des Legrant-Hauses zum Gartenhaus führte. Jack trat über die Steinstufe auf die kleine Veranda und schloss die Tür auf.
Im Haus zündete er eine Lampe an und ging Damien voraus. Auch wenn das Haus gründlich gereinigt worden war, haftete ihm der Geruch eines Gebäudes an, das lange leer gestanden hatte. In dem feuchten Klima der Sommermonate musste das Haus innen zwangsläufig Schimmel ansetzen, und der etwas erdige Geruch lag immer noch in der Luft, auch wenn Jack gesagt hatte, das Haus sei tagelang gelüftet worden.
Vom Eingangsbereich aus ging es links in einen Salon mit Esszimmer und rechts in einen geräumigen Raum, den er als Arbeitszimmer nutzen konnte. Im rückwärtigen Teil lag ein weiterer Raum mit einer kleinen Kammer, deren Nutzen sich Damien nicht erschließen wollte. Als Vorratskammer war sie zu klein – abgesehen davon, dass sie in einem Gartenhaus überflüssig war –, und als Kammer für einen Dienstboten entschieden zu eng. Damien verließ den Raum und folgte Jack die Treppe hinauf. Die Stufen waren massiv und so gut gearbeitet, dass sie nicht mehr als ein leises Knarren von sich gaben, als er sie betrat. Das Treppengeländer war mit Ornamenten verziert, offenbar war hier ein wirklicher Künstler am Werk gewesen.
Im Obergeschoss waren zwei Schlafzimmer und eine weitere Kammer. Damien sah sich im größeren der beiden Zimmer um, entdeckte dann, dass es einen Balkon hatte, der hinter dem Vorhang verborgen war. Das wäre durchaus ein Grund, dieses Zimmer zu seinem Schlafzimmer zu machen. Abends auf dem Balkon zu lesen und dabei eine Zigarre rauchen zu können, war eine wirklich verlockende Vorstellung. Damien öffnete die verriegelten Läden. Der Balkon führte nach Westen hinaus, das war ein weiterer Punkt für das Zimmer.
Versonnen sah Damien zu dem prachtvollen weißen Haus hinüber. Jack Legrant war ein Abkömmling jenes Zweiges der französischen Adelsfamilie Le Grand, der während der Hugenottenkriege nach England geflohen und sich dort niedergelassen hatte. Sie hatten ihren Namen anglisiert und jegliche Verbindung zu ihren in Frankreich verbliebenen Verwandten abgebrochen. Ein Teil der Familie war Anfang 1600 nach Indien ausgewandert und hatte sich am Aufbau der East India Company beteiligt. Seit die Einfuhr von Gütern wie Rohseide und Kattun nach England nicht mehr erlaubt war – aus Rücksicht auf die eigenen Märkte –, legten sie ihren Handelsschwerpunkt auf Tee aus China, der in England weiterverkauft wurde, sowie auf Waffenhandel mit Kanton. Mittlerweile erwies sich das Geschäft als ungemein einträglich, und die Legrants – bereits in England überaus einflussreich – weiteten ihren Ruf und Einfluss auf sämtliche Gebiete Indiens und um Indien herum aus, in denen die Engländer präsent waren. Seit einiger Zeit beteiligten sie sich an den Zuckergeschäften in Westindien, deren Absatzpreise kriegsbedingt angestiegen waren. Der Krieg hatte den Handel der zuckererzeugenden französischen Inseln geschädigt, was den Engländern überaus gelegen kam. Die Zuckerpreise blieben konstant hoch, und die Produktion wuchs. Was jedoch mitwuchs, war die Aufnahmefähigkeit des englischen Marktes, der den Gesamtertrag Britisch-Westindiens aufsog und immer noch weit davon entfernt war, gesättigt zu sein. Die Legrants hatten ihre Hände überall mit drin, wo Geld zu machen war, hatte Damiens Mutter – wenn auch selbst eine Legrant – einmal etwas verächtlich bemerkt.
»Sie sagen nichts«, sagte Jack in das Schweigen hinein. »Gefällt es Ihnen?«
»Ja.« Damien trat zurück und zog den Fensterladen wieder zu. »Ja, es gefällt mir.«
Elisha malte bedachtsam Buchstaben in Sanskrit auf einen Bogen Papier, hob den Pinsel und betrachtete ihr Werk stirnrunzelnd. Ihr war heiß, die Luft in der Bibliothek war drückend und schwer. Zwar waren an den Fenstern nasse Tücher aufgespannt worden, und die Punkah bewegte sich unaufhörlich, aber das Ergebnis war nicht nennenswert. Als sich die Tür zur Bibliothek öffnete, drehte sie sich um, und in dem Moment fiel ein Tintenklecks von dem feinen Kalligrafiepinsel auf das Papier. »Ach, zum Teufel«, sagte sie leise.
»Du sollst nicht fluchen«, belehrte May sie, in der Tür stehend. »Mama fragt, warum du nicht in den Salon kommst. Der Kuchen ist schon serviert.«
»Keine Lust«, entgegnete Elisha. »Und jetzt geh und mach die Tür zu.«
»Aber Mama sagt, du sollst …«
»Sag Mama, ich soll, aber ich will nicht.« Seit dem Abendessen, an dem sie mit Charlotte aneinander geraten war, hatte Elisha Hausarrest. Ihr Vater hatte ihr eine Strafpredigt gehalten – zu ihrer großen Genugtuung auch Charlotte –, und damit wäre es gut gewesen. Aber ihre Mutter hatte ihm so lange zugesetzt, dass er Elisha zusätzlich Ausgehverbot erteilte – schließlich wog ihre Schuld schwerer als die ihrer Schwester, die Strafe musste demnach entsprechend angepasst werden. Als wäre die Demütigung in Gegenwart des unbekannten Verwandten nicht schon schlimm genug. Elisha hatte sich seither so sehr geschämt, dass sie kaum ein Wort mit ihm wechselte. Nachdem er von sich aus auch keinerlei Versuche machte, sie anzusprechen – seine Aufmerksamkeit galt vornehmlich Charlotte –, fiel es nicht weiter schwer, ihn zu meiden. Charlotte flirtete bei Tisch und auch bei jeder anderen sich bietenden Gelegenheit heftig mit ihm, was ihm zu gefallen schien. Dabei war er verlobt. Aber so waren die Männer eben.
Wieder allein, steckte Elisha den Pinsel in das Tintenfass und widmete sich ihren Schriftzeichen. Sanskrit übte eine große Faszination auf sie aus, auch wenn ihre Mutter meinte, sie solle sich, wenn sie denn schon alte Sprachen lernte, lieber Latein und Griechisch widmen, den Sprachen der europäischen Gelehrten und Philosophen. Ihr zuliebe hatte Elisha es versucht, fand es aber so trocken, dass sie es nach wenigen Monaten wieder aufgab.
Sie lebte in Indien, was also lag näher, als die Sprache der indischen Gelehrten und Philosophen zu lernen, die ohnehin viel schöner war. Allein Worte wie Jambudvipa, der ursprüngliche Name Indiens, der so viel bedeutete wie »Land des Rosenapfels«, zergingen ihr förmlich auf der Zunge, und sie konnte nicht genug davon bekommen. Sie war eben im Begriff, den Pinsel wieder auf das Papier zu senken, als die Tür sich erneut öffnete. Diesmal allerdings war es ihr Vater, der in der Tür stand.
»Du hast dich ein wenig im Ton vergriffen bei der Botschaft, mit der du May zu deiner Mutter geschickt hast«, sagte er, während er die Tür hinter sich schloss.
»Wie hat sie es ihr denn ausgerichtet?«
»Wortwörtlich.« Jack kam zu dem Tisch, an dem Elisha saß, und nahm eines der beschriebenen Blätter mit Sanskritzeichen hoch. Anerkennend schnalzte er mit der Zunge, dann ließ er das Blatt sinken und sah Elisha über den Rand hinweg an. »Ich habe dich immer für intelligent genug gehalten, zu wissen, wann eine gewisse Diplomatie von Vorteil sein kann. Du bist wütend auf deine Mutter, weil sie darauf besteht, dass du Hausarrest hast. Was denkst du, folgt auf dein jetziges Benehmen?«
Elisha zuckte etwas trotzig die Schultern. Jack setzte sich auf den Tischrand, was seine Frau vermutlich entrüstet getadelt hätte. »Dass du deine Strafe damit wohl kaum abkürzen wirst, ist dir doch bewusst?«
»Als ob Mama mir auch nur einen Tag erlassen würde.«
»Du könntest es ja mal drauf ankommen lassen. Außerdem kann sie dein Ausgehverbot ohne weiteres verlängern, wenn du dich weiterhin nicht zu benehmen weißt.«
»Du kannst es auf ihren Wunsch hin ohne weiteres verlängern, meintest du.«
»Richtig, und das werde ich auch tun, weil du genau weißt, dass ich ein solches Verhalten nicht dulden kann.« Jacks Ton blieb ruhig und freundlich, was aber nicht über die Autorität darin hinwegtäuschte. »Wenn du deinen Stolz herunterschlucken könntest und in den Salon zu unserem Besuch gehst, wäre deine Mutter vielleicht geneigt, dich heute Abend mit mir zum Hafen gehen zu lassen.«
»Zum Hafen?«
»Heute Nachmittag ist ein Schiff aus Westindien eingelaufen, und ich muss noch einige Dinge in Bezug auf die Lieferung erledigen. Du bist doch gerne im Dunkeln am Meer.«
Der Seidenrock raschelte, als Elisha ihren Stuhl zurückschob und aufstand. »Nun, in dem Fall werde ich das Opfer natürlich auf mich nehmen. Wer ist denn heute zu Besuch gekommen?«
»Eine Mrs. Sewell. Ihr Mann ist erst seit einigen Tagen in Bombay.«
»Und sie hat einen erwachsenen Sohn, will ich annehmen, so schnell, wie sie bei uns gelandet ist«, vermutete Elisha.
Jack zwinkerte ihr anstelle einer Antwort zu.
Elisha liebte die Vielfalt der Gerüche in den Lagerhäusern der Kompanie: Zimt aus Ceylon, Kaffee aus arabischen Ländern, feinere Gewürze von dem Malaiischen Archipel, Sandelholz aus Timor. Ihre Nase war bereits darin geübt, die Gerüche in allen Nuancen zu unterscheiden. Ebenso wie sie wusste, welche Rolle die einzelnen Waren im Handel spielten. Pfeffer von der Malabarküste war ein wichtiges Gut im Europa-Handel, wohingegen arabischer Kaffee und die feineren Gewürze zu den wertvollsten Gütern zählten. Faszinierend fand Elisha auch die verschiedenen Farben und Arten von gewebter Baumwolle aus allen Teilen Indiens, die in Ballen in einem weiteren Lager lag. Seide aus Bengalen und China leuchtete in allen Farbnuancen, und Elisha konnte sich nicht sattsehen daran. Eine besondere Schwäche hatte sie jedoch für Sandelholz. Sie zündete gerne Sandelholzstäbchen in ihrem Zimmer an. Von einigen indischen Freundinnen wusste sie, dass diese das weiße Holz zerstießen und damit eine Paste zubereiteten, mit der sie ihre Körper einstrichen, etwas, das von ihren Ehemännern hochgeschätzt wurde. Shalina, die Ehefrau eines Rajputenfürsten und ihre beste Freundin, hatte einmal – halb im Scherz – gesagt, dass die Frauen sich deshalb sooft mit Sandelholz einreiben sollten, damit ihnen der Geruch vertraut sei und sie nach dem Tod ihrer Ehemänner auf den mit Sandelholz aufgeschichteten Scheiterhaufen etwas rochen, an das sie gewöhnt waren. Vertraute Gerüche besänftigten die Angst, sagten die alten Frauen. Elisha zog die Hand von dem Sandelholz zurück und erschauerte.
»Wusste doch, dass ich Sie hier finde, Miss Elisha«, schreckte sie eine Männerstimme aus ihren Gedanken auf, und sie sah Mr. Shreve, den Lagerverwalter, das Lager betreten. »Als Ihr Vater mir sagte, sie hätten ihn heute begleitet, war mir klar, Sie müssten entweder am Hafen oder im Lager sein.« Er ging zu einem Tisch links der Eingangstür und nahm ein kleines Bündel weißer Späne zur Hand. »Ich habe nicht vergessen, dass Sie das mögen«, sagte er und reichte es ihr.
»Sandelholz«, sagte Elisha. »Vielen Dank. Aber kann ich das so einfach mitnehmen?«
Mr. Shreve zuckte die Schultern. »Abfallprodukte, die sich nicht verkaufen. Entweder ich gebe es Ihnen, oder die Mitarbeiter hier im Lager nehmen es sich.«
Elisha bedankte sich und verließ das Lagerhaus, um zu ihrem Vater zu gehen. Abends lichtete sich das Gedränge auf den Straßen, die im warmen Licht der Fackeln eine eigene Art der Vertrautheit hatten, mit Schatten, wo sonst keine waren, und Pfützen von Dunkelheit auf dem Boden, wo der Feuerschein nicht hinreichte. Der Zugang zur Stadt war nur durch drei Stadttore möglich, eines davon auf der Südseite, wo die Engländer lebten, und eines auf der Nordseite in der schwarzen Stadt der Inder. Der Graben um die Stadt war künstlich angelegt worden, entsprungen dem Sicherheitsbedürfnis englischer Kaufleute. Das Zollamt und die Lagerhäuser lagen in der Nähe des Kastells. Um die Grünfläche, das sogenannte Bombay Green, lagen unter anderem das Government House und das Schatzamt.
Elisha kam am Marinehaus und den Kasernen vorbei und stand schließlich vor dem Gebäude der East India Company, in dem sich das Büro ihres Vaters befand. Weil sie keinen Treffpunkt ausgemacht hatten, beschloss sie, nachzusehen, ob er noch im Büro war. Sie wusste, dass sie sich zu lange im Lagerhaus aufgehalten hatte und dass ihr Vater es ungern sah, wenn sie so spät noch allein unterwegs war, aber das Lagerhaus wurde abends geschlossen, so dass sie dort nicht länger hätte warten können.
Das Geschoss, in dem das Büro ihres Vaters lag, war dunkel. Elisha betrat das Handelsgebäude, nur um festzustellen, dass die Tür zum Arbeitszimmers ihres Vaters verschlossen war. Sie ging zurück zur Treppe und überlegte, während sie durch den erleuchteten Korridor im zweiten Stock lief, wo ihr Vater wohl auf sie warten würde. Die meisten Türen waren geschlossen, wobei bei vielen noch Licht durch den Türspalt schimmerte.
Elisha verließ das Gebäude wieder und wollte zum Hafen zurückkehren, wo sie ihren Vater vermutete, als eine halb offene Tür zum Arzthaus, einige Häuser vom Gebäude der Kompanie entfernt, ihre Aufmerksamkeit erregte. Es war ein einstöckiges Haus, das noch aus der Zeit der Portugiesen stammte und in dem der Arzt der East India Company untergebracht wurde. Sie kannte das Behandlungszimmer noch aus der Zeit des vorhergehenden Arztes, der ein halbes Jahr zuvor an der Cholera gestorben war. Allerdings war der Raum nun anders eingerichtet.
Studierte Ärzte waren unter den reichen Mitgliedern der Gesellschaft äußerst gefragt. Man begab sich nur ungern in die Hände von Chirurgen, schlichten Wundärzten ohne universitäre Ausbildung, und wenn ein chirurgischer Eingriff unumgänglich war, zog man es vor, ihn unter Aufsicht eines Arztes vornehmen zu lassen.
Der Raum hatte große Fenster in der rückwärtigen Wand, wodurch er tagsüber lichtdurchflutet sein musste. An der Wand rechts der Tür stand eine Liege, deren weißes Baumwolllaken mit dunklem Blut befleckt war. Einige Stellen waren bereits zu einem rostigen Braun getrocknet, andere noch rot und feucht. Hinter der Liege war ein Schrank aus poliertem Nussbaumholz, dessen obere Türen Einsätze aus Glas hatten und mit einem Schlüssel verschlossen waren. Vor dem Fenster stand ein Schreibtisch, offenbar älteren Datums, mit einer zerkratzten Platte, die zum Teil mit Papieren bedeckt war. Ein ledergebundenes Buch lag aufgeschlagen darauf, so als habe jemand vorgehabt, etwas hineinzuschreiben. Elishas Blick wanderte weiter zu dem Bücherregal links vom Fenster, das aus dem gleichen Holz war wie der Schrank und das mit Büchern vollgestopft war – viele davon so abgegriffen, dass die Lederrücken dunkle Flecken aufwiesen.
Neben dem Bücherregal stand ein weiterer Tisch mit einem verschlossenen Holzkasten und einem dreibeinigen Mikroskop. Gebannt beugte Elisha sich vor, betrachtete das Mikroskop und konnte die Gravur des Herstellers – Edmund Culpeper – lesen. Zu gerne hätte sie sich näher damit befasst, aber sie traute sich nicht, es zu berühren. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf den Kasten neben dem Mikroskop, strich mit der Hand über das glänzende Holz und öffnete den Deckel einen Spalt weit, so dass sie die innen liegenden Messinginstrumente sehen konnte. Fasziniert hob sie den Deckel weiter an und betrachtete die Instrumente, die ordentlich aufgereiht in ihren samtbespannten Halterungen lagen. An den Seiten des Kastens standen kleine Flaschen mit verschiedenen Pulvern, in den Deckel war der Name Damien Catrall eingraviert. Obwohl ihr klar war, dass es sich nicht gehörte, konnte sie nicht widerstehen und nahm eines der Instrumente hinaus. Es war ein Rohr zum Abhören des Herzens, eines, wie sie es schon bei ihrem Hausarzt gesehen hatte, nur war dieses hier schöner gearbeitet und lag kühl und glatt in ihrer Hand.
»Legen Sie es wieder zurück«, sagte Damien von der Tür her. Elisha fuhr zusammen, und das Instrument fiel mit einem hellen Scheppern zu Boden. Wortlos bückte Damien sich danach, besah es von allen Seiten, ehe er es mit einem Tuch abwischte und in den Kasten zurücklegte. »Sie können sich alles ansehen, wenn Sie wollen, aber fragen Sie mich vorher.«
Elishas Gesicht brannte, während sie eine Entschuldigung stammelte. »Die Tür stand offen, und Sie waren nicht da«, versuchte sie ihr Verhalten zu erklären.
»Das kann ich als Rechtfertigung nur schwerlich akzeptieren«, entgegnete Damien, »oder was würden Sie denken, wenn Sie mich in Ihrem Zimmer vorfänden, wo ich mir Ihr Eigentum ansehe mit der Begründung ›die Tür stand offen‹?«
»Vermutlich würde ich mich wundern, dass es mein Eigentum ist, das Ihr Interesse weckt, und nicht Charlottes.«
Damien schien nicht so recht zu wissen, was er von ihrer Antwort halten sollte. Er schloss langsam den Holzkasten und legte seine Hand darauf. »Ihre Schwester ist eine äußerst charmante Unterhalterin«, sagte er, »aber wie Sie wissen, bin ich verlobt, was Ihren Spekulationen die Grundlage entziehen sollte.« In seinem Ton lag ein leiser Anflug von Tadel, so als gehöre sie zu jenen Klatschtanten, die hinter jedem harmlosen Gespräch einen tieferen Sinn vermuteten und nichts Eiligeres zu tun hatten, als diesen in die Welt hinauszuschreien.
Elisha knabberte an ihrer Unterlippe. »So hatte ich das nicht gemeint, Verzeihen Sie.« Sie hatte bisher drei Sätze von sich gegeben, wovon zwei Entschuldigungen und ein Satz unbedacht dumm waren. Nun war der beste Zeitpunkt, sich elegant zurückzuziehen. Nur was war elegant? Sich verabschieden, umdrehen und gehen? Sie tat es einfach.
»Wo ist denn Ihr Vater?«, hielt Damien sie zurück
»Das weiß ich auch nicht so genau. Ich hatte gehofft, er wäre in seinem Arbeitszimmer.«
»Sie wollen doch wohl nicht wirklich jetzt noch allein am Hafen herumlaufen?«
»Ich bin hier nicht zum ersten Mal, und die Angestellten kennen mich alle.«
»Aber die betrunkenen Matrosen am Landungssteg nicht, will ich annehmen.« Damien ging zu seinem Schreibtisch und setzte sich. »Warten Sie hier, ich begleite Sie gleich. Ich hatte ohnehin vor, mit Ihrem Vater zusammen zurückzufahren.«
»Ich brauche keine Begleitung«, wehrte Elisha ab.
»Entschuldigen Sie meine Beharrlichkeit, aber das sehe ich anders. Heute ist ein Schiff eingelaufen, die Männer haben ihren ersten Landgang seit Wochen, und vorhin sind mir einige Matrosen entgegengekommen, denen Sie besser nicht allein begegnen sollten. Ich muss nur kurz etwas aufschreiben, nehmen Sie solange Platz.« Damien deutete auf einen der beiden Stühle vor dem Schreibtisch.
In Momenten wie diesen wünschte Elisha sich ein wenig mehr von ihrer Mutter oder Charlotte, die die Situation würdevoll und elegant gemeistert hätten. Elisha setzte sich hin, weil sie wusste, es würde lächerlich wirken, bestünde sie trotz allem darauf, allein zu gehen. Sie sah zu Damien, der, den Kopf gesenkt, in dem vor ihm liegenden Buch blätterte. Das Kerzenlicht verlieh seinem tiefschwarzen, im Nacken zusammengebundenen Haar einen beinahe bläulichen Schimmer. So dunkles Haar war bei Engländern ungewöhnlich, und Elisha fragte sich unweigerlich, ob sein Vater nicht eurasischer Abstammung war, wenn dafür auch Damiens Haut zu hell schien. Aber es gab ja auch Eurasier, bei denen sich das englische Erbe in vielen Merkmalen durchsetzte. Anderseits hätte man ihm als Eurasier wohl kaum eine Stelle als Arzt der Kompanie angeboten, geschweige denn, ihm irgendeine Form von Respekt entgegengebracht.
Es bestürzte sie, den schlechten Eindruck, den er unweigerlich von ihr bekommen haben musste, noch zu vertiefen, indem sie einfach an seine Sachen gegangen war. Irgendwie gelang es ihr nicht, charmant und unterhaltsam zu sein. Immer, wenn sie über etwas reden wollte, das sie interessierte, eckte sie unweigerlich an. Sie scheiterte daran, interessante Unterhaltungen zu führen, ohne sich dabei in den Vordergrund zu stellen und dennoch im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses zu stehen – eben jeder Zoll eine Dame. Auch wenn ihr nicht klar werden wollte, warum das auf einmal so wichtig war.
Während sie schweigend wartete, tauchte Damien die Schreibfeder in das Tintenfass. 20. Mai1753, schrieb er, tiefe Fleischwunde im rechten Oberschenkel, unverheilt, beginnender Wundbrand, Amputation durch den Chirurgen. Im Folgenden beschrieb er jede Einzelheit des Verlaufs, von der Verletzung bis zur Amputation. Er war froh, dass Elisha nicht vor einer Stunde hier vorbeigekommen war. Zu viert hatten sie den Mann – einen jungen Offizier – festhalten müssen, der geschrien und sich erbrochen hatte, während der Chirurg sein Bein abnahm und den Stumpf ausbrannte. Damien hatte lediglich ein leichtes Narkotikum, das aus Mohn gewonnen wurde, zur Verfügung gestanden, und auch das nicht in ausreichenden Mengen. Es gab demnach also keinerlei Möglichkeit, den Schmerz auf ein erträgliches Maß zu lindern. Viele Patienten betranken sich vorher, was aber nur wenig nützte, weil sie meist dennoch alles mitbekamen. Wurden sie vor Schmerzen bewusstlos, war es das Beste, aber diesem Mann war so viel Glück nicht vergönnt gewesen.
Nach der Amputation war Damien über und über mit Blut bespritzt gewesen und hatte weniger das Gefühl gehabt, ein Heilkundiger zu sein als ein Schlächter. Noch dazu war es unklar, ob der Mann überhaupt überleben würde. Das Krankenhaus, in das er den Mann gebracht hatte – es gab insgesamt drei in Bombay –, war in einem desolaten Zustand. Damiens Bitten an die überforderten Wundärzte, einen verschmutzten Verband nicht mehrmals bei verschiedenen Patienten zu verwenden und sich zumindest hin und wieder die Hände zu waschen, hatten ihm nur erstaunte Blicke und halbherzige Zusagen eingebracht. Ihm war klar, dass nichts davon eingehalten werden würde. Aber den Mann in eines der anderen Krankenhäuser zu bringen würde nicht viel nützen, die Bedingungen ähnelten sich, das kannte er bereits aus England.
Damien steckte die Feder in ihren Halter, streute Sand über die beschriebene Seite und stand auf. »Kommen Sie«, sagte er und ließ Elisha den Vortritt zur Tür. Er löschte die Kerzen und schloss die Tür ab. Morgen früh würde er sich darum kümmern müssen, seine Kleidung und den blutigen Überwurf der Liege zu der Wäscherin zu bringen. Normalerweise hätte er alles verschnürt und ihr vor die Tür gelegt, was er aber in Elishas Gegenwart nicht tun wollte.
Während sie gemeinsam am Hafen entlanggingen, hörte Elisha das Lachen der betrunkenen Matrosen, hörte laute Männerstimmen, und einmal kamen ihnen zwei Männer entgegen, die Elisha im Vorbeigehen anstarrten. Damien berührte leicht Elishas Ellbogen. »Gehen Sie auf die andere Seite«, sagte er, ehe sie an einer Gruppe Männer vorbeikamen, die an der Kaimauer saßen.
Elisha ging um Damien herum, so dass er auf der Seite der Männer lief. Wieder berührte er ihren Ellbogen und führte sie neben sich her, als die Männer ihnen anzügliche Bemerkungen nachriefen und Damien Ratschläge gaben, die Elisha das Blut ins Gesicht trieben. Damien wurde wütend, wie immer, wenn jemand in seiner Gegenwart eine Frau respektlos behandelte, schwieg in dem Fall jedoch, weil es schlichtweg dumm gewesen wäre, mit einer Gruppe betrunkener Seeleute einen Streit vom Zaun zu brechen. Noch dazu, wenn eine junge Frau in seiner Begleitung war.
Schweigend gingen sie an den Lagerhäusern vorbei, während Elisha sich fieberhaft überlegte, was sie sagen könnte, um auch nur halbwegs den schlechten Eindruck zu lindern, den Damien unweigerlich von ihr bekommen haben musste. Erst ihr unmöglicher Auftritt bei Tisch, dann ihre Neugierde bezüglich seiner Instrumente, und schlussendlich, dass sie nachts allein am Hafen hatte herumlaufen wollen – etwas, das für eine Europäerin absolut undenkbar war. Sie biss sich auf die Lippen, öffnete mehrmals den Mund, um etwas zu sagen, überlegte es sich aber jedes Mal anders. Damien selbst machte keinerlei Anstalten, eine Unterhaltung anzuknüpfen, sondern schien vielmehr völlig in seine eigenen Gedanken versunken zu sein.
»Wenn ich meinen Vater das nächste Mal begleite«, begann Elisha, »darf ich dann einmal durch Ihr Mikroskop schauen? Ich habe so etwas bisher nur auf Bildern gesehen.«
»Ja, natürlich«, entgegnete Damien abwesend, ehe er wieder in Schweigen verfiel. Vermutlich glaubte er, sie hätte das in seiner Abwesenheit ohnehin schon getan und fragte einfach aus Höflichkeit. Elisha hielt nach ihrem Vater Ausschau, in der Hoffnung, so schnell wie möglich aus dieser peinlichen Situation befreit zu werden. Was hätte Charlotte jetzt getan? Mit den Wimpern geklimpert und etwas gesagt, das ihr Gegenüber begeistert aufgriff und woran sich eine Konversation knüpfen ließ.
»Ich dachte immer, nur Apotheker mikroskopieren«, machte sie erneut den Versuch einer Unterhaltung.
»Das ist richtig, aber mich hat es schon während meines gesamten Studiums interessiert.« Daraufhin trat wieder Schweigen ein, und Elisha wusste nicht, was sie antworten sollte, zu distanziert klang seine Stimme, so als sei er gedanklich abwesend.
Jack war in ein Gespräch mit Richard Bourchier, dem Gouverneur von Bombay, vertieft. Beide waren ernst, und Jack nickte mehrmals zu dem, was der Gouverneur sagte. Erst als Elisha und Damien bei ihm angekommen waren, bemerkte er sie. »Wo warst du denn?«, fragte er Elisha. »Ich habe Mr. Shreve gefragt, ob er dich gesehen hat, und er meinte, du wärst vor beinahe einer Stunde im Lagerhaus gewesen.«
»Ich wollte zu dir ins Büro kommen, aber du warst nicht mehr da«, entgegnete Elisha, während in ihren Augen die innige Bitte stand, sie nicht in Damiens Gegenwart zu tadeln. Jack verstand und sagte nichts weiter. Er schob ihre Hand in seine Armbeuge und fragte Damien nach seinen bisherigen Eindrücken. Schon bald waren beide in eine lebhafte Unterhaltung vertieft, die sie auch dann nicht unterbrachen, als sie in die Kutsche stiegen. Elisha nahm neben ihrem Vater gegenüber von Damien Platz und war froh, dass dieser ihr Gesicht in der Dunkelheit nicht erkennen konnte. Es war so beruhigend, nur die vertrauten Stimmen zu hören und sich dabei als unbeteiligter Beobachter zu fühlen. Den Kopf an die Schulter ihres Vaters gelehnt, lauschte sie schweigend.
»Die Konkurrenz der anderen Indien-Kompanien stellt nicht einmal unser größtes Problem dar«, schilderte Jack und bezog sich auf die 1602 gegründete holländische Ostindien-Kompanie und die französische Compagnie des Indes, die seit ihrer Neugründung 1719





























