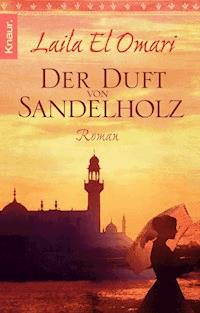4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es duftet nach Tee und Liebe ...
Indien, 1875: Nach einer skandalösen Scheidung flieht Katrina mit ihrem kleinen Sohn auf die Teeplantage ihres Bruders in Südindien. Als ihr Ex-Mann versucht, das Sorgerecht zu bekommen, beschließt sie, den undurchsichtigen Aidan zu heiraten. Nur so kann sie der Unmündigkeit entkommen und ihren Sohn behalten. Auch für Aidan ist es eine Vernunftehe. Der mittellose Offizier hat es auf Katrinas Mitgift abgesehen, mit der er eine eigene Teeplantage in den fruchtbaren Bergen von Nilgiri erwirbt. Während Katrina wieder erwarten Gefühle für ihren Mann entwickelt, verschwindet dieser jedoch immer wieder unter fadenscheinigen Begründungen. Was verheimlicht er vor ihr?
Ein fesselnder Gesellschaftsroman über die Doppelmoral der Gesellschaft zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft in Indien. Laila El Omari schreibt auch unter den Namen Anna Jonas, Nora Elias und Hannah Conrad.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 857
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
1
OOTACAMUND, NILGIRI-DISTRIKT, MÄRZ 1875
2
OOTACAMUND, APRIL 1875
3
OOTACAMUND, MAI 1875
4
OOTACAMUND, JUNI 1875
5
OOTACAMUND, JULI 1875
6
OOTACAMUND, SEPTEMBER 1875
7
OOTACAMUND, OKTOBER 1875
8
HIMACHAL PRADESH, NOVEMBER 1875
9
OOTACAMUND, DEZEMBER 1875
10
OOTACAMUND, FEBRUAR 1876
11
OOTACAMUND, APRIL 1876
12
KHAIBERPASS, JUNI 1876
13
OOTACAMUND, AUGUST 1876
14
OOTACAMUND, OKTOBER 1876
15
OOTACAMUND, NOVEMBER 1876
16
BOMBAY, FEBRUAR 1877
17
OOTACAMUND, MÄRZ 1877
18
KALKUTTA, APRIL 1877
19
OOTACAMUND, MAI 1877
20
OOTACAMUND, AUGUST 1877
21
OOTACAMUND, SEPTEMBER 1877
22
OOTACAMUND, DEZEMBER 1877
23
OOTACAMUND, APRIL 1878
24
OOTACAMUND, MAI 1878
25
KALKUTTA, JUNI 1878
26
OOTACAMUND, AUGUST 1878
27
KHAIBERPASS, SEPTEMBER 1878
28
OOTACAMUND, JANUAR 1879
29
LADAKH, REGION KASCHMIR, JANUAR 1879
30
OOTACAMUND, MÄRZ 1879
31
KALKUTTA, APRIL 1879
32
Ootacamund, Mai 1879
33
OOTACAMUND, JUNI 1879
34
LADAKH, AUGUST 1879
35
OOTACAMUND, DEZEMBER 1879
PERSONEN
DANKSAGUNG
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Feedback [no-toc]
Hat es Dir gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Indien, 1875: Nach einer skandalösen Scheidung flieht Katrina mit ihrem kleinen Sohn auf die Teeplantage ihres Bruders in Südindien. Als ihr Ex-Mann versucht, das Sorgerecht zu bekommen, beschließt sie, den undurchsichtigen Aidan zu heiraten. Nur so kann sie der Unmündigkeit entkommen und ihren Sohn behalten. Auch für Aidan ist es eine Vernunftehe. Der mittellose Offizier hat es auf Katrinas Mitgift abgesehen, mit der er eine eigene Teeplantage in den fruchtbaren Bergen von Nilgiri erwirbt. Während Katrina wieder erwarten Gefühle für ihren Mann entwickelt, verschwindet dieser jedoch immer wieder unter fadenscheinigen Begründungen. Was verheimlicht er vor ihr?
Laila El Omari
Tage des Monsuns
»Die Region, landläufig bekannt unter dem Namen Nilgiri oder die Blauen Berge von Coimbatore, liegt an jenem Punkt, wo das Ost- und West-Ghat sich vereinen [...]«
Richard F. Burton, Goa and the blue mountains
1
OOTACAMUND, NILGIRI-DISTRIKT, MÄRZ 1875
Vier Tage in einer Herberge, neben der sich das elendste Reiselager in den Bergen noch komfortabel ausnimmt, dachte Aidan Landor, während er auf dem Bett lag und, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, an die Zimmerdecke starrte. Rotes Frühlicht tastete sich in den Raum, ließ Konturen hervortreten und Schatten entstehen. Erste Schritte tappten über den Flur und die Treppe hinab, während die Stadt langsam erwachte. In dem Zimmer neben ihm weinte eine Frau in leisen Schluchzern.
Zu viel Opium in der letzten Nacht. Ein weiterer Tag, an dem einem der Kopf schwamm und man in der Gewissheit trieb, dass sich nichts ändern würde. Während es im Zimmer langsam heller wurde, lauschte Aidan auf die Geräusche im Haus. Die Geschäftigkeit nahm zu, Türen wurden geöffnet und zugeschlagen. Die Frau hatte aufgehört zu weinen.
Eine Absteige, in die jene Leute angeschwemmt wurden, die Ootacamund aufsuchten und sich nicht einmal zur untersten Gesellschaftsschicht der Stadt zählen konnten. Unverputzte Wände, deren Schäbigkeit auch das rotgoldene Licht des Vorabends nicht hatte kaschieren können, waren im Tageslicht grau und wirkten pockennarbig. Der Raum war nur notdürftig gesäubert worden, und der Abort im Flur verbreitete auf der Treppe einen beinahe unerträglichen Gestank. Im Gegensatz zu den unglücklichen Gestalten, die hier landeten, konnte Aidan sich jederzeit etwas Besseres leisten. Wer nach Ootacamund kam, hatte die Möglichkeit, unter zwei Hotels zu wählen: dem Dawson’s Hotel, das an der Westseite der Stadt lag, wenn man diese über den Sigur-Pass betrat, und das Alexandra Chambers, ehemals Victoria – beides wäre Aidan um einiges lieber gewesen. Aber er würde ein paar Tage warten, sich in die Stadt eingliedern, unauffällig, so, wie er gekommen war. Wenn er sich ein Zimmer nahm, würde keiner wissen, wie lange er schon hier war. Brian würde dann bereits fort sein, Brian, sein bester Freund und Reisegefährte, der in eben diesem Moment den Kopf zur Tür hereinsteckte.
»Störe ich?«
Ohne Aidans Antwort abzuwarten, trat er ein, warf die Tür hinter sich ins Schloss und ließ sich auf den einzigen Stuhl im Raum fallen. »Du hast nicht geschlafen«, schlussfolgerte er mit Blick auf Aidan, der vollständig bekleidet auf dem Bett lag. Er wies mit dem Kinn zur Wand hin und schloss mit der Frage:
»Waren wir zu laut?«
»Nein.«
»Thackery war gestern Abend kurz hier. Er wollte zu dir.«
»Ich war nicht da.«
»Das habe ich bemerkt. Er stand nämlich plötzlich unangemeldet in meinem Zimmer und wollte wissen, wo du zu finden bist.«
Aidan hörte die unausgesprochene Frage, ging aber nicht darauf ein. »Was hast du ihm gesagt?«
»Er soll heute wiederkommen.«
Einen leisen Fluch ausstoßend, sah Aidan zur Decke.
»Was hätte ich sagen sollen?« Brian streckte sich unbekümmert auf seinem Stuhl. »Ich werde übrigens doch schon heute weiterreisen.«
»Und sie?« Aidan nickte zur Wand hin.
»Bleibt hier. Ich habe es ihr heute Morgen gesagt.«
»Wie immer zartfühlend, Brian. Aus dem Bett einer Frau zu steigen und ihr zu sagen, dass es vorbei ist.«
Brian zuckte die Schultern.
»Ich dachte, sie sei ein anständiges Mädchen«, sagte Aidan.
»Sie hat ihr Elternhaus verlassen, um mit mir zu ziehen, obwohl sie mich kaum kannte«, antwortete Brian. »Nennst du das anständig?«
»Was wird jetzt aus ihr?«
»Ich habe ihr Geld gegeben, damit sie zu ihren Eltern zurückkehren kann.«
Aidan sagte nichts weiter dazu, die Rolle des Fürsprechers verlassener Frauen stand ihm nicht besonders. Er war von Anfang an dagegen gewesen, Gillian mitzunehmen, aber Brian war allein in Kalkutta gewesen, und als sie später wieder aufeinandergetroffen waren, hatte er das Mädchen bei sich gehabt. »Wo geht es für dich hin?«, wechselte er das Thema.
»Offiziell zunächst über das West-Ghat bis zur Dekkan-Ebene.«
Brian zwinkerte. »Inoffiziell in Richtung Norden, Himalaja.«
Aidan setzte sich auf und fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht. Seine Augen brannten, hatten die ganze Nacht schon gebrannt vom Rauch der Opium-Pfeifen. »Du weißt, ich denke daran, mich hier im Distrikt niederzulassen.«
»Immer noch die alte Idee von der Teeplantage? Mir war nicht bekannt, dass du neuerdings Reichtümer hortest«, spöttelte Brian.
»Ich habe einiges gespart, und den Rest bekomme ich auch noch irgendwie zusammen.«
»Denkst du, du wirst lange genug Ruhe haben?«
»Zumindest lange genug, um alles vorzubereiten und die richtigen Kontakte zu knüpfen.«
Brian stand auf und streckte sich. »Dann wünsche ich dir alles Gute«, verabschiedete er sich. »Und erzähl mir später, wie es war.«
»Bis wir uns wiedersehen, interessiert es dich vermutlich ohnehin nicht mehr.« Damit spielte Aidan auf die lange Trennung und Brians immer nur kurz währendes Interesse an den Angelegenheiten anderer an.
Brian blieb an der Tür stehen und drehte sich grinsend um. »Du als Teepflanzer, mein Freund, denkst du allen Ernstes, das würde ich mir entgehen lassen? Länger als zwei Monate hast du es doch nie an einem Ort ausgehalten.«
»Manchmal wird es Zeit, einige Dinge zu ändern.«
Bis in den späten Vormittag hinein blieb Aidan in seinem Zimmer, lag auf dem Bett, fühlte die abgestandene Luft, die sich feucht in den Atemwegen festsetzte und die Haut mit einem Film überzog. Er hörte den lautstarken Streit aus Brians Zimmer, das Schlagen der Tür, Brians gemächlichen Schritt die Treppe hinunter. Im Zimmer nebenan ging etwas zu Bruch.
Irgendwann schlief er ein und erwachte eine Stunde später. Seine Kleidung schien ihm am Körper zu kleben, aber nichtsdestotrotz war er erholt. Nachdem er sich einen Kampf mit einer der Mägde geliefert hatte – ein Mädchen mit den Ausmaßen einer Kriegsfregatte –, war ihm ein Bad bereitet worden. Später rasierte er sich, kleidete sich an und trat auf den schmutzigen Flur hinaus, in dem Bewusstsein, den ersten Schritt in ein neues Leben zu tun. Der Gedanke gefiel ihm und vertrieb die düstere Stimmung der letzten Tage.
»Aidan?« Eine blonde junge Frau stand am Fuß der Treppe, an das Geländer gelehnt, so als warte sie schon länger. »Brauchst du Gesellschaft?«
»Nicht in der Art, die dir vorschwebt, Gilly.«
Gillian wurde brennend rot. »Brian ist fort.« Sie folgte ihm, als er an ihr vorbeiging. »Und was ist nun mit mir?«
»Meines Wissens hat er dir Geld dagelassen.«
»Gerade genug, um wieder nach Kalkutta zu meinen Eltern zu fahren. Als ich mit Brian weggegangen bin, hat mein Vater mir aber gesagt, ich dürfe nicht mehr heimkommen.«
Aidan nickte desinteressiert. »Du wirst doch gewusst haben, worauf du dich einlässt.«
»Brian hat gesagt, ich bedeute ihm etwas.«
»Aber natürlich hat er das gesagt. Oder hättest du sonst sein Bett geteilt?«
Ihr stieg erneut das Blut in die Wangen, und Aidan war verwundert angesichts der Tatsache, dass sie nach all dem, was er von der Beziehung mitbekommen hatte, noch imstande war, zu erröten. Schließlich waren beide nicht gerade diskret gewesen.
Die Hauswirtin stand an der Tür zur Gaststube und starrte Gillian forschend an. Wo immer sie übernachtet hatten, hatten sich Gillian und Brian als Geschwister ausgegeben. Zwar fehlte ihnen jede Ähnlichkeit, aber beide waren blond und hatten blaue Augen, sodass sich jeder, der ausreichend naiv oder willig war, ohne Weiteres täuschen ließ. Dem Blick der Hauswirtin zufolge argwöhnte diese nach Brians Abreise, dass etwas nicht stimmte.
»He, Mädchen«, rief sie dröhnend, »hängste dich sofort an den Nächsten?« Ihr Blick fiel auf Aidan, etwas wohlwollender, ehe sie Gillian erneut ankeifte: »Nimm deine Sachen und verschwinde! Das hier ist ein anständiges Haus.«
»Mein ... Mr Casey hat für eine weitere Übernachtung im Voraus bezahlt«, antwortete Gillian und schob das Kinn vor.
»Für sich!«, widersprach die Wirtin. »Er ist fort, also kann ich das Zimmer neu vermieten.«
»Er hat das Zimmer für mich bezahlt«, beharrte Gillian.
»Davon, dass ich seine Hure hier weiter bewirten müsste, hat er nichts gesagt.« Die Wirtin verschränkte die stämmigen Arme vor der Brust.
Aidan seufzte und drehte sich auf halbem Weg zur Haustür um. »Mr Casey hat das Zimmer für fünf Nächte bezahlt, für sich und für die junge Dame.«
»Das hab ich nur erlaubt, weil er gesagt hat, sie sei seine Schwester.«
»Das mag sein, aber Sie haben sein Geld angenommen, und nun wurde er vorzeitig abberufen. Die junge Dame wird sich einer Reisegesellschaft anschließen und zu ihrer Familie zurückkehren.«
»Ich dulde keine Dirnen in meinem Haus«, wiederholte die Wirtin störrisch.
»Mr Casey hat die junge Dame bis morgen unter meine Obhut gestellt, und ich meinerseits dulde es nicht, dass sie allein die Nacht auf der Straße verbringt.«
Die Wirtin wollte widersprechen, blieb aber stumm, als Aidans Augen sich drohend verengten. »Nur noch bis morgen«, murmelte sie mürrisch.
Gillian lief Aidan nach, als er aus der Tür hinaus auf die staubige Straße trat. »Danke.«
Mit einem Schulterzucken tat er ihren Dank ab und sah sich um. Die gesamte Stadt schmiegte sich in bewaldete Bergsenken und Täler. Karren rumpelten die Straße entlang, ein junger britischer Soldat lehnte an einer Häuserwand und beobachtete das Treiben unter schweren Augenlidern hinweg. Teehandelskontore säumten die Straße, einheimische Diener eilten in die Gebäude hinein und wieder heraus, verschiedene Dialekte mischten sich. Zwei weiß gekleidete Inder traten in ein Handelskontor schräg gegenüber, während sie eifrig miteinander diskutierten. Eine Gruppe junger Sepoys ging die Straße entlang, unbewaffnet, denn das Gesetz untersagte die Herausgabe von Waffen an indische Soldaten, die der britischen Armee unterstanden. Zu deutlich standen allen noch die Gräuel des Sepoy-Aufstandes vor Augen, der erst nach viel Blutvergießen niedergeschlagen werden konnte und 1858 zum Ende der East India Company geführt hatte.
»Ich kann trotzdem nicht nach Kalkutta zurück«, beharrte Gillian.
»Das, meine Liebe, ist nicht mein Problem.«
Gegenüber der Herberge vor dem Kontor mit der Aufschrift Ramsay Tea hielt die schwarze Kutsche einer sichtlich wohlhabenden Familie. Der Kutschenschlag wurde von einem weiß gekleideten indischen Diener geöffnet, und ein Engländer stieg aus, der seinerseits einer Frau und einem kleinen Jungen von höchstens vier Jahren heraushalf. Der Mann war überaus korrekt gekleidet und trug einen Ausdruck blasierter Langeweile zur Schau. Der kleine Junge wurde von der Frau an die Hand genommen, als er im Begriff war, auf die Straße zu laufen, und ließ sich sichtlich widerwillig festhalten.
Neben Aidan stieß Gillian einen Laut aus, der sowohl verächtlich als auch neidisch klingen mochte. Vermutlich Neid, schloss er, angesichts der Tatsache, dass die junge Frau mit dem Kind genau das darstellte, was Gillian an Brians Seite hatte werden wollen. Diese Frau lief nicht Gefahr, verlassen und der allgemeinen Verachtung preisgegeben zu werden. Das würde ihre Familie nie zulassen. Aidan sah dem jungen Paar mit dem Kind nach, als es auf das Kontor zuging, und er konnte sich angesichts dieses offen präsentierten Familienlebens ein spöttisches Lächeln nicht verkneifen.
»Du solltest heiraten«, sagte Charles Ramsay zu der jungen Frau an seiner Seite, die eben ihren Sohn ermahnte, nicht mit den Füßen den Staub aufzuwirbeln. »Wirklich, ich finde, du solltest heiraten.«
Katrina zog ihren Sohn hinter Charles her über die Türschwelle zum Teekontor. So früh am Vormittag war kaum jemand hier, was ihr nur recht sein konnte. Vorsichtig sah sie zu ihrem Bruder, aber dieser neigte sich bereits über eine Liste mit Teelieferungen und schien keine Antwort zu erwarten.
Ein junger Mann kam dienstbeflissen aus dem hinteren Bereich des Lagers. »Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit, Sir.«
»Das hoffe ich ebenso«, antwortete Charles knapp, während er die Listen auf Fehler hin absuchte. Personal konnte man nicht trauen, das hatte seine Erfahrung immer wieder bestätigt. Er war auf der Hut.
»Einen schönen guten Morgen, Madam.« Der junge Mann zwinkerte nervös mit den Augen und wartete Katrinas Erwiderung des Morgengrußes nicht ab, sondern befasste sich mit einer Kiste für den Teetransport, die er zum Schutz gegen Feuchtigkeit mit Papier ausschlug.
»Caleb!«, rief Katrina, als sie bemerkte, dass ihr Sohn nach der Teewaage greifen wollte.
»Ich verstehe überhaupt nicht, warum du ihn mitgenommen hast«, sagte Charles, ohne aufzusehen.
So recht wusste Katrina das selbst nicht. Vielleicht hatte sie ihren Bruder, der mit Kindern nicht viel anfangen konnte, einfach ärgern wollen, aber nun war sie ein wenig überfordert. »Seine Ayah ist krank.«
»Sie ist ständig krank. Vielleicht solltest du dich nach jemand anderem umsehen. Sie ist faul und unzuverlässig. Cynthia fragt sich immerzu, was du an ihr findest.« Seine Stimme besagte deutlich, dass er die Antwort auf diese Frage nicht geben konnte. »Caleb ist an sie gewöhnt.« Zudem fand Katrina, dass dies ihre Schwägerin überhaupt nichts anging, aber das behielt sie für sich.
Während sie im Lager herumstand und nichts anderes zu tun hatte, als auf ihren Bruder zu warten, war Katrina für die Ablenkung durch ihr Kind beinahe dankbar. Sie hatte eigentlich gar nicht mitkommen wollen, aber sie konnte sich nicht ständig in ihr Zimmer einschließen, um voll Bitterkeit an Jahre zu denken, die ihr niemand zurückgeben würde. So viele verschwendete Gefühle, dachte sie, und für einen kurzen Moment wurde sie ein wenig schwermütig, was in der letzten Zeit öfter geschah.
Ein Mann mittleren Alters betrat das Kontor. »Guten Morgen, Mr Ramsay«, rief er, dann etwas kühler: »Ihr Diener, Mrs Alardyce.«
»Mr Jakes«, Charles sah gerade lange genug hoch, um dem Mann zu signalisieren, dass er dessen Ankunft zur Kenntnis genommen hatte. »Ich bin gleich für Sie da.«
Katrina ging durch das Lager und atmete den aromatischen Duft der Tees aus den Nilgiri Hills ein. Weiter hinten lagerten auch andere Teesorten. Ihr Bruder legte großen Wert auf ein breites Sortiment, aber das meiste war Tee aus seinen eigenen Teegärten. Charles ging vollkommen im Teeanbau auf. Malzige Assamtees, feine, liebliche Tees aus Darjeeling und aromatischer Tee aus Ceylon, der dem der Nilgiri-Berge so ähnlich war, lagerten in Kisten, die gestapelt und fertig zum Transport waren. Manchmal bezog Charles sogar Tee aus China und Japan, fertigte Mischungen und verbrachte Stunden um Stunden damit, zu testen, wie viele Unzen verschiedener Tees für neue Geschmacksrichtungen vonnöten waren.
Die Stimmen der Männer wurden leiser, als Katrina die hölzerne Treppe am Ende des Raumes hinaufstieg. Im oberen Stockwerk befanden sich die Wirtschaftsräume, von hier aus verwalteten Angestellte ihres Bruders sein Tee-Imperium. Katrina war sowohl mit den wichtigsten wirtschaftlichen Aspekten als auch mit vielen Feinheiten des Teeanbaus vertraut. Sie hatte gute Lehrer gehabt, erst ihren Vater, dann ... Stephen. Zwei Jahre, und sie war immer noch nicht imstande, an ihn zu denken, ohne dass ihr Herz heftig schlug und sie einen scharfen Schmerz verspürte.
Von dem Fenster neben der Treppe aus hatte man einen Blick auf die von lavendelfarbenem Nebel umhüllten Berge, die sich in der Ferne abzeichneten. Der Distrikt Nilgiri gehörte zum westlichsten Teil des Tamilnads, grenzte im Westen an Kerala, im Norden an den Karnatik und im Südosten an den Coimbatore-Distrikt. Das gebirgige Plateau erstreckte sich von der Küste her, Wälder zogen sich über die Berge bis zu den Ebenen und grenzten an das tiefer gelegene Flachland. Flüsse teilten das Land und trafen wieder aufeinander, ehe sie in den Moyar mündeten. Nilgiri – neelam giri, die blauen Berge. Wie die Berge zu ihrem Namen gekommen waren, wusste niemand so richtig. Einige waren der Meinung, es liege an dem bläulichen Dunst, der die Berge umgab, andere wiederum sagten, die Bewohner der Ebenen hätten ihnen den Namen gegeben wegen der blauvioletten Blüten der Neelakurinji, jener magnolienartigen Staude, die alle zwölf Jahre erblühte. Moderne Reisende hingegen führten ihn auf die von den Briten gepflanzten Blaugummibäume zurück. An manchen Tagen stand Katrina morgens an ihrem Fenster und sah zu den Bergen, traurig, weil ihr Leben noch dasselbe war wie am Abend zuvor.
»Katrina!« Charles’ Stimme drang zu ihr hoch. Sie eilte die Treppe wieder hinunter und stolperte beinahe über Caleb, der am Treppenabsatz saß und mit einem glänzenden Stein spielte. »Von Mr Jakes«, sagte Caleb und streckte ihr die Hand mit dem Stein entgegen. Katrina wusste, dass von ihr Bewunderung erwartet wurde, und bemühte sich, dem gerecht zu werden. Obwohl sie sich an die Mutterrolle gewöhnt hatte, war es ihr manchmal beinahe unheimlich, sich in diesem Kind wiederzufinden, sowohl in dessen Temperament als auch im Aussehen mit dem hellen goldbraunen Haar und den grünen Augen. Caleb hatte äußerlich nichts von seinem Vater geerbt.
»Katrina.« Charles klang nun etwas unduldsamer. »Das nächste Mal kümmerst du dich bitte selbst um ihn. Es kann nicht angehen, dass dein Sohn zwischen uns herumtobt, während wir geschäftliche Angelegenheiten besprechen.«
»Es tut mir leid, Charles.«
»Mr Jakes sagte, er habe Stephen gestern gesehen.« Charles schien nicht zu bemerken, wie Katrinas Schultern sich plötzlich versteiften. »Seit wann ist er wieder in der Gegend?«
»Da fragst du die Falsche«, antwortete sie kalt.
»Ich hoffe, er bleibt nicht lange. Gerade haben die Leute aufgehört zu reden.«
Dafür ist ihre Feindseligkeit immer noch dieselbe, dachte Katrina. Ihr Bruder öffnete ihr die Tür, und sie trat auf die Straße hinaus, wo die Stimmen der Menschen sie wie ein wabernder Umhang umschlossen. Sie hätte ihren Bruder nicht begleiten sollen, dachte sie erneut, als ein Nachbar Charles auf der Straße grüßte und einen gemurmelten Gruß an sie anschloss, begleitet von einem ausweichenden Blick. Charles hatte, schon ehe sie losgefahren waren, gesagt, er wünsche keinerlei Einmischung in seine Geschäfte, es sei denn, er frage danach. Ihr Mitkommen hatte er nur angeregt, um sie endlich wieder unter die Leute zu bringen. Langsam, Schritt für Schritt, würde er sie wieder gesellschaftsfähig machen, und nun, nachdem er den Anfang gemacht hatte, konnte seine Frau sie demnächst mitnehmen, wenn Besuche anstanden.
Katrina gab sich ruhig und angepasst, gehorsam der Familie ihres Bruders gegenüber, während alles in ihr schrie. Sie schaffte es, gelegentliche Anflüge von Unduldsamkeit hinter gesenkten Lidern zu verbergen, und wenn sie fürchtete, ihre Stimme nicht unter Kontrolle zu haben, schwieg sie. Sie war gefangen, und es gab keinen Weg hinaus.
Ehe sie sich von Charles in die Kutsche helfen ließ, sah sie die Straße entlang, fing etwas von dem Leben auf. Gegenüber war eine heruntergekommene Herberge, vor deren Stufen ein dunkelhaariger Mann und eine blonde Frau standen. Die Frau sah zu ihnen hinüber und sagte etwas, auf das der Mann mit dem Anflug eines Lächelns eine Antwort gab, die sie sichtlich verärgerte. Sie raffte ihr Kleid, wirbelte herum und stürmte in die Herberge zurück. Der Mann machte sich nicht die Mühe, ihr nachzusehen, sondern beobachtete weiterhin das Treiben auf der Straße.
Frei, dachte Katrina, als sie der blonden Frau mit den Blicken folgte, ich wünschte, ich wäre sie.
*
Ootacamund – Ooty, wie es die Engländer nannten – lag im Zentrum des Nilgiri-Distrikts. Mit seinem durch die Höhe bedingten milden Klima war es während der von April bis Juni dauernden ersten Saison die Sommerresidenz der in der Präsidentschaft Madras ansässigen Briten. Eine englische Stadt inmitten des Orients. Während Aidan von seinem Zimmer aus das Treiben auf der Straße betrachtete und sein Blick zu den sich über der Stadt erhebenden Bergen schweifte, war er sich sicher, dass es eine Gegend von dieser Schönheit in Indien kein zweites Mal gab. Über die tiefer gelegenen Regionen des Südwest-Ghats zogen sich sommergrüne feuchte Wälder, die sich entlang des Gebirgszugs des West-Ghats bis zur südlichen Spitze Indiens erstreckten und in denen Elefanten und Tiger beheimatet waren. Immergrüne Regenwälder bedeckten die höher gelegenen Gebirgsketten des Südwest-Ghats, dünnten mit zunehmender Höhe aus, sodass sie von offenem Grasland durchsetzt waren. Aidan bedauerte zutiefst, dass ihm momentan die Zeit für eine Reise dorthin fehlte.
»Lieutenant Landor!« Die Stimme hinter seinem Rücken verschaffte sich wütend Gehör.
Aidan drehte sich langsam vom Fenster weg, durch das er hinausgeschaut hatte, während sein Gesprächspartner stakkatoartig Wörter auf ihn abfeuerte.
»Wie hausen Sie hier überhaupt?«, fuhr der Mann ungehalten fort. Aidan maß den Raum mit Blicken, als sähe er ihn zum ersten Mal, und nahm sich – wie er es seit seiner Ankunft jeden Tag tat – vor, sich eine andere Unterkunft zu suchen. Er war müde und überreizt, und als wäre das nicht genug, musste er sich bereits seit mehr als einer halben Stunde einen Vortrag seines aufgebrachten Vorgesetzten anhören. »Major Thackery, Sir, ich bedaure zutiefst, dass Sie sich wiederholt umsonst hierherbemühen mussten.« Aidan bemühte sich um eine salbungsvolle Stimme, was ihm mitnichten gelang.
»Hat Lieutenant Casey Ihnen nicht ausgerichtet, dass ich nach Ihnen gefragt habe?«
»Doch, das hat er. Aber die Umstände machten es erforderlich, dass ich selten hier war.«
»Die Umstände, Lieutenant?« Thackery winkte ab, als Aidan zu einer Antwort ansetzte. »Ich denke, ich möchte es nicht genauer wissen. Ist Ihnen bekannt, ob Lieutenant Casey diese Frau mitgenommen hat, als er fortging?«
»Das hat er nicht, Sir.«
»Gut«, sagte Thackery, »gut. Der Verweis, den ich Lieutenant Casey erteilt habe, gilt auch für Sie. Ich möchte nie wieder hören, dass Sie eine Mission in Begleitung einer Frau antreten.«
Aidan lag eine Rechtfertigung auf der Zunge. Hatte er es Brian nicht viele Male gesagt? Und war Gillian denn nicht dessen Geliebte gewesen? Dann jedoch entschied er, Brian nicht in den Rücken zu fallen, und schwieg.
Thackery indes schien nicht davon überzeugt zu sein, dass seiner Anweisung wirklich Folge geleistet wurde. »Wo ist das Mädchen jetzt?«, fragte er und sah die Kommode an, als erwarte er, sie aus einer der Schubladen springen zu sehen.
»Ich glaube, bei ihren Eltern, Sir.« Aidan fiel ein, dass er Gillian seit dem Tag von Brians Abreise nicht mehr gesehen hatte. Am darauffolgenden Tag war sie fort gewesen.
»Bei ihren Eltern? Etwas Dümmeres ist Ihnen nicht eingefallen? Ich warne Sie, Lieutenant, wenn mir zu Ohren kommt, dass Sie oder Lieutenant Casey erneut in ihrer Begleitung unterwegs sind ...« Er ließ offen, was dann geschehen würde, aber sein Blick war beredt. »Was werden Sie nun tun, bis ich Sie wieder brauche?«
»Ich denke, ich werde hier bleiben.«
»Hier?« Thackerys Blick maß das Zimmer erneut.
»In Ootacamund, meinte ich. Es wird Zeit, sesshaft zu werden.«
»Das ist mit Ihrem Lebenswandel wohl kaum vereinbar, oder planen Sie Ihren Abschied?« In Thackerys Stimme schwang unüberhörbar der Unterton mit, dass Aidan besser damit beraten war, es nicht zu tun.
»Nein, Sir, natürlich nicht.«
»Nun gut, wenn Sie bleiben möchten, nur zu. Sie wissen, wann Sie sich bei mir zu melden haben, bis dahin tun Sie, was Ihnen beliebt.«
Ehe er das Zimmer verließ, sah er sich noch einmal um, so als suche er etwas – oder jemanden –, dann fiel die Tür hinter ihm ins Schloss.
Aidan hatte nicht gewusst, dass Thackery von Gillian Kenntnis hatte – Brian hatte diesen Umstand wohlweislich verschwiegen. »Gut für dich, dass du weg bist«, murmelte er. Zwar verstand er den Unwillen seines Vorgesetzten, aber seine und Brians Mission war zur Zufriedenheit aller beendet worden. Wozu also im Nachhinein der ganze Ärger?
Durch Thackery wieder an Gillian erinnert, überlegte Aidan, ob sie Brian vielleicht nachgereist war. Hatte sie mitbekommen, dass er in Richtung West-Ghat wollte? Sie konnte nicht wissen, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Vielleicht versuchte sie ja, sich durchzufragen, indem sie die Beschreibung von Brian überall weitergab. Einen Moment lang bedauerte Aidan sie. Sie würde ihn nicht weiter als bis ans Ende der Straße verfolgen können. Brian verschmolz mit der Umgebung, das hatte er immer schon meisterhaft beherrscht, ebenso wie Aidan. Anders hätten sie keine zwei Tage überlebt. Immer unsichtbar, sei es in der Kargheit der Berge oder inmitten von Menschenmengen. Zwei Schemen, die man sah, aber nicht wahrnahm. Schattenmenschen.
Langeweile. Katrina ließ das Wort lautlos über ihre Zunge rollen. Zeit, die in zähen Tropfen fiel. Um sie herum plätscherte das Gespräch zwischen ihrer Schwägerin Cynthia und deren Freundin Mrs Lowell. Katrina lächelte, wie es von ihr erwartet wurde, während sie ruhig weiterstickte. Wieder und wieder senkte sie die Nadel in den feinen Batist, füllte eine Lilie mit weißem Seidengarn. Die Unschuld der Lilie. Hüte, was du hast, mein Kind. Eine Frau hat nicht mehr.
Sie bemühte sich aufrichtig, der Unterhaltung der beiden Frauen zu folgen, aber Cynthias hektische Stimme und ihre Angewohnheit, wenn sie etwas erzählte, im Satz einzelne Wörter zu betonen, waren entnervend, und Katrinas Gedanken schweiften fortwährend ab. Ihr Lächeln erschien ihr immer maskenhafter. Während ihr Körper starr verharrte, aufrecht, wie sich das gehörte, bewegte sich lediglich die Hand mit der Sticknadel. Sie wagte einen flüchtigen Blick unter den Wimpern hervor zur Tür. Mit Erlösung war nicht zu rechnen.
Charles’ Bemerkung, Stephen sei wieder in der Stadt, ging ihr nicht aus dem Kopf. In der vergangenen Nacht war sie so weit gegangen, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn sie morgens aufwachte und feststellte, dass die letzten zwei Jahre ein Traum gewesen wären. Sie würde die Augen aufschlagen, Stephen neben sich erblicken und glücklich sein, erleichtert, so wie man es immer war, wenn man aus einem Albtraum erwachte und wusste, dass das wirkliche Leben davon nicht berührt war. Sie war über dem Gedanken eingeschlafen. In ihrem Traum war sie wach geworden, und Stephen neigte sich über sie. Licht fiel fächerartig durch die halb geöffneten Läden in den Raum, und sie war glücklich, war es so lange, bis ihre Ayah sie weckte.
Vor zwei Jahren hatte sie sich vorgenommen, nicht mehr an Stephen zu denken. Aber wie sollte sie es verhindern, wenn sie in diesem überladenen Salon saß und sich die Bilder ihres früheren Lebens aufdrängten? Sie hatte keine Enge gekannt, es war ihr nie untersagt gewesen, auszureiten, sie hatte sich um die Teegärten gekümmert – erst gemeinsam mit ihrem Vater, dann mit Stephen. Sich frei in der Gesellschaft zu bewegen, als geachtete Tochter und Ehefrau, war ihr so selbstverständlich gewesen, dass sie schon beinahe eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt hatte – auch das wurde nicht vergessen.
Katrina nahm sich zusammen und versuchte, Anschluss an die Unterhaltung zwischen ihrer Schwägerin und Mrs Lowell zu bekommen. Träge schwappten Worte über sie hinweg, während sie stickte, immer wieder dieselbe Bewegung. Sie hatte, seit sie hier saß, nicht damit innegehalten. Nun jedoch legte sie den kleinen Stickrahmen zur Seite und hob die Hand an die Augen.
»Aber, meine Liebe, ist dir nicht wohl?«, fragte Cynthia.
Ich ersticke, dachte Katrina, ich ersticke. »Nur eine vorübergehende Mattigkeit«, antwortete sie.
»Vielleicht legst du dich besser hin«, schlug Cynthia vor.
»Das wollte ich auch eben vorschlagen«, schaltete sich Mrs Lowell ein, hastig, als fürchte sie, nicht zu Wort zu kommen. »Sie sind in der Tat sehr blass.«
Katrina zögerte keinen Moment lang, stand auf und verließ den Raum, tauschte die Monotonie des Salons gegen ihr abgedunkeltes Zimmer, wo die Läden an diesem Tag fest verschlossen waren. Manchmal ertrug sie die Weite der Landschaft nicht. Wenn sie keine Freiheit haben konnte, wollte sie sie auch nicht sehen. Als Kind hatte sie geglaubt, unsichtbar zu werden, wenn sie die Augen schloss. Katrina legte sich in ihr Bett und schloss die Augen. Nur für einen Moment unsichtbar sein, nur ein flüchtiger Schatten.
»Dein ewiges Versinken in Selbstmitleid ist in höchstem Maße langweilig«, beschwerte sich Charles bei seiner Schwester. Diese wiederum dachte, dass sich da gerade der Richtige über Langeweile beschwerte. Er war ebenso wie Cynthia eine in ihrem vorgesehenen Stück agierende Gesellschaftspuppe. Lediglich wenn er über Tee sprach, kam Leben in ihn, die Augen bekamen einen ungewohnten Glanz, der Mund formte Wörter jenseits der gewohnten Phrasen und Ermahnungen.
»Selbstmitleid«, fuhr Charles nach einer effektheischenden Pause fort, »ist genau das, was die Leute von dir erwarten. Du solltest dich selbstbewusst geben, aber mit der nötigen Zurückhaltung. Kein Schuldeingeständnis – nein, das auf keinen Fall –, aber dennoch, hm, sagen wir, reuig?« Er runzelte die Stirn, schien abzuwägen, ob die Begriffe reuig und sich keiner Schuld bewusst sein nicht einen Widerspruch bildeten, ehe er in kurzen abgehackten Worten seinen Vortrag fortsetzte, zwischendurch nach Luft ringend, wenn er sich besonders erregte. Offenbar schnürte ihm das Korsett der Gesellschaftsnormen ebenso die Luft ab wie Katrina ihres aus Stahlfedern.
»Ich weiß beim besten Willen nicht, was aus dir werden soll«, war sein wenig ermutigender Schlusskommentar. »Wir müssen auch an Caleb denken. Manchmal glaube ich, es wäre das Beste gewesen, wenn Stephen ihn genommen hätte.«
Zorn flammte in Katrina auf, und diesmal unternahm sie keinen Versuch, ihn zu unterdrücken. »Man muss wirklich ein Mann sein, um so etwas zu sagen.«
»Er braucht einen Vater.«
»Stephen hat schon vor langer Zeit entschieden, nicht der Mann zu sein, dem diese Rolle zukommt.«
»Hätten wir gewusst, dass der Skandal unausweichlich ist, hätten wir mit ihm zu einer Einigung kommen können. Du solltest wieder heiraten, und mit einem Kind gestaltet sich das nun einmal schwierig.«
»Fürchtest du, mich bis an mein Lebensende am Hals zu haben?«
»Rede keinen Unsinn«, entgegnete Charles kalt. »Aber einer von uns muss ja mit klarem Kopf denken.«
»Du könntest mich nach England schicken, bis dorthin ist der Skandal sicher nicht gedrungen.« Ein magerer Versuch der Provokation, und er rächte sich augenblicklich.
»Glaub mir, ich hätte es getan, wenn ich mir sicher gewesen wäre, dass dem so ist.«
Manchmal fragte Katrina sich, ob ihr Bruder überhaupt wusste, wie viel Schaden man mit Worten anrichten konnte. Irgendwann würde sie es ihm sagen müssen. Sie könnte es jetzt tun, aber ihre Gedanken waren erfüllt von ihrem eigenen Leid.
2
OOTACAMUND, APRIL 1875
Der in einem weitläufigen Park gelegene Ooty-Club wurde von Offizieren wie auch der illustren Gesellschaft frequentiert. Die Hierarchie der englischen Gesellschaft erschien in Ootacamund weit ausgeprägter als in England, weil sie kleiner und überschaubarer war. Nicht jeder hatte Zutritt zum Club, der als der beste Indiens galt. Offiziere, die oftmals aus dem gleichen sozialen Umfeld kamen wie die Upper Class, waren gern gesehene Gäste. Auch innerhalb des Clubs gab es Abstufungen im sozialen Gefüge. Inder hatten keinen Zutritt, es sei denn als Personal. In englischer Tradition organisierte der Club sogar Fuchsjagden, war gesellschaftlicher Treffpunkt von Frauen, die keine weiblichen Angehörigen hatten und sich recht einsam fühlten in ihren Häusern, die voll waren mit Dienstboten, aber niemanden beherbergten, der ihnen die Zeit vertrieb. Männer nutzten den Club zu den gleichen Zwecken wie die Clubs in London, wo sie Freunde trafen, Beziehungen knüpften und erneuerten oder einfach der häuslichen Langeweile entflohen.
Der Club verfügte über eine Reihe eleganter Räume, über eine Bar, die sowohl für Männer als auch für Frauen zugänglich war, und eine dahinter gelegene Bar, die ausschließlich den Männern vorbehalten war und wo nach acht Uhr abends die strenge Kleiderordnung aufgehoben wurde und die Herren in Hemdsärmeln sitzen durften. Die Wände der Räume waren mit Holzpaneelen verkleidet, man schritt über seidig glänzendes Parkett, war umgeben von polierten Rosenholzmöbeln, auf denen sich das Licht der Kristalllüster brach. Jagdtrophäen reihten sich an den Wänden des Ballsaals, offenbar alle von Jagdbeuten der Clubmitglieder, als diese noch lebensmüde genug gewesen waren, Tiger, Leoparden und Bären zu jagen. Neben der Bibliothek der Stadt gab es auch im Club eine Bibliothek und einen Leseraum, in dem der Geruch alter Bücher hing.
Aidan beobachtete, auf einer Bank sitzend, die Frauen, die durch den Park spazierten. Eng geschnürte, gertenschlanke Wesen, leicht schwankend wie Schilfrohre. Erstaunlich, was ein gepresster Brustkorb, Atemnot und die aktuelle Schuhmode an Anmut hervorriefen. Aidan fand sie wunderschön anzusehen, ein bezaubernder Marionetten-Reigen, der die Wege auf und ab flanierte, aber bar jeder Sinnlichkeit. Dennoch fand er es unterhaltsam, ihnen dabei zuzusehen, wie sie plaudernd an ihm vorbeizogen, so als seien sie die Attraktion eines Theaters, dessen einziger Zuschauer er war.
Vor einigen Tagen hatte er seinem Vater geschrieben und überlegte, bis wann er die Antwort bekommen würde. Er brauchte Geld. Zwar hatte er in den letzten Jahren einiges gespart, aber es reichte bei Weitem nicht für das Haus mit den dazugehörigen Teegärten, das er sich angesehen hatte. Sein Vater würde sein Ansinnen vermutlich ablehnen – in seinen Augen war er nichts weiter als ein Müßiggänger, der sich in der Gegend herumtrieb, für mehrere Monate nichts von sich hören ließ und in seinen Briefen nur vage Andeutungen über seinen Verbleib machte.
Dabei hatte es aus Sicht seines Vaters vielversprechend angefangen, als Aidan den Wunsch verkündet hatte, zur Armee zu gehen. Das Haupterbe fiel an Aidans älteren Bruder, und weil die monatliche Rente, die Aidan bezog, nicht reichen würde, um davon einen Hausstand zu gründen, hatte er sich für die Armee entschieden. Sein Vater kaufte ihm ein Offizierspatent, und Aidan ging nach Kalkutta. Nach der Grundausbildung äußerte sein Vater den Wunsch, er möge zur Bombay-Kavallerie gehen, aber Aidan hatte sich bereits für eine Laufbahn als Kundschafter entschieden, in den Augen eines jeden Engländers ein schlichter Spion – kaum das, was sein Vater sich für ihn vorgestellt hatte.
Aidan ließ seine Familie und Freunde in dem Glauben, sich aus dem Armeedienst zurückgezogen zu haben und sein Offizierspatent lediglich des Ansehens wegen zu behalten. Wann immer er mit Brian durch die Berge zog, sich unter die Bergvölker mischte, wochenlang keine Sprache sprach außer den Dialekten der Gegend, in der er sich aufhielt, wusste er, dass er die beste Entscheidung seines Lebens getroffen hatte.
Dennoch wollte Vorsorge für die Zukunft getroffen werden. In den letzten Monaten ertappte Aidan sich dabei, dass er sich vorstellte, wie sein Leben verliefe, wenn er seine Tätigkeit nicht mehr ausübte, sei es aus Altersgründen oder weil er sich eine ernsthafte Verletzung zuzog, die ihn arbeitsuntauglich machen würde. Er hatte über die Jahre immer etwas Geld beiseitegelegt, und der Nilgiri-Distrikt hatte es ihm angetan, seit er ihn das erste Mal bereist hatte.
Aidan ließ den Blick wieder schweifen, sah eine junge Frau etwas abseits der anderen am Wegrand stehen und versonnen über den Park hinaus in die Ferne schauen. Er musterte ihr Profil und überlegte, wo er sie schon einmal gesehen hatte. Stirnrunzelnd ließ er seine Begegnungen der letzten Wochen vor halb geschlossenen Augen ablaufen und erinnerte sich an seinen ersten Morgen in Ooty. Die Frau, die mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn das Teekontor besucht hatte. Nun, auf die geringere Entfernung hin, bemerkte er, wie fein ihre Gesichtszüge gemeißelt waren, die gerade Nase, die weiche Linie ihres Mundes, die Wangenknochen, die ihrem Gesicht einen zartherben Zug verliehen.
Es war lange her, seit Aidan das letzte Mal mit einer englischen Frau geflirtet oder sich auch nur unterhalten hatte – abgesehen natürlich von Gillian, aber die zählte nicht. Weil ihm die in Gruppen vorbeischwebenden Frauen unerreichbar schienen, beschloss er, sein Können in gesellschaftlicher Konversation an dieser einen auszuprobieren, die immer noch in die Berge blickte, so als habe sie sie nie zuvor gesehen. Vielleicht eine Besucherin aus Madras, die ihre erste Saison in Ooty verbrachte.
Noch während er auf sie zuging, überlegte Aidan sich etwas Geistreiches, um sie anzusprechen. »Schöne Aussicht«, hörte er sich sagen. Nun gut, er war aus der Übung.
Die Frau fuhr herum und riss die Augen auf, sichtlich erschrocken. Aidan war befremdet, er hatte im freundlichsten Plauderton gesprochen. Er sagte das Erste, das ihm einfiel: »Wir sind uns schon begegnet, Mrs ...«
Sie zögerte, dann antwortete sie auf sein aufforderndes Nicken hin: »Alardyce. Ich fürchte, ich erinnere mich nicht an Sie.«
Ein grober Fauxpas, aber sie schien ihn nicht zu bemerken. »Es ist schon einige Zeit her. Sie waren in Begleitung Ihres Ehemannes und haben nur ein Mal in meine Richtung gesehen.«
In ihrem Gesicht zuckte es kurz. »Das muss in der Tat schon sehr lange her sein.«
Der Versuch, Konversation zu machen, gestaltete sich schwieriger als erwartet, und Aidan wünschte, er wäre auf der Bank sitzen geblieben. »Es war vor wenigen Wochen.«
Der Blick der jungen Frau war so verwundert, dass Aidan sich wie ein ausgemachter Idiot vorkam. »Hm, gegenüber der Herberge vor dem Teekontor der Ramsay-Tee-Gesellschaft?«, fragte er, um ihrer Erinnerung auf die Sprünge zu helfen.
Die Frau runzelte kurz die Stirn, dann blitzte Verständnis, gefolgt von einem Anflug echter Erheiterung, in ihren Augen auf. »Das war mein Bruder, Charles Ramsay. Ihm gehört das Teekontor«, fügte sie erklärend hinzu. »Ich bin nicht mehr verheiratet.«
Aidan nickte. Er verstand. Zwar trug sie keine Trauer mehr, was darauf schließen ließ, dass ihr Mann seit mehr als drei Jahren tot sein musste, aber sie tat ihm dennoch leid. Er wusste, was die Witwenschaft einer Frau für Beschränkungen auferlegte. Offenbar sah sie es ihm an, denn ihr Gesichtsausdruck versteinerte, und sie blickte zu Boden.
»Möchten Sie mich vielleicht ein paar Schritte durch den Park begleiten?«, schlug er vor.
Ihr Blick flog zu den plaudernden Menschen und wieder zu ihm zurück. »Ich bedaure, aber man könnte uns sehen.«
Das war grob beleidigend, und für einen Moment verschlug es Aidan die Sprache.
»Die Leute reden«, sagte sie. »Ich muss zurück, meine Schwägerin sucht mich sicher schon.« Sie nickte ihm zum Abschied kurz zu und eilte den Weg zum Clubgebäude hoch, keine zierlichen Trippelschritte, sondern Schritte in der Art, dass niemandem verborgen blieb, dass sie unter dem Rock nicht körperlos war. Aidan beobachtete ihre Tournüre, und obwohl ihn die Abfuhr ärgerte, musste er grinsen.
*
Charles bellte Befehle, als er seine Lagerhalle betrat, in der während seiner Abwesenheit offenbar der Müßiggang Einzug hielt. Er war für eine Woche in Coonoor gewesen, um sich mit Teehändlern aus der Gegend auszutauschen. Nun stand er inmitten der Halle und blickte jeden Arbeiter, der in seiner Arbeit des Teepackens innehielt, strafend an. Er bezahlte die Leute, da konnte er mit gutem Recht erwarten, dass sie taten, was man ihnen auftrug. Das Gefühl, bestohlen zu werden, stieg in ihm auf. Er würde sich noch einmal mit seinem Verwalter unterhalten müssen. Zwar sagte dieser immer wieder, dass alles bestens laufe, aber Charles blieb argwöhnisch. Vielleicht sollte er sich selbst seine Bücher vornehmen und den Verwalter bei Gelegenheit auch gleich austauschen.
Auf dem kurzen Weg vom Lager zum Kontor rechnete er die Gewinne aus, die durch den Erwerb weiteren Landes zu verzeichnen wären. Er grüßte gedankenverloren zwei Bekannte und betrat das Kontor. Ein Angestellter stand vor der holzvertäfelten Wand, ein schweres Buch in den Händen, in dem Charles sofort eines seiner Bilanzbücher erkannte, ebenso wie ihm der Blick des Mannes nicht entging, in dem er einen Anflug von Unbehagen zu erkennen glaubte. Wahrscheinlich tat er besser daran, sein gesamtes Personal zu ersetzen. Einer der Teehändler aus Kotagiri hatte ihm noch vor wenigen Tagen erzählt, wie die Bilanzbücher von seinen Mitarbeitern gefälscht worden waren. Charles misstraute seinem Personal ohnehin seit jeher, aber nun war er sich sicher, dass dergleichen auch unter seinem eigenen Dach geschah. Man musste die Leute lediglich überraschen, indem man zwei Tage eher zurückkehrte als erwartet.
»Sir.« Der Verwalter, Mr Johansson, sprang auf, als Charles das Büro betrat.
»Die letzten Monatsberichte«, befahl dieser.
»Wir haben Sie noch nicht erwartet«, sagte Mr Johansson, während er einige Ordner hervorzog, ohne zu zögern oder lange zu suchen.
»Meine Geschäfte waren schnell erledigt.« Charles ließ sich auf einem Stuhl nieder und schlug die erste Mappe auf.
»Ich glaubte, es sei wegen ...« Mr Johansson schien sich eines Besseren zu besinnen und verstummte.
»Wegen? Ich höre«, hakte Charles nach, ohne aufzublicken. Offenbar bestätigte sich sein Verdacht. Er wartete auf die stammelnden Erklärungen, die er sich anzuhören und abzuweisen gedachte.
»Nun, Sir, ich will keine Gerüchte bestätigen.«
»Mr Johansson ich denke doch, ich bin im Bilde. Mich interessiert, was Sie dazu zu sagen haben?«
»Meine Meinung dazu?« Der Verwalter war sichtlich verwirrt. Charles ließ die Mappe sinken und sah den Mann an. »Ganz recht.«
»Ich habe es nicht gesehen, meine Frau erzählte es mir.«
»Ihre Frau?«
»Das mit Ihrer Schwester, Sir. Ich meine, die Leute erzählen viel, und gerade die Frauen ...«
»Was ist mit meiner Schwester?«, fiel Charles ihm ins Wort.
»Im Ooty-Club, einen Tag nach Ihrer Abreise, Sir, wurde sie in Gesellschaft eines Mannes gesehen, eines Fremden, Sir.«
»Und?« Charles hoffte, dass seine Anspannung sich nicht in seiner Stimme widerspiegelte. »Was ist dabei? Es ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt.«
»Ganz recht, Sir«, bestätigte Mr Johansson hastig. »Ich habe es ohnehin nicht geglaubt, dass sie mit ihm allein war.«
Charles senkte kurz die Lider, sammelte sich und blickte wieder hoch. »Allein?«
»Nun ja, nicht wirklich allein, denke ich. Sonst hätte sie ja niemand sehen können, Sir. Nun ja, was die Frauen halt so reden.«
Die folgende Stille rann wie Eiswasser. Charles legte die Mappe auf den Tisch und stand auf. Langsame, konzentrierte Bewegungen, die eine Sicherheit vermitteln sollten, die er nicht besaß. Zum Teufel mit seiner Schwester. Sollte das der Dank für seine Mühen der letzten Jahre sein?
»Charles, du bist zurück?«, rief Cynthia, unüberhörbar erleichtert. »Ich muss mit dir ...«
»Jetzt nicht.« Charles warf dem herbeieilenden Dienstboten seinen Hut zu und stürmte die Treppe hoch zum Zimmer seiner Schwester. Ohne anzuklopfen, stieß er die Tür auf, sodass sie gegen die Wand knallte. Katrina saß am Fenster und fuhr erschrocken herum. Als Charles die Tür ins Schloss warf, zuckte sie kurz zusammen. Sie war sehr blass, mit dunklen Ringen unter den Augen.
»Ehe du etwas sagst, Charles ...«
»Halt den Mund! Was hast du dir dabei gedacht, dich so zu kompromittieren? Reicht der Ärger nicht, den wir deinetwegen hatten? Hast du auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich zwei Töchter habe, die es irgendwann einmal zu verheiraten gilt?«
»Ich habe nichts falsch gemacht, und ich sehe überhaupt nicht ein, das immer und immer zu wiederholen.« Obwohl ihre Stimme erschöpft klang, wirkte Katrina kämpferisch mit dem vorgestreckten Kinn und den geballten Fäusten. »Mich hat ein wildfremder Mann angesprochen, der außerdem dachte, dass du mein Ehemann seiest, und den ich nach wenigen Worten stehen lassen habe. Aber jeder erzählt etwas anderes, und mit jedem Tag dichtet jemand etwas hinzu, weil sie so aufgeregt sind und sich freuen, dass endlich mal wieder etwas passiert. Der Sommer ist dieses Jahr einfach zu langweilig!«
»Es geht nicht darum, was du getan hast und was nicht, sondern wie es vor den Leuten aussieht.«
»Ich kann die Leute nicht am Reden hindern, das weißt du.«
»Es ist ausgeschlossen, dass du weiterhin in meinem Haus lebst, wenn du nicht so weit auf dich achtgeben kannst, dass du nicht erneut ins Gerede kommst, und noch dazu wegen eines anderen Mannes.«
Katrinas Blick flackerte, wurde unsicher. »Willst du mich hinauswerfen?«
»Nein, zum Teufel, aber ich weiß nicht, was ich machen soll!«
Es gab zwei Dinge, die Katrina Aufschluss darüber gaben, wie es in ihrem Bruder aussah: Er fluchte, und er gestand eine Niederlage ein. Einen flüchtigen Moment lang tat er ihr leid, und sie hätte ihn gerne an sich gezogen und über sein Haar gestrichen. Ihr drängte sich sogar der absurde Gedanke an eine Entschuldigung auf, dabei hatte sie sich nichts zuschulden kommen lassen. Sie presste die Lippen zusammen, so als fürchte sie, die Bitte um Verzeihung könnte ihr gegen ihren Willen entschlüpfen. Mehrere zitternde Atemzüge lang verharrte sie.
»Erzähl jedem, dass es sich nicht so zugetragen hat«, sagte sie leise, als sie ihrer Stimme wieder traute.
»Wie sollte ich das tun? Ich war doch nicht einmal in der Stadt.«
»Aber ich habe es dir erzählt.«
»Oh, großartig. Und du denkst ernsthaft, irgendwer glaubt mir, wenn nicht einmal ich dir glaube?«
Um Katrinas Mund zuckte es kurz, dann wandte sie sich brüsk ab.
»Wer war der Mann?«, wollte Charles wissen.
»Ich habe keine Ahnung, er hat sich mir nicht vorgestellt.«
»Ein echter Gentleman, wie ich sehe.« Beißender Spott troff aus Charles’ Stimme und überlagerte die Wut. »Aber deinen Namen kennt er nun, will ich annehmen?«
Katrina nickte nur und hörte ihn seufzen. Offenbar wurden seine schlimmsten Erwartungen bestätigt.
»Wenigstens an meine Töchter hättest du denken können«, wiederholte Charles.
Langsam drehte Katrina sich zu ihm. »Sollte ich jemals wieder auf die Idee kommen, am Wegrand stehen zu bleiben und zu den Bergen zu sehen, werde ich vorher an deine Töchter denken.« Sie wandte sich ab und schaute erneut zum Fenster hinaus, lauschte dem hastigen Einatmen hinter sich, den abgehackten Schritten, der Tür, die aufgerissen und ins Schloss geworfen wurde.
*
Aidan grub die Hand in die dichte Mähne des Rotfuchses und drückte seinen Kopf an dessen Hals. Das Pferd, ein langbeiniger Vollblüter, war sein ganzer Stolz. Er hatte es vor vier Jahren erworben, zugeritten und seither keinen besseren und verlässlicheren Gefährten gehabt.
»Du wohnst komfortabler als ich, mein Freund«, sagte er und klopfte dem Pferd den Hals. Der Hengst schnaubte, suchte mit seidenweichen Nüstern Aidans Kleidung nach Leckereien ab. Papier raschelte, als er an die Brusttasche des Gehrocks stieß. Der Brief von Aidans Vater.
Obwohl er nicht ernsthaft damit gerechnet hatte, Geld zu erhalten, war Aidan auf die vernichtende Abfuhr, die sein Vater ihm erteilt hatte, nicht vorbereitet gewesen. Was verlangte er schon mehr als sein Geburtsrecht? War es vielleicht gerecht, dass sein älterer Bruder in Luxus lebte, ohne dafür zu arbeiten? Aidan erhielt monatlich kaum mehr als seine jüngste Schwester, und die würde irgendwann einen reichen Mann heiraten, ebenso wie es seine beiden anderen Schwestern getan hatten. Jüngere Söhne wurden Geistliche oder gingen zum Militär.
Natürlich lebte Aidan von seinem Sold nicht schlecht, aber er wollte etwas Eigenes haben, etwas, wo er sich willkommen fühlte, wenn er von einer Mission zurückkam. Jeder, den er kannte, hatte ein richtiges Zuhause. Selbst Sharif, der ihn und Brian von Zeit zu Zeit begleitete, besaß die kleine Landscholle, auf der sein Zelt stand.
Aidan klopfte dem Hengst ein weiteres Mal den Hals und zauste die Mähne. »Auf bald, Granat.« Ehe er den Stall verließ, gab er dem wachhabenden Jungen, der auf einem Strohballen in der Nähe der Tür saß und sichtlich müde war, eine Münze, die dieser beiläufig einsteckte.
Die in der Dunkelheit beleuchteten Straßen hatten etwas Anheimelndes, und wäre Aidan nicht so verärgert wegen des Tonfalls in dem Brief seines Vaters gewesen, hätte er mehr als einen Blick für seine Umgebung übrig gehabt. So jedoch steuerte er, die Augen auf die Straße gerichtet, den einzigen Ort an, an dem er die Nacht zu verbringen gedachte. Er griff in die Tasche seines eleganten Gehrocks und ließ ein paar Münzen klimpern.
Die Tür öffnete sich, kaum dass Aidan den Türklopfer losgelassen hatte. Schwere, rauchgeschwängerte Luft schlug ihm entgegen und verlor sich in der lauen Nacht. Der Mann, der die Tür geöffnet hatte, ein untersetzter Inder, trat zurück und bedeutete ihm, einzutreten.
Wenige Lidschläge später hatten sich Aidans Augen an das Dämmerlicht gewöhnt, fanden ihren Weg durch den Qualm, der über sitzende und liegende Gestalten hinwegwaberte. Er ging zwei Stufen hinunter, die in den Raum führten, und begab sich zu einem freien Platz an der Wand. Der süßliche Geruch von Opium lag in der Luft, überlagerte den von Absinth.
Ein Inder mit einem fleckigen Tuch um die Haare fragte Aidan nach seinen Wünschen und kehrte wenig später mit einer Opiumpfeife zurück. Aidan lehnte sich zurück, nahm den ersten Zug und schloss die Augen halb. Der Rauch quoll aus seinem Mund, brannte in seinen Augen und hinterließ einen süßen, schweren Geschmack, dem er mit dem nächsten Zug entgegenwirkte.
Wenige Minuten später ließ sich ein älterer Mann auf der Liege neben ihm nieder und sprach mit dem Dienstboten. Aidan kannte die Prozedur des Opiumrauchens seit Jahren, er hatte damit in Kalkutta begonnen. Er stellte sich die braunen Kügelchen vor, die sich beim Erhitzen goldfarben verfärbten und die sich zu Fäden ziehen ließen, wenn man sie in eine Pfeife gab. Die Prozedur hatte etwas Beruhigendes, ähnlich den Bildern, die man sich vorstellte, wenn man einschlafen wollte. Nach einer Weile überkam Aidan eine angenehme Mattigkeit.
»... hier!«, rief der Mann neben ihm und stieß ihn leicht an. Aidan schlug die Augen auf, blinzelte mit schweren Lidern.
»Neu hier?«, wiederholte der Mann. »Sind nicht aus Ooty? Hab Sie hier noch nie gesehen.«
Das Letzte, wonach Aidan der Sinn stand, war ein geschwätziger alter Mann. Er brummte eine Antwort, die man mit viel gutem Willen als »Ja« verstehen konnte, und schloss die Augen wieder. Offenbar war der Mann jedoch nicht gewillt, von ihm abzulassen.
»Hab’s gleich gemerkt. Ich kenne hier nämlich so ziemlich jeden Gentleman. Kommen Sie aus Madras?«
»Kalkutta«, murmelte Aidan.
»Ich war früher Offizier und in Kalkutta stationiert«, antwortete der Mann.
Aidan hielt in der Bewegung, die Pfeife zum Mund zu führen, inne und wurde wachsam.
»Hab im ersten Afghanistan-Krieg mitgekämpft. Daher auch die Verletzung.« Er klopfte auf sein Bein.
Aidan entspannte sich wieder und sog an dem Mundstück seiner Pfeife. Ein geschwätziger Alter, der ihm vermutlich die nächsten Stunden vom Krieg erzählen wollte. Erfahrungsgemäß wollten diese Menschen keine Antworten, sondern einfach nur reden.
»Seither bin ich morphiumabhängig«, fuhr der alte Mann fort. »Waren höllische Schmerzen. Jetzt ist das Bein verheilt, aber das Morphium nehm ich immer noch. Ich könnt Ihnen eine Menge über das Militär erzählen und über Ooty und die Gesellschaft hier. Muss man kennen, wenn man sich zurechtfinden will.« Offenbar hielt der Mann das Schweigen seines Nachbarn für eine Aufforderung, fortzufahren, und so erzählte er weiter. Aidan versank in einen Halbschlummer, den nur vereinzelt Worte durchdrangen.
Der Name Ramsay ließ ihn aufhorchen, vielleicht, weil es bisher der einzig ihm bekannte Name war. Er hob die bleiernen Lider, so weit es ihm möglich war.
»Hat ... Schwester«, erzählte der Mann. »In Schwierigkeiten. War ... Fremder auf ...ub.« Der Mann neigte sich vertraulich zu ihm, und nun hörte Aidan auch die Worte etwas deutlicher. »Macht ihm nichts als Ärger. Mit der ... Hals, sage ich Ihnen. Würde alles zahlen, um ... aus ... zu bekommen.«
Zwar bemühte Aidan sich, aber die Worte fanden keinen Halt, sondern verloren sich im Nebel. Er seufzte und schloss die Augen wieder. Sein Kopf schmerzte. Ohne weiter auf den alten Mann zu achten, ließ er sich in einen angenehmen Dämmerschlaf treiben.
Der Basar erwachte, als Aidan das Opiumhaus verließ. In seinem Kopf hämmerte es, und der Boden schien leicht zu schwanken. Er bewegte sich zunächst vorsichtig, um Erschütterungen zu vermeiden, für die sein malträtierter Kopf ihn umgehend bestrafen würde. Nun gut, verdient hatte er es. Es dauerte einige Schritte und Atemzüge an der frischen Luft, ehe ihm die Straße wieder fest erschien. Aidan sah zum See von Ooty und wünschte, er könnte mit dem Kopf voran hineinspringen.
Einheimische Händler bauten ihre Stände auf, breiteten seidene und baumwollene Ballen aus, öffneten Gewürzsäcke, deren Duft sich mit der klaren Bergluft vermischte, überfluteten die Straße mit Stimmen und Farben. Aidan zog seine Kleidung zurecht, fuhr sich mit den Fingern durch das Haar und machte sich auf den Heimweg. Seit Kurzem hatte er im nördlichen Teil der Stadt drei Zimmer in einem Bungalow angemietet.
Der Sohn der Hauswirtin öffnete die Tür, und Aidan war heilfroh, dass er nicht der Frau selbst gegenübertreten musste. Der junge Mann zwinkerte Aidan zu, wobei es ihm nur schwer gelang, ein Auge zu schließen, ohne das andere nicht ebenfalls halb zuzukneifen. »Besuch«, sagte er nur.
Aidan starrte ihn verständnislos an. Der Mann zwinkerte erneut mehrmals, sodass Aidan sich unvermittelt fragte, ob er nicht ganz richtig im Kopf war.
»Besuch«, sagte der junge Mann erneut. »Eine Frau.« Er grinste und deutete mit dem Daumen auf eine verschlossene Zimmertür.
»Sie lassen eine fremde Frau in meinen Räumen warten?« Ärger verdrängte die anfängliche Verblüffung in seiner Stimme.
»Sie sagte, Sie würden sich kennen.«
»Ich hoffe in Ihrem Interesse, nicht ausgeraubt worden zu sein«, rief Aidan über die Schulter, als er durch die Eingangshalle ging. Mit einem Ruck stieß er die Tür auf, und Gillian, die in einem Sessel geschlafen hatte, fuhr hoch.
»Aidan!«
»Was willst du hier?«, fragte Aidan unfreundlich.
»Wo warst du?«
Aidan musterte sie kalt. »Meine Liebe, ich denke, das geht dich nichts an.«
»Du rauchst immer noch Opium? Deine Augen sind ganz rot.« Gillians Stimme war schläfrig, und ihr Kleid war verrutscht, was Aidans Sinne nur zu deutlich wahrnahmen.
»Was willst du?«, wiederholte er. In seiner Stimme war die leise Warnung zu hören, seine Ruhe nicht mit Nachsicht zu verwechseln.
Gillian stand auf, zupfte an ihrem Kleid und strich gelöste Haarsträhnen zurück. »Ich brauche Geld.«
»Reichte es nicht für die Reise zurück nach Kalkutta?«
»Du weißt, warum ich nicht zurückkann.«
Aidan löste sein Halstuch und zog seinen Gehrock aus. »Wenn du Geld brauchst, dann such dir eine Arbeit. Ich habe nicht vor, die Rolle eines Bruders oder Beschützers zu spielen.« Sein Blick glitt flüchtig über ihren Körper. »Ebenso wenig die eines zahlenden Liebhabers.«
Röte schoss Gillian in die Wangen. »Ich bin keine Hure!«
»Dann benimm dich auch nicht wie eine. In gewissen Kreisen gilt es beispielsweise für eine Frau als äußerst unschicklich, auf einen Mann während der Nacht in seinen Räumen zu warten.«
Gillian blinzelte und sah zu Boden. »Wenn du mir nichts gibst, muss ich betteln gehen.«
»Tust du das nicht in diesem Moment bereits?«
»Ach, geh zum Teufel, Aidan!«, schrie sie.
Aidan löste seinen Geldbeutel, zählte einige Münzen in die Hand und warf ihr den Beutel zu. »Das erste und letzte Mal, Gilly.«
Einen kaum hörbaren Dank auf den Lippen, steckte Gillian den Beutel ein und ging zur Tür. Ohne sie zu öffnen, blieb sie davor stehen und starrte auf das Holz. »Weißt du, wo Brian ist?«
»Ich bedaure.«
Gillian nickte, drückte die Klinke der Tür hinunter und verließ den Raum ohne ein weiteres Wort.
*
Der Weg der 1849 begonnenen Nilgiri Mountain Railway, der Bergeisenbahn, deren Bau den Plänen des Schweizers Niklaus Riggenbach folgte, würde sein Ende in Ootacamund nehmen. Zwei britische Ingenieure unterhielten sich im Ooty-Club über die Option, der Madras Railway Company beizutreten, die das Projekt derzeit verwaltete. Geplant war eine Route, die Mettupalayam mit Ooty verband und die ihren Weg durch das Gebirge nahm, durch Tunnel, über abgründige Gebirgszüge, Brücken und durch Täler. Neue Perspektiven der Reise eröffneten sich, und die achtundzwanzig Meilen würden künftig wesentlich leichter zurückzulegen sein als bisher.
Aidan schlenderte durch die Räume des Clubs, lauschte einigen Gesprächen, ohne sich daran zu beteiligen, und blieb an einem großen Tisch stehen, an dem die jungen Offiziere, Frischlinge in der Armee, spöttisch Snooker genannt, ihrem neuen Zeitvertreib nachgingen, einem Spiel, das sie aus Langeweile erfunden hatten und Black Pool nannten. Angenehmer Zeitvertreib, dachte Aidan, während er die Offiziere amüsiert beobachtete, aber sicher keiner, der mehr als eine Saison bestehen würde. Wer hätte schon dauerhaft Spaß daran, mit einer schwarzen Kugel fünfzehn rote Kugeln durch die Gegend zu stoßen?
Aidan ging in einen der Clubräume, die Männern vorbehalten waren, ließ sich eine Zigarre geben und setzte sich in einen der Sessel mit Blick auf den Park. Der Club war 1841 von einem Captain Douglas gegründet worden, der zusammen mit sieben weiteren Offizieren der Madras- und Bombay-Armee das erste Komitee bildete. Kurz nach seiner Entstehung konnten bereits dreihundertsechzig Mitglieder verzeichnet werden. Die Aufnahmegebühr betrug zweiundvierzig Rupien, und es gab für männliche Mitglieder die Möglichkeit, sich für hundertdreißig Rupien monatlich in eines der elf Zimmer einzumieten. Aidan hatte keinerlei Schwierigkeiten, die Mitgliedschaft zu erwirken. Er war Offizier der Bengalen-Kavallerie, hatte sich keine Verfehlungen zuschulden kommen lassen und entstammte einer angesehenen Familie.
Neben ihm unterhielt sich eine Gruppe junger Stutzer über die Vorteile einer England-Reise. Warum sie so heftig diskutierten, konnte Aidan sich nicht erklären, schließlich sagten sie alle das Gleiche, nur mit anderen Worten. Als sie sich endlich einig waren, schwenkte das Gespräch um zu den Vorkommnissen in Ooty, und wieder fiel der Name Ramsay, der Aidan auf irritierende Weise zu begleiten schien.
Es drehte sich um einen Skandal, der für jemanden, der nicht eingeweiht war, aber nur schwer zu durchschauen war. Offenbar war eine Frau im Spiel. Aidan war so sehr daran gewöhnt, Informationen zunächst willkürlich in sich aufzusaugen, später analytisch auseinanderzunehmen und wieder in einer für ihn verständlichen Ordnung zusammenzusetzen, dass er jede Einzelheit des Gesprächs mitbekam, ohne den Eindruck zu erwecken, er lausche.
»Dummes Geschwätz«, murrte ein alter Mann neben ihm, der an einer erkalteten Pfeife sog. Ob sein Kommentar sich auf das Gerede der jungen Männer oder die Zeitung, die er eben zusammenlegte, bezog, war nicht auszumachen.
Aidans Neugierde hingegen war erwacht, und er drehte sich zu dem Mann um. »Ich habe auch schon von den Schwierigkeiten gehört, in denen Mr Ramsay steckt«, sagte er im Plauderton. Der Neuankömmling, der wissen möchte, was in der Gesellschaft so vor sich geht.
Der alte Mann musterte ihn, aber ob das Ergebnis zu seinen Gunsten oder Ungunsten ausfiel, war nicht zu erkennen. »Dummes Geschwätz«, wiederholte der Mann und verfiel in Schweigen.
Ehe Aidan darauf antworten konnte, verstummten die Gespräche um ihn herum, und die Leute sahen zur Tür. Ein hochgewachsener schlanker Mann, Aidan schätzte ihn auf Anfang dreißig, betrat den Salon, blieb kurz stehen, sah sich mit einem Lächeln um und kam zu der Sitzgruppe, wo Aidan und der mürrische alte Mann saßen. Das Unbehagen der Umstehenden war förmlich mit den Händen zu greifen, was den Mann nicht zu stören schien. Mit aufreizender Nonchalance ließ er sich in einem der Clubsessel nieder und griff nach der Holzschachtel mit den Zigarren. Er sah Aidan an, und erneut glitt ein Lächeln über die ebenmäßigen Züge. »Ah, neu in der Stadt? Mit wem habe ich das Vergnügen?«
Mit einem schnellen Blick schätzte Aidan sein Gegenüber ein, erkannte die leicht gezwungene Unbekümmertheit. »Aidan Landor«, stellte er sich vor.
»Herzlich willkommen in Ooty«, entgegnete der Mann. »Mein Name ist Stephen Alardyce.« Er sah sich um. »Aber ich bitte Sie, meine Herren, tun Sie sich keinen Zwang an. Selbst zu mir ist der Klatsch gedrungen, und ich bedaure zutiefst die prekäre Lage, in die sich das arme Kind erneut gebracht hat.«
Das Gemurmel setzte wieder ein, zögernd erst, dann in der vorherigen Lautstärke. Stephen Alardyce zündete eine Zigarre an und lehnte sich zurück. Sein Blick wanderte ziellos durch den Raum, schweifte über die Gruppe junger Männer, die ihr Gespräch wieder aufgenommen hatten – wenn auch der Gegenstand ihrer Diskussionen nun ein anderer war.
Aidan fragte sich, in welchem Verhältnis der Mann zu Charles Ramsays Schwester stand, denn dass beide zufällig denselben Namen trugen, erschien ihm unwahrscheinlich. Er konnte nicht in Abrede stellen, dass ihn das Thema Ramsay mittlerweile neugierig gemacht hatte. Nicht nur, dass Charles Ramsays Schwester sich keineswegs so benommen hatte, wie man es von einer Dame ihres Standes erwarten konnte, er traf auch immer wieder auf den Namen.