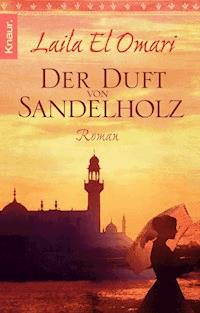4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romane zum Davonträumen in ferne Welten
- Sprache: Deutsch
Ein Wunsch nach Rache, Liebe und Leidenschaft.
Kalkutta, 1875: Als Alec nach zehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, steht er vor dem Nichts. Das Einzige, was ihn noch antreibt, ist der Gedanke an Rache. Rache an dem Mann, der ihn einst unschuldig verurteilt hat.
London, 1878: Alec reist geschäftlich nach London und begegnet dort Lady Helena Ashington. Schnell erkennt er, dass sie die Tochter seines Erzfeindes ist - doch da hat er sein Herz bereits an sie verloren. Auch Helena verliebt sich Hals über Kopf in Alec und hofft, dass er ihr die Möglichkeit gibt, ihrem strengen Elternhaus und einer arrangierten Verlobung zu entfliehen. Alec muss eine Entscheidung treffen. Er will Helena nicht für seine Rache missbrauchen. Aber er kann sie auch nicht loslassen ...
Ein spannender Roman über Liebe und Intrigen in Indien und im patriarchalischen englischen Adel des 19. Jahrhunderts. Laila El Omari schreibt auch unter den Namen Anna Jonas, Nora Elias und Hannah Conrad.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Prolog
Kalkutta, 1865
TEIL I 1875
1
London
2
3
Kalkutta
4
London
5
Kalkutta
6
Essex
7
Kalkutta
8
TEIL II 1878
9
London
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Essex
29
30
31
32
33
TEIL III 1881 – 1882
34
London
35
36
Kalkutta
37
London
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
London
50
51
TEIL IV 1884 – 1885
52
Essex
53
54
Kalkutta
55
Essex
56
London
57
Kalkutta
58
London
59
Kalkutta
60
London
61
62
Kalkutta
63
London
64
65
66
Kalkutta
67
London
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Kalkutta 1886
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Hat es Dir gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Kalkutta, 1875: Als Alec nach zehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, steht er vor dem Nichts. Das Einzige, was ihn noch antreibt, ist der Gedanke an Rache. Rache an dem Mann, der ihn einst unschuldig verurteilt hat.
London, 1878: Alec reist geschäftlich nach London und begegnet dort Lady Helena Ashington. Schnell erkennt er, dass sie die Tochter seines Erzfeindes ist – doch da hat er sein Herz bereits an sie verloren. Auch Helena verliebt sich Hals über Kopf in Alec und hofft, dass er ihr die Möglichkeit gibt, ihrem strengen Elternhaus und einer arrangierten Verlobung zu entfliehen. Alec muss eine Entscheidung treffen. Er will Helena nicht für seine Rache missbrauchen. Aber er kann sie auch nicht loslassen ...
Laila El Omari
Die englische Erbin
Prolog
Kalkutta, 1865
Alec kletterte mühsam aus den Tiefen seiner Bewusstlosigkeit, ein stetes Hämmern in seinem Kopf, das anschwoll, je näher er dem Erwachen kam. Ausgestreckt auf dem Bauch liegend, tastete er langsam den Boden ab, seine Finger berührten nichts als feuchten Stein. Wo war er?
Ein schmieriger Film überzog den Boden, es roch nach faulendem Stroh, und irgendwo, dicht an seinem Ohr, hörte er ein Trippeln und Quieken. Ratten, dachte er mit unterschwelligem Entsetzen. Weitere Laute füllten den Raum, wurden zu Stimmen, artikulierten sich zu Worten.
»Ich glaub, der macht’s nicht lang.«
»So’n junger Bursche!«
Jemand lachte, kurz darauf griffen Hände nach ihm, fuhren grob über seinen Körper und umfassten sein Gesicht, zerrten an ihm. Sie taten ihm weh, merkten sie das nicht? Ein kurzes Gerangel, und die Hände zogen sich zurück, wüste Beschimpfungen folgten. Jemand stolperte über seine Beine, dann packten ihn Hände an den Schultern, und er wappnete sich für den kommenden Schmerz. Der nicht kam. Behutsam wurde er auf den Rücken gedreht. Alec blinzelte, wartete, ließ seinen Augen Zeit, aus dem Nebel Konturen zu lösen, verschwommen erst, dann körperlich.
»Na los, Bursche, steh auf, hier bei uns überlebst du nicht lang, wenn du dir nicht selbst helfen kannst.«
Alec bemühte sich, den Schmerz in seinem Kopf zu ignorieren, und versuchte aufzustehen, was ihm erst nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang. Er taumelte, Halt suchend, ein paar Schritte, bevor seine Beine unter ihm wegknickten und er wieder am Boden kniete.
Seine Augen gewöhnten sich allmählich an die Dunkelheit, und er sah sich vorsichtig um. Feuchte, mit grünlichem Schimmel bedeckte Mauern, schmutzig graue Stoffbündel, aufgereiht an den Wänden, zerrissen, mit herausquellendem Stroh. Am entsetzlichsten erschien ihm jedoch der Anblick der Männer, die um ihn herumstanden und auf ihn herabsahen, mit bärtigen Gesichtern, in zerlumpter Kleidung und mit tief in ihre Höhlen eingesunkenen Augen.
»Wo bin ich hier?«, fragte er mit einer Stimme, die ihm selbst fremd war.
Erst kurzes ungläubiges Schweigen, dann Gelächter, in das schließlich alle Umstehenden einstimmten. »Wo du hier bist? Dies ist der Vorhof zur Hölle«, rief einer.
»Vorhof?«, schrie eine heisere Stimme. »Das hier ist die Hölle.«
Ein älterer Mann hockte sich vor Alec, das Gesicht unter dem Bart kaum erkennbar.
»Der Vorhof zur Hölle«, setzte der Mann an, »liegt in einem Rattenloch von Kalkutta. Warst du bei der Verurteilung betrunken, oder bist du nicht ganz richtig im Kopf?« Johlendes Gelächter folgte.
Verurteilung? Ein Schlag, daran erinnerte Alec sich, und dann Dunkelheit. Sein Verstand arbeitete sich durch die letzten Reste des Nebels in seinem noch immer schmerzenden Kopf, um die Bedeutung des Gesagten zu erfassen. Verurteilung? Ein Irrtum, sagte er sich schließlich, eine Verwechslung, die er aufklären würde. Sein Blick glitt erneut über die Mauern und blieb an einer massiven Holztür hängen. Er erhob sich, versuchte ein paar Schritte und schleppte sich zu ihr. Mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, schlug er mit der Faust dagegen und blieb dann an die Wand gelehnt stehen.
Die Männer betrachteten ihn neugierig. »Hey, Bursche! Was treibst du denn da? Glaubst du, wenn du klopfst, wird geöffnet und du spazierst hier so einfach raus?«
»Der alte Wiggins hat’s bestimmt nicht mal gehört.«
»Ich muss mit jemandem sprechen«, sagte Alec. »Das alles ist ein Missverständnis. Ich gehöre hier nicht her.«
»Er gehört hier nicht her«, rief ein Mann und lachte. »Bursche, wir gehören hier alle nicht her, oder denkst du, wir sitzen aus reinem Vergnügen hier?«
Alec ließ sich davon nicht beirren. Erneut schlug er mit der Faust gegen die Tür. »Aufmachen!«, rief er mit rauer Stimme. »Aufmachen, sage ich!« Wieder musste er sich an die Wand lehnen, um nicht zu fallen. Der betäubende Schmerz in seinem Kopf hatte sich verstärkt, und ein Schwindel erfasste ihn. Als sich jedoch hinter der Tür immer noch nichts tat, wurde er ungeduldig. Er versuchte, seine Benommenheit abzuschütteln, und wartete kurz, bis er das Gefühl hatte, wieder sicherer auf den Beinen zu stehen.
»Macht die Tür auf! Aufmachen!« Seine Faust schlug noch ein paar Mal gegen die Tür, dann hörte er endlich, wie sich jemand näherte, ein Schlüsselbund rasselte und die Tür quietschend, begleitet von Flüchen, geöffnet wurde. Ein dicker, unrasierter Mann, der fast genauso abstoßend roch wie die Gefangenen, stand vor Alec und funkelte ihn an.
»Was machst du denn für ’nen Lärm? Auch als Neuer haste dich an die Regeln zu halten. Essen gibt’s morgen früh, und sonst haste nichts zu verlangen, verstanden?«
Er war im Begriff, die Tür wieder zu schließen, doch Alec stemmte sich dazwischen. Der Mann holte mit seinem Knüppel aus und schlug ihn hart vor die Schulter.
»Pass bloß auf, du, für Aufmüpfigkeit gibt’s Strafverlängerung.«
Alec ignorierte mühsam den Schmerz in seiner Schulter. »Mr .... Sir. Das alles ist ein Irrtum. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten.«
»Irrtum? Das sagen sie alle. Es gefällt keinem in der Obhut vom alten Wiggins. Was soll das denn heißen: ›Ich bin nicht der, für den Sie mich halten‹? Du bist doch Alec Delany?«
»Ja, aber ...«
»Verurteilt wegen Diebstahl.«
»Nein, es muss eine Verwechslung vorliegen, vielleicht jemand, der denselben Namen trägt wie ich ... Ich bin niedergeschlagen worden und dann hier wieder aufgewacht. Ich ...«
»Willst du dich über mich lustig machen mit so ’ner schwachsinnigen Geschichte? Lord Ashington ist ’n hoher Herr und ’n angesehener Richter. Wenn er mir was bescheinigt, ist mir egal, was so’n Lumpenpack, wie du’s bist, sagt, Bursche. Und für deine Frechheit gibt’s Strafverlängerung. Wirst schon noch lernen, wer hier das Sagen hat!«
»Ich wollte nicht unverschämt sein, ich ...«
»Zurück jetzt!« Wiggins versetzte Alec einen Stoß, so dass dieser zurücktaumelte, und schlug die Tür zu. Der Schlüssel knirschte im Schloss.
Fassungslos starrte Alec auf die verschlossene Tür, dann drehte er sich langsam zu den Männern um, ratlos, Hilfe suchend.
»Hier kommst du nicht raus. Find dich besser damit ab! Das hier ist in den nächsten Jahren dein Zuhause«, sagte der ältere Mann, der Alec zuvor auf die Beine geholfen hatte.
»Das war dumm. Diese Schreierei. So was mag Wiggins nicht. Gibt mindestens zwei Jahre extra!«, ertönte eine weitere Stimme.
Jahre! Und niemand, der ihm zuhören wollte. In Alecs Augen flackerte allmählich Panik auf. Er setzte sich auf den kalten Steinboden und vergrub sein Gesicht in den Händen. Jemand kam näher und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Alec drehte den Kopf, als sich der Mann, der ihm zuvor geholfen hatte, neben ihm niederließ.
»Ich bin Thomas. Einfach nur Thomas. Einen Familiennamen hab ich nicht mehr. Würd’ meinen Leuten nur Schande machen, einer wie ich. Daran«, er machte eine ausschweifende Handbewegung, »gewöhnst du dich mit der Zeit.«
Einer der Männer kam in diesem Moment mit lüsternem Grinsen auf Alec zu, beugte sich zu ihm hinunter, griff nach seinem Kinn und hob sein Gesicht zu sich hoch. »Ein hübscher Junge bist du. Wird dir hier nicht langweilig werden.« Die anderen lachten, und Alec schlug angewidert die Hand des Mannes weg. Der Mann griff erneut nach ihm und bekam sein Hemd zu fassen. »Wirst schon noch gefügig werden, Kleiner.« Mit der anderen Hand versuchte er, Alecs Gesicht zu fassen zu bekommen, aber der alte Thomas schaltete sich ein: »Lass ihn in Ruh’! Ist doch noch ganz durcheinander, der arme Kerl.«
Der Mann zögerte kurz, zog dann aber, auf Thomas’ drohenden Blick hin, fluchend seine Hand zurück, drehte sich um und ließ sich, vor sich hin schimpfend, in einer anderen Ecke des Raumes nieder.
»Bei denen musste aufpassen«, sagte Thomas zu Alec. »Bist der Jüngste hier, und viele von denen haben seit Jahren keine Frau mehr gesehen ... Verstehst du?«
Alec erwiderte nichts, aber seine Augen weiteten sich vor Entsetzen.
Thomas zuckte die Schultern. »Mach nur nicht den Fehler, so zu kuschen wie der arme Johnny da. Der verkriecht sich die ganze Zeit in einer Ecke, weil er Angst hat vor dem, was sie mit ihm machen, wenn sie sich an ihn erinnern.«
Mit diesen Worten ließ Thomas ihn allein. Alec sah ihm nach und hätte ihn am liebsten zurückgerufen.
Während der folgenden Stunden sah er, wie die Männer auf einen der Mitgefangenen losgingen, einen schmächtigen Burschen, der sich unauffällig in die Ecke geduckt hatte. Er wandte das Gesicht ab, aber die gequälten Schmerzensschreie konnte er nicht ausblenden, auch nicht, als er sich die Fäuste auf die Ohren presste und die Stirn auf seine angezogenen Knie legte. In den siebzehn Jahren seines Lebens hatte er nie zuvor solche Angst gehabt. Er betete inständig darum, man möge ihn in Ruhe lassen.
Angestrengt behielt er von nun an die Männer im Auge und studierte den Raum. Dicke, blasse Maden bewegten sich träge im Stroh. Die Hitze staute sich, und die feuchte Luft mischte sich mit dem Gestank von Fäulnis und Exkrementen, so dass Alec beim Atmen das Gefühl bekam, ersticken zu müssen. Nur einmal schien ein schwacher Pfeffergeruch in der Luft zu hängen, gerade stark genug, um wahrgenommen zu werden. Es war, als ginge in diesem Moment ein Gewürzhändler am Fenster vorbei.
Durch ein kleines Fenster fiel ein Lichtstrahl, in dem Staubflocken tanzten. So gering dieses Licht war – es schenkte dem Raum kaum eine Andeutung von Helligkeit –, schöpfte Alec daraus dennoch zumindest ein kleines bisschen Zuversicht. Während sich sein Blick an dem schmalen Lichtstrahl festhielt, blitzte für einen Moment die Erinnerung an den Paria-Jungen auf, dem er Geld gegeben hatte, und an die verschleierte Frau, die seinen Weg unmittelbar danach gekreuzt hatte. Ob es Tage oder nur wenige Stunden her war, konnte er nicht sagen. Er war in eine schmale Gasse eingebogen, wohin ihn sein Botengang führte. Ein Sikh ging wenige Meter vor ihm, machte einen Moment lang den Eindruck, als hätte er sich verirrt und war dann in einem Hauseingang verschwunden. Alecs Amüsiertheit über diese Szene war das Letzte, woran er sich erinnern konnte.
Die Stunden vergingen. Das Licht, das durch das kleine Fenster sickerte, schwand allmählich und machte einer tiefen Dunkelheit Platz. Die Männer suchten sich einer nach dem anderen einen Strohsack, sie wurden ruhiger, und man hörte sie atmen, schnarchen und husten. Irgendwer schluchzte leise. Das Rascheln von Stroh war zu hören, und immer wieder glaubte Alec, der angestrengt in das Dunkel hineinlauschte, das Trippeln und Quieken der Ratten zu hören. Er kämpfte mit der Müdigkeit, zwang sich, wach zu bleiben. Er durfte hier keinesfalls einschlafen. Irgendwann würde sein Vater sich Sorgen machen und anfangen, nach ihm zu suchen, dann klärte sich diese unselige Geschichte schon auf.
»Junge, bist du noch wach?«, unterbrach Thomas’ Stimme direkt neben ihm Alecs Gedanken. Erschrocken registrierte Alec, dass er nicht gehört hatte, wie dieser näher gekommen war. Jetzt setzte Thomas sich ihm gegenüber auf den Boden.
»Ich muss hier raus«, sagte Alec.
»Sprich leiser«, mahnte Thomas, »sonst weckst du sie noch auf.«
»Es stimmt nicht, dass ich verurteilt wurde«, fuhr Alec flüsternd fort. »Ich weiß nicht einmal, wer dieser Lord Ashington ist. Und abgesehen davon habe ich noch nie etwas gestohlen.«
»Lord Ashington ist ein großer Herr ... und ’n gnadenloser Richter. Bist nicht der Erste hier, der die Ehre hatte. Wenn er dich ins Gefängnis schickt, kannste nichts dagegen tun.«
»Aber ich habe nicht ...«
»Jetzt hör mir gut zu, Junge. Du bist nun mal hier, und hier kommst du so schnell nicht weg, nicht, wenn die da oben es so wollen.«
Alec spürte, dass Wut in ihm hochstieg. »Niemand, hörst du, niemand wird mich an diesem entsetzlichen Ort festhalten, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe!«
»Sprich leise, habe ich gesagt. Wer sollte dir denn helfen? Bei uns ist nur der alte Wiggins, und der wird dir nicht zuhören.« Thomas’ Stimme wurde noch eindringlicher. »Versuch, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen! Einen Tag lang kannste dich so aufführen, aber lass die anderen nicht immer spüren, dass du dich für etwas Besseres hältst. Das ist gefährlich. Und ich kann nicht immer auf deiner Seite sein. Jeder muss hier an sich denken.«
»Ich halte es in diesem Loch keinen weiteren Tag aus.«
»Bei Diebstahl kommst du ja wieder raus, vor allem, wenn’s der erste war. Du musst nur eins tun: lange genug überleben.«
»Ich muss gar nichts. Es wird sich alles aufklären. Spätestens morgen wird mein Vater da sein, und dann komme ich raus.« Alecs Stimme war voller trotziger Zuversicht.
»Anscheinend willste mich nicht verstehen. Dass du unschuldig bist, glaubt dir niemand, nicht hier drinnen und nicht da draußen. Es interessiert auch keinen. Überleben, nur darauf kommt’s an. Mach nicht auf dich aufmerksam, dann kannst du in ein paar Jahren draußen ein neues Leben beginnen.« Thomas gähnte laut und stand auf. »Nimm dir einen von den Strohsäcken. Und schlaf mit dem Rücken zur Wand. Männer wie Mike nutzen’s aus, wenn man schläft«, sagte er noch, dann hörte Alec, wie er auf die andere Seite des Raumes ging.
Alec starrte eine Weile in die Dunkelheit, in die Richtung, in die Thomas gegangen war. Er machte aber keine Anstalten, dessen Rat zu folgen und sich hinzulegen, sondern blieb sitzen und starrte vor sich hin. Er spürte, wie allmählich Verzweiflung in ihm aufstieg. Und wenn Thomas nun Recht hatte und er hier wirklich nicht herauskam? Dieser Gedanke war so grauenerregend, dass er ihn nicht zu Ende denken wollte. Nein, er würde nicht irgendwann ein dahinvegetierendes, stinkendes Wrack sein wie die anderen Männer. Das Ganze war so absurd, es musste sich irgendwann einfach aufklären, wenn auch dieser entsetzliche Wiggins fest davon überzeugt schien, dass ein Irrtum ausgeschlossen war.
Ashington. Alec hatte diesen Namen noch nie zuvor gehört. Sein Vater war Händler, vielleicht hatte er mal Kontakt zu Lord Ashington gehabt, aber das war ja keine Erklärung oder Begründung dafür, ihn, Alec, ins Gefängnis zu stecken. Noch dazu ohne Prozess, obwohl angeblich einer stattgefunden haben sollte.
Schließlich wurde Alec doch von Müdigkeit übermannt. Er tastete sich an der Wand entlang, bis er warmes, etwas öliges Stroh unter seinen Händen spürte. Er dachte lieber nicht daran, wer schon alles vor ihm darauf gelegen hatte. Zusammen mit der Feuchtigkeit staute sich eine unsägliche Hitze in dem Raum, der Gestank war beinahe unerträglich. Mit äußerster Konzentration unterdrückte Alec einen plötzlich aufsteigenden Brechreiz. Er biss die Zähne zusammen und atmete durch den Mund, um nichts riechen zu müssen. Morgen, dachte er, morgen wird sich alles aufklären. Vater wird sich um alles kümmern.
TEIL I1875
1
London
Helena!« Eilige Schritte waren auf der Treppe zu hören, bevor die Stimme noch einmal ertönte. »Helena! Bist du fertig?«
Soll sie doch kommen und nachschauen, dachte Helena, während sie ihre Perlenkette, ein Geschenk ihres ältesten Bruders Jerome, umlegte. Sie war ohnehin verärgert, weil ihre Mutter angeordnet hatte, ihre Zofe Amelia solle sich zuerst um ihre Cousine kümmern. Dabei war es ihr Geburtstag, und sie musste eigentlich zuerst fertig sein. Jetzt flatterte Amelia um Helena herum und beeilte sich, ihre Frisur festzustecken.
»Sei etwas gastfreundlicher!«, hatte Eleonore Ashington ihre Tochter gemahnt. »Celias Zofe ist krank, und du weißt, wie schnell sie nervös wird, wenn sie das Gefühl hat, nicht pünktlich fertig zu werden.«
»Helena! Deine Mutter hat schon zwei Mal nach dir gefragt.« Die Schritte näherten sich der Zimmertür, und ein energisches Klopfen ertönte.
Diese lästige Person, dachte Helena und bemühte sich auch nicht um einen freundlichen Ton, als sie ihre Cousine hereinbat.
»Du lieber Himmel, bist du etwa immer noch nicht fertig? Deine Mutter erwartet jeden Moment die ersten Gäste.« Celia konnte etwas Schadenfreude darüber, vor Helena ihre Toilette beendet zu haben, nicht verbergen.
Hättest du dir nicht so viel Zeit gelassen, wäre ich seit einer Stunde fertig, dachte Helena, sprach es aber nicht aus, sondern lächelte ihre Cousine stattdessen zuckersüß an. »Aber meine liebe Celia, du weißt doch, dass meine Zofe zu spät erschienen ist. Ich nehme dir natürlich nicht übel, sie so lange beansprucht zu haben, immerhin dauert es ja umso länger, je mehr Umfang einzukleiden ist.«
Celia schoss das Blut ins Gesicht, und sie öffnete den Mund zu einer Entgegnung, blieb aber, da ihr keine beleidigende Erwiderung einfiel, stumm und blickte demonstrativ zur Seite.
Amelia steckte die letzten Nadeln fest. Helena stand auf und drehte sich einmal vor dem Spiegel, zufrieden mit dem Bild, das sich ihr bot. Ihre Mutter war mit diesem Kleid nicht einverstanden gewesen, es schien ihr zu unauffällig, dabei war es zwar schlicht, aber gleichzeitig sehr elegant.
»Sie sehen wundervoll aus, Lady Helena«, sagte Amelia hingerissen.
Das Kleid war aus cremeweißer Seide und kontrastierte mit dem dunklen Haar, das den Schimmer von Honig hatte, und den goldgesprenkelten Augen.
Celia blickte die schlanke Gestalt ihrer Cousine voller Neid an.
»Helena«, ertönte die Stimme von Lady Ashington aus dem Korridor. Sie brauchte ihre Stimme nie zu erheben, um gehört zu werden. Helena wandte sich direkt zur Tür. Ihre Mutter betrat das Zimmer, gekleidet in ein Kleid aus grünem Brokat, das glänzende dunkle Haar kunstvoll hochgesteckt. Sie gab Amelia durch ein Kopfnicken zu verstehen, dass sie entlassen sei.
»Celia, meine Liebe, lass mich bitte einen Moment mit Helena allein«, wandte sie sich an ihre Nichte.
Nachdem Lady Ashington sicher sein konnte, dass sich Celias Schritte über den Korridor entfernten, sah sie ihre Tochter aus ihren dunklen Augen prüfend an. »Das Kleid war eine sehr glückliche Entscheidung von dir. Im Nachhinein muss ich sagen, es gefällt mir wesentlich besser als das blaue.«
»Danke Mama.« Mit angehaltenem Atem ließ Helena die Musterung ihrer Mutter über sich ergehen.
»Es werden viele bedeutende Gäste anwesend sein, also hoffe ich, du wirst dich mit deinen Reden etwas zurückhalten. Lass mich bitte ausreden«, fuhr sie fort, als sie bemerkte, dass Helena den Mund zu einer Erwiderung öffnete. »Jeden Moment können die ersten Gäste kommen, und ich werde meine Zeit nicht mit fruchtlosen Diskussionen verschwenden. Verhalte dich angemessen, so wie wir und die Gesellschaft es von einer Dame erwarten! Ich warte unten auf dich.«
»Warum kommst du so spät?«, fragte Eleonore Ashington missbilligend, als Helena beinahe zehn Minuten später zu ihr trat. Das Eintreffen der ersten Gäste enthob Helena einer Antwort. Sie stand neben ihren Eltern am Eingang zum Saal und begrüßte Mr. und Mrs. Cordes, die etwas verstimmt darüber schienen, die Ersten zu sein. Wer sollte da ihren Auftritt bemerken? Edward, der einzige Sohn der Cordes, wurde auf Helenas Lächeln hin rot, dann lächelte er zurück, wobei er seine schiefen Zähne zeigte. Erst ein diskreter Wink seiner Mutter erinnerte ihn daran, dass er Lord und Lady Ashington noch nicht begrüßt hatte. Er wandte sich mit einem Ruck Helenas Eltern zu, grüßte verlegen und stolperte daraufhin hastig in den Saal. »Tölpel!«, murmelte Lord Arthur Ashington fast unhörbar durch die Zähne.
Ein nicht enden wollender Strom von Leuten flanierte an ihnen vorbei. Helena glaubte, ihr Lächeln müsse aussehen wie eingefroren, während sie fortwährend die ankommenden Gäste begrüßte und banale Höflichkeiten austauschte. Sie ließ die Musterungen über sich ergehen, ignorierte die bewundernden Blicke der jüngeren Herren und bemühte sich, auch zu Leuten, die sie nicht mochte, freundlich zu sein. Als sie verstohlen in den Saal blickte, fing sie einen Blick ihres Bruders Jerome auf, der ihr zuzwinkerte und dann eine Grimasse schnitt.
Im nächsten Moment trafen Lord William Vanderley und sein Sohn Matthew ein. Lord Vanderley, der Viscount von Claremont, war einer der engsten Freunde von Helenas Vater; eine Zeit lang hatten die beiden Familien als Nachbarn in Kalkutta gelebt. Lady Vanderley war in Bombay gestorben, und Lord Vanderley hatte Indien nach dem Tod seiner Frau verlassen. Lord Ashington dagegen war noch drei weitere Jahre in Kalkutta als Richter tätig gewesen, bevor er mit seiner Familie ebenfalls nach England zurückkehrte, wo er sein Richteramt niederlegte, seinen Platz im Oberhaus einnahm und sich um seine Landgüter kümmerte.
Matthew Vanderley war vierundzwanzig Jahre alt, der einzige Sohn von Lord Vanderley und somit auch der einzige Erbe. Ungemein gut aussehend mit seinem vollen hellbraunen Haar, dem ebenmäßigen Gesicht und den graublauen Augen, deren Spott vernichtend sein konnte, war er arrogant, skrupellos, und ihm wurden Affären mit Frauen aller Gesellschaftsschichten angedichtet. Er äußerte sich allerdings nie dazu, sondern tat derartige Gerüchte mit einem Lächeln ab, das alles bedeuten konnte. Matthew lebte seit zwei Jahren wieder in London, hatte die Stadt in einem Atemzug zurückerobert, ließ keine Feier aus und versetzte die jungen, unverheirateten Mädchen in die wildesten Schwärmereien. Großzügig ließ er jede in den Genuss seines Charmes kommen, unterhielt sie, schenkte ihr sein träges, sinnliches Lächeln und amüsierte sich später in beißendem Spott über sie.
Lord Vanderley begrüßte Helena freundlich und ging dann weiter zu ihren Eltern. Matthew blieb vor ihr stehen und ließ seine Blicke über sie gleiten, wobei er jede Einzelheit aufzunehmen schien. Sie hatte ihn noch nie besonders gut leiden können, aber in Momenten wie diesen erwachte in ihr der unbändige Wunsch, ihm ins Gesicht zu schlagen.
»Meine liebe Helena, darf ich hoffen, dass Sie mir Ihren ersten Tanz schenken werden?«, fragte er höflich, und allein Helena sah das begehrliche Aufblitzen in seinen Augen.
»Es tut mir leid, Matthew, aber den ersten Tanz habe ich bereits Jerome versprochen.« Helena bemühte sich, Bedauern in ihre Stimme zu legen. Es war in ihrer Familie für unverheiratete Mädchen üblich, den Ball mit dem Bruder, dem Vater oder einem anderen Familienmitglied zu eröffnen. Matthew wusste das, seine Frage war also überflüssig und aufdringlich. »Du darfst sicher den zweiten Tanz mit ihr tanzen«, mischte sich Lord Ashington ein und warf seiner Tochter einen vielsagenden Blick zu. Helena unterdrückte einen ergebenen Seufzer und strahlte Matthew gezwungen an.
Als die letzten Gäste eingetroffen waren, begab Helena sich mit ihren Eltern in den Saal. Die Flügeltüren der Veranda standen weit offen und gaben den Blick auf den Garten frei, der mit Lampions festlich geschmückt war.
Lady Ashington neigte den Kopf zu ihrer Tochter und sagte: »Du hättest Matthew ruhig den ersten Tanz schenken können. Er gehört schließlich fast zur Familie. Niemand hätte Anstoß genommen, weil jeder weiß, wie eng dein Vater und Lord Vanderley befreundet sind.« Dass Matthew die Liste der in Frage kommenden Heiratskandidaten anführte, hing unausgesprochen in der Luft.
Der Raum war aufs Prachtvollste geschmückt. Die Kronleuchter waren auf Hochglanz poliert, und große Sträuße frischer Blumen verbreiteten einen betörenden Duft. Spiegel verstärkten in dem ohnehin schon großen Tanzsaal das Gefühl von Weitläufigkeit und vervielfältigten den funkelnden Glanz der Brillanten, die die prachtvoll gekleideten weiblichen Gäste zierten. Kristallleuchter an den Wänden erhellten jede Nische des riesigen Saals. Ihre Eltern hatten wirklich keine Kosten gescheut.
Suchend sah sich Helena im Saal um und entdeckte ihre Brüder in der Nähe der Veranda. Ihr ältester Bruder, der fünfundzwanzigjährige Jerome, achter Viscount Ellingwood, unterhielt sich mit einem älteren Herrn, den sie nur flüchtig kannte. Die um zwei Jahre jüngeren Zwillinge George und Calvin standen etwas weiter von ihm entfernt, und Helena glaubte, selbst aus der Entfernung die knisternde Spannung spüren zu können, die stets zwischen ihnen herrschte. Wahrscheinlich brachte allein die Anwesenheit der Gäste sie dazu, wenigstens den Anschein höflichen geschwisterlichen Umgangs aufrechtzuerhalten. Sie waren sich so unähnlich, wie Zwillinge nur sein konnten. Zwar waren beide schlank und hoch gewachsen, doch darin erschöpfte sich die Ähnlichkeit auch schon. Calvin kam mit seinem hellbraunen Haar und den blauen Augen eindeutig nach seinem Vater, während George blond war und grüne Augen hatte. Ihr Cousin Simon, mit dem hellbraunen Haar und den grünblauen Augen unverkennbar ein Ashington, stand neben Calvin, die beiden waren in ein lebhaftes Gespräch vertieft. Simon war der Sohn des einzigen Bruders von Helenas Vater und der beste Freund von Calvin.
Jerome blickte während des Gesprächs auf und sah seine Schwester auf sich zukommen. Höflich verabschiedete er sich von seinem Gesprächspartner und kam ihr entgegen.
»Nun, Schwesterherz, gefällt dir der Aufmarsch gut situierter Familien mit heiratswilligen Söhnen?«
»Hör auf, Jerome! Du bist manchmal wirklich unausstehlich.« Jerome lachte und nahm ihren Arm, um sie auf die Veranda zu führen. Die Abendluft war samtweich und lud eigentlich dazu ein, spazieren zu gehen. Aber jeden Moment würde der erste Tanz beginnen.
»Warum eröffnest du den Ball nicht mit Vater?«, fragte Jerome.
»Er hat es mir nicht angeboten«, erwiderte Helena und bemühte sich um einen unbeteiligten Gesichtsausdruck. Sie atmete die Abendluft mit ihrem Duft nach Blumen in tiefen Zügen ein. Jerome sah seine Schwester forschend an.
»Das liegt wohl daran, dass er ungern tanzt«, erwiderte er.
»Oder daran, dass er erleichtert ist, es dir als meinem ältesten Bruder überlassen zu können, die gesellschaftlichen Pflichten mir gegenüber zu übernehmen. Zumal du sie auch noch gerne wahrnimmst.«
Jerome antwortete darauf nicht. Es war bezeichnend für ihre Beziehung zueinander, sich auch ohne Worte zu verstehen. Von allen Geschwistern ähnelten sie sich am meisten, sowohl im Wesen als auch im Aussehen. Nur Jeromes Augen waren nicht wie Helenas, er hatte die sensiblen Augen seiner Mutter. Jerome bemühte sich immer darum, Konflikte zwischen Helena und ihrem Vater zu verhindern, er wusste, dass Lord Ashington seine Tochter an einem wesentlich höheren Maßstab maß als seine Söhne und dass es Helena unmöglich war, diesen Anforderungen gerecht zu werden.
In dieser Hinsicht unterschied sich Jerome von seinen Brüdern. Zwar pflegte George zu seiner Schwester ein freundschaftliches Verhältnis, dieses blieb jedoch oberflächlich. Calvin hingegen tat noch nicht einmal das. Er gab sich distanziert und ließ sich mit Helena kaum einmal auf ein näheres Gespräch ein.
»Wem hast du deine weiteren Tänze versprochen?«, fragte Jerome, um das Thema zu wechseln.
Helena schnitt eine Grimasse. »Den zweiten Tanz mit Matthew hat Vater mir aufgenötigt. Du weißt ja, was für große Stücke er auf ihn hält.«
»Völlig zu Unrecht, aber was dieses Thema betrifft, hat Vater noch nie mit sich reden lassen. Er denkt wahrscheinlich, er sei es William schuldig, dabei ist Matthew ein ganz anderes Kaliber als sein Vater. Meiner Meinung nach sollte man bei ihm vorsichtig sein.«
»Es ist mir im Grunde genommen auch vollkommen egal, solange ich ihm gegenüber nur meine Pflichten als Gastgeberin erfüllen muss.« Helena fuhr mit den Fingern über das schmiedeeiserne Gitter, das die Veranda abgrenzte. Ein leichter Wind kam auf, wehte ihr eine Haarsträhne ins Gesicht, die sie gedankenverloren zur Seite strich.
»Wir sollten wieder in den Saal zurückgehen«, sagte Jerome. »Wenn du schon nicht das Verlangen hast, mit deinen Gästen zu sprechen, haben sie trotzdem das Recht, die Gastgeberin mal zu Gesicht zu bekommen. Außerdem wird es Zeit, den Tanz zu eröffnen.« Er bot ihr seinen Arm und führte sie in den Saal zurück.
Am späten Abend war das Fest immer noch im vollen Gang. Die Leute tanzten und schienen sich bestens zu amüsieren. Helena stand mit vom Tanzen erhitzten Wangen in einer Nische und fächelte sich Luft zu. Sie sah die hohe schlanke Gestalt ihres Vaters im Türbogen zum zweiten Saal stehen, wo die Erfrischungen angeboten wurden. Seine ruhige, kultivierte Art wirkte Respekt einflößend. Sein Haar war immer noch voll und von grauen Strähnen durchzogen, was sein Aussehen noch markanter machte. Er unterhielt sich angeregt mit einem Geschäftspartner aus Frankreich. Seinem Gesichtsausdruck zufolge schien er eine neue Idee zu verfolgen, von der er sein Gegenüber zu überzeugen suchte. Helena hatte sich immer gewünscht, in wirtschaftliche Fragen eingearbeitet zu werden, aber jegliche Vorschläge in dieser Richtung wurden von ihren Eltern als Überspanntheit abgetan. Frauen, so ihr Vater, hatten ihre Fähigkeiten im häuslichen Bereich zu entfalten.
»Ich bedaure denjenigen, dem Ihr Unmut gilt«, ertönte plötzlich eine Männerstimme hinter ihr. Sie fuhr herum.
»Matthew! Haben Sie mich erschreckt.« Wie gelang es ihm bloß immer wieder, sie ausfindig zu machen?
Matthew lächelte unbekümmert. »Wer ein gutes Gewissen hat, sollte eigentlich nicht so schreckhaft sein.«
Helena wurde rot. »Und wer gute Absichten hat, schleicht sich eigentlich nicht von hinten an wie ein Dieb.«
Matthew gab keine Antwort, sondern hob eine Augenbraue.
»Habe ich Sie verärgert?«, fragte Helena.
»Nein, amüsiert.«
»Wie bedauerlich.« Helena wandte sich von ihm ab, um ihm zu signalisieren, dass seine Anwesenheit unerwünscht war, aber entweder merkte er es nicht oder es war ihm egal.
»Möchten Sie mir nicht die Ehre geben, mich in den Garten zu begleiten?«, fragte er. Sie hatte bereits eine abschlägige Antwort auf der Zunge, aber da er sich ohnehin nicht zurückweisen lassen würde, nahm sie resigniert seinen Arm. Im Vorbeigehen erhaschte sie einen Blick auf das neiderfüllte Gesicht ihrer Cousine Celia. Sie wusste, diese hätte alles darum gegeben, jetzt an ihrer Stelle zu sein. Celias Verliebtheit in Matthew war allgemein bekannt. Sollte sie sich nicht etwas mehr Zurückhaltung auferlegen, würde sie sich endgültig zum Narren machen. Die Gesellschaft war in dieser Hinsicht gnadenlos.
Gegen einen Spaziergang im Garten war eigentlich nichts einzuwenden, schließlich war er extra zu diesem Zweck mit zahllosen Lampions ausgestattet worden. Doch trotz dieser hellen Beleuchtung ging Helena ungern mit Matthew über die stillen Gartenwege. Schweigend flanierten sie an dem Springbrunnen vorbei, dessen Wasserfontänen das Licht auffingen, um es in perlende Diamanten zu verwandeln. Matthew führte sie von dem Weg hinunter auf eine Rasenfläche, wo ein von Efeu überwachsener Pavillon stand. Helena war sich sicher, dass er ihr ansah, wie unbehaglich sie sich fühlte, und es in vollen Zügen auskostete.
»Setzen Sie sich doch, meine Liebe.« Matthew setzte sein charmantestes Lächeln auf und wies auf die Bank in der Laube, aber Helena blieb stehen und spielte mit einer Efeuranke. Matthew nahm ihre unveränderte Haltung mit einem leichten Heben der Augenbrauen zur Kenntnis.
»Unsere Väter denken daran, in die Pferdezucht zu investieren«, bemerkte er beiläufig. Für Helena kam diese Eröffnung vollkommen unerwartet, und sie verspürte einen Stich, weil jemand außerhalb ihrer Familie eher in die Pläne ihres Vaters eingeweiht war als sie.
»Tatsächlich?«, entgegnete sie. »Davon habe ich noch nichts gehört. Ich nehme an, mein Vater denkt da an Rennpferde, ist das richtig?«
»Allerdings. Woher wussten Sie das?«
»Nun, es erscheint mir einfach am lukrativsten. Vorausgesetzt natürlich, man versteht etwas davon und zieht Pferde mit guten Anlagen.«
Matthew schien ihr gegen seinen Willen Anerkennung zu zollen. »Unsere Väter wären dann Geschäftspartner, das heißt, wir würden uns sehr oft sehen«, fuhr er fort und sah sie abwartend an.
Helena beschloss, ihm nicht den Gefallen zu tun, aufzubrausen. Schließlich sahen sie sich ja jetzt schon mehr, als ihr lieb war.
»Ich würde Sie gerne öfter sehen«, bekräftigte Matthew und stützte sich mit einer Hand seitlich am Pavillon ab.
Aha, dachte Helena, schon sind wir beim Kern der Angelegenheit angelangt. »Es tut mir leid, dass meine Wünsche so gar nicht den Ihren entsprechen«, entgegnete sie gezwungen höflich.
Matthew zog die Augenbrauen hoch und gab keine Antwort, als wäre er sich bewusst, dass sein Schweigen ihr weit unbehaglicher war als alles, was er hätte antworten können.
»Matthew, wenn Sie sich weiterhin mit mir unterhalten möchten«, fügte sie schließlich mit einem gezwungenen Lächeln hinzu, »schlage ich einen Themenwechsel vor. Ansonsten muss ich Ihnen zu meinem Bedauern sagen, dass ich an Ihrer weiteren Gesellschaft kein Interesse mehr habe.«
»So? Wenn mir dieses Thema aber nun besonders gefällt, was dann?« Er steckte eine Hand in die Tasche und sah sie abwartend an.
Helena presste die Lippen zusammen, hob das Kinn und machte Anstalten, an ihm vorbeizugehen.
Matthew versperrte ihr den Weg. »Warum so eilig, liebste Helena. Wir haben doch noch gar nicht richtig begonnen, uns zu unterhalten.«
»Was bis jetzt gesagt wurde, reicht mir. Ich lege keinen Wert auf eine Fortsetzung des Gesprächs. Wenn Sie mich bitte vorbeilassen würden.«
Matthew machte keine Anstalten, ihr den Weg freizugeben. Helena war nun wirklich wütend. Was dachte er sich bloß dabei, sich ihr in dieser Weise aufzudrängen? Sie wich keinen Schritt zurück. »Wir können uns gerne auf dem Weg zurück weiter unterhalten, aber mir ist inzwischen etwas kühl geworden, und ich möchte hier nicht länger stehen.«
»Vielleicht sollten wir näher zusammenrücken, damit Ihnen wieder warm wird«, sagte er mit bedeutsamem Blick in ihre Augen.
Helena spürte, dass ihr die Situation zu entgleiten drohte. Sie begann, langsam, hoch erhobenen Hauptes, an ihm vorbeizugehen, als er nach ihrem Arm griff und sie mit einem Ruck an sich zog. Erschrocken stemmte sie sich mit den Händen gegen seine Brust.
Sein Gesicht näherte sich dem ihren. »Sagen Sie, sind Sie je geküsst worden?«
Helena wurde blutrot, was Matthew zum Lachen reizte. »Ein Kuss, liebe Helena, nichts als ein kleiner Beweis Ihrer Gunst, und Sie lernen im Gegenzug dazu das Leben für wenige Sekunden von einer neuen, aufregenden Seite kennen.«
»Wagen Sie es, und ich schreie das ganze Haus zusammen.«
»Und gönnen den anderen damit ein aufregendes Schauspiel? Sind Sie sicher, dass Sie sich eine solche Aufmerksamkeit wünschen? Was würden die Leute denn zu sehen bekommen? Sie in meiner Umarmung. Haben Sie aus Empörung geschrien oder aus freudiger Überraschung? Was glauben Sie, wie leicht es für mich wäre, die Leute von Letzterem zu überzeugen.«
Seine Stimme wurde samtweich. »Also versuchen Sie diese Spiele nicht mit mir. Ich habe mehr Erfahrung darin als Sie, ich kann dabei gar nicht verlieren.« Sein Gesicht kam näher. »Ein Kuss nur«, flüsterte er, »dann lasse ich Sie gehen, und niemand muss etwas davon erfahren.«
Helena trat gegen sein Schienbein und bemerkte befriedigt, wie er erschrocken zurückfuhr und ihre Hände freigab. Sie wollte eben an ihm vorbeieilen, da fasste er sie wieder am Arm und riss sie so heftig herum, dass sie dachte, er würde ihr die Schulter auskugeln. Wieder zog er sie an sich, hielt sie diesmal aber eisern fest.
Helena bog ihren Kopf zur Seite. »Lassen Sie mich los!«, rief sie mit erstickter Stimme. Er antwortete nicht, sondern drehte mit hartem Griff ihr Gesicht zu sich hin und zwang seine Lippen auf ihre.
»Was geht hier vor?«, rief jemand dicht hinter ihnen. Matthew fuhr zurück und stieß Helena von sich. Sie stolperte außer Atem zurück und rang nach Luft. »Simon!«, rief sie erleichtert, als sie erkannte, wer da plötzlich aufgetaucht war, und lief auf ihren Cousin zu, blieb dann aber abrupt stehen. Direkt hinter ihm stand Calvin und starrte sie fassungslos an, dann verzerrte sich sein Gesicht zu zügelloser Wut. Er trat auf sie zu. »Erkläre mir das«, fuhr er sie an.
»Was gibt es da schon groß zu erklären?«, schaltete sich Matthew ein, der zwar blass geworden war, aber seine gewohnte Kaltblütigkeit zurückgewonnen hatte. »Es tut mir leid, Calvin, wir sind da wohl etwas zu weit gegangen.« Er lächelte entschuldigend.
»Bitte, Calvin«, sagte Helena, »lass uns später ...«
»Nein, erst wird das hier klargestellt. Was treibst du mitten in der Nacht mit ihm im Pavillon?«
Simon ging dazwischen. »Calvin, muss das jetzt und hier ...«
»Allerdings muss es das.« Calvin wandte sich an seine Schwester, packte sie bei den Schultern und schüttelte sie. »Antworte gefälligst.«
»Es ist ihr sicher peinlich«, warf Matthew ein. »Wir sind spazieren gegangen, und der Mondschein lässt einen nun einmal auf romantische Gedanken kommen. Es tut mir wirklich leid, Calvin.«
»Calvin, das kann doch nicht wahr sein. Du wirst ihm doch wohl nicht glauben.« Helena spürte, wie sich eine unbändige Wut in ihr ausbreitete. Er war ihr Bruder. »Ich wollte nicht ... ich dachte, wir gehen nur spazieren. Er ... er hat mich festgehalten ...«
»Es reicht«, rief Calvin außer sich vor Wut, »entweder ich erfahre sofort die Wahrheit, oder Vater wird die weitere Befragung fortsetzen.«
Simon machte eine beschwichtigende Handbewegung, um ihn zum Schweigen zu bringen. Behutsam drehte er Helenas Gesicht zum Licht und sah die gut sichtbaren Abdrücke von Matthews Fingern an ihrem Kinn, dort, wo er sie festgehalten hatte. »Und wie erklärst du das hier?«, wandte er sich fragend an Matthew.
Stirnrunzelnd betrachtete Calvin das Gesicht seiner Schwester und wandte sich dann wieder Matthew zu, seine Augen schmal.
»Du kannst mich schlagen, wenn du willst«, sagte Matthew auf die unausgesprochene Drohung hin, »aber ihr Wort steht gegen meins, und jeder wird sein eigenes Urteil darüber fällen. Ein paar Abdrücke in ihrem Gesicht besagen gar nichts, außer, dass ich vielleicht ein wenig zu leidenschaftlich war.« Er zuckte die Schultern. »Nun, das kann vorkommen, auch wenn die junge Dame mehr als willig ist.«
Calvin sah Helena an, dann wandte er sich an Matthew. »Du bist gut beraten, das nicht noch einmal zu tun, egal wie willig meine Schwester ist.« Er ignorierte Helenas empörten Ausruf. »Das ist das Haus meines Vaters, und als sein Gast bist du ihm den nötigen Respekt schuldig. Dass du niemandem von dieser Sache erzählen wirst, versteht sich sowieso von selbst.«
Matthews Gesicht war nicht zu entnehmen, was er dachte. Bei aller Kaltblütigkeit hatte er wohl doch nicht mit dem Auftauchen von Helenas Bruder und ihrem Cousin gerechnet. Er nickte kurz, zum Zeichen seiner Einwilligung, drehte sich um und ging gemessen, ohne übermäßige Eile zum Haus zurück.
Calvin nahm Helenas Arm und zerrte sie grob den Weg zurück zum Haus. Erfolglos versuchte Helena, sich aus seinem Griff zu befreien.
»Calvin, was soll das? Du tust mir weh. Lass mich doch erklären, was passiert ist!«
»Erklären? Und du denkst, das würde reichen, ja?« Calvin drehte sich zu ihr um, unverhohlenen Zorn in den Augen.
»Ja, genau das denke ich. Ich bin deine Schwester.«
Simon ging dazwischen. »Natürlich glauben wir dir, Helena.«
»Dann tut doch was. Ihr könnt ihn doch nicht so davonkommen lassen«, drängte Helena verzweifelt.
»Es tut mir leid, Helena, aber jegliche Maßnahme gegen Matthew würde nur die Aufmerksamkeit der Leute auf diesen Vorfall lenken«, erklärte Simon ihr nachsichtig.
»Aber er hat mir Unrecht getan und außerdem ...« Sie verstummte, weil sie das Gefühl hatte, alle Gegenargumente seien sowieso sinnlos.
»Das Beste wird sein, du gehst durch den Hintereingang direkt in dein Zimmer«, schlug Simon vor, während sie weitergingen. »Wir werden deinen Eltern sagen, dir sei plötzlich sehr schwindlig geworden. So spät in der Nacht wird niemand an deiner Abwesenheit Anstoß nehmen.«
Leise ging Helena durch die Hintertür in die Eingangshalle, floh die Treppe hinauf in ihr Zimmer und läutete nach Amelia. Während ihre Zofe ihr aus dem Kleid half, gab sie sich ihrem Ärger über Matthew, Calvin und Männer im Allgemeinen hin.
Eine Viertelstunde später kam Jerome in ihr Zimmer. Helena saß vor ihrem Frisiertisch und war gerade dabei, ihr Haar für die Nacht zu flechten. Verlegen mied sie seinen Blick.
Jerome beugte sich zu ihr hinunter. »Simon hat mir alles erzählt.« Er nahm sie bei den Schultern und zwang sie, ihn anzusehen. »Lass dir von niemandem einreden, es sei deine Schuld gewesen. Wärest du nicht so höflich zu Matthew gewesen und mit ihm gegangen, hätte Vater dir Vorhaltungen gemacht. Gegen einen Spaziergang im Garten ist ja normalerweise auch nichts einzuwenden.«
Er stand auf, und nun zeigte sich seine Wut unverhohlen. »Das gibt ihm aber nicht das Recht, dich anzufassen.« Jerome sah seiner Schwester eindringlich in die Augen. »Von nun an wirst du nie wieder mit ihm allein sein.«
Sein Vater war ausgesprochen streng, was Helenas Umgang mit Männern betraf, nur bei Matthew schien er mit Blindheit geschlagen.
Helena spielte mit der Bürste auf ihrem Tisch. »Calvin hat nichts«, sie sah ihren Bruder an, »absolut gar nichts zu Matthew gesagt, und Simon meinte nur, wir sollten die Sache vergessen.« Die Enttäuschung über das Verhalten ihres Bruders und ihres Cousins stand ihr ins Gesicht geschrieben.
Jerome hockte sich vor sie und sah sie an. »Simon hat das wohl nur getan, um einen Skandal zu vermeiden. Nimm es ihm nicht übel. Und Calvin ... du kennst ihn doch.«
Helena nickte nur und blickte ihm nach, als er ihr eine gute Nacht wünschte und das Zimmer verließ.
George stand mit Tobias Sherman – einem alten Freund aus Schultagen – an einem der großen Erkerfenster und beobachtete die Gäste. Sein Blick blieb an Florence Birmingham hängen.
»Seit wann ist Florence wieder in der Stadt?«, wandte er sich an Tobias.
»Ihre Eltern haben sie vor einer Woche von der Schule genommen. Angeblich gab es Ärger mit ihrem Verhalten. Genaueres weiß ich aber auch nicht.«
George erinnerte sich gut an Florence. Bis vor zwei Jahren hatte er sie häufig gesehen, wenn sie Mrs. Birmingham zu Besuchen bei seiner Mutter begleitete. Er wollte sie begrüßen, verabschiedete sich daher kurz bei Tobias und ging auf sie zu. Florence sah ihn, noch bevor er bei ihr war, und strahlte ihn mit freudiger Überraschung an. »George, wie schön, Sie zu sehen.«
»Die Freude ist ganz meinerseits«, antwortete George liebenswürdig. »Ich habe nicht gewusst, dass Sie wieder in der Stadt sind, sonst hätte ich natürlich schon viel früher nach Ihnen Ausschau gehalten«, schloss er mit einem Lächeln.
»Es hat sich alles sehr kurzfristig ergeben, ich habe selber nicht damit gerechnet, so bald wieder in London zu sein.« Sie drehte den Fächer zwischen ihren schlanken Fingern.
»Ich freue mich sehr, Sie wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe natürlich, wir werden Sie nicht so bald wieder an das Pensionat verlieren«, sagte George galant, während er die goldenen Lichtreflexe in ihrem blonden Haar betrachtete. Ihre grauen Augen trübten sich für einen Augenblick, was sie jedoch durch ein Lächeln geschickt zu überspielen wusste.
»Ach«, Florence zögerte beinahe unmerklich, »ich habe meine Familie so sehr vermisst, dass ich wohl nicht mehr dorthin zurückkehren möchte.« Eine leichte Röte überzog ihre Wangen, und sie wich seinem Blick aus.
»Und Ihre Eltern sind einverstanden mit Ihrem Entschluss?«, fragte George verblüfft.
»Ja«, erwiderte Florence kurz. »Mir ist furchtbar heiß«, wechselte sie das Thema und sah zu den geöffneten Fenstern. George, der den Wink verstand, bot ihr seinen Arm und führte sie dorthin.
»Wo ist Helena?«, fragte Florence. »Ich habe sie nur kurz gesehen, und da war sie immer von Freundinnen umringt. Ich konnte kaum drei Worte mit ihr wechseln.«
»Ich habe sie auch bereits eine ganze Weile nicht gesehen. Sie werden ihr aber mit Sicherheit noch häufiger begegnen. In der nächsten Zeit stehen ja einige Feiern an, außerdem besucht Ihre Mutter meine Mutter regelmäßig. Sie werden sie doch sicher ab und zu mal begleiten, nicht wahr?«
»Ja, sicher. Sie wird es sich auch gar nicht nehmen lassen, mich zu all ihren Freundinnen zu schleppen und allen zu verkünden, dass ich wieder da bin.« Sie lachte.
George gab eine höfliche Floskel von sich und sah über ihre Schulter hinweg seine Mutter mit einer Frau sprechen, die er als Mrs. Hawthorne erkannte. Es interessierte ihn im Grunde genommen nicht übermäßig, worüber die beiden redeten, aber der Blick, den seine Mutter in seine Richtung warf und dann schnell wieder abwandte, gefiel ihm nicht.
Florence schien über etwas, das ihr nicht behagte, nachzudenken, denn sie hatte die Stirn leicht gerunzelt und presste ihren Fächer zwischen ihren Fingern. Sie schien seinen Blick zu spüren, der auf ihr ruhte, denn sie blickte zu ihm hoch und lächelte gezwungen. »Entschuldigen Sie, George. Ich bin wohl unhöflich, Sie einfach anzuschweigen.«
»Möchten Sie mit mir auf die Veranda kommen?«, bot George ihr an.
»Gerne, aber wir müssen in der Nähe der Tür bleiben.«
George führte sie auf die Veranda, wobei er sorgsam darauf bedacht war, sich mit ihr nicht zu weit zu entfernen.
Eleonore Ashington wusste, dass Mrs. Hawthorne sie bewunderte, eine Bewunderung, in der ein nicht geringes Maß an Neid mitschwang. Adele Hawthorne hatte immer davon geträumt, in eine adlige Familie einheiraten zu können, aber ihre Eltern verheirateten sie stattdessen mit einem wohlhabenden Geschäftsmann. Nun führte sie zwar ein Leben in Luxus, aber es verbitterte sie oft, keinen Titel führen zu können. Sie hatte sechs Töchter, ihr einziger Sohn war im Alter von zwei Jahren gestorben. Ihr Mann wollte um jeden Preis einen Sohn haben und hatte erst nach mehreren Fehlgeburten und einer Verwarnung vom Arzt, eine erneute Schwangerschaft werde seine Frau womöglich das Leben kosten, eingesehen, dass sein Herzenswunsch nicht zu verwirklichen war. Er hatte daraufhin nach zwanzig Ehejahren jegliches Interesse an seiner Frau verloren, und es hieß, er habe eine Geliebte in einem seiner Londoner Stadthäuser.
Mrs. Hawthorne beugte sich zu Eleonore Ashington hinüber. »Falls du Recht hast und George wirklich Interesse an der kleinen Birmingham hat, dann solltest du es auf jeden Fall unterbinden, ehe es Früchte trägt.«
Eleonore sah sie besorgt an. »Vielleicht ist es nur eine vorübergehende Anwandlung. Sie kennen sich ja schon, seit sie Kinder waren.«
Mrs. Hawthorne schnaubte verächtlich. »Damals war sie ja noch eine akzeptable Partie, aber dann kam ihr Vater auf die hirnverbrannte Idee, sie auf diese Schule zu schicken. Meine Adeline wollte auch auf ein Institut in der Schweiz gehen. ›Nein‹, habe ich ihr gesagt, ›du bleibst hier, wo ich ständig ein Auge auf dich haben und dir beibringen kann, eine Dame zu werden.‹ Man muss aus einer Frau keine Gelehrte machen. Das vertreibt die Männer nur.«
Es war eine Eigenart von Mrs. Hawthorne, ständig vom Thema abzuschweifen und ihre familiären Erlebnisse mit in die Unterhaltung einzubringen, aber sie wusste in der Gesellschaft gut Bescheid und konnte nahezu jedes Gerücht als richtig oder falsch enttarnen. Eleonore schwieg demnach zu ihren Ausführungen und redete erst weiter, als ihre Freundin geendet hatte.
»Mir geht es weniger um die Schule, die sie besucht hat, als vielmehr um das, was man sich erzählt, seitdem sie wieder hier ist.«
»Aber meine Liebe«, Mrs. Hawthorne sah sie nachsichtig an, »das eine ergibt doch das andere. Hätte ihr Vater sie nicht auf diese Schule geschickt, wäre diese unglückselige Sache doch niemals passiert.«
»Es ist immerhin nur ein Gerücht«, beschwichtigte Eleonore. »In Gerüchten steckt immer ein Quäntchen Wahrheit«, entgegnete Mrs. Hawthorne resolut. »Ich an Stelle ihrer Mutter würde sterben vor Scham.«
Eleonore blickte zur Verandatür und sah George mit Florence zusammen hinausgehen. Wahrscheinlich unterhielten sie sich über völlig belanglose Dinge, und George würde das Mädchen am nächsten Morgen schon wieder vergessen haben. Man wusste ja schließlich, wie Männer in diesem Alter waren. »Ich werde abwarten, wie sich die Sache entwickelt, Adele. Solltest du Recht haben, werde ich auf jeden Fall etwas unternehmen.«
Mrs. Hawthorne stieß hörbar die Luft aus. »Ich kann nur hoffen, dass es dann nicht schon zu spät ist. Jeder weiß, wie heißblütig junge Menschen sind.«
»Trotz allem kann ich nicht einfach hingehen und ihm ohne weiteres verbieten, mit ihr zu reden. Ich möchte erst abwarten, ob er nach diesem Fest in Kontakt mit ihr bleibt. Dann ist es immer noch früh genug, etwas zu unternehmen.«
»Nun, meine Liebe, ganz wie du meinst«, erwiderte Mrs. Hawthorne etwas spitz. Sie hatte gesagt, was zu sagen war. Am Ende würde sie sich nicht vorwerfen müssen, unbesonnen gehandelt zu haben. Vielleicht war dieses unerträgliche Überlegenheitsgefühl ja so eine Eigenart adliger Frauen.
2
Rose Ashington hatte ihr Frühstück bereits beendet, als Elaine, die Ehefrau ihres Sohnes Anthony, sich endlich bequemte, im Frühstückszimmer zu erscheinen. Sie hatte ihn immer vor einer Ehe mit der verwöhnten Tochter eines Mannes von zweifelhaftem Ruf gewarnt, aber Kinder wussten ja alles besser als ihre Eltern. Nun hatte man den Ärger in der Familie. Zugegeben, Elaines Vater war sehr reich, aber die Art, wie er an sein Geld gekommen war, war äußerst umstritten. Und auch wenn Elaine mit ihrem rotbraunen Haar und den grünen Augen recht gut aussah, gab es an ihr doch nichts Prägnantes, das sie besonders ausgezeichnet hätte.
»Guten Morgen, Schwiegermama«, grüßte Elaine betont freundlich und nahm am Tisch Platz.
Die alte Frau erwiderte den Morgengruß, konnte aber einen Anflug von Missbilligung nicht verhehlen. Selbst eine Feier, die bis tief in die Nacht dauerte, war kein Grund, am Vormittag vollkommen übernächtigt am Frühstückstisch zu erscheinen. Sie selbst war auch bis zum Schluss dort anwesend gewesen und trotzdem heute Morgen zur gewohnten Zeit aufgestanden.
»Wo ist Celia?«, fragte sie.
Elaine sah auf. »Celia? Ich nehme an, sie lässt sich gerade frisieren, sie wird sicher jeden Moment kommen.«
»Ab morgen wird sie ihren Bruder morgens in den Park zum Ausreiten begleiten. Es wird Zeit, dass sie sich mehr bewegt. Mit ihrer plumpen Art, bar jeder Anmut, wird sie sonst der Fehlschlag dieser Saison.«
»Aber du weißt doch, wie ungern sie mit Simon zusammen ausreitet.« Elaine griff zum Schälchen mit dem Kompott und bestrich eine Scheibe Toast.
»Mit der Zeit wird sie es gern tun. Helena reitet jeden Morgen mit Jerome aus, sie weiß zu reden, und sie bewegt sich anmutig. Sieh dir ihre gesellschaftlichen Erfolge im Vergleich zu denen deiner Tochter an!«
»Sind wir wieder beim leidigen Vergleich zwischen Helena und Celia? Sie sind nun einmal verschieden. Abgesehen davon, weiß Celia im Gegensatz zu Helena, wann sie den Mund zu halten hat, und redet nicht unverblümt drauflos.«
»Worüber sollte sie auch unverblümt reden, wenn sie nichts weiß?« Rose bemerkte die Anstrengung, die es Elaine kostete, ruhig und beherrscht zu bleiben. Sie würde diesen Anschein noch einige Minuten lang aufrecht halten können, dann kam die wahre Elaine zum Vorschein. Mangelnde Erziehung ließ sich nun einmal nicht verleugnen.
»Wie war Helenas plötzliches Verschwinden gestern zu erklären?«, fragte Elaine, zweifellos, um auf ein unverfänglicheres Thema als ihre Tochter zu sprechen zu kommen.
»Es war wohl ein plötzliches Unwohlsein.«
»Du meinst, es ging ihr nicht gut?«
»Ich glaube, das sagte ich, ja.« Man konnte nur hoffen, dass sich Elaines Verstand nicht auf die Kinder vererbt hatte. Nun, auf Simon wohl nicht, aber bei Celia konnte man sich da nicht so sicher sein. Vielleicht, dachte Rose, musste man Celia nur dazu bringen, ihrem Verstand, so er denn vorhanden war, mehr zu tun zu geben. Es war durchaus möglich, dass sie alle aufs Angenehmste überrascht sein würden.
»Celia hat Helena mit Matthew Vanderley zusammen in den Garten gehen sehen«, äußerte Elaine lauernd und hob ihre Tasse an die Lippen.
»Und? Was ist schon dabei, im Garten spazieren zu gehen?«, verteidigte Rose ihre Enkelin. »Fast alle haben es getan.«
»Ja, aber wieso ist ausgerechnet die Gastgeberin danach nicht wieder aufgetaucht? Niemand hat Helena danach gesehen. Ich habe die Verandatür fast die ganze Zeit über im Auge behalten. Matthew kam später wieder zurück, und kurz nach ihm kamen Simon und Calvin. Ich kenne Simon, irgendetwas hat ihn furchtbar aufgeregt.«
Rose schnaubte verächtlich. »Bitte komm auf den Punkt, Elaine, damit dieses absurde Gespräch beendet werden kann.«
»Nun, ich denke«, begann Elaine, nun etwas verunsichert, weil ihre Schwiegermutter sich so wenig schockiert zeigte, »ich denke«, wiederholte sie, »dass Helena eine ... unerlaubte Zusammenkunft mit dem jungen Herrn hatte.«
»Sprich nicht um den heißen Brei herum, Elaine, das steht dir schlecht zu Gesicht. Du willst mir damit im Klartext sagen, Simon und Calvin hätten Helena und Matthew bei einer unmoralischen Handlung ertappt, Helena daraufhin veranlasst, sich zurückzuziehen, und Matthew unbehelligt weiterfeiern lassen. Nun, wenn dein Sohn und Calvin die Zukunft der Ashingtons verkörpern, dann scheint ja zumindest auf eurer Seite Ehre und Moral mit euch zu sterben. Bei Arthur gibt es noch Hoffnung, schließlich hat er noch zwei weitere Söhne.«
Elaine lief rot an und setzte ihre Tasse so abrupt ab, dass das Porzellan schepperte. »Du willst nur nichts Schlechtes über Helena hören.«
»Wie Recht du damit hast, meine Liebe. Ich will nichts Schlechtes über sie hören, ebenso wenig wie über Celia, Simon und Arthurs Söhne.«
In diesem Moment betrat Celia den Raum. Sie gähnte und sah verschlafen aus. Nie, dachte Rose, nie wäre sie selbst so vor ihrer Mutter und Großmutter aufgetreten.
»Guten Morgen, Celia, mein Kind. Ich hoffe, du hast gut geschlafen?«, fragte sie.
»Ja, danke, Großmutter«, murmelte Celia.
»Das ist schön, denn es war das letzte Mal, dass du bis in den späten Vormittag hinein geschlafen hast. Ab morgen wirst du deinen Bruder morgens in den Park begleiten.«
Celia riss entsetzt die Augen auf und schien etwas sagen zu wollen. Doch Rose Ashington kam ihr zuvor: »Keine Widerrede, du wirst tun, was ich sage!« Die alte Dame sah ihre Enkelin scharf an, und das unerbittliche Funkeln in ihren Augen erstickte jeden Widerspruch.
»Immer bist du mit Celia so streng, aber Helena nimmst du ständig in Schutz«, machte Elaine ihrem Unmut erneut Luft. »Wir werden nicht vor Celia über Helena diskutieren. Ich äußere meine Kritik über Celia auch nicht in Gegenwart ihrer Cousine.« Es schien Elaine wirklich an jeglicher Art von Takt zu mangeln.
»Aber ich habe gesehen, wie sie mit Mr. Vanderley in den Garten gegangen ist«, nuschelte Celia, die sich inzwischen an den Tisch gesetzt und einen Toast genommen hatte, zwischen zwei Bissen.
»Celia, ich möchte nie wieder sehen, dass du mit vollem Mund sprichst«, mahnte Rose. »Wenn du nicht imstande bist, wie eine erwachsene Dame zu essen, schlage ich vor, du nimmst die Mahlzeiten wieder im Kinderzimmer zusammen mit der Gouvernante ein. Darüber hinaus möchte ich nie wieder hören, dass du Angehörige deiner Familie verleumdest.«
Celia nickte nur und ihre Mimik zeigte, wie sehr der Tadel der alten Frau sie getroffen hatte.
Rose stand auf, um sich in ihr Morgenzimmer zu begeben und ihre täglichen Briefe zu schreiben. Elaine folgte ihr.
»War das nötig, das Mädchen so zu beschämen? An Celia hast du immer etwas auszusetzen.«
»Sie muss lernen, sich zu benehmen, Elaine. Wenn du dich schon weigerst, ihr Anstand beizubringen, dann muss ich es eben tun.«
»Sie ist mein Kind, nicht deins!«
»Dann solltest du dich gelegentlich daran erinnern und ihr eine angemessene Erziehung angedeihen lassen, damit sie sich in der Gesellschaft Respekt verschaffen kann.«
Sie ließ ihre Schwiegertochter stehen und ging in ihr Morgenzimmer. Mit Eleonore, der Ehefrau ihres Sohnes Arthur war sie damals direkt einverstanden gewesen. Sie war zwar keine Adlige, aber ihre Familie genoss einen tadellosen Ruf, und ihre Erziehung und Bildung waren erstklassig. Sie erinnerte sich noch daran, wie Arthur ihr von seinem Wunsch erzählt hatte, die einzige Tochter der Dorans aus Somerset zu heiraten. Die ganze Familie war hingerissen gewesen von der schönen Eleonore, die von Anfang an perfekt in die Rolle der Herrin von Darking Hall, dem großen Herrensitz in Essex, passte. Sie war von jeher charmant gewesen und vereinte Schönheit und Geist vollendet miteinander. Rose hatte sich mit ihr immer besser verstanden als mit Elaine. Der einzige Streitpunkt war die Erziehung von Helena. Während Elaine mit Celia zu weich war und ihr nichts verbot, war Eleonore mit Helena zu hart. Es war müßig, mit ihr darüber zu reden, sie selbst hatte es bis zur Verzweiflung getan, ohne dass es etwas geändert hätte.
Rose hatte gerade die Tür des Morgenzimmers hinter sich geschlossen und wollte sich ihren Briefen zuwenden, als es klopfte und Simon zur Tür hereinkam. Er trug noch seine Reitkleidung und war offensichtlich gerade erst nach Hause gekommen. Rose hatte nicht gemerkt, wann er von der Feier zu Ehren von Helenas Geburtstag heimgekommen war, aber weil er im Anschluss daran noch mit seinen Cousins und einigen Freunden ausgegangen war, musste es in den frühen Morgenstunden gewesen sein.
»Guten Morgen, Großmutter.« Er beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie auf die Wange.
»Guten Morgen, Simon. Wie war es im Park?«
»Wie immer.« Simon setzte sich in einen zierlichen Sessel und lehnte sich zurück. »Vornehme Damen, die ihre neuen Kleider spazieren fahren, affektierte Herren, ein paar ältere Damen mit hysterischen kleinen Hunden und zu guter Letzt einige normale Leute.«
Rose lächelte. »Normal? Wie wer zum Beispiel?«
»Nun, wie Jerome und Helena. Wir haben sie auf dem Rückweg getroffen.«
»Damit lieferst du mir das Stichwort, Simon«, setzte Rose an und wurde ernst. »Was ist gestern Nacht im Garten vorgefallen? Und komm mir nicht mit Ausflüchten. Helena hätte das Fest nie verlassen, ohne sich von mir zu verabschieden.«
Simon lehnte sich vor und sah ihr in die Augen. »Es bleibt unter uns?«
»Wenn du mir bis jetzt nicht traust, dann wirst du es wohl nie mehr tun. Habe ich jemals eine deiner Jugendsünden, die du mir gebeichtet hast, an deinen Vater verraten?«
Simon grinste verschwörerisch, dann berichtete er mit kaum verhohlenem Ärger, was sich im Garten abgespielt hatte. Er war aufgestanden und lief im Zimmer auf und ab, während er erzählte. Rose hörte ihm mit unbewegter Miene zu und sagte dann, nachdem er zum Schluss gekommen war, sie habe sich etwas in dieser Art bereits gedacht. »Gut, Simon«, fuhr sie fort, »ich danke dir. Ich hoffe, außer euch hat niemand etwas von dieser unseligen Geschichte bemerkt?«
»Ich denke, nicht. Es war ja sonst niemand im Garten.«
»Es war richtig, keine lautstarke Auseinandersetzung oder gar Schlimmeres vom Zaun zu brechen. Bei solchen Dingen ist es wichtig, so zu handeln, dass außer den Betroffenen niemand etwas erfährt.«
»Nun«, setzte Simon an, »ich denke, Helena war ohnehin unschuldig an der ganzen Sache.«
Die alte Dame sah ihm direkt in die Augen. »Aber natürlich, Simon. Daran habe ich keinen Augenblick gezweifelt.«
3
Kalkutta
Die Sonne brannte heiß auf die staubigen Straßen, und der Geruch von Abfall und Unrat war schier unerträglich. Die Menschen schlichen, von der Hitze niedergedrückt, durch die Stadt, Bettler, durch Krankheiten entstellt oder verkrüppelt, saßen an den Häuserwänden, auf der Suche nach einer Illusion von Schatten. Kleine Kinder mit Augen, in die sich eine tiefe Hoffnungslosigkeit eingeschlichen hatte, liefen zwischen den Menschen umher, bettelten oder stahlen. Verfaultes Gemüse lag am Straßenrand, von schwarzen Fliegen umschwärmt. Die Stadt dampfte.
Ein Mann mit einer schmutzigen Uniform öffnete das Tor eines klotzigen, heruntergekommenen Gebäudes. In der einen Hand hielt er einige Blätter, auf denen sich zahllose Flecken und Fingerabdrücke abzeichneten, mit der andern Hand wischte er sich mit einem schmutzigen Taschentuch den Schweiß vom Gesicht. Seine Finger fuhren unter dem speckigen Kragen seines Hemdes den verschwitzten Hals entlang.
»Verflucht heiß«, murmelte er schlecht gelaunt vor sich hin. Er wäre lieber in seinem Büro sitzen geblieben, hätte etwas Kaltes getrunken und weiter Karten gespielt. Mit barscher Stimme rief er: »Nun beeilt euch doch, ihr Drecksgesindel, und bringt ihn endlich raus! Hab keine Lust, hier einzugehen.«