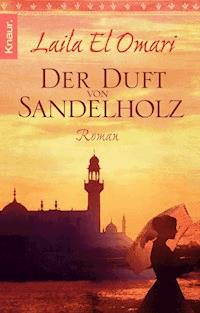4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unwahrscheinliche Liebe zu Zeiten der Belagerung Gibraltars.
1778: Olivias Leben gerät aus den Fugen, als ihr Vater nach Gibraltar versetzt wird. Auf der Überfahrt trifft sie auf den Offizier Sir John Retallick. Überrascht stellt sie fest, dass ein Teil ihrer Familie John bereits zu kennen scheint. Aber niemand will darüber sprechen.
In Gibraltar angekommen, drängt John sie zur Heirat. Trotz der widrigen Umstände entwickelt Olivia Gefühle für ihn. Doch als Gibraltar belagert wird, spitzt sich ihr Schicksal dramatisch zu. Welches Geheimnis teilt John mit Olivias Familie? Während Olivia versucht, das herauszufinden, wird sie immer tiefer in ein Spiel aus Rache, Intrigen und Verrat hineingezogen ...
Eine opulente Familiensaga um Verrat, Hass, Lügen, Vergebung und Liebe. Laila El Omari schreibt auch unter den Namen Anna Jonas, Nora Elias und Hannah Conrad.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 866
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Teil I
1
Ostindienfahrer Athena, Atlantischer Ozean, Juli 1778
London, Januar 1776
2
Gibraltar, Juli 1778
London, Februar 1776
3
Gibraltar, August 1778
London, Februar 1776
4
Gibraltar, Oktober 1778
London, März 1776
5
Gibraltar, November 1778
London, Oktober 1776
6
Gibraltar, Januar 1779
London, Dezember 1776
7
Gibraltar, März 1779
London, Dezember 1776
8
Gibraltar, Mai 1779
London, Januar 1777
9
Gibraltar, Mai 1779
London, Februar 1777
Teil II
10
Gibraltar, Juni 1779
London, Februar 1777
11
Gibraltar, Juli 1779
London, März 1777
12
Gibraltar, September 1779
London, März 1777
13
Gibraltar, Dezember 1779
London, April 1777
14
Gibraltar, Januar—Februar 1780
London, Mai 1777
15
Gibraltar, Juni 1780
London, Juni 1777
16
Gibraltar, Oktober 1780
Cornwall, November 1777
17
Gibraltar, Februar 1781
London, Februar 1778
18
Gibraltar, April 1781
Ostindienfahrer Athena, Atlantischer Ozean, Juli 1778
Teil III
19
Gibraltar, August 1781
20
Gibraltar, November-Dezember 1781
21
Gibraltar, April 1782
22
Gibraltar, August-September 1782
23
Gibraltar, Januar-Februar 1783
24
Gibraltar, März 1783
Epilog
Cornwall, Juli 1784
Zeitleiste
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
1778: Olivias Leben gerät aus den Fugen, als ihr Vater nach Gibraltar versetzt wird. Auf der Überfahrt trifft sie auf den Offizier Sir John Retallick. Überrascht stellt sie fest, dass ein Teil ihrer Familie John bereits zu kennen scheint. Aber niemand will darüber sprechen.
In Gibraltar angekommen, drängt John sie zur Heirat. Trotz der widrigen Umstände entwickelt Olivia Gefühle für ihn. Doch als Gibraltar belagert wird, spitzt sich ihr Schicksal dramatisch zu. Welches Geheimnis teilt John mit Olivias Familie? Während Olivia versucht, das herauszufinden, wird sie immer tiefer in ein Spiel aus Rache, Intrigen und Verrat hineingezogen ...
Laila El Omari
Der Purpurhimmel
Nulli expugnabilis hosti
(Keinem Feind eroberbar)
Wahlspruch von Gibraltar
Teil I
*
»Wenn jemand wünscht, al-Andalus zu besuchen, dies ist sein Tor.«
LISAN AD-DIN IBN JATIB über Gibraltar
1
Ostindienfahrer Athena, Atlantischer Ozean, Juli 1778
Wenn Olivia Gefühle als Farben hätte beschreiben können, so wären die ihren grau mit silbrig-blauen Schlieren gewesen, wie der regenschwangere Himmel, den das von sanften Wellen gekräuselte Wasser spiegelte – ein Spiegelbild ihrer selbst, das um das Schiff herum zerfloss bis an den Horizont.
Sie hatten erst vor wenigen Minuten abgelegt, und Olivia hielt eisern an dem Entschluss fest, die Reise nicht mit Blick zum Ufer anzutreten. Abschied hatte sie bereits vor Wochen genommen, hatte jede Blume im Garten ihrer Eltern berührt, auf ihre eigenen Schritte gelauscht, auf das Geräusch ihrer Schuhe auf den Londoner Straßen, Bekanntes mit Blicken abgetastet. Portsmouth war die erste Etappe ihrer Reise, und es war ihr fremd gewesen, ein erster kleiner Schritt ins Unbekannte, aber dennoch vertraut genug, um noch Heimat genannt werden zu dürfen. Während nun ihre ganze Familie mit den übrigen Fahrgästen den am Kai drängenden Freunden, Bekannten oder auch einfach nur Schaulustigen zuwinkte, war sie über das Deck nach vorne gegangen, denn es fühlte sich falsch an, einem neuen Leben mit dem Rücken voran zu begegnen.
Der Bug des Schiffes wälzte sich durchs Wasser und grub eine Schneise, die sich hinter dem Heck wieder schloss. Feiner Sprühnebel benetzte Olivias Gesicht, während sie unter ihren Fingerspitzen das glatte Holz der Reling spürte. Sie lehnte sich so weit nach vorne, dass die Stangen ihres Schnürleibchens gegen ihre Rippen drückten, und sah in das aufgewühlte Wasser, wo das Meer aufgerissen wurde wie eine Wunde.
»Wenn du dich an dieser Stelle vom Schiff stürzt, gerät dein Körper direkt unter den Bug, und du würdest unbemerkt einfach verschwinden. Kein sehr eindrucksvoller Abgang«, spottete ihr Zwillingsbruder Stanley, der leise hinter sie getreten war.
Sie richtete sich auf und drehte ihm den Kopf halb zu. »Vielleicht überlebe ich es auch und schwimme einfach an Land zurück – unbemerkt von allen.«
Er zuckte mit den Schultern. »Wäre auch kein großer Verlust.« Kurz darauf wandte er sich ihrer älteren Schwester Ruby zu, die in diesem Moment zu ihnen trat, und jeder Spott in seinem Gesicht wich Zärtlichkeit und Besorgnis. Ihre Großtante hatte einmal zu Olivia gesagt: »Du und Stanley habt alles an dunkler Schönheit bekommen, was diese Familie zu bieten hatte, während Ruby wirkt, als habe sie alle Helligkeit aufgesogen.«
Wenn Ruby jemals etwas Sonnengleiches gehabt hatte, war davon nun, im Angesicht ihres nahenden Todes, nicht mehr übrig als ein Abglanz. Aber selbst dieser zauberte Röte auf ihre Wangen und Glanz in ihre Augen, die nur jemand, der sie kannte, als fiebrig bezeichnen würde.
Die beiden stellten sich ebenfalls an die Reling, nahe beieinander, als wollten sie Geheimnisse austauschen. Zwischen Stanley und Olivia hingegen war zwei Schritte breit Platz, was zwar sicher unbeabsichtigt, aber bezeichnend dafür war, wie es immer schon gewesen war. Stanley hatte Ruby immer nähergestanden als seiner Zwillingsschwester. Ruby, die Lebenslustige, die Abenteuerhungrige, an die er sich von klein auf gehängt hatte, als hungere er nach dem Leben, das sie ausstrahlte. Olivia hingegen hatte sich vor dem aufbrausenden Temperament ihrer älteren Schwester stets in Distanziertheit geflüchtet. »So schön ist sie«, hatte Olivia ihre Großtante einmal über sich sagen hören, »aber Mädchen von ihrem Schlag haben kein Herz.« Und die schöne Olivia ohne Herz wusste, sie sollte Mitleid haben mit der lebenshungrigen Ruby, die nun, anstatt vom Leben zu zehren, von diesem aufgezehrt wurde.
Es hatte sich seit einigen Monaten jedoch eine seltsame Kühle zwischen Ruby und Stanley geschlichen, nach einer Reise an die Küste von Cornwall, die Ruby unternommen und während der Stanley sie kurz vor ihrer Rückkehr besucht hatte, um die restliche Zeit mit ihr zu verbringen. Rubys Distanziertheit hatte gleichwohl etwas Verzweifeltes, als wolle sie Stanleys Bemühen um sie nachgeben, könne es jedoch nicht, ohne sich selbst zu verraten.
Ihre Mutter stellte sich nun in die Lücke zwischen Olivia und Stanley, ihre Lieblinge. Zwischen ihr und Ruby hatte es nie Nähe gegeben, und ihr Zusammenleben war geprägt von Streitereien bei Tisch und Rubys Widerstand gegen alles, was das gesellschaftliche Leben vorschrieb. Was auch immer es war, das von ihr verlangt wurde, sie wollte es nicht, und oftmals schien es, als begehre sie auf nur um des Aufbegehrens willen. Mit ihrem Vater verstand sie sich gut, dieser jedoch war ständig gedanklich abwesend und sagte stets auf Rubys tränenreiche Bitten, ihr beizustehen: »Deine Mutter weiß, was sie tut.«
War das Verhältnis zwischen ihrer Mutter und ihrer Schwester schon immer von Spannungen geprägt, so hatten sich diese kurz vor Rubys Abreise nach Cornwall auffallend zugespitzt. Ruby und Stanley hingegen schienen einander zu jenem Zeitpunkt näher gewesen als je zuvor. Niedergedrückt hatte Stanley gewirkt, ohne jeden ersichtlichen Grund. Zu der Zeit hatte es angefangen, dass Ruby immer blasser wurde, kränkelte und schließlich zur Erholung, wie man Olivia sagte, nach Cornwall geschickt wurde. Bis zu ihrer Abreise suchte sie Stanleys Nähe, und einmal hatte Olivia sie heimlich dabei beobachtet, wie sie weinend an seiner Brust lag.
Ein rasselndes Husten ertönte. Als Olivia sich nach links wandte und leicht vorbeugte, um an ihrer Mutter und Stanley vorbei ihre Schwester anzusehen, bemerkte sie, wie diese sich in Hustenkrämpfen leicht krümmte, den Arm ihres Bruders um die Schultern. Auch ihre Mutter drehte den Kopf zu ihrer Ältesten hin.
Sir John Retallick stand an einen Mast gelehnt, sah von weitem über die Reling hinweg bis zum Horizont, während ihm der Wind dunkle Haarsträhnen ins Gesicht wehte und die Bänder, die sein Haar im Nacken zusammenhielten, flattern ließ. Er verengte die Augen leicht, als könne er dadurch dem, was er sah, noch mehr Schärfe verleihen. Seine Blicke ruhten nun auf der Familie, die nur wenige Schritte von ihm entfernt stand, ihn jedoch nicht bemerkte. Die Mutter war, als sie zur Reling trat, sogar so nah an ihm vorbeigekommen, dass John sich wunderte, dass sie ihn nicht gesehen hatte.
Erst hatte die jüngste Tochter allein dort gestanden, den Rücken durchgedrückt, so gerade, als wolle sie sich selbst Stärke beweisen. Während er sie beobachtete, hatte er sich zum ersten Mal gefragt, wie wohl alles gekommen wäre, hätten sie und ihr Bruder Stanley sich so nahegestanden, wie Zwillinge dies normalerweise taten.
Als Ruby sich plötzlich krümmte und sich mit einer Hand an der Reling festhielt, während sie die andere Hand mit einem Taschentuch an den Mund führte, beobachtete John die Mutter eindringlich. Aus ihrem Profil ließ sich keine Gefühlsregung ablesen, doch war sie nie eine Frau gewesen, die ihre Emotionen zeigte. Sieh genau hin, dachte er, so fühlt es sich an, sein Kind zu verlieren.
*
Die Ostindienfahrer segelten im Auftrag der East India Company zwischen Europa und Indien hin und her. Auf dem Weg nach Indien wurden verschiedene Häfen angelaufen, darunter auch Gibraltar, wo die Reise von Olivia und ihrer Familie ihr Ende finden würde. Es waren die größten Handelsschiffe, die derzeit auf den Meeren verkehrten, massiv und aus gut abgelagertem, sehr haltbarem Holz gefertigt. Sie waren dafür gebaut, sowohl Handelsgüter als auch Passagiere zu transportieren, und fuhren schwer bewaffnet, um sich gegen Piratenüberfälle zur Wehr zu setzen. Die Athena war mit drei Decks in der Länge von hundertfünfundsiebzig Fuß und fünfzig Kanonen ausgestattet. Es war ein imposanter Anblick gewesen, als das Schiff vor Portsmouth vor Anker gelegen hatte. Auf dem Rückweg von Indien würde es beladen sein mit Waren wie Seide, edlen Stoffen, Baumwolle, Opium und Gewürzen.
Olivia schlenderte über das Deck, das vom Regen der vorhergehenden Nacht feucht glänzte. Wind rauschte in den Segeln. Gibraltar. Wer wollte schon ins karge Nirgendwo? Indien, Arabien – das wäre eine Reise wert gewesen. Versetzte man nicht nur Offiziere nach Gibraltar, die sich etwas hatten zuschulden kommen lassen? Ihre Mutter hatte sie zwar diesbezüglich beruhigt, aber Olivia war dennoch nicht überzeugt. Zu plötzlich war alles gekommen.
Sie ging wieder an den Bug des Schiffes, hielt sich an einem Tau fest und lehnte sich vor, um in das schäumende Wasser zu sehen, schiefergraue Tiefe unter bleigrauem Himmel. Die Meerluft schmeckte salzig auf den Lippen, und Gischtspritzer benetzten ihre Wimpern. Sie hatte die Nacht hindurch wenig geschlafen, weil sie Ruby durch die dünne Wand, die ihre Kabinen trennte, immer wieder hatte husten hören. Sie fragte sich, ob ihre Schwester den Tod an ihrem Bett lauern sah. Der Gedanke an einen wartenden Tod auf der anderen Seite der dünnen Wand brachte auch Olivia um den Schlaf.
Irgendwann hatte sie eine Männerstimme gehört – unzweifelhaft die ihres Bruders. Es war ungehörig, bei Nacht zu seiner Schwester ins Zimmer zu gehen, aber wer sollte ihn dafür schelten? Erst hatte er geredet, und falls Ruby geantwortet hatte, dann so leise, dass nichts zu hören gewesen war. Irgendwann war das Sprechen melodischen Tönen gewichen, und Olivia wusste, dass Stanley sang, so wie Ruby für ihn gesungen hatte, als sie beide noch Kinder gewesen waren. Sie hatten beide schöne Singstimmen.
Ihre Erinnerung an die vergangene Nacht wurde jäh durch das Gefühl unterbrochen, nicht mehr allein zu sein. Sie drehte sich um und sah sich einem ihr fremden Mann gegenüber, der die Hände hinter dem Rücken verschränkt hielt. Er musterte sie mit einer Art distanziertem Interesse, als sitze er im Theater und versuche zu ergründen, ob die Vorstellung ihr Geld wert sei. Seiner Kleidung zufolge gehörte er zu ihren Kreisen, aber sie hatte ihn bei noch keiner der Mahlzeiten an Bord gesehen. Er trat auf sie zu, ohne sie aus den Augen zu lassen, und Olivia wollte instinktiv einen Schritt zurücktreten, was jedoch mit der Reling im Rücken unmöglich war.
»Miss Kilbourne, nehme ich an?« Er lächelte.
»Olivia Kilbourne«, murmelte sie, ehe sie sich daran erinnerte, dass er sich zuerst hätte vorstellen müssen.
»Olivia.« Die Art, wie er ihren Namen aussprach, hatte, gepaart mit seinem taxierenden Blick, etwas erschreckend Sinnliches. »Haben Sie etwa vor zu springen, Miss Kilbourne?«
Irritiert sah sie ihn an. »Keineswegs.« Wirkte sie etwa wie eine versuchte Selbstmörderin? Oder war Gibraltar so schrecklich, dass sich Stanley und diesem Unbekannten beim Anblick einer Frau allein am Bug nur dieser eine Schluss aufdrängte?
»Keineswegs, Mr ....?« Sie neigte abwartend den Kopf.
»Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung.« Er wirkte dabei keineswegs zerknirscht, sondern eher, als mache er sich insgeheim lustig über sie. »Sir John Retallick, zu Ihren Diensten.«
Er hatte grüne Augen, wie sie selbst. Diese Gemeinsamkeit erschien Olivias phantasiebegabtem Geist plötzlich bedeutsam, ebenso der Sonnenstrahl, der in diesem Moment durch die Wolkendecke brach und das Deck in buttergelbes Licht tauchte.
Mit einem Platschen schlug weißer Möwenmist auf den Planken direkt vor ihr auf und spritzte auf ihren Rocksaum. Olivia sprang zur Seite, was in ihrem ausladenden Kleid vermutlich ebenso unbeholfen aussah, wie es sich anfühlte. Sir John Retallick legte den Kopf in den Nacken und brach in schallendes Gelächter aus.
»Olivia?« Stanley kam über das Deck, lief beinahe, und umfasste ihr Handgelenk fester, als notwendig gewesen wäre. »Mama sucht dich überall.«
Er drehte sich zu dem Mann und nickte ihm zu. »Sir John.«
»Lieutenant Kilbourne.«
Mit einer zaghaften, der Höflichkeit geschuldeten Geste wandte Olivia sich noch einmal um, ehe sie ihrem Bruder folgte. »Wenn Sie mich bitte entschuldigen.«
»Es war mir ein Vergnügen, Miss Kilbourne.«
»Ihr kennt euch?«, fragte Olivia ihren Bruder, als sie außer Hörweite waren.
»Kennen ist zu viel gesagt.«
»Warum sind wir ihm auf dem Schiff noch nicht begegnet?«
Stanley hielt inne und drehte sich zu ihr um. »Von dem halte dich fern.«
»Ist er nicht gesellschaftsfähig? Er ist ein Adliger.«
»Verarmt und auf der Flucht vor seinen Gläubigern, heißt es.«
Olivia war nicht beeindruckt. »Viele Adlige sind verarmt und heiraten dann reiche Frauen.«
»Heiraten?« Er warf ihr beim Gehen einen kurzen Blick über die Schulter zu. »Na, das ging ja schnell nach nur einer Begegnung.«
»Ich habe nicht von mir gesprochen.«
»Natürlich. Er kommt für dich ohnehin nicht in Frage.« Olivia hasste kryptische Andeutungen, und ihr Bruder neigte dazu, sie damit zu provozieren. Sie wusste ganz genau, dass es nur darum ging, ihre Neugierde anzustacheln, nicht jedoch zu befriedigen. Sie ging ihm dennoch in die Falle. »Warum nicht?«
Wieder blieb er stehen und drehte sich zu ihr um, seufzend, als habe er ein begriffsstutziges Kind vor sich. »Olivia, denk doch mal nach. Wenn er gesellschaftsfähig wäre, als Adliger und Offizier, würde er dann nicht nach Indien gehen oder irgendwohin, wo er eine richtige Karriere und eine passende Frau finden würde? Aber er fährt nach Gibraltar.«
»So wie wir.«
Er zögerte und wandte sich ab. »Ja, so wie wir.«
»Wo willst du hin?«
Augusta Kilbourne blickte über die Schulter zu ihrem Mann, der auf einem der beiden Sessel in der Kabine saß und ein Buch in der Hand hielt – zweifellos irgendeine langweilige Erzählung über Kriegsschlachten. »An die frische Luft.«
»Um diese Zeit?«
»Ich brauche frische Luft, Frank«, antwortete sie scharf. Das täte ihm fürwahr ebenfalls gut, so blass, wie er aussah. Ein Gesicht wie ein Fischbauch, dachte sie plötzlich, wer hatte das noch gesagt? Der Vergleich reizte sie zum Lachen, das hatte er damals schon, als sie ihn von – sie kam einfach nicht auf den Namen – gehört hatte. Dennoch schaffte sie es, ernst zu bleiben, und sah ihren Mann an.
Er ruderte zurück. »Ich war lediglich interessiert.«
Sie zuckte in einer nachlässigen Geste mit den Schultern und verließ die Kabine.
Der Korridor war eng und nur spärlich beleuchtet. Den Nachmittag hatte sie mit Konversation und später mit ihren Töchtern verbracht. Sie konnte nur hoffen, dass Gibraltar nicht so langweilig war, wie ihr jeder erzählte. Aber eine Wahl war ihr nicht geblieben. Es musste sein, um ihre Kinder zu schützen, genauer gesagt Stanley, denn Ruby war ohnehin nicht mehr zu helfen. Wieder diese ungewohnte Enge in der Brust beim Gedanken an ihre Älteste. Die Vorstellung, ihr Kind zu überleben, war unerträglich, darin unterschied sie sich in nichts von den meisten anderen Müttern. Auch dass Ruby selbst schuld war, bot keinen Trost.
Eine Bekannte, deren Kind gestorben war, hatte einmal gesagt, dass sie, hätte man sie vor die Wahl gestellt, anstelle ihres Kindes hätte sterben wollen. Augusta dachte darüber nach. Nein, sterben wollte sie nicht für Ruby, denn wer würde dann auf Stanley und Olivia aufpassen?
Stanley hatte Olivia mit John Retallick schäkern sehen. Es hatte einer freundlichen, wenn auch unmissverständlichen Zurechtweisung bedurft. Aber Augusta machte sich keine Sorgen, um Olivias Gehorsam machte sie sich niemals Sorgen. Im kommenden Jahr würde sie ihr einen Ehemann suchen, und Olivia, die Ruhige, Besonnene, würde sich fügen. Patty, eine Tante von Frank und Großtante der Kinder, sagte zwar: »Stille Wasser sind tief«, aber solche Allgemeinplätze galten schwerlich für jeden. »Bei Ruby«, so ihre weiteren Worte, »weißt du, woran du bist, bei Olivia nicht.« Es lag wohl an Pattys Alter, dass sie ständig und überall glaubte, ihre Weisheit kundtun zu müssen.
Augusta ging an Deck. Kühl war die Luft, wie gewaschen vom Regen. Es waren wenige Passagiere unterwegs, was ihr nur recht war. Sie spazierte über die feuchten Planken und lauschte auf das Rauschen des Meeres. Irgendwann blieb sie stehen und sah in die Dunkelheit, eine so tiefe allumfassende Finsternis, dass sie sich fragte, wie die Seeleute diese Nacht um Nacht, Monat um Monat ertragen konnten.
»Suchen Sie ebenfalls die Einsamkeit?«, fragte eine Männerstimme leise hinter ihr. Sie fuhr herum, sah jedoch niemanden und spähte mit halbgeschlossenen Augen zu den Masten, wo sie nun die Silhouette eines Mannes ausmachen konnte, der langsam auf sie zukam und schließlich im milchigen Licht einer Laterne stand.
»Lord Westlake, ganz der Ihre.« Er neigte leicht den Kopf. »Augusta Kilbourne.« Sie lächelte und sah ihn aufmerksam an. »Die Einsamkeit?«, kam sie auf seine Frage zurück. »Suchen Sie die denn?«
Er erwiderte das Lächeln. »Das zumindest dachte ich bis eben.«
*
Olivia hatte von John Retallick geträumt, seltsam wirre Träume, in denen auch Ruby vorkam, die eine wachsbleiche Totenmaske trug, wie Olivia sie auf alten Bildern gesehen hatte. Morgens wurde sie von Kopfschmerzen geplagt und fühlte sich elend. Sie stand auf, wusch sich, so gut es in diesen beengten Verhältnissen möglich war, und wartete auf ihr Dienstmädchen, damit dieses ihr beim Ankleiden zur Hand ging.
Am Frühstückstisch saß nur ihr Vater, und auch ansonsten war der Raum noch weitgehend leer. Sie neigte sich zu ihm und küsste ihn auf die Wange.
»Guten Morgen, Papa.«
Auf das Frühstück verzichtete sie und trank stattdessen nur einige Schlucke Tee.
»Hast du Ruby heute schon gesehen?«, fragte ihr Vater.
Sie schüttelte den Kopf. Nur gehört.
»Gehört habe ich sie nachts«, sprach er ihren Gedanken aus. »Das arme Kind.« Er wirkte bekümmert und war sehr blass. Olivia wusste, dass ihm das Fortgehen aus England arg zu schaffen machte und die fortschreitende Krankheit seiner Ältesten ihn niederdrückte, seit der Arzt seinerzeit die Diagnose mitgeteilt hatte – Schwindsucht. Mit jedem Tag sah er schlechter aus. Dass sein volles hellbraunes Haar durch das zunehmende Grau stumpf wirkte, machte ihn älter, und die Blässe hatte etwas Kränkliches. Seine Züge hätte niemand als fest oder markant bezeichnen können, aber dafür war sein Gesicht immer schon ein Spiegel all seiner Empfindungen gewesen. Er würde nie jemanden über seine Gefühle täuschen können, er war wie Ruby.
Olivia trank ihren Tee aus und legte eine Hand auf die ihres Vaters. »Ich gehe ein wenig an Deck spazieren. Möchtest du nicht mitkommen?«
»Nein, geh nur, mein liebes Kind, ich werde noch ein wenig lesen.« Er runzelte die Stirn, als komme ihm gerade ein unliebsamer Gedanke. »Aber solltest du nicht lieber Stanley mitnehmen? So allein als junge Frau unter lauter Matrosen ...«
»Mach dir keine Sorgen, es sind sicher schon einige Passagiere draußen, um sich ein wenig Bewegung zu verschaffen.« Sie stand auf und griff nach ihrem Hut. »Bis später, Papa.«
Die frische Seeluft tat ihr gut. Es war wärmer als am Tag zuvor, und die steingrauen Wolkenmassen waren weißen Wolkenfetzen gewichen. Olivia beschattete die Augen mit der Hand und sah zu dem Küstenstreifen, der eine dunkle Linie am dunstigen Horizont war.
»Das ist Portugal«, hörte sie eine Frauenstimme sagen.
Olivia drehte sich um und sah sich einer jungen Dame gegenüber, die sie bereits beim Essen am Vortag gesehen hatte, die Tochter irgendeines Ingenieurs.
»Constance Stockwell«, stellte die junge Frau sich vor. Ein eher reizloses Geschöpf, urteilte Olivia, während sie sich ihrerseits vorstellte und kaum verhehlen konnte, wie wenig Lust sie auf ein Gespräch hatte. Constance Stockwell hatte kupferrotes Haar, war ein wenig zu füllig, ihr Mund ein wenig zu groß und die Nase ein wenig zu klein. Zudem war sie bestimmt schon Mitte zwanzig und offenkundig unverheiratet, also eine alte Jungfer, und diese waren in den seltensten Fällen unterhaltsame Gesprächspartnerinnen.
»Wie können Sie erkennen, dass dies Portugal ist und nicht bereits Spanien?«, fragte Olivia, weniger aus Interesse, sondern nur, weil sie es noch unangenehmer fand, wenn sie schweigend nebeneinanderstünden, als wären sie alte Freundinnen.
»Ich habe diese Reise bereits einmal gemacht, aber damals bin ich bis nach Indien gefahren.«
»Und bis wohin reisen Sie diesmal?«
»Mein Vater lässt sich in Gibraltar nieder. Ich war nicht lange in Indien, nur zwei Jahre. Meine jüngeren Schwestern haben dort geheiratet.« Sie lächelte spöttisch. »Der Heiratsmarkt in Indien soll großartig sein.«
Für dich hat offenbar nicht einmal der gereicht, dachte Olivia und nickte höflich.
»Reisen Sie nach Indien?«, fragte Miss Stockwell.
»Nein, wir sind ebenfalls auf dem Weg nach Gibraltar.«
»Ich bin schon so gespannt darauf.«
Olivia musterte sie. »Tatsächlich?«
Einige Passagiere spazierten an ihnen vorbei und neigten grüßend die Köpfe. Olivia sah sich nach einer Möglichkeit um, sich von der jungen Frau verabschieden zu können, ohne unhöflich zu wirken.
»Dort ist Sir John Retallick«, sagte Constance Stockwell in diesem Moment und schaute zum Heck des Schiffes.
Olivia drehte sich um, mildes Interesse heuchelnd, dann jedoch runzelte sie irritiert die Stirn. Sie hatte Ruby noch schlafend gewähnt, aber diese junge Frau, die dort auf Sir John einredete, war ohne Zweifel ihre Schwester. John Retallick schwieg, die Hände in die Seiten gestemmt, den Blick gesenkt. Als Ruby verstummte, sah er auf und gab eine Antwort, wobei er nur eine knappe Handbewegung machte, als wolle er verdeutlichen, dass etwas abgeschlossen sei. Und im selben Moment überkam Ruby wieder ein Hustenanfall. Sie suchte nach ihrem Taschentuch, aber John Retallick reichte ihr bereits seines. Ohne lange zu zögern, nahm sie es und presste es an ihre Lippen, krümmte sich. Passagiere blieben stehen, eine Frau legte ihr die Hand auf den Arm. John Retallick sagte noch etwas, wahrscheinlich ein Abschiedswort, und verließ die kleine Ansammlung. Er kam in ihre Richtung, und Olivia, die immer noch peinlich berührt war von dem Vorfall am Tag zuvor, tat so, als bemerke sie ihn nicht.
»Constance, meine Liebe«, sagte er, als er bei ihnen war. »Wie geht es Ihnen?«
»Sehr gut, Sir John, danke der Nachfrage.«
»Grüßen Sie Ihre Eltern von mir.« Er nickte Olivia zu. »Miss Kilbourne.« Dann ging er weiter und stieg die Treppe hinunter, die unter Deck führte.
Als Olivia sich umwandte, begegnete sie dem forschenden Blick von Miss Stockwell. »Vor dem nehmen Sie sich lieber in Acht, er ist offenbar interessiert.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, verabschiedete sie sich. Olivia starrte ihr nach und ging dann langsam zu ihrer Schwester. Ruby hatte sich wieder gefangen und hielt das Taschentuch zerknüllt in ihrer Hand. Blutflecken waren noch nicht zu sehen. Manchmal beobachtete Olivia, wie Ruby zögerte, ehe sie auf das Taschentuch sah, und dann beim Anblick des blütenweißen Stoffes die angehaltene Luft ausstieß.
»Komm«, sagte Olivia, »ich bringe dich in die Kabine.«
Ruby schien widersprechen zu wollen, fügte sich dann jedoch.
»Hat der Gentleman dich aufgeregt?«, fragte Olivia.
»Nein.« Ruby spielte abwesend mit dem Taschentuch, zog es auseinander und knüllte es wieder zusammen. Sie war blasser als gewöhnlich.
»Ihr wirktet, als ob ihr euch kennt.«
Ruby schüttelte nur den Kopf, aber ob sie das tat, um damit eine Bekanntschaft zu verneinen oder um zum Ausdruck zu bringen, dass sie darüber nicht sprechen wollte, ließ sich nicht unterscheiden.
Auf dem Weg die Treppe hinunter kam ihnen ihre Mutter entgegen, die im Gegensatz zu ihrem Vater überaus frisch und gut gelaunt wirkte. Sie wechselte ein paar Worte mit ihnen, erklärte Ruby dann, sie werde sie später in ihrer Kabine besuchen, und ging weiter.
»Sag ihr, ich schlafe, dann wird sie mich nicht stören wollen«, bat Ruby Olivia.
Admiral zur See war eine Laufbahn, die einzuschlagen Stanley sich schon als Kind gewünscht hatte. Seine Eltern jedoch hatten andere Pläne mit ihm gehabt. Es war, so sagten sie, wesentlich leichter, seine Karriere zu fördern, wenn er in die Fußstapfen seines Vaters trat. Man kannte sich untereinander. Stanley konnte gut fechten, aber er war nicht gerade das, was man einen begnadeten Taktiker nannte, denn ihm fehlte die Hingabe an das, was er tat. Daher konnte auch die Hilfe seines Vaters seine Laufbahn nicht beschleunigen – wobei sich Stanley des Öfteren fragte, worin dessen Einfluss bestand, denn er hatte seinen Vater nie für einen guten Offizier gehalten und konnte sich nicht erklären, wie dieser es so rasch zum Major gebracht hatte. Was seine eigene Karriere anging, so war Stanley sich inzwischen sicher, jede Aussicht auf eine mögliche Beförderung zum Captain verspielt zu haben. Eine unbedachte Entscheidung hier, eine falsche Entscheidung da, und schon war es darum geschehen gewesen. Wenn er jedoch an Ruby dachte, so war seine verspielte Captain-Würde wohl wahrlich das kleinere Problem.
Stanley wanderte durch das Schiff und erkundete alles. Seine Uniform sorgte dafür, dass man ihm den nötigen Respekt entgegenbrachte und ihm kein Zugang verwehrt wurde. Schließlich konnte es durchaus passieren, dass man irgendwann Seite an Seite kämpfte. Die East India Company hatte ihre eigene Armee.
Es gab einen Ort, den die Seeleute an Bord »die Hölle« nannten, jener Raum im Bug am Vordersteven, wo der Bootsmann und sein Maat arbeiteten, wenn es etwas instand zu setzen gab, und wo einiges an Material für die Betakelung gelagert wurde. Stanley hatte ihn sich angesehen, weniger aus Interesse, sondern weil ihn seit Monaten der Gedanke an die Hölle verfolgte und er sich einen Vorgeschmack geben wollte, um der Vorstufe, die er durchlebte, noch eine physische Komponente hinzuzufügen. Hier hatte er jede Bewegung des Schiffs in ihrer vollen Wucht spüren können, und das Donnern der Wassermassen gegen den Bug war ohrenbetäubend.
Stanley ging die Stufen zurück zum Passagierdeck und strich mit der Hand über das polierte Holz des Geländers. Aus dem Salon hörte er leises Klavierspiel und musste unwillkürlich an Olivia denken. In gewisser Weise waren sie alle musikalisch, er und Ruby konnten singen, waren dafür jedoch völlig untalentiert, was das Spielen eines Instruments anging, bei Olivia war es umgekehrt. Auf Soireen war es nicht selten vorgekommen, dass ihre Mutter ihn und Ruby hatte singen lassen, während Olivia sie beide am Klavier begleitete. Natürlich hatte Ruby sich dazu nur selten bewegen lassen, was meist Anlass zu heftigen Szenen gewesen war.
London, Januar 1776
Ich bin doch kein dressierter Affe!«
»Ruby! Nicht diese Wortwahl.« Augusta Kilbourne war mit ihrer Geduld sichtlich am Ende, auch wenn sie sich alle Mühe gab, sich nichts dergleichen anmerken zu lassen.
Stanley hatte auf einem Sessel im Salon Platz genommen, die Beine lang ausgestreckt, und beobachtete die Szene amüsiert. Auf dem Klavierhocker saß Olivia, strich über die Tasten und schlug gelegentlich einen Ton an, als wolle sie den Streit musikalisch untermalen. Vor dem Klavier stand Ruby, die Hände zu Fäusten geballt, das honigbraune Haar gelöst – ein Affront für ihre Mutter, die viel Wert auf korrektes Erscheinen beim nachmittäglichen Tee legte. Kaltes Winterlicht malte ein Schattenmuster auf den Boden.
»Dass ihr drei musiziert, habe ich bereits mehreren Bekannten erzählt. Wenn du dich nun sträubst, wird jeder über dich sagen, du seiest eine ungehorsame Tochter.«
Falsches Argument, Mutter, dachte Stanley.
»Sollen sie es nur tun.« Ruby warf ihr Haar mit einer raschen Bewegung des Kopfes zurück. Sie sah zu Stanley und dann zu Olivia. »Reicht es nicht, wenn die beiden dein Unterhaltungsprogramm spielen? Stanley ist zu höflich, um nein zu sagen.«
Auf den Wangen ihrer Mutter zeigten sich rote Flecke, ein untrügliches Zeichen ihrer Wut, die sie nur mühsam zügelte. »Du vergisst dich, Ruby!«
»Papa?« Ruby sah ihren Vater an, der in einem Sessel schräg neben Stanley saß.
Frank Kilbourne hielt sich aus dieser Art von Streitereien meist heraus, aber offenbar konnte er dieses Mal dem flehenden Blick seiner Tochter nicht widerstehen. »Wenn sie aber doch nicht möchte, Augusta.«
Als wolle sie nicht glauben, dass ein Einwand ausgerechnet von dieser Seite kam, drehte ihre Mutter sich um. »Frank, deine Begabung mag im Bereich der Kriegsstrategien liegen, aber was die Erziehung meiner Kinder angeht, kannst du mir durchaus vertrauen, dass ich weiß, was ich tue.«
Ruby sah ihren Vater abwartend an. Dieser jedoch hob entschuldigend die Hände, eine Geste, die aussagte, dass er getan hatte, was er konnte.
»Du wirst singen, Ruby, und ich möchte jetzt keine Widerrede mehr hören.« Für Augusta Kilbourne war die Angelegenheit offenbar erledigt.
Mit dem Blick eines Menschen, der im Kriegsgefecht steht und weiß, dass er keinerlei Verbündete mehr auf seiner Seite hat, sah Ruby sich im Salon um. Sie ging ohne ein weiteres Wort.
»Ruby, die Teestunde ist noch nicht vorbei«, rief ihre Mutter ihr hinterher, jedoch ohne eine Reaktion zu erhalten. Irgendwo im Haus knallte eine Tür.
»Gab es keinen gemütlicheren Ort für ein Treffen?« Stanley zog frierend die Schultern hoch.
Sein Freund Jared spähte schweigend in die Dunkelheit. Angesichts ihrer beider eleganten Aufmachung und des Umstands, dass Männer aus ihren Kreisen nachts im Hafenviertel nur schwerlich etwas zu suchen hatten, hoffte Stanley, dass sie nicht in die Falle irgendwelcher Strolche gegangen waren. »Ein Bekannter eines Bekannten«, hatte Jared den Mann genannt, auf den sie warteten, und hatte »eine wahre Goldgrube« in Aussicht gestellt.
Zu beiden Seiten der Themse zwischen Tower Bridge und London Bridge befanden sich Lagerhäuser, Schiffswerften und Docks. Schiffe lagen im offenen Fluss und warteten darauf, ihre wertvolle Ladung an Land bringen zu können, was wegen der Überlastung der Legal Quays, wo die zollpflichtigen Waren gelöscht wurden, oftmals mit sehr langen Wartezeiten verbunden war. Die mit meist kostbaren Gütern aus dem Orient beladenen Schiffe wurden dadurch das Ziel von organisierten Diebesbanden und waren daher schwer bewaffnet. Dennoch war der Kampf meist aussichtslos.
»Ich hoffe, dein Bekannter kommt bald, mir ist nämlich kalt«, zischte Stanley.
»Ja, nur Geduld.«
Stanley schwieg für einige Minuten. »Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum genau es geht.«
Mit einem ungeduldigen Seufzen drehte Jared sich zu ihm um. »Du bist mein Freund, und ich vertraue dir, aber ich möchte dir lieber zeigen, was für uns dabei herausspringt, damit du nicht wegen eventueller Skrupel schon von vornherein nein sagst.«
»Etwas Illegales?«
Jared zuckte mit den Schultern und sah ihn schweigend an.
»Na, du hast ja Nerven.« Stanleys Gesicht verfinsterte sich. »Du weißt, dass ich Offizier der Krone bin.«
»Und? Das sind andere auch.« Jared taxierte ihn. »Willst du wirklich gehen?«
Sein Freund kannte ihn einfach zu gut. »Nun«, sagte Stanley gedehnt, »wir sind mit deiner Kutsche hier, weg komme ich nur, wenn ich zu Fuß gehe, nicht wahr? Also kann ich es mir ebenso gut ansehen.«
»Ganz recht.« Der Mann stand so plötzlich neben Stanley, dass dieser einen Satz zurückmachte. Anstelle des abgerissenen Strauchdiebs sah er jedoch zu seinem Erstaunen einen elegant gekleideten Mann in den Vierzigern, der durchaus im Bekanntenkreis seiner Eltern verkehren könnte.
»Es tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe«, sagte der Mann. Er machte eine einladende Handbewegung in die Dunkelheit. »Wenn die Herren mir bitte folgen wollen.«
Stanley war äußerst unbehaglich zumute, als er zusammen mit Jared hinter dem Mann her durch eine Reihe von finsteren, verwinkelten Gassen lief. Er hoffte nur, dass sein Freund wirklich wusste, was er tat. Vereinzelt warfen Lampen in Hauseingängen schmutzig gelbe Lichtpfützen auf die unebene, von einem schmierigen Film überzogene Straße. Es roch nach ranzigem Fett und Fisch. Stanley hielt die Hand an seinem Degen, bereit, ihn jederzeit ziehen zu können.
»Du hast gesagt, die ganze Sache sei eine hervorragende Investition«, flüsterte er Jared zu. »Woher hast du das Geld?«
»Von meinem Bruder. Sagen wir, geborgt.« Jared grinste entwaffnend.
»Du hast es gestohlen?«
»Ich darf über das Geld frei verfügen, und er bekommt es ja zurück.«
»Ich kann mir von meinem Vater aber nicht einfach Geld borgen, er würde es merken und Fragen stellen, und ich weiß nicht, ob meine eigenen Mittel ausreichend sind, wenn es wirklich etwas Größeres ist.«
»Ich kann dir ein Darlehen geben.«
Stanley nickte nur, obwohl ihm nicht wohl bei der Sache war.
Der Mann blieb stehen, und Stanley sah sich um. Hier war überhaupt nichts außer einem Schuppen, der aussah, als stürze er beim ersten Windstoß ein. Zwei Männer traten aus den Schatten und stellten sich hinter sie.
Stanley fuhr herum. »Was geht hier vor?«
»Eine Vorsichtsmaßnahme, schließlich kenne ich Sie nicht.« Der Mann gab den beiden Männern einen Wink, und diese traten mit Tüchern in den Händen auf Stanley und Jared zu, um ihnen die Augen zu verbinden. Stanley riss dem Mann vor ihm das Tuch aus der Hand.
»Da mache ich nicht mit, ich werde zurückgehen.«
Der Mann lächelte spöttisch. »Dann nur zu. Allerdings hoffe ich, Sie haben Verständnis dafür, dass ich Ihnen keinen Fremdenführer mitgeben kann, der Ihnen den Weg zurück zeigt.«
»Nun stell dich nicht so an«, sagte Jared und ließ sich widerstandslos die Augen verbinden.
Stanley zögerte, haderte für wenige Sekunden mit sich, dann band er sich ebenfalls das Tuch vor die Augen.
»Ihre Waffen?«
»Auf keinen Fall.« Mit einer raschen Bewegung legte Stanley die Hand wieder auf den Knauf seines Degens.
Der Mann insistierte nicht weiter. »Damit eins klar ist, ich werde meinen wahren Namen nicht nennen und möchte die Ihren auch nicht wissen. Zudem verlegen wir unsere Waren nach jeder Transaktion, uns steht eine Reihe von Räumlichkeiten zur Verfügung.«
Nach wenigen Minuten, die Stanley und Jared durch nach Kloake und saurer Milch stinkende Gassen geführt wurden, blieben sie stehen, und die Männer nahmen ihnen die Augenbinden ab. Sie standen vor einem großen Haus, offenbar ein altes Lagergebäude, das zwar verwahrlost, aber im Großen und Ganzen noch gut instand gehalten war. Der Mann hantierte an einem Schloss herum und schob einen Riegel beiseite.
»Nur damit von Anfang an kein Missverständnis entsteht, meine Herren. Das Gebäude wird streng bewacht.« Er lächelte. »Sie werden gleich verstehen, warum.«
Er zündete eine Lampe an und führte sie durch einen nach Schimmel riechenden Raum, in der alte Webstühle standen, von Staub und Spinnweben überzogen. Dahinter war ein weiteres Tor, das er nun aufschloss. Er stieß die Tür auf und gab den Blick frei auf eine matt beleuchtete Halle, in der sich mehrere Männer befanden und Kisten packten.
Stanley trat einen Schritt vor und sah sich um. Seide in allen Farben, Sandelholz, Kaliko, Baumwolle, Tee, Kisten mit kostbaren Gewürzen, Kaffee – eine Schatzkammer. Schleichhandel, so wusste Stanley sofort. Er hatte natürlich schon davon gehört, von dem märchenhaften Vermögen, das viele Männer anhäuften, die ihre eigenen Geschäfte unter Umgehung des Handelsmonopols der East India Company machten.
»Bist du dabei?«, fragte Jared und lachte. Seine Begeisterung war ansteckend. So war Jared eben, und obwohl Stanley Bedenken hatte, stimmt er in das Lachen ein. »Ich wäre ein Narr, wenn nicht, oder?«
In den frühen Morgenstunden betrat Stanley sein Elternhaus. Sie hatten gefeiert, waren von einer Vergnügungsstätte zur anderen gezogen und schließlich in einem sehr teuren Etablissement gelandet, wo sie morgens die Letzten gewesen waren, die gingen. Jetzt war Stanley zum Umfallen müde und wollte nichts mehr als in sein Bett.
Auf dem Weg zur Treppe kam er am Salon vorbei, dessen Tür offen stand, was er nicht weiter beachtet hätte, hätte er nicht den kühlen Luftzug bemerkt. Stirnrunzelnd betrat er den Raum und bemerkte die offene Terrassentür. Ein nachlässiger Dienstbote oder einer, der sich mit einem Dienstmädchen zu einem verbotenen Stelldichein einfand. Das würde am nächsten Tag ein Nachspiel haben. Stanley wollte die Tür eben schließen, als er die Gestalt bemerkte, die einsam auf den Stufen zum Garten saß. Er trat hinaus und sah Ruby, bekleidet mit nicht mehr als einem Batistnachthemd.
»Was tust du hier?«, fragte Stanley behutsam, weil er fürchtete, dass sie schlafwandele.
Sie drehte sich zu ihm, die Augen klar und wach. Ihr Körper zitterte leicht in der Kälte. »Mit einer Halsentzündung werde ich schwerlich singen müssen.«
Stanley widerstand der Versuchung, sich sein Surtout auszuziehen und ihr um die Schultern zu legen, und er verdrängte den Gedanken an sein warmes Zimmer und das einladende Bett. Stattdessen setzte er sich neben sie.
»Du musst nicht bleiben«, sagte Ruby und umschlang ihre Knie mit den Armen.
»Ich weiß«, sagte Stanley und blieb.
2
Gibraltar, Juli 1778
Am fünften Tag der Reise liefen sie Gibraltar an. Olivia stand an der Reling und blickte auf das karge Felsland, das ihre neue Heimat werden sollte. Von Gibraltar selbst fiel als Erstes der Berg ins Auge, ein klobiges und gewaltiges Vorgebirge, das nach Süden in Richtung der spanischen Provinz Andalusien auskragte und dem die arabischen Seeleute einst den Namen Djabal at-Tariq gegeben hatten, nach Tariq ibn Ziyad, jenem maurischen Feldherrn, unter dem Gibraltar im Jahr 711 erobert worden war und der als erster Muslim Fuß auf spanischen Boden gesetzt hatte. Aus Djabal at-Tariq war im Laufe der Jahrhunderte Gibraltar geworden.
Olivia hatte vor ihrer Abreise in der Bibliothek ein Buch über Gibraltar gefunden und geglaubt, die Beschreibungen und Bilder darin hätten sie auf das vorbereitet, was sie zu sehen bekommen würde. Beim Anblick dieses enormen Felsens, der die Landmasse vor sich beinahe erdrückte, wurde ihr jedoch flau im Magen.
Die eigentliche Stadt erstreckte sich über einen schmalen Küstenstreifen am Fuß des Berges, wo die Ausläufer flach zum Meer hin abfielen. Festungsmauern rund um die Stadt erweckten den Eindruck eines Bollwerks, in das kein Eindringen möglich war. Gibraltar, der Schlüssel des Mittelmeers, war seit 1704 britisches Hoheitsgebiet und mit dem Frieden von Utrecht seit 1713 »auf unbegrenzte Dauer« britisch geworden.
Das Schiff ankerte in der Bucht von Gibraltar an der Spitze der Iberischen Halbinsel. Die wenigen Passagiere, die von Bord gingen, wurden in Beibooten an Land gebracht. An der Alten Mole stand bereits ein Offizier mit mehreren Soldaten und einigen Trägern, um die Familie von Major Kilbourne zu ihrer neuen Unterkunft zu geleiten.
»Lieutenant Willowby, zu Ihren Diensten, Sir«, stellte er sich Olivias Vater vor. »Willkommen in Gibraltar.« Er grüßte sie reihum, während ihr Vater ihm anschließend seine Familie vorstellte, danach ging Lieutenant Willowby ihnen voraus zu zwei Kutschen, auf denen die Träger bereits das Gepäck festschnallten. Olivia sah sich noch einmal um, entdeckte John Retallick, der mit dem Rücken zu ihr stand, und musste, während sie sich abwandte, an die Worte von Miss Stockwell denken. Vor dem nehmen Sie sich lieber in Acht, er ist offenbar interessiert.
Ein an ihr interessierter Mann – das war nicht unbedingt etwas Neues, Olivia wusste, sie war eine gute Partie. Aber das aufregende Kribbeln war weg, das den Gedanken an eine Eroberung stets begleitet hatte, und unvermittelt tauchte das Gesicht jenes Mannes auf, dem dieser Umstand geschuldet war. Henry. Sie biss sich auf die Unterlippe, so heftig, dass der Schmerz das Bild überlagerte, dann blickte sie sich noch einmal um und lief beinahe in Stanley hinein, der sich unwirsch zu ihr umdrehte.
»Pass gefälligst auf«, zischte er.
Ihre Eltern bestiegen eine der Kutschen, Olivia und ihre Geschwister die andere. Nachdem Stanley sich davon überzeugt hatte, dass Ruby bequem saß, ging die Fahrt los. Schmal und beengt kroch die Stadt am Felsen entlang. Militärische Anlagen und Gebäude prägten das Stadtbild, Häuser im Stil der genuesischen Architektur duckten sich im Schatten der Festungsmauern. Das eigentliche Stadtgebiet lag zwischen dem Hafen und der höhergelegenen Main Street. Die Kutsche hielt schließlich vor einem Bungalow, der so gelegen war, dass das Kalksteinmassiv, wenn man nach Osten blickte, das gesamte Sichtfeld einnahm.
»Also wenn man das hier mit unserem Haus in London vergleicht ...«, sagte Augusta Kilbourne, als sie wenig später durch die Räume gingen. »Aber man kann es sich nun einmal nicht aussuchen.«
Olivia sagte gar nichts, sondern sah sich nur schweigend um. Wie sie wohnten, war gleichgültig, das Gefühl des Verlustes wäre auch nicht kleiner gewesen, wenn sie ein hochherrschaftliches Haus bezogen hätten. Sie fand den Bungalow jedoch ganz hübsch mit seinen schwarz-weißen Fliesen in der Eingangshalle, dem Salon, in dem ein buntes Mosaikmuster eine Wand zierte, und den Zimmern in ihren hellen, freundlichen Farben. Sie und Ruby bekamen zwei Schlafzimmer, die durch eine Tür miteinander verbunden waren. Ursprünglich, so erklärte der Offizier, sei dies ein großer Raum gewesen, den man geteilt habe. Daher waren die Räume auch die kleinsten Schlafzimmer im Haus, aber immer noch großzügig genug, um nicht beengt zu wirken. Ruby nahm ohnehin alles kommentarlos hin, und Olivia mochte ihr in Rosa und Cremegelb gehaltenes Zimmer. Ihre Eltern und Stanley wurden in einem anderen Korridor untergebracht. Ansonsten gab es außer dem großen Salon mit der Mosaikwand noch einen Speisesaal, einen kleinen Salon, eine Bibliothek, einen sehr großen Salon, der die gesamte Breite linker Hand des Hauses einnahm und wohl für Feiern gedacht war, zwei Gästezimmer und ein Boudoir vor dem Zimmer ihrer Mutter. Die Küche lag nach hinten hinaus, und die Dienstbotenquartiere waren ausgelagert.Der Garten hatte es Olivia angetan, und sie erkundete ihn, sobald es ihr möglich war. Die Dienstboten räumten die Koffer aus, und ihre Mutter inspizierte weiter ihr neues Heim. Ihr Vater und Stanley waren mit dem Offizier in die Kaserne gegangen. Während das Haus vor Geschäftigkeit zu summen schien, war es im Garten angenehm still. Von einer Mauer umgeben und mit kleinen Lauben und Nischen versehen, war es ein wunderbarer, schattiger Ort, frühlingshaft warm nach dem kühlen und regnerischen Wetter in England. Olivia raffte den Rock ihres hellen Kleides und spazierte quer über den Rasen. Schnurgerade Wege inmitten von Gärten anzulegen, hatte sie schon immer als überflüssig erachtet.
Als sie ihre Runde durch den Garten beendet hatte, sah sie zu ihrem Erstaunen Ruby auf die Veranda treten und ins Leere starren, wie sie es öfter tat, so als suche sie etwas in der Ferne, das ihr verlorengegangen war und von dem sie hoffte, es würde von allein wieder zu ihr kommen. Nein, korrigierte Olivia sich, Hoffnung lag nie in diesem von Traurigkeit genährten Blick. Olivia hob die Hand und winkte ihrer Schwester zu, Ruby winkte zurück, und jetzt lächelte sie sogar.
Obwohl sie vom Alter her nicht so weit auseinanderlagen, war Ruby ihr immer wie die überlegene große Schwester vorgekommen, die das Leben kannte, und Ruby ihrerseits hatte sie stets mit der Fürsorglichkeit der Älteren behandelt. Vor zwei Monaten hatten Olivia und Stanley ihren einundzwanzigsten Geburtstag gefeiert, Ruby wurde im Oktober dreiundzwanzig.
»Gefällt es dir?«, fragte Olivia, als sie bei ihrer Schwester angelangt war.
Ruby sah sich um, als sehe sie den Garten erst jetzt. »Es ist ... ganz reizend.«
Sie hatte ebenso wenig aus England fortgewollt wie Olivia und ihr Vater, und bei der Szene, die der Ankündigung gefolgt war, war wieder etwas von der alten Ruby zu erkennen gewesen. Olivia hatte auf den Gesichtern der anderen dieselbe Hoffnung entdeckt, die sie selbst gehegt hatte: dass die Krankheit nur eine Illusion gewesen war und dass der Wutanfall die Wiederherstellung der wahren Ruby ankündigte. Eine Hustenattacke hatte jedoch jeden weiteren Gedanken in diese Richtung erstickt. Danach hatte Ruby zwar geschwiegen, in ihren fiebernden Augen war die Auflehnung jedoch nicht erloschen.
Geholfen hatte es indes nichts, und dass sie bei ihrer Großtante blieb und die Familie allein fuhr, davon hatte ihre Mutter nichts wissen wollen, obwohl ihr Vater einlenkte. »Das Klima«, so Augusta Kilbourne, »ist wesentlich besser für Ruby als der ständige Regen und der Nebel, das hat der Arzt mir gestern erst gesagt.« Das hatte jegliche Einwände zum Verstummen gebracht, noch ehe sie geäußert werden konnten, und Stanley, das hatte Olivia ihm deutlich angesehen, hatten derer noch etliche auf der Zunge gelegen. Zwar widerstrebte ihm die Trennung von Ruby, aber wenn sie in England glücklich war, so sollte sie es nach seinem Dafürhalten ruhig bleiben. Stand jedoch ihre Gesundheit auf dem Spiel, nun, dann musste sie das Unglücklichwerden in Kauf nehmen. Dabei, so dachte Olivia, ging es doch ohnehin nur darum, die Krankheit aufzuschieben. War es wirklich so, dass man lieber lange unglücklich litt, als eine kurze Zeit dort zu verbringen, wo man sich heimisch fühlte?
»Wir müssen uns wohl arrangieren«, sagte Ruby.
»Glaubst du, wir bleiben lange?«
»Mama ist sehr vage geblieben, was das anging, aber Stanley hat angedeutet, dass in absehbarer Zeit keine Rückkehr nach England geplant ist.«
Olivia nickte und ließ sich auf einem der Stühle nieder, die um einen zierlichen Tisch gruppiert waren. »An einem solchen Ort hätten wir normalerweise nicht einmal Urlaub gemacht.«
Ein spöttischer Zug zeigte sich flüchtig um Rubys Lippen. »Du meinst, du würdest das anders sehen, wenn es hier schöner wäre? Du bist doch nie gerne gereist, wenn das Ziel über England hinausging.«
Olivia seufzte.
»Ich habe übrigens bemerkt, dass du dich an Bord mit Constance Stockwell unterhalten hast.«
»Kennst du sie?«
Ruby setzte sich nun ebenfalls. »Nur flüchtig, sie war in Indien und seit letzter Saison wieder in London. Sie sollte dort wohl heiraten, und das hat nicht geklappt. Sie ist sehr eigenwillig. Frauen wie sie haben es schwer.« Für einen kurzen Moment sah sie versonnen ins Leere, als erinnere sie sich an etwas, dann kehrte ihr Blick zu Olivia zurück. »Du wirst sie sicher öfter treffen, die Gesellschaft hier ist sehr überschaubar.«
Olivia hob die Brauen. »Eine alte Jungfer, wie erbaulich.«
»Glaub mir, du wirst sie mögen.« Ruby stand wieder auf. »Ich werde mich ein wenig hinlegen. Sag Mama bitte Bescheid, dass ich schlafe, damit sie nicht auf die Idee kommt, mich aufzusuchen.«
»Ist es nicht langsam an der Zeit, dass ihr euren Frieden miteinander macht?«
»Den Zeitpunkt dafür haben wir verpasst.«
Die Bücher ihres Vaters waren bereits ausgepackt, und sein persönlicher Dienstbote sortierte sie in die Regale. Olivia, die alles gesehen hatte, was es im Haus zu besichtigen gab, und der rasch langweilig wurde, schlenderte nun von Bücherstapel zu Bücherstapel. Im Haus herrschte noch emsige Geschäftigkeit, wie das eben so war, wenn nach einem Umzug alles neu eingerichtet werden musste. Sie selbst stand dabei nur im Weg. Es waren bereits Karten von Frauen hier ansässiger Offiziere abgegeben worden. In der Garnison waren viertausend Männer stationiert, und die übrige englische Bevölkerung umfasste etwas über fünfhundert Personen. Olivia fragte sich, wie sie die Langeweile ertragen sollte.
Sie nahm sich La Princesse de Clèves von Madame de La Fayette und ging zurück auf die Terrasse. Das Buch hatte sie schon mehrmals gelesen, aber das war es, was sie momentan brauchte: etwas Vertrautes, das ihr nichts abverlangte, als sich ganz hineinfallen zu lassen. Während sie las, schwand allmählich das Licht des Nachmittags, und ein Dienstmädchen brachte einen Kerzenständer nach draußen. Es war immer noch warm, und die Wärme war seidenweich, ganz anders, als Olivia sie aus England kannte.
Sie hörte Schritte im Salon und das leise Klirren, mit dem ein Degen abgeschnallt und auf einen Tisch gelegt wurde. Olivia legte das Buch weg und drehte sich zu Stanley um.
»Wir hatten euch früher zurückerwartet.«
Mit einem Aufseufzen ließ Stanley sich ebenfalls an dem Tisch nieder und drehte ihr Buch so zum Licht, dass er den Titel sehen konnte. »Wie oft willst du diesen Roman eigentlich noch lesen?«
Sie nahm ihm das Buch aus der Hand. »Sooft es mir gefällt.« Mit den Fingerspitzen zog sie den Titelzug nach. »Stehen eigentlich politische Veränderungen an?«
Er weitete erstaunt die Augen. »Nein, wieso? Warum interessierst du dich überhaupt auf einmal für Politik?«
»Weil ich nicht verstehe, warum wir hier sind.«
»Vater und ich sind versetzt worden, wie du sehr wohl weißt.«
»Beide auf einmal? Ist das nicht ungewöhnlich?«
Stanley musterte sie mit leicht schief gelegtem Kopf. »All das ist dir doch bekannt. Papa wurde versetzt, ich bin ihm gefolgt, weil ich dachte, in einem anderen Land ergeben sich vielleicht neue Möglichkeiten.«
»Ja, in Indien möglicherweise. Du hast auf dem Schiff Andeutungen gemacht.«
»Daran erinnere ich mich nicht. Überhaupt, was verstehst du schon von diesen Dingen?«
»Wurde Papa strafversetzt wegen irgendetwas, über das ihr nicht sprecht?«
Stanleys Geduld war offenbar am Ende. »Nein, verdammt.«
Wenn er anfing zu fluchen, war es angebracht zu schweigen, sonst artete die Sache schnell in Streit aus, in dessen Verlauf erfahrungsgemäß sehr unschöne Dinge gesagt wurden. Olivia dachte, er würde nun aufstehen und zu Ruby gehen, aber zu ihrem Erstaunen blieb er und sah in den Garten, der nun in völliger mondloser Dunkelheit dalag. Er senkte den Kopf leicht, als denke er über etwas Schwerwiegendes nach, und das Kerzenlicht glänzte auf seinem schwarzbraunen, glatten Haar, das dem ihren so ähnlich war. Das Auffälligste an ihm waren jedoch seine Augen, so dunkelbraun, dass man kaum die Iris von der Pupille unterscheiden konnte. Ruby hatte grüne Augen wie Olivia und ihr Vater. In ihren Augen konnte man lesen, in Stanleys nicht. Es war manchmal beinahe unheimlich, wenn Olivia in seinem Gesicht zu forschen versuchte und seine Augen in solchen Momenten wirkten wie schattenlose Seen.
Sie saßen schweigend beisammen, aber es war kein gemeinsames Schweigen, sondern eines, bei dem jeder für sich blieb. Solange sie denken konnte, war Olivia innerhalb der Familie allein gewesen. Vielleicht rührte ihre Distanz zu Ruby daher, dass sie schon von klein auf gespürt hatte, dass etwas empfindlich im Ungleichgewicht war. Nicht sie, Olivia, war die andere Hälfte seiner Seele, sondern Ruby.
*
Es waren wahrhaftig keine aufregenden Gesellschaften, zu denen man sie einlud. Die Frauen saßen beieinander und redeten, die Männer standen beieinander und redeten. Olivia fragte sich, ob sie die Einzige war, die sich so unerträglich langweilte. Ihrer Mutter war nichts anzumerken, aber das mochte nichts heißen. Die anderen Frauen wirkten so, als unterhielten sie sich gut, während sie über ihre Kinder sprachen und über ihre Ehemänner, die nur wenige Schritte entfernt waren und ohne Zweifel hören konnten, wie großartig sie waren, einer besser als der andere, von ihren beruflichen Möglichkeiten ganz zu schweigen. Was hatte sie dann nur hierher verschlagen, fragte sich Olivia.
Sie erfuhr jedoch einiges über das Leben in Gibraltar. So war die Trinkwasserversorgung schwierig, das einzige frische Wasser war Regenwasser, denn es gab keine Quellen. Allerdings hatten die Spanier das Problem recht gut gelöst und ein Aquädukt angelegt, das das Regenwasser auffing, und es entstanden immer neue Zisternen. Die Regenzeit ging von September oder Oktober bis April oder Mai, und der Dezember und Januar waren die regnerischsten Monate mit schweren Regenfällen, starken Winden und Gewitterstürmen. Dieses Wasser wiederum half der Bevölkerung durch den heißen, trockenen Sommer. Abgesehen von der Problematik mit dem Wasser gab es auch kein Land, das kultiviert werden konnte. Wie jede andere Küstenregion deckte die Stadt einen gewissen Bedarf an Nahrungsmitteln mit Fisch, aber dieser reichte bei weitem nicht für die gesamte Bevölkerung. Die Menschen hier waren auf die Lieferung von Waren angewiesen, das hielt die Stadt in einer Abhängigkeit von außen und machte sie angreifbar. Wie, dachte Olivia, sollte sie das aushalten? Und warum wirkte ihre sonst so kapriziöse Mutter angesichts dieser Umstände dennoch zufrieden? Weil sich ihr ohnehin kein Ausweg bot, beschloss Olivia, das Beste daraus zu machen und sich etwas zu suchen, das sie für den Verzicht, den sie leistete, entschädigte. Die Stadt war allerdings wahrhaftig nicht dazu angetan, denn außer dem Felsen, der in der Tat sehr eindrucksvoll war, boten sich nur wenige Dinge dazu an, mehr als einmal hinzuschauen. Der Garten war schön, der Blick aufs Meer ebenfalls, aber weil Olivia weder das Verlangen dazu verspürte, sich der Gärtnerei zu widmen – was ihre Mutter schwerlich erlaubt hätte –, noch den ganzen Tag wie eine verlassene Frau auf der Mole stehen und in die Ferne gucken wollte, begann sie, sich genauer umzuschauen. Sie beobachtete die Menschen um sich herum und die Häuser, die sie aufsuchte. Und sie sah John Retallick wieder.
»Ich danke dir, mein Freund.« John nahm den Eimer mit den Fischen entgegen und reichte ihn seinem Diener. Der Fischer, ein junger Mann, dessen Vater Genuese und Mutter Spanierin gewesen waren, warf das Tau seines Bootes über einen Pflock und verknotete es.
»Ich habe ja mit einigem gerechnet«, sagte der Mann, »aber nicht damit, dich hier noch einmal wiederzusehen. Sagtest du nicht, du hättest genug von der Stadt?«
»Die Dinge haben sich geändert.«
»Hier nicht, leider.«
Ein junges Mädchen kam über den Pfad gelaufen, der von den Fischerhütten zum Strand führte. Sie winkte, und ihr schwarzes Haar tanzte in wilden Locken auf ihren Schultern.
»Meine Schwester, du erinnerst dich?«
»Sie war noch ein Kind.«
»Das ist lange vorbei.«
John lächelte das Mädchen an. »Ah, Esperanza, du bist eine Wohltat für die Augen.«
Sie lachte und warf das Haar zurück, was ihr Bruder stirnrunzelnd beobachtete. »Kommst du uns besuchen?« Mit in die Hüften gestemmten Händen lehnte sie sich ein winziges Stück zurück, kokettierte.
»Nein, ich bedaure. Ich bin noch eingeladen, und wenn ich mich zu oft fernhalte, fangen die Leute an zu reden.«
»Da unterscheidet ihr Engländer euch in nichts von uns.« Pablo gab seiner Schwester die Fische und scheuchte sie den Pfad hoch, dann wandte er sich an John. »Sie tut immer so erwachsen und erfahren, dabei ist sie gerade sechzehn geworden. Sie zu verheiraten ist nicht so einfach.«
Bei den in Gibraltar lebenden Spaniern heirateten Mädchen für gewöhnlich mit dreizehn oder vierzehn, daran gemessen hatte Esperanza bereits das normale Heiratsalter überschritten. Zwischen Pablos Brauen erschien eine steile Falte. »Die alten Frauen reden über sie, weil sie so ungebändigt ist, sie sagen, ich lasse sie verwildern. Und die jungen Frauen sind neidisch auf sie und reden ebenfalls. Die Männer sind lüstern, zumindest die, die jung genug wären, sie zu heiraten. Und die anständigen sind schon verheiratet.«
John klopfte ihm auf die Schulter. »Ich beneide dich nicht darum. Pass gut auf sie auf.«
Seufzend nickte der junge Fischer, schulterte sein Bündel und machte sich ebenfalls auf den Weg zu seiner Hütte. John hingegen schickte seinen Diener heim, bestieg sein Pferd und ritt zum Haus von Ingenieur Stockwell.
Constance Stockwell bot keineswegs das Bild einer jungen Frau, die sich freute, in Gesellschaft zu sein. Vielmehr trug sie ihre Langeweile deutlicher zur Schau, als Olivia das je gewagt hätte. Irgendwie hatte sich in ihrem Kopf das Bild einer Constance gefestigt, die für jeden Besuch dankbar war und jegliche Gelegenheit beim Schopf ergriff, vielleicht doch noch einen Mann abzubekommen. Aber es interessierten sie offensichtlich weder die anwesenden Männer – gut, die meisten waren alt genug, ihr Vater zu sein – noch die Frauen, die immerhin Mütter und Schwestern möglicher Heiratskandidaten waren. Was ihr Aussehen anging, musste Olivia ihren ersten Eindruck korrigieren. Constance besaß durchaus eine gewisse Ausstrahlung mit ihrer makellosen hellen Haut, dem glänzenden kupferfarbenen Haar und den blauen Augen mit den langen Wimpern. Wenn man sie länger beobachtete, sah man eher Vorzüge als Nachteile.
Olivia bemerkte den Blick einer jungen Frau, die sie bisher nur einmal gesehen hatte, die Ehefrau eines Offiziers und Richters, den Olivia noch nicht kennengelernt hatte. Mary Holbrooke. Die junge Frau sah gelegentlich interessiert zu ihr herüber, aber nie so lange oder intensiv, um als aufdringlich empfunden zu werden. Vielmehr drückte ihr Blick den ehrlichen Wunsch nach einer näheren Bekanntschaft aus. Sie saßen jedoch zu weit voneinander entfernt, und stünde eine von ihnen auf, um quer durch den Raum auf die andere zuzugehen, würde schlagartig jedes der einlullenden Gespräche zum Erliegen kommen.
Olivia sah zu den Männern, bei denen es lebhafter zuging, aber im Gegensatz zu den Frauen hatten sie auch eine Aufgabe, die sie hergeführt hatte. Stanley war ebenfalls hier, und auch Ruby hatte ihre Schwäche der letzten Tage überwunden und begleitete ihre Geschwister auf Besuche, obwohl sie meist nur still dasaß und mit den Augen Bildern zu folgen schien, die außer ihr niemand sehen konnte. Olivia fragte sich, ob sie langsam aus der Wirklichkeit abglitt. Ein Dienstbote erschien, und ihm auf dem Fuß folgte John Retallick. Er ließ seinen Blick kurz über die Runde schweifen, nickte den Damen grüßend zu und ließ ein flüchtiges Lächeln aufblitzen, das, wie jeder unschwer erkennen konnte, Constance Stockwell galt, die ihrerseits ohne jede Verlegenheit zurücklächelte. Dann gesellte er sich zu den Männern und wandte den Frauen den Rücken zu. Während die Frauen Miss Stockwell mit lächerlich wissenden Blicken taxierten und man förmlich sehen konnte, wie es in ihren Köpfen arbeitete, versank Olivia tiefer in ihrem Stuhl und starrte grüblerisch zu Boden.
»Achte auf deine Haltung«, sagte ihre Mutter kaum hörbar. »Du willst doch nicht, dass die Leute glauben, du hättest einen schwachen Rücken.«
Olivia war es herzlich gleichgültig, was die Leute glaubten. Verstohlen sah sie zu den Männern hinüber, und für einen Moment erstarrte sie. Ihr Blick war auf einen ihr unbekannten Gentleman gefallen. Henry, dachte sie, er sieht im Profil aus wie Henry. Und mit der Erinnerung an Henry Adair kam auch die an durchtanzte Nächte, geflüsterte, schwärmerische Liebeserklärungen und verstohlene Küsse in sommerwarmen Gärten. Unvermittelt drehte John Retallick sich um, hob kaum merklich eine Braue, als sein Blick dem ihren begegnete, und eilig wandte sie sich ab.
»Eine sehr gute Partie«, hörte sie eine der Frauen sagen.
»Ja, aber das war, ehe er sein ganzes Geld verloren hat.«
»Und ehe sein Bruder ...« Die Frau verstummte. »Na ja, Sie wissen schon.«
»Vor den unverheirateten Mädchen sollten Sie dergleichen Themen lieber unterlassen«, sagte eine andere Frau bissig. »Oder wollen Sie Alpträume hervorrufen?«
Olivia hob den Kopf, um zu sehen, wer das gesagt hatte. In diesem Moment stand ihre Mutter auf und gab damit das Zeichen zum Aufbruch. »Deine Schwester soll sich nicht überanstrengen.« Dafür hatte jeder Verständnis, und Ruby war in der Tat wieder sehr blass geworden. Stanley erhob sich nun ebenfalls, um seine Mutter und Schwestern nach Hause zu begleiten.
»Vielleicht möchte Miss Kilbourne noch ein wenig bleiben?«, fragte Constance Stockwell unvermittelt an Augusta Kilbourne gewandt. »Ich würde mich sehr freuen. Außerdem möchte ich sie gerne Mrs. Holbrooke vorstellen, die noch nicht das Vergnügen hatte, ihre Bekanntschaft zu machen.«
Olivia sah Miss Stockwell an, irritiert, dass diese offenbar während ihrer scheinbaren Langeweile sehr genau beobachtet hatte und genau zu wissen schien, dass sie und Mary Holbrooke sich gerne kennenlernen würden. Noch ehe ihre Mutter etwas erwidern konnte, antwortete sie: »Es wäre mir ein Vergnügen.«
Olivia sah ihrer Mutter an, dass diese Einwände erheben wollte, dies aber nicht guttun konnte, ohne unhöflich zu erscheinen.
»Dann lasse ich Tee in der Gartenlaube servieren«, fuhr Constance Stockwell an Olivia gewandt fort. Der Vorschlag wurde von Mary Holbrooke mit einem Lächeln begrüßt.
»Nun gut.« Augusta Kilbourne zögerte. »Ich schicke dir nachher die Kutsche wieder zurück.«
»Das ist nicht nötig«, sagte Constance Stockwell. »Wir lassen Ihre Tochter heimbringen.« Sie lächelte Olivia an, und diese verabschiedete sich von ihrer Mutter und ihren Geschwistern, wobei Stanley wirkte, als gefalle es ihm ganz und gar nicht, sie zurückzulassen.
Der Garten der Stockwells war klein und gepflegt. Damit in dieser Kargheit überhaupt so viel Vegetation gedieh, verlangten Gärten intensive Pflege. Ein Dienstmädchen servierte Tee und Kuchen in einer kleinen Laube, in der die drei jungen Frauen mit ihren ausladenden Kleidern gerade eben Platz hatten.
Zunächst herrschte verlegenes Schweigen, und schließlich kam eine zögernde Unterhaltung über den mageren Gesellschaftsklatsch, der sich in Gibraltar bot, in Gang, bis das Gespräch auf England, das Königshaus und mögliche gemeinsame Bekannte überschwenkte und schließlich erlahmte.