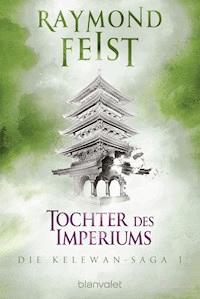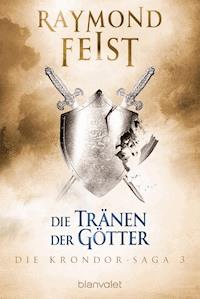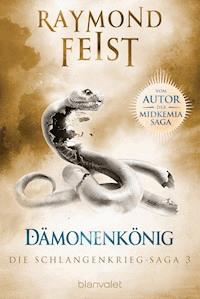9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DER DUNKLE KRIEG VON MIDKEMIA
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker der heroischen Fantasy in überarbeiteter Neuausgabe!
Schreckliche Zeiten sind auf Midkemia und Kelewan ausgebrochen. Beide Welten werden von einem großen Krieg erschüttert, der alles zu verwüsten droht. Nur der mächtige Magier Pug hat noch die Kraft, die Kämpfe zu beenden und die Welten vor der Vernichtung zu bewahren. Seine Mission führt ihn und seine Gefährten tief ins Reich der blutdürstigen Dasati. Noch nie ist jemand lebendig von dort zurückgekehrt. Doch Pug hat keine Wahl, der Preis für sein Versagen wäre zu hoch …
Der vorliegende Roman ist bereits erschienen unter dem Titel: »Die Erben von Midkemia 6: Der verrückte Gott«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Schreckliche Zeiten sind auf Midkemia und Kelewan ausgebrochen. Beide Welten werden von einem schrecklichen Krieg erschüttert, der alles zu verwüsten droht. Nur der mächtige Magier Pug hat noch die Kraft, die Kämpfe zu beenden und die Welten vor der Vernichtung zu bewahren. Seine Mission führt ihn und seine Gefährten tief ins Reich der blutdürstigen Dasati. Noch nie ist jemand lebendig von dort zurückgekehrt. Doch Pug hat keine Wahl, der Preis für sein Versagen wäre zu hoch …
Autor
Raymond Feist wurde 1945 in Los Angeles geboren und lebt in San Diego im Süden Kaliforniens. Viele Jahre lang hat er Rollenspiele und Computerspiele entwickelt. Aus dieser Tätigkeit entstand auch die fantastische Welt seiner Romane: Midkemia. Die in den 80er Jahren begonnene Saga ist bereits ein Klassiker des Fantasy-Genres, und Feist gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Fantasy in der Tradition Tolkiens.
Von Raymond Feist bereits erschienen
Die Midkemia-Saga
Die Midkemia-Chronik
Die Schlangenkrieg-Saga
Die Erben von Midkemia
Der dunkle Krieg von Midkemia
Die Kelewan-Saga
Die Krondor-Saga
Die Legenden von Midkemia
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Raymond Feist
Der dunkle Krieg von Midkemia 3
Der Zorn des Gottes
Roman
Deutsch von Regina Winter
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Wrath of a Mad God. The Darkwar (Vol 3)« bei Voyager/Harper Collins Publishers, London.
Der vorliegende Roman ist 2009 bereits im Blanvalet Verlag erschienen unter dem Titel: »Die Erben von Midkemia 6: Der verrückte Gott«.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2008 by Raymond E. Feist
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2009 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
Karten: © Melanie Korte, Inkcraft
DN · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24879-6V001
www.blanvalet.de
Die Flucht
Miranda schrie. Das mörderische Brennen in ihrem Kopf ließ einen winzigen Augenblick nach, und in diesem Moment fand sie, was sie gesucht hatte. Der Großteil ihres Bewusstseins war damit beschäftigt, ihre Willenskraft gegen jene einzusetzen, die sie gefangen hatten, aber ein winziges Fragment – ein disziplinierter Bruchteil ihres Bewusstseins – hatte auf der Lauer gelegen. An all diesen Tagen von Verhören und Untersuchungen hatte sie jede noch so kleine Pause genutzt, um diesen einen Splitter ihres Intellekts abzutrennen und sich so über den blendenden Schmerz hinwegzusetzen und zu beobachten. Bei den letzten vier Begegnungen mit den Todespriestern der Dasati hatte sie diese Distanz zu sich selbst geschaffen und ihren Körper gezwungen, den Schmerz zu ertragen.
Er war da, das wusste sie. Entzündete Nerven protestierten gegen die fremden Energien, die über die Oberfläche ihres Geistes zuckten, prüften, tasteten, Einsicht in ihr tiefstes Wesen suchten. Aber sie hatte schon vor Jahrhunderten gelernt, körperlichen Schmerz zu ignorieren. Die geistigen Angriffe waren schwieriger, denn sie wandten sich gegen die Wurzel ihrer Macht, die einzigartige Intelligenz, die sie zur besten Magierin ihres Heimatplaneten machte.
Diesen Dasati-Priestern ging jegliche Subtilität ab: Sie hatten ihre Gedanken aufgerissen wie ein Bär einen Baumstumpf, wenn er nach Honig sucht. Ein schwächerer Geist wäre schon beim ersten derartigen Angriff vollkommen ausgelöscht worden. Nach der dritten dieser Attacken war von Miranda so wenig übrig, dass sie beinahe zur Idiotin geworden wäre. Aber sie hatte sich gewehrt, und das Wissen, dass es ohne Überleben keinen Sieg gab, hatte sie dazu gebracht, ihre beträchtlichen Talente zuerst auf das Durchhalten zu konzentrieren, dann auf Einsicht.
Ihre Fähigkeit, die schrecklichen Angriffe beiseitezuschieben und sich auf diesen winzigen Splitter von Wissen, den sie sich verschafft hatte, zu konzentrieren, verhinderte, dass sie den Verstand verlor. Ihre Entschlossenheit, aus der Gefangenschaft zu fliehen und mit diesem Wissen nach Hause zurückzukehren, gab ihr ein Ziel.
Nun stellte sie sich bewusstlos, ein neuer Trick im Kampf gegen ihre Gegner. Solange die Todespriester nicht über ausgefeiltere Fähigkeiten verfügten als jene, die sie bisher demonstriert hatten, würden sie nicht bemerken, dass sie sich verstellte, und sie hielten sie für bewusstlos. Dieser angebliche Mangel an Bewusstsein war ihre erste erfolgreiche Aktion, seit man sie gefangen genommen hatte. Sie wagte nur gerade genug körperliches Bewusstsein, dass ihr Atem langsam und flach blieb, obwohl sie annahm, dass die Todespriester, die sie studierten, nicht genug über Menschen wussten, um zu verstehen, welche körperlichen Funktionen sie überwachen sollten.
Nein, ihr Kampf fand im Kopf statt, und dort würde sie früher oder später siegen. Sie hatte mehr über die Leute gelernt, die sie gefangen hatten, als diese über sie, da war sie ganz sicher.
Einzeln konnten die Dasati sich nicht mit ihr anlegen – sie hätten nicht einmal einen von Mirandas fortgeschritteneren Schülern besiegen können. Ohne die Falle, die Leso Varen ihr gestellt hatte, um ihr die Orientierung zu nehmen, wäre sie wahrscheinlich leicht mit den beiden Todespriestern fertiggeworden. Aber sie durfte Varen nicht unterschätzen, er war ein Nekromant mit jahrhundertelanger Erfahrung, und allein würde es Miranda schwerfallen, ihn zu besiegen: Soweit sie wusste, war schon dreimal einer seiner Körper getötet worden, von einer Gruppe, die ihn zudem noch überrascht hatte, und dennoch hatte er überlebt. Varen zusammen mit den Todespriestern – das war zu viel für sie gewesen.
Nun wusste sie, was diese Todespriester waren – eine Art Nekromant. Ihr Leben lang hatte Miranda Priestermagie ignoriert, wie es die meisten Magier von Midkemia taten, sie als eine Manifestation der Macht der Götter betrachtet. Nun bedauerte sie das. Ihr Mann Pug war der einzige Magier in ihrer näheren Umgebung, der ein wenig vertraut mit Priestermagie war und versucht hatte, so viel wie möglich darüber in Erfahrung zu bringen, obwohl die diversen Orden auch untereinander zur Geheimniskrämerei neigten. Er hatte viel über diese dunkelste Form der Magie gelernt, weil er es mehrmals mit pantathianischen Schlangenpriestern zu tun gehabt hatte, einer Todessekte mit ihren ganz eigenen verrückten Ambitionen. Mehrmals hatte er ihre Versuche vereitelt, die ganze Welt in Aufruhr zu versetzen.
Miranda hatte nur Bruchstücke von Diskussionen über dieses Thema aufgeschnappt. Jetzt wünschte sie sich, sie hätte besser zugehört.
Dennoch lernte sie jeden Moment mehr. Die Todespriester waren bei ihren Nachforschungen ungeschickt und ungenau und offenbarten dabei mehr von ihrem eigenen magischen Wesen, als sie über das ihre erfuhren. Dieser Mangel an Subtilität wirkte sich zu Mirandas Vorteil aus.
Sie hörte, wie sie gingen, hielt die Augen aber weiterhin geschlossen, während sie langsam das Bewusstsein in die oberen Ebenen ihres Geistes zurückkehren ließ und sich dabei fest an alles klammerte, was sie gerade neu erfahren hatte. Dann kehrte die Klarheit zurück, und mit ihr kamen die Schmerzen. Miranda kämpfte gegen den Drang an zu schreien und benutzte tiefes Atmen und geistige Disziplin, um mit dem Schmerz fertigzuwerden.
Sie lag auf einer Steinplatte, aber selbst dieser Stein hatte sein ganz eigenes bösartiges Wesen, eine für Miranda fremde Energie. Ihn auch nur zu berühren war unangenehm, und man hatte Miranda unbekleidet darauf festgeschnallt. Schweiß lief ihr in Strömen über den ganzen Körper, und ihr war übel. Ihre Muskeln drohten zu verkrampfen, und sie konnte diese zusätzlichen Schmerzen wirklich nicht gebrauchen. Sie benutzte jeden Trick, den sie kannte, um ihre Selbstbeherrschung zu steigern, sich zu beruhigen und die Schmerzen von sich wegzutreiben.
Beinahe eine Woche war sie nun schon von den Dasati untersucht worden und hatte dabei Demütigungen und Pein ertragen, während die Todespriester versuchten, so viel wie möglich über sie und die Menschheit herauszufinden. Sie war insgeheim dankbar für die ungeschickte Herangehensweise ihrer Feinde, und sie hatte dadurch zwei wichtige Erkenntnisse erhalten: Diese Dasati hatten keine Erfahrung mit menschlicher Tücke, und sie unterschätzten sie gewaltig.
Sie schob ihre Spekulationen über die Dasati beiseite und wandte die Aufmerksamkeit ihren Fluchtmöglichkeiten zu. Nachdem sie von Leso Varen und den Todespriestern gefangen genommen worden war, hatte sie rasch begriffen, dass es das Beste war, ihren Folterern gerade genug zu verraten, um das, was sie ansonsten sagte, glaubwürdig erscheinen zu lassen. Varen, dessen bösartiges Bewusstsein derzeit den Körper eines Tsurani-Magiers namens Wyntakata bewohnte, war seit ihrer Gefangennahme nicht wieder erschienen, wofür sie dankbar war, denn seine Anwesenheit hätte den Dasati nur Vorteile verschafft. Sie wusste, dass Varen seine eigenen verrückten Pläne hatte und nur so lange ein Verbündeter der Dasati bleiben würde, wie es ihm nutzte. Ihn interessierte nur sein eigener Erfolg, nicht der kranke Ehrgeiz dieses fremden Volkes.
Sie öffnete die Augen. Wie erwartet, waren die Dasati gegangen. Einen Moment lang hatte sie sich Sorgen gemacht, dass einer vielleicht schweigend und reglos zurückgeblieben war, um sie zu beobachten. Manchmal sprachen sie freundlich mit ihr, als würden sie sich mit einem Gast unterhalten, zu anderen Zeiten übten sie körperliche Gewalt aus. Es schien wenig Muster oder Sinn hinter ihrem Vorgehen zu geben.
Zuerst hatten die Todespriester ihr ihre Kräfte gelassen, denn sie waren vollkommen von sich überzeugt und hatten sehen wollen, wozu Miranda imstande war. Aber am vierten Tag ihrer Gefangenschaft hatte sie einen Todespriester mit der vollen Wut ihrer Magie angegriffen, als dieser sich herausgenommen hatte, ihren nackten Körper zu berühren. Danach hatten die Dasati sie mit einem Zauber belegt, der jeden ihrer Versuche, ihre Magie anzuwenden, vereitelte.
Die kreischenden Nerven in jedem Zoll ihres Körpers erinnerten sie daran, dass die physischen Folgen ihrer Folter nicht verschwunden waren. Sie holte lange und tief Luft und nutzte all ihre Fähigkeiten, um den Schmerz zu lindern.
Sie überlegte, ob das, was sie gerade von ihren Feinden gelernt hatte, der Wahrheit entsprach oder ob sie sich nur an eine leere Hoffnung klammerte. Sie zwang sich, auf neue Art zu denken, setzte einen kleinen Zauber ein und sprach dabei die Worte so leise, dass kaum ein Laut zu hören war. Die Schmerzen sickerten tatsächlich langsam aus ihr heraus. Endlich hatte sie entdeckt, wonach sie gesucht hatte.
Sie schloss die Augen und stellte sich noch einmal das Bild vor, das sie bei der Folter vor Augen gehabt hatte. Sie wusste intuitiv, dass sie etwas äußerst Wichtiges entdeckt hatte, aber ihr war immer noch nicht vollkommen klar, um was es sich handelte. Einen Augenblick wünschte sie, irgendwie mit Pug oder seinem Freund Nakor in Kontakt treten zu können, denn beide hatten mehr Einsichten in das Wesen der Magie als sie selbst, bis hin zu den Grundlagen der Energien, die Magier nutzten – was Nakor beharrlich als »Stoff« bezeichnete.
Sie lächelte dünn und holte noch einmal tief Luft. Sie hätte gelacht, wären ihre Schmerzen nicht immer noch so heftig gewesen.
Nakor wäre entzückt gewesen über ihre neuen Informationen über das Reich der Dasati: Der »Stoff« dieser Ebene war ähnlich wie die Energien, die jeder Magier auf der Insel des Zauberers kannte, aber es war … Wie würde Nakor es ausdrücken?, fragte sie sich. Es war verdreht. Es war, als bewegten sich die Energien in einem Winkel zu dem, was sie kannte.
Sie fühlte sich, als müsste sie wieder neu laufen lernen, nur diesmal musste sie »zur Seite« denken, wenn sie sich vorwärtsbewegen wollte.
Sie dehnte ihren Geist aus und ließ mentale »Finger« die Schnallen ihrer Fesseln berühren. Es kostete sie nur wenig Anstrengung, sie zu lösen. Rasch befreite sie sich, setzte sich auf, bewegte Schultern, Rücken und Beine und spürte, wie das Blut in ihre Glieder zurückkehrte, zusammen mit Schmerzen, die bis ins Mark zu gehen schienen.
Miranda maß ihr Leben in Jahrhunderten, aber sie sah nicht älter aus als vierzig. Sie war schlank, aber überraschend stark, denn es gefiel ihr, auf der Insel des Zauberers über die Hügel zu wandern und lange im Meer zu schwimmen. In ihrem schwarzen Haar gab es nur wenig Grau, und ihre dunklen Augen waren klar und jugendlich. Die Magie schenkte einigen Leuten ein langes Leben.
Sie holte noch einmal tief Luft. Das Brennen in ihrem Magen wurde schwächer. Die Dasati hatten zumindest auf heiße Eisen und scharfe Gegenstände verzichtet und sich damit zufriedengegeben, sie einfach zu schlagen, wenn sie glaubten, dass ihnen das mehr Informationen liefern könnte.
Wenn sie Nakor je wiedersehen sollte, würde sie ihn küssen, denn ohne sein Beharren darauf, dass die Magie irgendwie aus einer grundlegenden Energie herrührte, hätte sie nie verstanden, wieso diese hier bei den Dasati anders funktionierte …
Sie war sicher, dass sie sich immer noch auf Kelewan befand, in der schwarzen Energiekuppel, die sie Augenblicke vor ihrer Gefangennahme gesehen hatte. Dieser »Raum« war nichts weiter als ein Ausschnitt dieser Kuppel, und hoch über ihr befand sich tintenschwarze Leere oder zumindest eine so hohe Decke, dass sie in der Dunkelheit verschwand. Sie blickte sich um, betrachtete, was sie nun klar sehen konnte, da sie nicht mehr an die Steinplatte festgeschnallt war. Der Bereich, in dem sie sich befand, war mit einem Vorhang abgetrennt, aber sie konnte die Biegung der Kuppel sehen, die sich über ihrem Kopf erhob, denn die Stangen und Leisten, die die Vorhänge hielten, waren nur etwa zehn Fuß hoch.
Das Material dieser Vorhänge war einheitlich in einem dunklen Grünblau gehalten, wenn sie das richtig deutete im Licht des Raums, einem pulsierenden Leuchten, das von einem seltsam aussehenden grauen Stein ausging, der in der Nähe auf einem Tisch lag.
Sie schloss die Augen und dehnte ihre Wahrnehmung aus, und nach ein paar Sekunden stieß sie auf etwas, was nur die äußere Hülle der Kuppel sein konnte.
Wie also, fragte sie sich, waren die vertrauten Regeln der Magie von Dasati-Regeln ersetzt worden? Es war, als hätten sie ihre eigene Welt mitgebracht …
Sie stand auf. Plötzlich begriff sie. Sie wollten nicht nur in Kelewan eindringen, sie würden Kelewan verändern, es zu einer Welt machen, auf der sie bequem leben konnten. Sie würden den Planeten kolonisieren!
Jetzt war es von äußerster Wichtigkeit, dass sie sich aus diesem Gefängnis befreite und sofort die Versammlung aufsuchte, um die Erhabenen zu warnen. Die Dasati brauchten diese Kuppel nur auszuweiten. Es würde nicht einfach sein, aber es war ein relativ direktes Verfahren. Bei genügend Energie würde diese Kuppel den gesamten Planeten umfassen und ihn zu einer Welt im zweiten Reich der Wirklichkeit machen oder zumindest zu so etwas wie Delecordia, die Welt, die sich laut Pug zwischen den beiden Ebenen befand.
Sie tastete sich geistig weiter, machte ihre mentalen Finger klein und schwach und war darauf vorbereitet, sie sofort zurückzuziehen, wenn sie ein Lebewesen berührten, damit sie den Todespriestern oder anderen Dasati nicht verriet, dass sie frei war.
Sie sah sich um, entdeckte ihre Kleidung, die jemand in die Ecke geworfen hatte, und zog sich schnell an. Es hätte zwar niemanden gestört, hätte sie die Versammlung der Magier nackt betreten, denn für die Tsurani war Nacktheit etwas erheblich Natürlicheres als für viele der Kulturen auf Midkemia, aber ein solcher Auftritt kam ihr einfach würdelos vor.
Miranda zögerte. Sie musste sich beeilen, und dennoch wäre sie gern noch ein wenig geblieben, um mehr Nachforschungen anstellen und so der Versammlung mehr Information bringen zu können. Einen Augenblick fragte sie sich, ob sie sich mit einem Zauber unsichtbar machen sollte, um weiter in dieser … dieser Blase herumzuschleichen. Nein, sie sollte ihre Warnung lieber sofort überbringen und mit der Macht der Versammlung im Rücken zurückkehren.
Sie schloss die Augen und tastete geistig nach der Hülle über ihr. Es tat weh, und sie zog sich schnell wieder zurück, aber sie hatte erfahren, was sie wissen musste. Die Hülle war die Grenze zwischen ihrem Reich und dem der Dasati oder zumindest dem Teil davon, den sie mit nach Kelewan gebracht hatten. Sie würde sie durchdringen können, aber sie brauchte mehr Zeit, um sich darauf vorzubereiten.
Sie fragte sich, wie viele Dasati sich wohl hier aufhielten, und schickte eine winzige Wahrnehmungsfaser, einen klitzekleinen Fühler aus, um Lebensenergie zu erspüren. Sie fühlte, wie Energie sie streifte, so schwach wie ein Löwenzahnsamen, der vom Wind an ihrer Wange vorübergeweht wurde, und zog sich sofort zurück, um nicht entdeckt zu werden. Das war einer. Wieder und wieder tastete sie, bis sie sicher war, dass sich tatsächlich nur die beiden Todespriester in der Kuppel befanden.
Sie holte tief Luft und machte sich bereit. Dann zögerte sie. Sie wusste, dass es klüger gewesen wäre, sofort zu fliehen, sich so schnell wie möglich zur Versammlung zu begeben und mit einem Heer von Erhabenen zurückzukehren, um dieses Eindringen nach Kelewan im Keim zu ersticken. Aber ein anderer Teil von ihr wollte mehr über die Eindringlinge herausfinden, um besser verstehen zu können, womit sie es zu tun hatten. Eine böse Vorahnung vervollständigte ihren Gedanken: für den Fall, dass Pug nicht aus der Dasati-Welt zurückkehren würde …
Sie war überzeugt, dass sie beide Todespriester überwältigen und vielleicht einen von ihnen gefangen nehmen konnte. Sie hätte nur zu gern Gelegenheit gehabt, die Gastfreundschaft zurückzugeben, die sie von ihnen erfahren hatte. Aber sie wusste auch, dass Varen sehr wahrscheinlich zur Versammlung zurückgekehrt war, und wenn man ihn dort nach ihr fragte, würde er einfach sagen, dass sie unerwartet nach Midkemia zurückgekehrt wäre. Es würde Wochen dauern, bis man in Kelewan erfuhr, dass sie nicht nach Hause gekommen war, und erst dann würde die Versammlung beginnen, ihr Verschwinden zu untersuchen.
Einer der Nachteile, eine Agentin des Konklaves zu sein, bestand in der Geheimhaltung, und diese umfasste die meisten Dinge, die sie tat. Es konnte also länger als einen Monat dauern, bis man sie vermisste.
Sie betrachtete die »Wand« ganz in ihrer Nähe. Sie tastete vorsichtig mit ihren Sinnen und versuchte, den Rhythmus der Energien zu spüren. Das hier würde schwierig werden, da sie die Umgebung nicht gut kannte, und ein Sprung über eine lange Strecke hin zu einer vertrauten Stelle, wie es die Versammlung war, durch diese dichte Kugel aus Magie könnte ebenfalls unbekannte Probleme mit sich bringen.
Also beschloss sie, dass es klüger sei, nur über eine kurze Entfernung zu springen, auf eine Anhöhe, an die sie sich erinnerte, weil die Büsche dort in voller Blüte standen, etwas, das ihr aufgefallen war, bevor sie die Anhöhe überquert und die Kugel gesehen hatte.
Auf einmal spürte sie eine Präsenz. Sofort fuhr sie herum und sah einen der Todespriester, der mit einem Gerät, das er in der Hand hielt, auf sie zeigte. Sie versuchte anzuwenden, was sie über die Magie hier in dieser Kugel gelernt hatte, und wirkte einen Zauber, der ihn einfach nur hätte umwerfen sollen. Stattdessen spürte sie, wie Energien aus ihr herausflossen, als hätte man sie aus ihrem Körper gerissen, und sah die entsetzte Miene des Fremden, als er von einer unsichtbaren Kraft getroffen wurde, die ihn durch den Vorhang warf.
Hinter dem Vorhang befand sich eine Wand aus fremdartigem Holz. Sie explodierte, als der Todespriester hindurchbrach und in dem Raum dahinter landete. Sein lebloser Körper hatte einen blutigen Schmierfleck am Boden hinterlassen, und Miranda stellte überrascht fest, dass Dasati-Blut eher orangefarben als rot war.
Die überraschende Wildheit des Angriffs brachte einen unerwarteten Vorteil: Der zweite Todespriester lag auf dem Boden, bewusstlos von der Wucht, mit der sein Kumpan ihn getroffen hatte.
Miranda sah sich rasch die beiden Dasati an und fand bestätigt, dass der erste tot und der zweite bewusstlos war. Sie schaute sich um, um sich zu überzeugen, dass niemand sonst ihren Erkundungen entgangen war, und einen Augenblick später konnte sie tatsächlich davon ausgehen, dass sie mit einer Leiche und einem potenziellen Gefangenen allein war.
Nachdem eine Trennwand zerbrochen und eine andere umgeworfen war, konnte sie nun den gesamten Raum ihres Gefängnisses überblicken. Die Kuppel hatte einen Durchmesser von etwa hundert Fuß, unterteilt von Holzwänden und Vorhängen, und enthielt zwei Pritschen mit Bettzeug, einen Tisch mit Schreibmaterial und noch eine von diesen seltsamen Steinlampen, eine Kommode und eine große geflochtene Matte auf dem Boden aus gestampfter Erde. Sie entdeckte zudem eine Ansammlung von seltsamen Gegenständen.
Das Einzige, was sie nicht finden konnte, war das Gerät, das ihnen erlaubt hatte, vom Reich der Dasati nach Kelewan zu gelangen. Miranda hatte sich etwas Großes vorgestellt, ähnlich wie die Spaltmaschinen der Tsurani oder zumindest etwas wie ein Podest, auf das man sich stellen musste, aber nichts hier schien einen solchen Zweck zu erfüllen.
Sie war bereits wütend, und nun trieb ihre Frustration sie noch mehr an. Wie konnten es diese Fremden wagen, auf diese Ebene zu kommen und sie anzugreifen? Miranda hatte ihr Leben lang gegen ihr cholerisches Wesen angekämpft, ein Erbe ihrer Mutter, und obwohl sie die meiste Zeit einen relativ ruhigen Eindruck machte, war ihre Familie längst zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste war, ihr in solchen Situationen weiträumig aus dem Weg zu gehen.
Ein Stapel von seltsam wächsernem Papier lag auf dem Boden, und Miranda kniete sich hin, um ein paar Blätter aufzuheben. Wer wusste schon, was hier in dieser fremden Sprache aufgezeichnet war. Vielleicht konnte das neue Erkenntnisse über diese Geschöpfe liefern.
Sie hörte ein leises Stöhnen und sah, dass der noch lebende Todespriester sich wieder bewegte. Ohne nachzudenken, richtete sie sich auf, machte einen Schritt und trat ihm dann so fest gegen das Kinn, wie sie konnte.
»Au!« Das Kinn des Dasati fühlte sich an wie Granit. »Verdammt!«, schimpfte sie, denn sie befürchtete, sich den Fuß gebrochen zu haben. Die Papiere in der Hand, kniete sie sich neben den bewusstlosen Mann und packte ihn vorn am Gewand. »Du kommst mit mir!«, zischte sie.
Sie schloss die Augen und wandte ihre gesamte Aufmerksamkeit den Wänden der Kugel zu, bis sie den Fluss der Energie spüren und sich auf ihn einstimmen konnte, so wie man die Wirbel an einer Laute dreht, um die Tonhöhe der Saiten zu ändern.
Als sie glaubte, fertig zu sein, wünschte sie sich nach draußen, ein kleines Stück von der Wand entfernt. Sie schrie, als ihr ganzer Körper einen Moment lang von einer Kaskade von Energie getroffen wurde, als schnitte Eis in ihre Nerven, dann kniete sie auf dem trockenen Gras in den Hügeln der Provinz Lash. Es war Morgen, was sie aus irgendeinem Grund überraschte, und sie konnte die Schmerzen, die sie beim Atmen hatte, kaum ertragen.
Ihr gesamter Körper protestierte gegen die Umkehr ihrer Umgebung. Was immer die Dasati getan hatten, um ihr die Möglichkeit zu geben, auf ihrer Ebene zu leben oder vielmehr in dem Stück davon unter der Kuppel – wieder herauszukommen verursachte ihr mörderische Schmerzen.
Der Todespriester schien den Übergang ebenfalls überlebt zu haben. Sie kniete neben ihm und umklammerte immer noch sein Gewand, als würde einzig diese Verbindung sie bei Bewusstsein halten. Ein Augenblick verging, die Schmerzen ließen ein wenig nach, und schließlich spürte sie, wie sie sich langsam anpasste. Sie holte tief und keuchend Luft und blinzelte, um klarer sehen zu können, dann schloss sie die Augen wieder. »Das ist nicht gut.«
Sie holte noch einmal tief Luft, ignorierte die brennenden Schmerzen, die das Öffnen der Augen verursacht hatte, und wünschte sich in den Musterraum der Versammlung …
Zwei Magier befanden sich im Raum, als sie erschien. Sie ließ ihren Gefangenen fallen.
»Fesselt ihn! Er ist ein Todespriester der Dasati!« Sie wusste nicht, ob diese beiden erfahren hatten, was Pug der Versammlung berichtet hatte, seit der Talnoy nach Kelewan gebracht worden war, um ihn dort zu studieren, aber jeder Erhabene hatte sicher von den Dasati gehört. Einen bewusstlos vor ihren Füßen liegen zu haben ließ sie einen Moment zögern, aber dann beeilten sich die beiden Schwarzen Roben, ihrer Anweisung nachzukommen.
Die Aufregung der Flucht und das Mitschleppen eines Gefangenen hatten Miranda ans Ende ihrer ohnehin geschwächten Kräfte gebracht. Sie machte zwei taumelnde Schritte, dann fiel sie bewusstlos zu Boden.
Als Miranda die Augen wieder öffnete, befand sie sich in dem Raum, der ihr oder Pug zur Verfügung stand, wenn sie Kelewan aufsuchten. Alenca, das älteste Mitglied der Versammlung der Magier, saß auf einem Hocker neben ihrem Bett, mit gefasster Miene wie das eines Großvaters, der geduldig darauf wartet, dass ein Kind nach einer Krankheit wieder erwacht.
Miranda blinzelte, dann krächzte sie: »Wie lange?«
»Ein Nachmittag, die darauf folgende Nacht und heute Morgen. Wie geht es Euch?«
Miranda setzte sich vorsichtig auf und entdeckte, dass sie ein schlichtes weißes Leinenhemd trug.
Alenca lächelte. »Ich hoffe, Ihr nehmt es uns nicht übel, dass wir Euch ein wenig gesäubert haben. Ihr wart in einem schlimmen Zustand, als Ihr hier erschienen seid.«
Miranda schwang die Beine aus dem Bett und stand vorsichtig auf. Ihr gesäubertes, gebügeltes Gewand lag auf einem Sofa vor dem Fenster, durch das man den See sehen konnte. Die Nachmittagssonne glitzerte auf dem Wasser.
Ohne sich um den alten Mann zu kümmern, zog Miranda das Hemd aus und ihr Gewand an. »Was ist mit dem Dasati?«, fragte sie und betrachtete sich in dem kleinen Spiegel an der Wand.
»Er ist immer noch bewusstlos und liegt, wie es aussieht, im Sterben.«
»Tatsächlich?«, fragte Miranda. »Ich dachte nicht, dass er so schwer verletzt ist.« Sie blickte den alten Magier an. »Ich muss ihn sehen, und wir müssen so viele Mitglieder, wie Ihr könnt, zur Versammlung rufen.«
»Das ist bereits geschehen«, erwiderte der alte Mann mit einem leisen Lachen. »Es hat sich schnell verbreitet, dass wir einen Gefangenen haben, und nur die Mitglieder, die zu krank zum Reisen sind, sind nicht hier.«
»Wyntakata?«, fragte Miranda.
»Wird selbstverständlich vermisst.« Er bedeutete Miranda, durch die Tür zum Flur zu gehen, und folgte ihr dann. »Wir nehmen an, er ist entweder tot oder hatte etwas mit dieser Sache zu tun.«
»Er ist nicht Wyntakata«, sagte Miranda. »Er ist Leso Varen, der Nekromant.«
»Ah, das erklärt vieles.« Der alte Mann seufzte, während sie um eine Ecke bogen. »Es ist wirklich eine Schande. Ich mochte Wyntakata, obwohl er immer vom Hundertsten ins Tausendste kam, wenn er etwas sagte. Aber er war schlau und stets ein angenehmer Begleiter.«
Es fiel Miranda schwer, den Wirt von seinem Parasiten zu unterscheiden, aber ihr wurde klar, dass das Bedauern des alten Mannes aufrichtig war. »Es tut mir leid, dass Ihr einen Freund verloren habt«, sagte sie, »aber ich fürchte, wir könnten sehr viele Freunde verlieren, bevor diese Sache vorbei ist.«
Sie blieb stehen, wo weitere Flure abzweigten, und sah Alenca an, der auf den Korridor zeigte, den sie nehmen sollten. »Wir halten den Dasati in einem Raum mit Schutzzaubern gefangen.«
»Gut«, sagte Miranda.
Zwei Magieschüler in grauen Gewändern standen an der Tür Wache, und drinnen standen zwei Erhabene neben dem Todespriester.
Einer, ein Mann namens Hostan, grüßte Miranda, während der andere sich über die bewusstlose Gestalt auf dem Strohsack beugte. »Cubai und ich sind überzeugt, dass etwas ganz und gar nicht stimmt mit diesem … Mann.«
Der Magier, der den Todespriester untersucht hatte, nickte. »Es lässt sich nicht erkennen, ob er wieder zu sich kommen wird, und sein Atem wirkt angestrengt. Wäre er ein Mensch, würde ich sagen, er hat Fieber.« Ratlos schüttelte er den Kopf. »Aber bei diesem Geschöpf habe ich nicht die geringste Ahnung, worauf ich achten soll.«
Cubai war ein Magier, der sich viel mehr für die Heilkunst interessierte als die meisten Erhabenen, da das eigentlich die Domäne von Heilern vom Niederen Pfad der Magie und von Priestern bestimmter Orden war. Miranda hielt ihn für ideal, um auf den Todespriester aufzupassen.
»Als ich ihre Gefangene war«, sagte sie, »habe ich ein paar Dinge über diese Geschöpfe herausgefunden. Die Dasati sind durchaus menschenähnlich, zumindest in dem Sinn, wie uns auch Elfen, Zwerge und Kobolde ähneln: grob menschlich der Form nach, aufrecht auf zwei Beinen stehend, Augen vorn in einem erkennbaren Gesicht, und ich weiß, dass es bei ihnen zwei Geschlechter gibt und die weiblichen Dasati Kinder zur Welt bringen. Ich habe das herausfinden können, als ich von den Todespriestern genau untersucht wurde. Ich beherrsche ihre Sprache nicht, aber ich habe ein oder zwei Wörter aufgeschnappt und eine gewisse Vorstellung davon erhalten, was sie über Menschen denken.«
Sie drehte sich um, als eine Handvoll Magier in den Raum kamen, nachdem sie erfahren hatten, dass Miranda wach und zu dem Todespriester gegangen war. Sie hob die Stimme, sodass alle sie hören konnten. »Sie sind körperlich erheblich stärker als wir. Ich nehme an, es handelt sich um einen Aspekt ihres Wesens, der von ihrer Anwesenheit auf diesem Planeten verstärkt wird. Aber ich glaube, sie haben gewisse Schwierigkeiten mit den Unterschieden zwischen den beiden Planeten, daher die Energiekuppel, die sie geschaffen haben, um darin zu leben. Dennoch, jeder durchschnittliche Dasati-Krieger kann alle bis auf die stärksten Menschen besiegen, seien es Tsurani-Krieger oder Soldaten des Königreichs.« Dieser Zeitpunkt war so gut wie jeder andere, mögliche Hilfe aus Midkemia zu erwähnen, dachte sie.
Sie schaute hinab zu dem Todespriester und versuchte, das, was sie sah, mit dem in Verbindung zu bringen, was sie bemerkt hatte, als er und sein Kollege ihre Experimente an ihr durchgeführt hatten. »Er sieht nicht gut aus, das ist eindeutig.« Sie beugte sich über ihn und bemerkte einen Schimmer von Schweiß auf seiner Stirn. »Ich denke, Ihr habt recht hinsichtlich des Fiebers, Cubai. Ich glaube, er ist auch blass, aber das könnte vom Unterschied des Lichts in zwei …« Sie brach ab, als sie sah, dass die Lider des Dasati flatterten, und trat zurück. »Ich glaube, er wacht auf!«
Sofort begannen zwei Magier, Schutzzauber zu beschwören, während andere schnell Einschränkungszauber wirkten, aber der Dasati wachte nicht wirklich auf oder erhob sich. Stattdessen bog er sich mit einem leisen, gequälten Stöhnen und fing an sich zu verkrampfen.
Miranda zögerte, ihn zu berühren, und dieses Zögern hielt sie auch davon ab, ihn aufzufangen, als er von der Matratze auf den Boden fiel.
Während er heftiger um sich schlug, fing seine Haut an, Blasen zu werfen. Ohne genau zu wissen, wieso sie es tat, rief Miranda: »In Deckung!«
Die Magier zogen sich zurück. Plötzlich umzuckten Flammen den Körper des Todespriesters, und dann wurden die, die immer noch in der Nähe standen, von einem gewaltigen Anwachsen von Hitze und Licht beinahe geblendet, die Flammen versengten ihnen die Haare, und sie wichen schnell weiter zurück.
Es stank nach Schwefel und verfaulendem Fleisch, und vielen wurde übel von dem Gestank. Miranda ah, dass auf dem Boden nur noch der schwache Umriss seines Körpers in weißer Asche geblieben war.
»Was ist hier gerade passiert?«, fragte Alenca, offensichtlich erschüttert von dem Geschehen.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Miranda. »Ich denke, dass sie außerhalb der Kuppel nicht mit dem Überschuss an Energie zurechtkommen, der für uns alltäglich ist. Es ist womöglich zu viel für ihn gewesen, und … nun ja, Ihr habt gesehen, was passiert ist.«
»Was jetzt?«, fragte der alte Magier.
»Wir gehen wieder zur Kuppel und untersuchen sie«, antwortete Miranda und übernahm damit ungefragt das Kommando. »Dieses Eindringen stellt eine Gefahr für das Kaiserreich dar.«
Das allein genügte, um die Erhabenen zu mobilisieren. Alenca nickte. »Wir müssen nicht nur Ermittlungen anstellen, sondern diese Kuppel vernichten.« Er wandte sich einem anderen Erhabenen zu und sagte: »Hochaka, würdet Ihr so gut sein, dem Licht des Himmels in der Heiligen Stadt Bericht zu erstatten? Der Kaiser muss erfahren, was geschieht, und richtet ihm aus, dass wir ihm einen detaillierteren Bericht schicken, wenn wir fertig sind.«
Miranda amüsierte sich über den entschlossenen Tonfall des alten Magiers; als junger Mann musste er eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein. »Ich habe mich in der Kuppel magisch umgesehen, bevor ich geflohen bin.« Sie hielt um der Wirkung willen inne, bevor sie hinzufügte: »Ich bitte, dass Ihr mir gestattet, Euch zu führen.«
Die Erhabenen im Zimmer schienen verblüfft – eine Frau, und auch noch eine Ausländerin, die sie führen wollte? Alenca aber sagte mit ruhiger, klarer Stimme: »Das ist nur logisch.«
Mit diesen vier Worten übertrug er Miranda das Kommando über die Versammlung der Magier, der mächtigsten Vereinigung von Magie auf zwei Welten.
Sie nickte. »In der Zwischenzeit bringt bitte innerhalb der nächsten Stunde so viele Mitglieder der Versammlung zusammen, wie in die Große Halle passen. Ich werde berichten, was ich weiß, und vortragen, was meiner Meinung nach getan werden sollte.«
Magier eilten davon, um mittels ihrer Künste so viele Angehörige der Versammlung herbeizurufen, wie sie erreichen konnten. Miranda würde ihnen dann erklären, dass das Kaiserreich von Tsuranuanni und der gesamte Planet Kelewan ihrer bisher größten Gefahren gegenüberstanden.
Sie kehrte in ihr Zimmer zurück und ließ sich dort auf das weiche Sofa fallen. Sie wagte nicht, sich aufs Bett zu legen, denn sie wusste, dass sie dann schnell wieder eingeschlafen wäre. Eine durchgeschlafene Nacht und eine Mahlzeit machten nicht rückgängig, was die Dasati ihr angetan hatten. Aber sie musste schnell handeln, denn sie wusste, dass die Zeit gegen sie arbeitete. Welchen Prozess die Dasati auch begonnen hatten, er würde umso schwieriger zu unterbrechen sein, je mehr Zeit verging.
Ein Klopfen an der Tür kündigte das Eintreffen einer Schülerin in grauem Gewand an, eine der wenigen jungen Frauen, die nun Magie lernten. Sie brachte ein Tablett mit einem Porzellankrug, einem Becher und einem Teller mit Obst und Gebäck. »Erhabene, der Erhabene Alenca dachte, Ihr solltet vielleicht etwas zu Euch nehmen.«
»Danke«, sagte Miranda und bedeutete dem Mädchen mit einer Geste, das Tablett abzustellen. Sobald die junge Frau weg war, wurde sich Miranda bewusst, welch großen Hunger sie hatte. Sie fiel über das Essen her und spürte bald, wie die Energie in ihren schmerzenden, beschädigten Körper zurückkehrte. Wieder wünschte sie, sie wäre dem Vorbild ihres Mannes gefolgt und hätte mehr Priestermagie studiert. Pug hatte sich dieser Kunst schon mehrere Male bedient, und Miranda wusste, dass er durch diese Art von Magie die Möglichkeit gehabt hätte, dass sie sich fühlte, als hätte sie eine Woche geschlafen und nicht Tage von Demütigung und Folter ertragen müssen, und das wäre ihm schon mit einer einfachen Beschwörung oder einem widerlich schmeckenden, aber wirkungsvollen Elixier gelungen.
Die Erinnerung an Pug machte sie nachdenklich. Sie konnte sich keine drei Personen vorstellen, die eine Reise ins Reich der Dasati besser überstehen könnten – auf die zweite Ebene der Wirklichkeit, wie Pug es nannte. Dennoch machte sie sich Sorgen. Miranda war eine komplizierte Frau mit komplexen Gefühlen, und sie liebte ihren Mann sehr. Nicht mit der selbstvergessenen Leidenschaft der Jugend – dies hatte sie schon hinter sich gehabt, als Pug noch ein Kind gewesen war –, sondern mit einer tiefen Wertschätzung seiner einzigartigen Eigenschaften und seines Wissen, was ihn zu einem so hervorragend zu ihr passenden Lebensgefährten machten. Ihre Söhne waren ein unerwarteter Bonus machtvoller Lebensmagie gewesen und hatten sich als ein Segen erwiesen, mit dem sie nie gerechnet hätte. Einige Leute hielten sie vielleicht nicht gerade für die beste Mutter, aber sie genoss es, die Mutter solcher Männer zu sein.
Caleb war eine Herausforderung gewesen, als sich herausgestellt hatte, dass er magisch nicht begabt war, zumal sich Magnus in dieser Hinsicht als Wunderkind erwiesen hatte. Sie liebte beide Söhne – mit diesem besonderen Gefühl für einen Erstgeborenen, das sie gegenüber Magnus empfand, und diesem ebenso besonderen Gefühl für den Jüngsten der Familie, das noch vergrößert wurde durch ihr Wissen, wie schwierig Calebs Kindheit in einer Gemeinschaft von Magiebenutzern gewesen war. Die Streiche der anderen Kinder waren besonders grausam gewesen, und dass Magnus zu seinem kleinen Bruder gehalten hatte, erwies sich gleichzeitig als Segen und Fluch.
Dennoch, beide Kinder waren zu Männern von hervorragenden Eigenschaften herangewachsen, Männern, die sie mit Liebe und Stolz betrachtete.
Sie blieb einen Moment schweigend sitzen und stand dann auf. Diese drei Männer – Pug, Magnus und Caleb – waren Grund genug für sie, dass sie die Dasati-Welt notfalls zerstören würde, denn sie waren ihr wichtiger als jeder andere in ihrer langen Geschichte. Sie spürte, wie sie wütend wurde, und wusste, wäre Pug hier gewesen, hätte er ihr gesagt, sie solle ihr cholerisches Temperament zügeln, da es nur ihr Urteilsvermögen trübte.
Miranda reckte sich und ignorierte protestierende Muskeln und Gelenke. Sie würde später Zeit finden, mit ihren körperlichen Problemen fertigzuwerden. Im Augenblick musste sie sich um eine bevorstehende Invasion kümmern.
Ein Klopfen an der Tür zeigte, dass Alenca eingetroffen war. »Sie sind hier«, sagte er.
Miranda nickte. »Danke, alter Freund.« Sie ging mit ihm zur Großen Halle der Versammlung der Magier.
Wie erwartet waren beinahe alle Plätze besetzt, und leises Murmeln verklang, als Alenca seine Position auf dem Podium einnahm.
»Brüder … und Schwestern«, begann er, denn er erinnerte sich rechtzeitig, dass es nun auch vereinzelt weibliche Erhabene gab. »Wir sind hier auf die Bitte einer alten Freundin – Miranda.« Er trat beiseite und ließ sie seinen Platz einnehmen.
Es gab niemanden in der Großen Halle, der nicht wusste, wer Miranda war. Pug hatte bereits den Status eines Erhabenen gehabt, noch bevor Alenca zur Welt gekommen war, und Miranda hatte durch ihre Verbindung mit ihm einen gewaltigen Vorteil – und selbstverständlich war sie selbst ebenfalls eine mächtige Anwenderin der Magie.
»Kelewan sieht sich einer Invasion gegenüber«, sagte Miranda ohne Einführung. »In diesem Augenblick dehnt sich eine Kuppel schwarzer Energie in einem Tal weit im Norden aus. Ich habe sie zuerst als Brückenkopf betrachtet, ganz ähnlich wie der Spalt, den eure Ahnen für ihre Invasion auf meinem Heimatplaneten benutzten.« Sie bezog sich absichtlich auf den Spaltkrieg. Sie wusste, dass jeder Schüler in dieser Versammlung über die gesamte tragische Geschichte dieser schlecht beratenen Invasion informiert war, in der das Leben von so vielen um der Machtpolitik willen geopfert worden war. Das tödliche »Spiel des Rates« hatte für Tausende von Soldaten beider Seiten den Tod bedeutet, weil eine politische Fraktion im Hohen Rat nicht hatte nachgeben können. Mehrere Erhabene waren Mitverschwörer bei dieser mörderischen Intrige gewesen, die den Sinn gehabt hatte, den damaligen Kriegsherren und seine Fraktion in eine unangreifbare Machtposition zu bringen. Erst das Einschreiten von Pug und der Aufstieg einer bemerkenswerten jungen Frau, Lady Mara von den Acoma, hatten dieses tödliche Spiel beendet.
»Alle hier wissen, warum der Spaltkrieg geführt wurde«, fuhr Miranda fort, »also werde ich euch nicht über Dinge belehren, die ihr bestens kennt. Bei der derzeitigen Invasion haben wir es allerdings nicht mit Feinden zu tun, die nach politischem Einfluss und reicher Beute streben. Es handelt sich überhaupt nicht um einen Krieg, wie wir ihn kennen. Dies hier ist nicht nur eine Invasion, sondern der Beginn einer Kolonisierung, ein Prozess, der mit der vollkommenen Vernichtung jeder Lebensform auf diesem Planeten enden wird.«
Das führte nach einem kollektiven Nach-Luft-Schnappen zu ungläubigem Gemurmel. Miranda hob die Hand, sah sich um und suchte Augenkontakt mit so vielen Angehörigen der Versammlung wie möglich. Dann sagte sie: »Folgendes weiß ich: Die Dasati wollen Eure Welt umwandeln. Sie werden sie vollkommen verändern, damit sie ihrer eigenen ähnlich wird. Sie werden jedes Stück Land mit Geschöpfen ihrer eigenen Welt versehen, vom kleinsten Insekt bis zum größten Tier. Das Wasser wird giftig sein, die Luft wird eure Lungen verbrennen, und die Berührung noch des geringsten Geschöpfs, das sie herbringen, wird das Leben aus euren Körpern saugen. Das hier ist keine Geschichte, die jemand erfunden hat, um Kinder zu erschrecken, Erhabene. Es ist, was die Dasati unter der schwarzen Kuppel, aus der ich geflohen bin, bereits getan haben.«
Eines der jüngeren Mitglieder rief: »Wir müssen handeln!«
»Ja«, stimmte Miranda zu. »Schnell, aber nicht übereilt. Ich schlage vor, eine Gruppe von denen unter uns, die die Kunst von Licht, Hitze und anderen Aspekten von Energie am besten beherrschen, zusammen mit denen, die Meister sind, was lebende Geschöpfe angeht – und vielleicht sollten wir uns auch mit den mächtigsten Magiern des Niederen Pfads in Verbindung setzen –, sollte sich sofort in dieses Tal begeben, um die Gefahr zu studieren, und dann müssen wir diese Kuppel zerstören.«
»Wann soll das geschehen?«, fragte der junge Magier, der schon zuvor das Wort ergriffen hatte.
»Sobald wir können«, erwiderte Miranda. »Wir müssen uns mit dem Kaiser in Verbindung setzen, und wir werden Soldaten brauchen. Die Dasati werden nicht einfach dasitzen und zulassen, dass wir ihre Kuppel vernichten. Wir werden Wesen gegenüberstehen, die keine Angst haben zu sterben, Wesen, die unserer Magie viel entgegensetzen können, und wir werden starke Arme und Schwerter brauchen, um mit ihnen fertigzuwerden.«
»Ich schlage vor«, sagte Alenca, »dass Ihr in kleineren Gruppen besprecht, was getan werden muss, und dann treffen wir uns nach dem Essen wieder. Dann werden wir entscheiden, auf welche Weise wir dieser Gefahr entgegentreten.« Er stieß seinen Stab auf den Steinboden und erklärte die Besprechung damit für beendet.
Miranda wandte sich dem Ausgang zu und flüsterte Alenca zu: »Habt Ihr diesen jungen Mann gebeten, die Diskussion ein wenig voranzutreiben?«
»Ich finde, seine Zeiteinteilung war perfekt.«
»Ihr seid ein sehr gefährlicher Mann, alter Freund.«
»Jetzt warten wir«, sagte Alenca. »Aber ich denke, heute Abend wird es eine sehr lebhafte Diskussion geben, und ich kann keinen anderen Weg sehen als den, den Ihr vorgeschlagen habt.«
Sie gingen weiter auf Mirandas Zimmer zu. »Das hoffe ich«, sagte sie, »und ich hoffe, dass mein Plan funktioniert. Ansonsten müssten wir das Kaiserreich auf einen Krieg gegen den gefährlichsten Kriegsherren in Eurer Geschichte vorbereiten.«
Zweihundert Männer standen bereit, Soldaten aus den nächsten Landsitzen der Provinz, die ohne Zögern auf den Ruf der Erhabenen von Tsuranuanni reagiert hatten. Sie waren in zwei Gruppen aufgeteilt, beide unter Befehl eines Erhabenen, der seinerseits auf Anweisungen von Miranda wartete. Obwohl im Kaiserreich länger als eine Generation Frieden geherrscht hatte, waren Tsurani-Disziplin und ihre Ausbildung unverändert geblieben. Das hier waren zähe, entschlossene Männer, bereit, für die Ehre des Hauses ihres Herrn zu sterben.
Miranda und ein Dutzend Erhabene gingen langsam den Hügel hinauf, von dessen Kuppe aus sie die Dasati-Kuppel das erste Mal gesehen hatte. »Alles bereit?«, fragte sie leise.
Männer nickten und wechselten Blicke. Nicht ein einziger lebender Erhabener des Kaiserreichs hatte schon einmal in einem Kampf gestanden; die letzten Erhabenen waren im Spaltkrieg durch Feindeinwirkung umgekommen, mehr als hundert Jahre zuvor. Dies hier waren Gelehrte, keine Krieger. Aber diese Magier waren auch diejenigen, die unglaubliche Macht ins Spiel bringen konnten, würde das notwendig werden.
Langsam bewegten sich dreizehn Magiebenutzer, eindeutig die machtvollsten Anwender dieser geheimnisvollen Kunst, den Hügel hinauf. Vor der Kuppe stellte sich Miranda auf die Zehenspitzen, um über den Hügel zu spähen, und sagte dann: »Verdammt!«
Vor ihnen lag ein leeres Tal, und der einzige Beweis für die Anwesenheit der Dasati bestand in einem großen Kreis aus geschwärzter Erde, wo sich die Kuppel befunden hatte.
»Sie sind weg«, sagte einer der jüngeren Magier.
»Sie werden wiederkommen«, erklärte Miranda und drehte sich um. Sie holte tief Luft, dann sagte sie: »Ich schlage vor, dass Ihr in jedem Haus im Kaiserreich die Neuigkeiten verbreitet, dass jedes Dorf und jeder Bauernhof, jedes Tal und jeder Hügel, jede isolierte Ritze durchsucht und wieder durchsucht werden muss.« Sie sah allen in ihrer Nähe in die Augen. »Sie werden wiederkommen, und das nächste Mal wird es nicht nur eine kleine Kuppel sein. Das nächste Mal werden sie kommen, um zu bleiben.«
Gambit
Jommy verzog das Gesicht.
Er saß unter einem Zelttuch, das rasch aufgehängt worden war, um Schutz vor dem gnadenlosen Regen zu bieten, hatte die Knie an die Brust gezogen und sagte: »Ich verstehe einfach nicht, warum.«
»Wir fragen nicht, warum«, entgegnete Servan, der neben dem jungen Offizier kauerte, »wir befolgen einfach Befehle.«
Sie saßen an einem Hügelabhang, von dem aus man eine ferne Bucht sehen konnte. Ein Aussichtspunkt, der ihnen hoffentlich die Möglichkeit bieten würde zu verhindern, dass irgendwer eintraf, ohne dass sie es bemerkten. Im Augenblick bestand das Problem darin, dass der Regen die Aussicht auf eine Weise einschränkte, dass eine zweite Person in der Nähe sitzen und ebenfalls Ausschau halten musste. Und so hatte man Jommy ausgewählt, gemeinsam mit Servan zu wachen.
Jommy sah seinen Begleiter an. Das schmale Gesicht, bei dem das dunkle Haar jetzt nass in der Stirn klebte, war in den letzten Monaten erstaunlich gealtert. Das anstrengende Leben auf dem Marsch hatte Servans jugendliche Gestalt zudem einige Pfunde gekostet, und Tage in der Sonne und das Schlafen auf dem Boden hatten seine Haut gebräunt und ihr ein ledriges Aussehen verliehen. Der junge Höfling, den Jommy in den letzten Monaten gut kennengelernt hatte, war jetzt ein junger Veteran, der sich auf seinem dritten Feldzug in ebenso vielen Monaten befand.
Die beiden waren niemals Freunde gewesen, aber zusammen mit ihren vier anderen Begleitern – Tad, Zane, Grandy und Geoffrey – wussten sie einander nun als verlässliche Kameraden zu schätzen. In der relativ kurzen Zeit, nachdem man sie aus der Universität von Roldem herausgerissen und in die Rolle junger Offiziere geworfen hatte, hatten sie eine intensive Ausbildung in der Realität militärischen Lebens erhalten. Zu Jommys Ärger hatte man Servan diesmal einen höheren Rang verliehen, was bedeutete, dass Jommy seinen Befehlen ohne Zögern folgen musste. Bisher hatte sich für Servan keine Gelegenheit ergeben, sich für den Unfug zu rächen, den Jommy ihm bei ihrer letzten Operation angetan hatte, als ihm das Kommando zugefallen war, aber Jommy wusste, dass dies noch kommen würde.
Die beiden jungen Offiziere waren an einen Ort tief in den Bergausläufern einer Region abkommandiert worden, die als die Berge der Quor bekannt waren, eine zerklüftete felsige Halbinsel, die von der Ostgrenze des Kaiserreichs von Groß-Kesh nach Norden vorragte. Etwa hundert Mann, eingeschlossen diese beiden jungen Offiziere, waren vor einer Woche an dieser Küste abgesetzt worden. Man ging davon aus, dass jemand hier an Land gehen würde, obwohl man ihnen nicht mitgeteilt hatte, um wen es sich dabei handelte. Jommy wusste lediglich, dass es keine Freunde sein würden.
Auch Jommy war älter geworden, aber als Bauernjunge und Arbeiter für eine Karawane war er bereits an ein härteres Leben gewöhnt gewesen, als sein Begleiter es geführt hatte, und man sah ihm seine neuesten Erfahrungen nicht so deutlich an. Seine gewiefte Dreistigkeit hatte sich in eine ruhige Selbstsicherheit verwandelt, und die Zeit, die er mit den anderen jungen Offizieren der Universität von Roldem verbracht hatte, hatte ihn ein gewisses Maß an Demut gelehrt, denn offenbar hatten dort alle irgendetwas besser gekonnt als er. Dennoch, ein Teil seines Wesens blieb unverändert: seine beinahe einzigartige Fähigkeit, den meisten Situationen etwas Amüsantes abzugewinnen.
Diese hier brachte ihn allerdings an seine Grenzen. Ihre einzige Wärmequelle war ein Feuer in einer großen Höhle eine Meile den elenden Hang hinauf, und die Feinde, die angeblich erscheinen sollten, gaben sich offenbar keine Mühe, pünktlich zu sein.
»Nein«, sagte Jommy, »ich meine nicht, warum wir hier sind. Ich meine, warum sind wir hier?«
»Hast du geschlafen, als der Hauptmann seine Befehle gegeben hat?«, erklang eine Stimme hinter ihnen.
Jommy drehte sich um, erkannte aber nur eine schattenhafte Gestalt, die sich unbemerkt genähert hatte. »Ich wünschte, du würdest das nicht tun«, beschwerte er sich.
Der Mann setzte sich neben Jommy und ignorierte dabei, dass sich die Hälfte seines Körpers immer noch außerhalb des knapp bemessenen Schutzes des behelfsmäßigen Unterstands befand. »Ich wäre wirklich ein schlechter Dieb, wenn ich mich nicht in einem wilden Sturm an euch beide anschleichen könnte.«
Der Neuankömmling war nur ein paar Jahre älter als sie, aber sein Gesicht zeigte Spuren verfrühten Alterns, darunter auch ein paar unerwartete graue Haare in seinem dunklen Bart. Er war beinahe so groß wie Jommy, aber nicht ganz so kräftig; seine Bewegungen und seine Haltung wiesen jedoch auf eine drahtige Zähigkeit hin, die Jommy überzeugte, dass er bei einem Faustkampf ein schwieriger Gegner sein würde.
Servan nickte. »Jim«, sagte er zum Gruß.
Der junge Dieb war in das gleiche Netz von Intrigen geraten, das Servan und Jommy auf diesen einsamen Hügel verschlagen hatte. Er war eine Woche zuvor erschienen, auf einem Schiff mit Nachschub für das, was Jommy inzwischen bei sich als »diese verfluchte Unternehmung« bezeichnete.
Servan und Jommy dienten beide derzeit in der Armee von Roldem, obwohl Jommy aus einem Land auf der anderen Seite der Welt stammte. Servan war von Adel, sogar von königlicher Abkunft und in der Nachfolgelinie für den Thron, falls zehn oder elf Verwandte unerwartet dahinscheiden sollten. Aber im Augenblick waren sie Teil von etwas, das nur als äußerst ungewöhnliche Kompanie bezeichnet werden konnte, Soldaten aus Roldem, dem Königreich der Inseln, Kesh und sogar eine Gruppe von Bergleuten und Pionieren aus der Zwergenstadt Dorgin, alle unter dem Kommando von Kaspar von Olasko, ehemals Herzog eines Landstrichs, der nun eine Provinz des Königreichs Roldem darstellte. Früher ein gejagter Gesetzloser, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt war, war es ihm in den letzten Jahren gelungen, seinen Ruf wiederherzustellen, und nun hatte er einen besonderen Status sowohl in Roldem als auch im Kaiserreich Groß-Kesh.
Sein Adjutant war ein Hauptmann aus Roldem namens Stefan, der zufällig Servans Vetter war, was ihn zu einem weiteren weitläufigen Verwandten des Königs von Roldem machte.
Das Eintreffen des Neuen hatte einen zusätzlichen erstaunlichen Aspekt dieser Expedition enthüllt. Jim war einer von einem halben Dutzend Männern, die man sich selbst dann, wenn man über eine lebhafteste Fantasie verfügte, nicht als Soldaten vorstellen konnte, die aber bei Soldaten untergebracht waren, mit Soldaten auszogen und von denen man erwartete, dass sie Befehlen ebenso gehorchten, als wären sie Soldaten. Jommy und Servan hatten dem Dieb darüber nur entlocken können, dass er zu einer besonderen Gruppe von »Freiwilligen« gehörte, die hier war, um mit den vereinten Streitkräften von Roldem, Kesh, dem Königreich und ein paar Offizieren der östlichen Königreiche ausgebildet zu werden.
Der neugierige Jommy hatte einiges unternommen, um herauszufinden, was denn nun eigentlich los war, aber die letzten paar Monate in diversen Einheiten aus Roldem hatten ihn auch gelehrt, dass ein junger Offizier gut daran tat, zu schweigen und zuzuhören. Servan verfügte bereits über diese Eigenschaften.
Dennoch, Jommy konnte seine Neugier nicht vollkommen unterdrücken, also dachte er, eine andere Herangehensweise an das Thema könnte ihm vielleicht einen Hinweis darauf geben, was hier los war. »Jim, du kommst aus dem Königreich, richtig?«
»Ja«, erwiderte der junge Dieb. »Ich bin in Krondor geboren und habe dort auch einen Großteil meines Lebens verbracht.«
»Du behauptest, ein Dieb zu sein …«, begann Jommy.
Jim verlagerte das Gewicht und streifte Jommy dabei leicht, dann hielt er ihm grinsend seinen Beutel vor die Nase. »Das hier gehört dir, glaube ich?«
Servan musste sich anstrengen, nicht zu lachen, als Jommy sich seinen Beutel schnappte, den er unter seinem Hemd getragen hatte. »Also gut«, sagte er. »Du bist ein Dieb.«
»Ein sehr guter Dieb.«
»Ein sehr guter Dieb«, gestand Jommy ihm zu. »Aber ich würde wirklich gern wissen, warum sich ein sehr guter Dieb aus Krondor hier am Rand der Welt wiederfindet.«
»Das ist so eine Geschichte«, erwiderte Jim vage. »Ich bin viel rumgekommen.«
»Oh«, sagte Servan, der eine Ablenkung von diesem lästigen Regen erwartete.
»Ja«, sagte der freundliche Dieb. »Ich war an ein paar merkwürdigen Orten.« Er lächelte, und Jahre schienen von ihm abzufallen, als er eine beinahe jungenhafte Albernheit an den Tag legte. »Da war diese eine Situation, nicht unähnlich dem, was wir hier erleben, als ich gezwungen war, in einer Höhle auf einer fernen Insel vor einem herabprasselnden Regen wie diesem Schutz zu suchen.«
Jommy und Servan wechselten einen Blick, und beide lächelten, nickten und dachten das Gleiche: Kein Wort von dem, was sie zu hören bekommen würden, würde wahr sein, aber die Geschichte könnte sich als unterhaltsam erweisen.
»Ich befand mich … nun, auf einer Reise, die mich von Krondor wegführte.«
»Geschäfte?«, fragte Servan.
»Gesundheitsgründe«, erwiderte Jim, und sein Grinsen wurde noch breiter. »Es schien mir angeraten, dass ich mich für eine Weile von Krondor fernhielt.«
Jommy versuchte, nicht zu lachen. »Also bist du …?«
»Ich nahm ein Schiff, das von Krondor an die Ferne Küste fahren sollte, und in Carse fand ich ein paar Jungs, die Informationen über ein … ein Unternehmen hatten, das allen, die sich ihm anschlossen, gutes Geld einbringen würde.«
»Piraten«, sagten Jommy und Servan beinahe gleichzeitig.
»Freibeuter, aus Freihafen auf den Sonnenuntergangsinseln.« Jim nickte. »Damals behauptete der Kapitän, unter dem sie segelten, er habe einen Kaperbrief von der Krone. Gesehen habe ich den allerdings nie. Aber da ich damals ein vertrauensseliger Bursche war, glaubte ich ihm.«
Jommy bezweifelte, dass es im Leben des Diebs einen einzigen Augenblick gegeben hatte, in dem er ein »vertrauensseliger Bursche« gewesen war, aber er verkniff sich eine diesbezügliche Bemerkung.
»Also gut, ich bin also auf dieser Insel, in dieser Höhle, mit diesem Elfenmädchen …«
»Hast du etwas ausgelassen?«, fragte Servan.
»Ja, sicher, eine Menge, aber ich rede von seltsamen Orten, an denen ich war.«
»Lass ihn weitererzählen«, sagte Jommy mit schlecht verborgener Heiterkeit.
»Jedenfalls, die Jungs, mit denen ich unterwegs gewesen bin, die suchten nach mir, denn ich hatte ihre nicht gerade ehrenhaften Absichten begriffen, was meinen Anteil am Schatz anging …«
»Schatz?«, warf Servan ein, aber Jommy hob die Hand. Er wollte diese Geschichte hören.
»Ja, das ist ein anderer Teil der Geschichte«, erklärte Jim. »Wie auch immer, wie ich schon sagte, ich versteckte mich in dieser Höhle, wo ich diesem Elfenmädchen begegnet bin, das Jazebel hieß …«
»Jazebel«, wiederholte Jommy.
»Jazebel«, wiederholte auch Jim. »Und sie hatte ihre eigene Geschichte, wie sie dorthin gekommen war. Sie versuchte, sich nicht von diesen Bären umbringen zu lassen, nur, dass es keine richtigen Bären waren, eher große pelzige Eulen.«
»Große pelzige Eulen«, sagte Servan, nun mit eindeutig staunender Miene. Jommy konnte kaum an sich halten, und im Augenblick waren Kälte und Regen vergessen.
»Wie ich schon sagte, es war ein seltsamer Ort, weit hinter den Sonnenuntergangsinseln. Sie hatte Eier für Elfenmagie gesammelt. Aber wie auch immer, sie und ich konnten die Geschöpfe lange genug abwehren, bis meine elenden Kumpane an der Höhle vorbeigezogen waren, und dann schlüpften wir raus und erreichten einen sicheren Ort.«
»Wie bist du je wieder nach Hause gekommen?«, fragte Jommy.
Jim grinste. »Sie hatte diesen magischen Stein, ein Elfending, und sobald wir waren, wo wir waren, konnte sie Magie wirken, und die brachte uns nach Elvandar.«
»Elvandar? Ist das in der Nähe des Wolkenlands?«, fragte Servan; das Wolkenland stammte aus einer Kindergeschichte.
»Elvandar gibt es wirklich, Servan«, sagte Jommy. »Ich kenne Leute, die schon mal dort waren.«
»Demnächst erzählst du mir noch, dass du auch ein paar Elfen kennst.«
Jommy lächelte. »Nicht persönlich, aber ich kenne Leute, die sie kennen.«
»Also«, fuhr Jim fort, »da ich das Mädchen gerettet hatte und all das, gaben die Königin und ihr Gemahl mir zu Ehren ein Festessen, bedankten sich bei mir und sagten, ich sei jederzeit willkommen, wenn ich sie besuchen wollte. Dann halfen sie mir, diesen Außenposten in Jonril zu erreichen – den oben im Herzogtum Crydee, nicht den in Kesh, nach dem er benannt wurde –, und von dort gelangte ich wieder nach Krondor.«
»Erstaunlich«, sagte Jommy.
»Mehr als erstaunlich«, stellte Servan fest. »Unglaublich.«
Jim griff in seine Tunika und zog eine Lederschnur hervor, an der er ein wunderschön gearbeitetes Amulett trug. »Die Königin selbst hat mir das hier gegeben. Sie sagte mir, jeder Elf würde mich daran als Freund ihres Volkes erkennen.«
Sowohl Jommy als auch Servan beugten sich vor, um den Anhänger näher zu betrachten. Es war ein Muster miteinander verbundener Knoten, in Knochen oder Elfenbein geschnitzt, und der Anhänger wirkte tatsächlich so, als wäre er nicht von Menschen hergestellt worden.
Der Dieb wurde plötzlich ernst. »Ich mag vieles sein, Jungs: Schurke, Abenteurer, Dieb und wenn nötig auch ein mörderischer Halsabschneider, aber noch niemand hat Jimmyhand einen Lügner genannt.«
»Jimmyhand?«, fragte Jommy.
»Mein … mein Name als Dieb sozusagen. Nach einem berühmten Dieb von damals, Jimmy die Hand. Einige sagen, dass ich ihm irgendwie ähnlich bin. Und meine Mutter hat sogar behauptet, er wäre mein Urgroßvater gewesen. Aber ich denke, sie wollte nur, dass ich mich irgendwie besonders fühlte. Also habe ich als kleines Kind immer gesagt: ›Ich bin Jimmyhand‹, weil ich das mit ›Jimmy die Hand‹ nicht richtig hinkriegte. Und es blieb hängen. Tatsächlich heiße ich Jim Dasher.«
In der Zeit, die er bei Caleb und seiner Familie auf der Insel des Zauberers verbracht hatte, hatte Jommy oft Geschichten »von damals« gehört, von den Leuten, die dabei gewesen waren, und einige davon hatten sich auch um den berüchtigten Jimmy die Hand gedreht, einen Dieb, der der Legende nach Agent des Prinzen von Krondor geworden war und später einen Adelstitel erhalten hatte. Er war sogar bis zum Herzog von Rillanon und Krondor aufgestiegen, was die beiden mächtigsten Ämter im Königreich waren, wenn man den König nicht mitzählte.
Jommy betrachtete den Dieb forschend. Er kannte ihn kaum, war aber der Ansicht, dass er eine angenehme Gesellschaft war. Seine unglaublichen Geschichten bildeten jedenfalls eine willkommene Abwechslung an jenen langweiligen Tagen, die sie damit verbrachten, auf einen Feind zu warten, der vielleicht niemals eintreffen würde. Er bezweifelte nicht, dass Jim so gefährlich war, wie er behauptete, aber unter der Oberfläche gab es auch etwas, das Jommy schon zu erkennen gelernt hatte, als er noch ein Straßenjunge gewesen war: Sein Instinkt signalisierte ihm, dass er diesem Jim Dasher trauen konnte.
Er nickte und sagte dann: »Jim, ich werde dich nie einen Lügner nennen, bis zu dem Tag, an dem ich dich beim Lügen erwische.«
Jim starrte Jommy einen Augenblick an, dann grinste er. »Also gut.«
Servan wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem fernen Strand zu, den sie bewachen sollten. »Wie lange noch?«
»So lange, wie es braucht«, erwiderte Jommy.
»Also nicht mehr lange«, sagte Jim und zeigte in die verregnete Düsternis. »Ein Boot.«
»Wie kannst du …«, begann Servan, dann sah er es ebenfalls, einen winzigen dunklen Fleck, der mit jedem Augenblick größer wurde.
Ein Langboot fuhr in die Bucht ein …
»Das Schiff liegt wahrscheinlich weiter draußen vor Anker«, sagte Jommy.
»Ich werde dem Hauptmann Bescheid geben«, verkündete Servan und verließ den Unterstand. »Ihr beobachtet sie weiter.«
Auch Jommy kroch heraus. »Gehen wir ein bisschen näher heran.«
Jim hielt ihn zurück. »Warte. Da kommt noch ein Boot.«
Nach einem Moment sah Jommy, wie ein zweites Langboot aus dem Grau auftauchte und dem ersten folgte.
»Nun«, flüsterte Jim, obwohl die Boote viel zu weit weg waren, als dass jemand dort sie hätte hören können, »was hältst du davon?«
»Nun ja«, sagte Jommy, »ich denke, dass die Informationen des Hauptmanns offenbar zutreffen.«
»Nicht, was das zweite Boot angeht«, verbesserte Jim.
Die beiden Langboote wurden an den Strand gerudert, und Männer sprangen heraus, zogen die Boote auf den Sand und sicherten sie mit Stangen und Seilen.
»Sieht aus, als hätten sie vor, eine Weile zu bleiben«, meinte Jommy.
»Was ist denn das?«, fragte Jim und zeigte auf das zweite Boot.
Die Besatzungsmitglieder der beiden Boote waren wie normale Seeleute gekleidet, aber jeder trug ein schwarzes Tuch um den Kopf, das hinter dem linken Ohr verknotet war. Die meisten waren barfuß, was sie ebenfalls als Seeleute kennzeichnete, aber einige hatten schwere Stiefel an. Und der letzte Mann, der aus dem zweiten Boot stieg, hatte sich in ein dunkel orangefarbenes Gewand mit schwarzen Biesen gehüllt. Seine Züge waren unter der Kapuze verborgen, aber die anderen Männer wirkten ihm gegenüber unterwürfig, ja, als fürchteten sie sich vor ihm. Keiner bot ihm Hilfe beim Aussteigen an, und alle machten einen großen Bogen um ihn, als er an Land kam.
»Ein Magier.« Jim spuckte das Wort beinahe aus. »Ich hasse Magier.«
»Ich bin ein paar Magiern begegnet, die ganz in Ordnung waren«, wandte Jommy leise ein.
»Ich nicht. Eine magische Falle in Darindus hätte mir mal beinahe den Kopf abgerissen. Wenn ich Zeit genug habe, kann ich jede Falle entdecken, die ein Sterblicher aufgebaut hat, aber Magie …«
»Na ja«, beharrte Jommy, »ich bin ein paar Magiern begegnet, die ich mochte.«
Jim schwieg, während die Männer am Strand ausschwärmten. Es war klar, dass sie die Umgebung erkundeten, weil sie wissen wollten, ob man sie beobachtete. Jommy und Jim nahmen rasch den behelfsmäßigen Unterstand auseinander, versteckten das Zelttuch hinter dem Baum und zogen sich dann nach rechts in ein dichteres Gebüsch zurück.
Ohne ein Wort darüber zu äußern, teilten sie den gleichen Gedanken: In ein paar Minuten würde eine bewaffnete Kompanie über den Hügel hinter ihnen kommen, doppelt so viele Männer wie dort am Strand, aber bis zu diesem Augenblick wäre es eine gute Idee, sich nicht sehen zu lassen.
Jommy spürte, wie Jim ihn fest an der Schulter packte. Jim zeigte auf sich und Jommy, dann den Hügel hinauf. Jommy wies auf einen kleinen Felsvorsprung ein paar hundert Fuß den Weg entlang, und Jim nickte.
Sie bewegten sich durch den Regen, der ein wenig nachgelassen hatte, was Jommy ärgerte. Er wollte mehr Deckung, nicht weniger, und ausgerechnet jetzt wurde das Wetter nach Tagen strömenden Regens zu einem wirklich ungünstigen Zeitpunkt besser.
Als sie den Vorsprung erreichten, legten sich beide hin und ignorierten den Schlamm.
Die Männer aus den Booten hatten sich verteilt und luden offenbar Vorräte aus.
»Wirkt wirklich so, als wollten sie eine Weile bleiben«, sagte Jommy noch einmal.
»Ein drittes Boot!«, flüsterte Jim.
Es kam rechts von den beiden anderen ans Ufer, und mehr Seeleute sprangen heraus, zogen es auf den Strand und fingen dann damit an, Ausrüstung zu entladen. Kisten wurden weitergereicht, und Jim stellte fest: »Das da mögen mörderische Hunde sein, aber sie haben Disziplin.«
Jommy beobachtete das Geschehen ohne Kommentar.