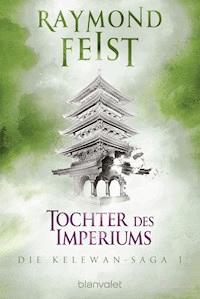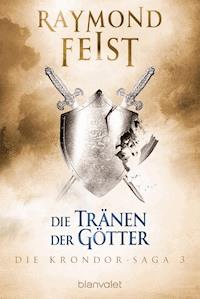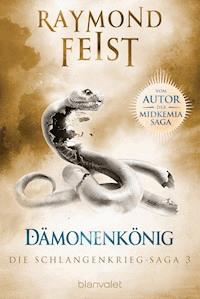7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DIE LEGENDEN VON MIDKEMIA
- Sprache: Deutsch
Seit langer Zeit leisten die Menschen von Midkemia den Invasoren von der anderen Seite des Spalts tapferen Widerstand. Doch lange können sie den Angriffen nicht mehr standhalten. Sie sind gezwungen, eine ungewöhnliche Allianz einzugehen: Um im Kampf nicht von den Dunkelelfen überwältigt zu werden, müssen sich die königlichen Truppen mit ihrem Feind, den Tsurani-Invasoren, verbünden – nur so können sie den bitteren Winter in der Wildnis überstehen und die Dunkelelfen in die Flucht schlagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Raymond Feist und William Forstchen
Die Legenden von Midkemia 1
Die Brücke
Roman
Aus dem Englischen
Das Buch
Seit langer Zeit leisten die Menschen von Midkemia den Invasoren von der anderen Seite des Spalts tapferen Widerstand. Doch lange können sie den Angriffen nicht mehr standhalten. Sie sind gezwungen, eine ungewöhnliche Allianz einzugehen: Um im Kampf nicht von den Dunkelelfen überwältigt zu werden, müssen sich die königlichen Truppen mit ihrem Feind, den Tsurani-Invasoren, verbünden – nur so können sie den bitteren Winter in der Wildnis überstehen und die Dunkelelfen in die Flucht schlagen.
Der Autor
Raymond Feist wurde 1945 in Los Angeles geboren und lebt in San Diego im Süden Kaliforniens. Viele Jahre lang hat er Rollenspiele und Computerspiele entwickelt. Aus dieser Tätigkeit entstand auch die fantastische Welt Midkemia seiner Romane. Die in den 80er Jahren begonnene Saga ist bereits ein Klassiker des Fantasy-Genres, und Feist gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Fantasy in der Tradition Tolkiens.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Honoured Enemy« bei Voyager, HarperCollins Publishers, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe Juni 2016 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München Deutsche Erstveröffentlichung © 2002 bei Verlagsgruppe Random House GmbH, München Copyright © der Originalausgabe 2001 by Raymond Elias Feist Umschlaggestaltung und -illustration: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
Vorbemerkungen
Wie immer bin ich vielen Leuten zu Dank verpflichtet. Dazu gehören:
Die ursprünglichen Mütter und Väter von Midkemia sowie jene, die später noch Beiträge zur Entwicklung dieser Welt geleistet haben. Ohne sie wäre deren Landschaft weit weniger farbenprächtig.
Ich möchte außerdem Rich, Andy, Jim, Rick und den anderen danken, die jeden Freitag an den Treffen bei Flemmin’s teilgenommen haben und deren Humor viele Wochen erst erträglich gemacht hat. Und ich danke Mira für ihre angenehme Gesellschaft und weil sie mich von Zeit zu Zeit von meinen Sorgen abgelenkt hat.
Wie immer danke ich Jonathan Matson.
Ich danke natürlich meinem Mentor, Dr. Gunther Rothenberg, der mir ein Vorbild an Ehre und Mut war, sowie Dr. Dennis Showalter, der in vielerlei Hinsicht ein großartiger Berater gewesen ist, und Brian Thomsen, Bill Fawcett und Eleanor Wood.
Widmung
Für Janny Wurts, die mir gezeigt hat, dass zwei Köpfe häufig weit besser sind als einer.
Raymond E. Feist
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Erkenntnis
Der Regen hatte aufgehört.
Lord Brucal, Marschall der Armeen des Westens, betrat das Kommandozelt. Er schnaubte wie ein Schlachtross und fluchte leise. »Verdammtes Wetter«, sagte er schließlich. Der ältere General, noch immer breitschultrig und in bester körperlicher Verfassung, fuhr sich mit der behandschuhten Hand über die Stirn, um die feuchten Haare aus dem Gesicht zu streichen.
Borric, Herzog von Crydee und Stellvertretender Kommandeur des Marschalls, blickte seinen alten Freund mit einem ironischen Lächeln an. Brucal war ein kräftiger Krieger und ein zuverlässiger Verbündeter, was die politischen Wirren des Königreichs der Inseln betraf, und darüber hinaus war er auf dem Schlachtfeld ein sehr fähiger General. Aber er besaß auch eine Neigung zur Eitelkeit, und Borric wusste, dass er sich jetzt, da ihm die geliebten Haare am Schädel klebten, in gereizter Stimmung befand.
»Na, immer noch krank?« Borric war ein beeindruckender Mann mittleren Alters, dessen Haare und Bart immer noch überwiegend schwarz waren und erst wenige graue Spuren aufwiesen. Er trug Schwarz – die einzige Farbe, die er sich nach dem Tod seiner Frau viele Jahre zuvor gestattete –, abgesehen von dem braunen Überwurf von Crydee mit der goldenen Möwe darauf; die Möwe hockte auf einer kleinen goldenen Krone, das Zeichen für Borrics königliche Herkunft. Seine Augen waren dunkel und durchdringend, doch spiegelte sich in ihnen eine leise Erheiterung über die Unzufriedenheit des alten Freundes.
Wie Borric erwartet hatte, stieß der alte, graubärtige Herzog einen Fluch aus. »Ich bin nicht krank, verflucht! Ich habe nur einen leichten Schnupfen.«
Borric dachte an die Zeit, da Brucal ein junger Mann gewesen war und seinen Vater auf Crydee besucht hatte. Er rief sich sein Lachen in Erinnerung, das stets von einer stürmischen Fröhlichkeit und strahlenden Augen begleitet worden war. Auch als die rötlich braunen Haare grau geworden waren, hatte Brucal noch jeden Tag voll ausgekostet. Zum ersten Mal begriff Borric, dass sein Freund ein alter Mann geworden war.
Ein alter Mann, der allerdings noch immer behände sein Schwert ziehen und damit beträchtlichen Schaden anrichten konnte, wie Borric im Stillen zugeben musste. Und ein Mann, der nachdrücklich bestritt, dass er krank war.
Brucal streifte die schweren Handschuhe ab und reichte sie seinem Adjutanten. Einem anderen gestattete er, ihm den schweren, pelzgesäumten Umhang abzunehmen, den er für den Weg von seinem eigenen Zelt hierher getragen hatte. Er war in eine schlichte blaue Hose und eine graue Tunika gekleidet, hatte den Überwurf jedoch in seinem Zelt gelassen. »Und dieser verdammte Regen macht es auch nicht besser.«
»Noch eine solche Woche, und wir müssen mit den ersten richtigen Schneefällen rechnen.«
»Unsere Kundschafter sagen, dass es weiter nördlich um den Himmelssee herum bereits kräftig schneit«, erwiderte Brucal. »Wir sollten in Betracht ziehen, die Reservetruppen den Winter über zurück nach LaMut und Yabon zu schicken.«
Borric nickte. »Möglicherweise bleibt es noch eine weitere Woche mild, bevor die Winterstürme einsetzen. Damit hätten die Tsuranis genügend Zeit, irgendetwas anzuzetteln. Ich neige dazu, die Hälfte der Reservetruppen hier in der Nähe zu behalten. Die andere Hälfte werde ich zurück nach LaMut schicken.«
Brucal studierte die Karte, die auf dem großen Tisch vor Borric lag. »In der letzten Zeit haben sie nicht sehr viel getan, oder?«, fragte er.
»Genauso viel wie im letzten Jahr«, sagte Borric und deutete auf die Karte. »Ein Ausfall hier, ein Überfall dort. Es gibt jedoch kaum Hinweise darauf, dass sie noch weiter vordringen wollen.«
Borric musterte die Karte; die nach Midkemia eingedrungenen Tsuranis hatten einen beträchtlichen Teil der Grauen Türme und der Freien Städte eingenommen, aber in den letzten fünf Kriegsjahren hatte er die Front stabil halten können. Den Herzögen war ein Überfall auf das Tal in den Bergen gelungen, von wo aus die Tsuranis operierten, und seither gab es keinerlei Nachrichten darüber, was hinter den feindliche Linien vorging.
Brucal schnäuzte sich in einen Stofffetzen, der zum Ölen der Waffen benutzt wurde, und warf ihn dann in die Kohlenpfanne neben sich. Seine große Nase war rot und glänzte. Seine Augen hatten in der letzten Zeit an Glanz verloren, bemerkte Borric. Obwohl Brucal trotz seines fortgeschrittenen Alters noch gesund und kräftig war, war er ein alter Soldat, und der Feldzug währte nun schon mehr als neun Jahre.
Borric dachte zurück an die Zeit, da die tsuranischen Eindringlinge zum ersten Mal gesichtet worden waren. Es waren zwei Jungen aus seiner eigenen Festung gewesen, die ein zerstörtes tsuranisches Schiff an der Landzunge bei Crydee gefunden hatten. Später hatte die Elbenkönigin von fremden Wesen berichtet, die in den Wäldern zwischen Elvandar und dem Herzogtum von Crydee aufgetaucht waren.
Die Welt hatte sich verändert: dass fremde Wesen aus einer fremden Welt durch ein magisches Tor eingedrungen waren, war eine Tatsache und nicht länger ein Wunder. Er hatte einen Krieg zu führen und zu gewinnen. Borric hatte mit Tinte einige Anmerkungen auf die Karte geschrieben.
»Was ist das?«, fragte Brucal und deutete auf ein neues Zeichen, das Borric erst am Morgen eingetragen hatte.
»Eine weitere Wanderungswelle von Dunklen Brüdern. Es sieht so aus, als würde ein ziemlich großer Teil von ihnen von den südlichen Ausläufern der Nordberge herunterkommen. Sie benutzen einen schmalen Pfad in der Nähe der Elbenwälder. Ich kann allerdings keinen Grund erkennen, warum sie so etwas um diese Jahreszeit tun sollten.«
»Diese finsteren Gesellen brauchen doch gar keinen Grund«, bemerkte Brucal.
Borric nickte. »Mein Sohn Arutha hat damals, vor fünf Jahren, als die Tsuranis meine Burg belagert haben, von einer großen Streitkraft von Dunklen Brüdern berichtet, die sich mit den Tsuranis angelegt hätten. Aber diese Dunklen Brüder sind von den Tsuranis aus den Grauen Türmen vertrieben worden und waren unterwegs nach Norden, um zu ihren Verwandten in den Nordlanden zu gelangen. Sie haben sich seither ruhig verhalten.«
»Es gibt möglicherweise doch einen Grund.«
Borric zuckte mit den Schultern. »Ich höre, alter Freund.«
»Der Treck ist ein bisschen zu lang, als dass er nichts zu bedeuten hätte«, bemerkte Brucal, während er sich mit dem Handrücken die Nase abwischte. »Und die Dunklen Brüder sind nicht dumm.«
»Die Dunklen Brüder mögen alles Mögliche sein, aber dumm sind sie ganz sicher nicht«, stimmte Borric ihm zu. »Wenn eine solch große Streitmacht von ihnen marschiert, muss das einen Grund haben.«
»Wo befinden sie sich jetzt?«
»Den jüngsten Berichten der Kundschafter zufolge halten sie sich in der Nähe der Elbenwälder auf. Sie weichen sowohl den Zwergen von Bergenstein als auch den Elbenpatrouillen aus und marschieren Richtung Osten.«
»Das einzige Ziel dort ist der Himmelssee«, sagte Brucal, »es sei denn, sie haben vor, sich nach Süden zu wenden und die Elben oder die Tsuranis anzugreifen.«
»Wieso der Himmelssee?«
»Es könnte sein, dass sie versuchen, oben in den Nordlanden nach Osten zu gelangen. Von den Zähnen der Welt aus erstreckt sich in nordöstlicher Richtung ein Gebirgsausläufer, der Hunderte von Meilen lang und unpassierbar ist. Es gibt aber eine Verbindung, die zwischen den Nordbergen zu den Zähnen der Welt verläuft, am Himmelssee vorbei.« Der alte Herzog strich sich über den noch immer nassen Bart. »Das ist einer der Gründe, wieso wir oben in Yabon so viel Ärger mit den Schurken haben.«
Borric nickte. »Wir in Crydee werden ziemlich in Ruhe gelassen, verglichen mit den Zusammenstößen, die deine Garnisonen mit ihnen haben.«
»Ich wünschte nur, ich wüsste, wieso so viele kurz vor dem Winter versuchen, nach Osten zu gelangen.«
»Irgendetwas geht da vor«, bestätigte Borric.
»Ich habe den Rabenclan bekämpft, seit ich ein Junge war«, sagte Brucal. Er schwieg eine Weile. »Ihr Oberanführer ist ein abscheulicher Hund namens Murad. Falls dieser Haufen aus den Nordlanden vorhat, sich mit ihm zu verbünden …«
»Was dann?«
»Ich weiß nicht genau, was dann geschieht, aber es kann nur etwas Schreckliches sein.« Brucal blickte wieder auf die Karte. »Halten sich in diesem Gebiet gerade Leute von uns auf?«
»Es gibt dort nur die Garnisonsfestungen entlang der tsuranischen Front sowie ein paar Patrouillen, die sich noch so lange dort aufhalten werden, bis es richtig Winter wird.«
Brucal beugte sich etwas tiefer hinab, um die kleinen Zeichen besser entziffern zu können, die mit Tinte auf die Karte gemalt worden waren, dann gab er ein Geräusch von sich, das irgendwo zwischen Schnauben und Lachen lag. »Hartraft.«
»Wer?«, fragte Borric.
»Er ist der Sohn von einem meiner Junker. Dennis Hartraft. Er befehligt für Baron Moyet eine Kompanie von Dieben und Halsabschneidern, die sich die Plünderer nennen. Er hält sich in diesem Gebiet auf.«
»Was tut er da?«, fragte Borric. »Sein Name kommt mir zwar vertraut vor, aber ich kann mich nicht erinnern, mal einen Bericht von ihm erhalten zu haben.«
»Dennis hält nicht viel von Schreibkram«, sagte Brucal. »Was er dort tut? Er bekämpft die Tsuranis mit außerordentlicher Brutalität. Es ist etwas Persönliches.«
»Gibt es eine Möglichkeit, ihm mitzuteilen, dass die Dunklen Brüder auf dem Marsch sind?«
»Er ist sehr unabhängig. Er wird in den nächsten ein, zwei Wochen zum Lager von Baron Moyet zurückkehren. Ich werde den Baron benachrichtigen, dass er Dennis eine Nachricht zukommen lässt, wenn das irgendwie möglich ist.«
Brucal lachte. »Aber es würde durchaus zu ihm und dem Rabenclan passen, wenn sie sich miteinander anlegen.«
»Wieso glaubst du das?«
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte Brucal. »Jedenfalls ist zwischen seiner Familie und Murads Blutsaugern sogar noch mehr vorgefallen als zwischen ihm und den Tsuranis.«
»Also was geschieht, wenn dieser Hartraft und die Dunklen Brüder aufeinander stoßen?«
Brucal seufzte und wischte sich die Nase. »Dann werden eine ganze Menge Leute sterben.«
Borric trat von dem Tisch mit der Karte zurück und blickte durch die Öffnung des Pavillons nach draußen. Ein leichter Schneeregen hatte eingesetzt. Nach einer Weile sagte er: »Vielleicht verfehlen sie sich ja auch, und Hartraft gelangt sicher zu Moyets Lager zurück.«
»Vielleicht«, erwiderte Brucal. »Aber wenn dieser Haufen aus dem Norden zwischen Dennis’ und Moyets Lager gelangt oder einige vom Rabenclan vorhaben, auf sie zu stoßen …«
Brucal ließ den Gedanken unbeendet. Borric wusste auch so, was er dachte. Wenn sich so viele Dunkle Brüder zwischen Hartraft und seiner Basis befanden, waren die Chancen für die Soldaten des Königreichs, wohlbehalten nach Hause zurückzukehren, gleich Null. Borric ließ seine Gedanken schweifen, dachte an die kalten Berge im Norden und den eisigen Winter, der kurz bevorstand, dann schob er die Grübeleien beiseite. Es gab andere Fronten, andere Konflikte, um die sie sich kümmern mussten, und er konnte Hartraft und seinen Männern ohnehin nicht helfen, selbst wenn er gewusst hätte, wo sie sich aufhielten. Zu viele Männer waren in diesem Krieg bereits gestorben, um sich wegen einer weiteren bedrohten Einheit den Schlaf rauben zu lassen. Und abgesehen davon hatten sie ja möglicherweise auch Glück.
1
Trauer
Der Boden war gefroren.
Hauptmann Dennis Hartraft, Kommandeur der Plünderer, starrte schweigend auf das nicht sehr tiefe Grab, das in der gefrorenen Erde ausgehoben worden war. Der Winter war schließlich schnell und mit aller Härte hereingebrochen, früher als gewöhnlich, und nach sechs Tagen leichten Schneefalls und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ließ sich der Boden nur mit Mühe bearbeiten.
Es ist so verflucht kalt, dachte er. Es war schlimm genug, dass man den Männern keine ordentliche Feuerbestattung bieten konnte, weil der Rauch ihre Position verraten hätte. Da sie sich jedoch hinter den feindlichen Linien befanden, war es ihnen auch unmöglich, die Toten zurück zur Garnison zu schaffen, um sie dort zu verbrennen. Sie erhielten daher lediglich ein Loch im Boden, damit sie nicht von den Wölfen gefressen werden würden. Ist das alles, was am Ende übrig bleibt, nur die Dunkelheit und die eisige Umarmung des Grabes? Mit der linken Hand, der Schwerthand, rieb er sich geistesabwesend über die rechte Schulter; die alte Wunde schien immer dann am meisten zu schmerzen, wenn Schnee fiel.
Ein Priester von Sung schritt an dem Grab entlang; er murmelte Gebete vor sich hin und vollführte mit den Händen segnende Gebärden. Dennis stand steif da und sah zu, wie einige Männer Gebärden zu anderen Göttern machten – die meisten zu Tith-Onaka, dem Gott des Krieges –, während andere reglos dastanden. Ein paar blickten ihn an, sahen seine Augen und wandten sich rasch ab.
Die Männer konnten seine unterdrückte Wut sehen … und das Gefühl der Leere, das ihn beherrschte.
Der Priester schwieg jetzt. Er hielt den Kopf gesenkt und webte einen Bann über das Grab. Die Göttin der Reinheit würde die Toten vor jeder Besudelung schützen. Dennis verlagerte sein Gewicht unbehaglich von einem Bein aufs andere und blickte auf die Wolken, die im Westen eine undurchdringliche graue Wand bildeten. Im Osten verdüsterte sich der Himmel.
Die Nacht brach herein und mit ihr die Gewissheit, dass noch mehr Schnee fallen würde, dass der erste große Sturm des Jahres über sie kommen würde. Dennis lebte schon seit vielen Jahren in diesem Gebiet; er wusste, dass ihnen ein langer und harter Winter bevorstand. Jetzt war es seine Aufgabe, seine Männer sicher und wohlbehalten zurück ins Lager von Baron Moyet zu bringen. Wenn allerdings in den nächsten Tagen deutlich mehr Schnee fiel, würde sich das als problematisch erweisen.
Der Priester trat vom Grab zurück, hob die Hände zum dunklen Himmel und begann wieder zu singen.
»Die Messe ist zu Ende«, sagte Dennis. Er hatte leise gesprochen, doch seine Wut durchschnitt die Luft wie ein scharfes Messer.
Der Priester blickte verblüfft auf. Dennis ignorierte ihn und drehte sich zu den Männern um, die sich hinter ihm versammelt hatten. »Ihr habt eine Minute Zeit, um Lebewohl zu sagen.«
Jemand trat neben Dennis und räusperte sich. Ohne aufzublicken wusste Dennis, dass es Gregory aus Natal war. Und er begriff, dass sein Mangel an Höflichkeit dem Priester von Sung gegenüber unklug gewesen war.
»Wir befinden uns noch immer hinter den feindlichen Linien, Vater. Wir müssen aufbrechen, sobald die Kundschafter zurückgekehrt sind«, hörte Dennis Gregory sagen. »Der Winter bricht rasch herein, und wir sollten sehen, dass wir uns im Schutz von Fort Brendan befinden, wenn ein richtiger Schneesturm einsetzt.«
Dennis warf einen Blick über die Schulter zu Gregory, dem großen, dunkelhäutigen Natalen, der seinem Kommando zugeteilt worden war.
Gregory erwiderte den Blick, und ein Lächeln stand in seinen Augen. Wie immer ärgerte es Dennis, dass der Natale genau zu wissen schien, was er dachte und fühlte. Er wandte sich ab und zeigte mit dem Finger auf die etwa ein Dutzend Männer, die das Grab ausgehoben hatten. »Hört endlich auf zu gaffen und füllt das Grab wieder auf!«
Die Männer machten sich an die Arbeit, während Dennis zum Rand der Lichtung stapfte. Früher einmal hatte sich die Lichtung mit dem kleinen Gehöft darauf diesseits der Grenze des Königreichs befunden, doch jetzt, im neunten Jahr des Spaltkriegs, war das Gehöft schon seit langem verlassen.
Sein Blick schweifte kurz über die eingestürzte Hütte, die faulenden Stämme, die geschwärzten Dachbalken. Mannshohe Schösslinge erhoben sich aus der Ruine. Der Anblick rief die Erinnerung an eine andere Ruine wach, die sich nur etwa fünfzig Meilen von hier befand, doch verbannte er sie sofort aus seinen Gedanken. Schon vor langer Zeit hatte er gelernt, sie zu verdrängen.
Er musterte den Wald vor sich, tat so, als wartete er auf die Rückkehr der Kundschafter. Gewöhnlich pflegte Gregory die Patrouillen anzuführen, doch Dennis hatte ihn in seiner Nähe haben wollen, für den Fall, dass sie gezwungen waren, sich rasch zurückzuziehen. Im Laufe der vielen Jahre, die er erfolgreich hinter den tsuranischen Linien operierte, hatte er gelernt zu erkennen, wann er seinem Gefühl vertrauen musste. Davon abgesehen hielt sich da draußen ein äußerst fähiger Kundschafter auf – der Einzige der gesamten Kompanie, der es mit Gregorys Fähigkeiten im Wald aufnehmen konnte.
Dennis lehnte sich gegen den Stamm einer Fichte; er unterdrückte das Bedürfnis, ausgiebig zu seufzen, und atmete stattdessen tief aus. Die Luft war klar und frisch, roch nach Winter, Kiefern und Schnee, doch davon drang nichts zu ihm durch. Ihm kam es so vor, als wäre die Welt um ihn herum wirklich tot, als wäre auch er einer der Toten, und seine gesamte Aufmerksamkeit galt den leisen Geräuschen, mit denen hinter ihm die gefrorene Erde wieder auf das Grab geschaufelt wurde.
Der Priester war ziemlich verblüfft über Dennis’ respektloses Verhalten und trat zu Gregory, als er sah, dass sich Dennis von der Gruppe gelöst hatte. Er blickte den großen Natalen an. Gregory hatte lediglich den Kopf geschüttelt, als Dennis davongestapft war, und schaute sich jetzt um. Niemand sagte etwas, und so war nichts zu hören außer dem Aufschaufeln der eisigen Erde. Die Männer blickten ihren Anführer an, der jetzt am Rand des angrenzenden Waldes stand.
Gregory räusperte sich wieder, dieses Mal etwas lauter. Die Männer wandten sich jetzt ihm zu, und er bedeutete ihnen, sich wieder um ihre Aufgabe zu kümmern.
»Er hasst mich«, sagte Vater Corwin. Seine Stimme klang traurig.
»Nein, Vater. Er hasst nur dies alles hier.« Gregory nickte in Richtung des Schlachtfeldes. Der Schnee war niedergetrampelt und teilweise rosa gefärbt; zerbrochene Waffen, Pfeile und zweiundfünfzig tote Tsuranis lagen auf der Lichtung, darunter auch die Verwundeten, denen mit einem Messer die Kehlen durchtrennt worden waren.
Gregory blickte den Priester eindringlich an. »Es war nicht Euer Fehler. Ihr habt diese Schlacht nur zufällig ausgelöst.«
Der Priester schüttelte müde den Kopf. »Es tut mir Leid. Ich hatte mich verirrt und wusste nicht, dass die Tsuranis so dicht hinter mir waren.«
Gregory musterte den alten Priester. Die Pupillen seiner hellblauen Augen waren geweitet, das Weiß der Augen blutgeädert. Der Priester sah ihn an, ohne mit der Wimper zu zucken, senkte nicht einmal für einen kurzen Moment den Blick. Wer als Bettelmönch einem Orden diente – auch dem der Göttin der Reinheit –, musste ziemlich zäh sein, um von dem wenigen leben zu können, das das Land bot. Gregory zweifelte nicht daran, dass der Amtsstab am Gürtel des Priesters blutverschmiert war und dass Vater Corwin im Laufe der Jahre eine Reihe von Gefahren hatte durchstehen müssen. Darüber hinaus sagte ihm seine normalerweise gute Menschenkenntnis, dass dieser Priester zwar sanftmütig erscheinen mochte, dass aber ganz offensichtlich unter der Oberfläche ein gehöriges Maß an Stärke und Kraft schlummerte.
»Ich wünschte, ich hätte das Kloster nie verlassen, um hier zu helfen«, seufzte der Priester, der jetzt doch den Blick senkte. »Wir haben uns verirrt, meine Brüder Valdin, Sigfried und ich. Wir wollten zum Lager von Baron Moyet, haben aber eine falsche Abzweigung genommen und uns plötzlich hinter den tsuranischen Linien wiedergefunden.«
»Nur die natalischen Kundschafter und die Elben können diese Pfade benutzen, ohne Gefahr zu laufen, sich zu verirren«, beruhigte ihn Gregory. »Die Wälder hier sind tückisch, Vater. Es heißt, dass manchmal sogar der Wald selbst die Pfade verbirgt und neue entstehen lässt, um die Unbedachten vom Wege abzubringen.«
»Bruder Valdin und Bruder Sigfried sind gefangen genommen worden«, fuhr der Priester fort, seine Geschichte zu erzählen. »Ich konnte entkommen. Ich hatte den Pfad verlassen, um mich zu erleichtern, als die tsuranische Patrouille die beiden Brüder ergriff. Nachdem sie sie weggeschleppt hatten, bin ich einfach in die entgegengesetzte Richtung gerannt. Ich habe mich wie ein Feigling verhalten.«
Der natalische Kundschafter zuckte leicht mit den Schultern. »Manch einer würde es Vorsicht und nicht Feigheit nennen. Ihr wolltet den Tsuranis nicht den Triumph gönnen, einen dritten Gefangenen zu machen.«
Der Priester schien noch immer nicht überzeugt.
»Ihr hättet nicht das Geringste für sie tun können«, erklärte Gregory jetzt mit aller Deutlichkeit, »es sei denn, Ihr hättet ihnen in die Gefangenschaft folgen wollen.«
Corwin schien nun zumindest ein wenig beruhigter zu sein. »Aber Ihr müsst zugeben dass es dumm von mir war, einfach so drauflos zu rennen. Wäre ich leiser gewesen, hätte ich die Tsuranis nicht hierher geführt. Als ich dann gesehen habe, dass sich einer Eurer Männer neben dem Pfad versteckt hat, bin ich instinktiv auf ihn zugelaufen.«
Gregory kniff die Augen zusammen. »Nun, hätte er sich mehr Mühe gegeben, und sich besser versteckt, hättet Ihr ihn gar nicht bemerken können.«
»Ich wusste nicht, dass sie so dicht hinter mir waren.« Der Priester deutete auf die tsuranischen Leichen auf dem Schlachtfeld.
Gregory nickte.
Was als sauberer, rascher Hinterhalt mit nur geringen Verlusten geplant gewesen war, hatte sich in ein Blutbad verwandelt. Achtzehn ihrer eigenen Männer waren tot, beinahe ein Viertel von Dennis’ Kommando, sechs weitere schwer verletzt. Wie es aussah, hatten die Soldaten des Königreichs diese Begegnung für sich entschieden, aber um einen weit höheren Preis, als nötig gewesen wäre.
Der Priester machte sich daran, seine Geschichte noch einmal zu erzählen. Gregory musterte ihn. Es war offensichtlich, dass der Mann stark mitgenommen war. Er war ärmlich gekleidet und trug Sandalen anstelle von Stiefeln. Zwei Zehen zeigten bereits erste Anzeichen von Erfrierungen. Seine Hände zitterten leicht, und seine Stimme klang, als würde sie jeden Augenblick versagen.
Der Priester schwieg jetzt; er brauchte einige Zeit, um die Kontrolle über sich wiederzuerlangen. Er entließ einen tiefen Seufzer, dann blickte er Dennis an, der allein am Rand der Lichtung stand.
»Was ist mit Eurem Kommandeur?«, wollte er von dem Natalen wissen.
»Sein ältester Freund liegt in diesem Graben«, flüsterte Gregory mit einem Nicken in Richtung der achtzehn Leichen, die nebeneinander in der schmalen Kuhle lagen, die aus dem gefrorenen Boden ausgehoben worden war.
»Bevor Jurgen zu Dennis’ Kommando gekommen ist, hatte er schon dessen Vater gedient. Ein Teil des Landes, das die Tsuranis jetzt besetzen, befand sich früher einmal im Besitz von Dennis’ Familie. Sein Vater stand im Dienst von Lord Brucal; er war der Junker von Valinar. Dennis’ Familie hat zu Beginn des Krieges alles verloren. Als die Tsuranis bei ihnen auftauchten, hatten sie noch so gut wie nichts von ihnen gehört. Der alte Junker und seine Männer wussten gar nicht genau, wen sie da eigentlich bekämpften, als sie starben. Dennis und Jurgen waren unter den wenigen Überlebenden dieses ersten Angriffs; Jurgen war seine letzte Verbindung zu seiner Vergangenheit.« Gregory machte eine Pause und blickte den Priester ernst an. »Und jetzt ist auch diese Verbindung abgeschnitten.«
»Es tut mir Leid«, erwiderte der Priester leise. »Ich wünschte, das alles wäre nicht geschehen.«
»Nun, Vater Corwin, es ist aber nun mal geschehen«, sagte Gregory mit ausdrucksloser Stimme.
Der Priester blickte ihn an, und Tränen standen in seinen Augen.
»Es tut mir Leid«, wiederholte der Priester leise.
Gregory nickte. »Aber wie sagte meine Großmutter immer: ›Davon, dass es dir Leid tut, öffnet sich kein einziges Ei.‹ Schaffen wir also etwas Ordnung und sehen wir zu, dass wir wegkommen. Vor allem sollten wir Euch ein Paar Stiefel besorgen, sonst sind Euch spätestens Morgen sämtliche Zehen abgefroren.«
»Wo wollt Ihr die Stiefel hernehmen?«
»Von den Toten natürlich.« Er deutete auf den Haufen voller Stiefel, Waffen und Umhänge, die den Toten abgenommen worden waren, bevor man sie in das Grab gelegt hatte. »Sie brauchen sie jetzt nicht mehr, im Gegensatz zu den Lebenden«, fügte er entschieden hinzu. »Wir ehren ihr Andenken durchaus, aber es wäre höchst unklug, solch hervorragende Waffen und Stiefel mit ihnen zu begraben.« Er deutete mit einer kurzen, ruckartigen Bewegung seines Kinns. »Das Paar da sieht aus, als könnte es Euch passen.« Der Priester zitterte, aber dann ging er doch hin und hob die Stiefel auf.
Während er seine Sandalen abband, trat Alwin Barry, frisch ernannter Sergeant der Kompanie, an den Grabrand und warf einen Klumpen gefrorener Erde in das Grab.
»Haltet mir einen Platz in Tiths Halle frei«, murmelte er und beschwor damit einen alten Glauben unter den Soldaten, demzufolge die Tapferen und Heldenhaften eine Nacht lang vom Gott des Krieges beköstigt und verpflegt wurden, bevor sie zu Lims-Kragma geschickt wurden, wo über sie gerichtet werden würde. Barry senkte respektvoll den Kopf, dann wandte er sich ab, eilte zu dem Pfad, der quer über die Lichtung führte, und befahl seinen Männern, sich zum Abmarsch bereitzumachen.
Andere Soldaten näherten sich jetzt eilig dem Grab, hoben ebenfalls etwas Erde auf und warfen sie auf die Toten. Einige vollführten segnende Gebärden, einer entkorkte eine Trinkflasche, hielt sie hoch, nahm einen Schluck und goss den Rest des Brandys in das Grab. Die Flasche warf er gleich hinterher.
Normalerweise wurden im Königreich die Toten eher selten beerdigt, aber seit Jahrhunderten schon ruhten Soldaten unter der Erde. Die Männer hatten ihre eigenen Rituale, den Toten Lebewohl zu sagen – Rituale, die nichts mit denen der Priester zu tun hatten. Dabei ging es nicht um die Reise der Kameraden zur Halle von Lims-Kragma, zu der sie ohnehin bereits unterwegs waren. Es ging darum, sich von Männern zu verabschieden, die erst wenige Stunden zuvor neben ihnen ihr Blut vergossen hatten. Es ging um ein Abschiednehmen unter Brüdern.
Richard Kevinsson, neuer Rekrut der Kompanie, war einer der Letzten, die sich dem Grab näherten. Der Junge war ein Junker von Landonare, der von dort geflohen war, als die Tsuranis die Besitztümer seiner Familie überrannt hatten. Er war ganz Feuer und Flamme und voller Racheschwüre gewesen, als er der Kompanie beigetreten war. Jetzt standen ihm Tränen in den Augen, und sein Gesicht war bleich. Blut klebte an seiner Wange – die Folgen eines Hiebes, der gleich unterhalb des zerbeulten Helms die Haut durchtrennt hatte. »Es tut mir Leid«, flüsterte er mit bebender Stimme.
Er kniete nieder, hob einen Erdklumpen auf und richtete seinen Blick auf den alten Sergeanten, der in der Mitte des Grabes umgeben von seinen toten Kameraden lag. Die Totengräber arbeiteten hart, doch noch immer war auf Jurgen keine Erde gefallen. Der Mann sah aus, als wäre er in einen tiefen Schlaf gefallen; abgesehen von der blutgetränkten Tunika erweckte er den Anschein, als würde er sich jeden Augenblick aufsetzen und lächeln und dabei seine schiefen Zähne entblößen. Der junge Mann hatte oft von seiner ersten Schlacht geträumt, von den heroischen Taten, die er vollbringen würde. Stattdessen hatte er auf dem Boden gelegen und den Feind wie ein erschrecktes Kaninchen angestarrt, nach dem verlorenen Schwert getastet und vor Angst laut aufgeschrien … und dann war Jurgen zu ihm gestürmt und hatte den Tsurani mit einem einzigen Hieb niedergemacht.
Aber indem Jurgen ihm das Leben gerettet hatte, hatte er auch einem feindlichen Speerwerfer die Möglichkeit gegeben, ihn direkt anzugreifen.
Jurgen hatte Richard in die Augen gesehen, als der Speer ihn traf, und einen kurzen Augenblick lang hatte er gelächelt, als wäre er ein freundlicher alter Mann, der ein Kind vor einem geringfügigen Kratzer bewahrt hatte. Dann hatte sich sein Gesicht vor Schock verzerrt, als sich der tsuranische Speer in seinen Rücken gebohrt hatte und aus der Brust wieder ausgetreten war.
Richard hatte gesehen, wie das Leben aus den Augen des alten Mannes gewichen war. Es war nur ein kurzer Augenblick gewesen, doch er war ihm vorgekommen wie eine Ewigkeit, als das Licht seiner Augen erlosch. Und Richard hatte gewusst, dass der alte Mann sich für ihn geopfert hatte, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern.
Er blickte auf Jurgen hinunter. Man hatte ihm die Augen geschlossen, aber in seiner Erinnerung und in den Alpträumen, die ihn sein restliches Leben lang verfolgen würden, waren sie noch immer geöffnet, starrten sie ihn noch immer an.
»Ich hätte an Eurer Stelle sein sollen«, flüsterte er, vor Kummer kaum in der Lage, überhaupt etwas zu sagen.
Er fiel beinahe vornüber, und Schluchzer schüttelten seinen Körper. Er wusste, dass die anderen ihn beobachteten, dass sie über ihn urteilten. Er wunderte sich, dass sie nicht ebenfalls weinten, und er schämte sich für sein Versagen an diesem Tag.
Er ließ die Erde aus der Hand gleiten und zuckte zusammen, als der Klumpen Jurgens Gesicht traf. Beschämt drehte er sich um und ging davon, zitternd und mit hängenden Schultern, während er erfolglos versuchte, die Tränen zu unterdrücken.
Die wenigen, die noch nach Richard an das Grab traten, warfen stumm den rituellen Klumpen Erde hinein und gingen mit leeren Augen davon.
Die Kompanie formierte sich zum Abmarsch, und Alwin bestimmte einige Männer dazu, die Tragen mit den Verwundeten zu schleppen.
Die Totengräber waren beinahe fertig. Trotz der Kälte waren ihre Gesichter schweißnass, und ihr heißer Atem bildete Wolken vor ihren Gesichtern, als sie sich hastig bemühten, ihre Arbeit zu vollenden.
Am Rand der Lichtung starrte Dennis noch immer auf den Wald, ohne allerdings wirklich etwas zu sehen. Dann erregte irgendetwas, irgendein Gefühl, seine Aufmerksamkeit. Ein einsamer Vogel stieg durch die Zweige hindurch in die Lüfte. Das verärgerte Schnattern eines Eichhörnchens erklang.
Seine linke Hand fuhr zum Schwertgriff. Er warf einen Blick über die Schulter. Gregory kniete neben einem Tsurani; er musterte das Gesicht des Feindes, als könnte er aus dessen reglosen Gesichtszügen etwas über diese fremden Eindringlinge aus einer anderen Welt erfahren. Wie Dennis hatte auch er etwas gespürt, etwas, das sich näherte. Sein Blick huschte zu den Männern, die am Pfad standen. Einige der älteren Soldaten reagierten ebenfalls und zogen dadurch die Aufmerksamkeit der anderen auf sich.
Dennis betrachtete Alwin und stellte enttäuscht fest, dass der neue Sergeant deutlich später reagierte als Gregory. Dann reckte er schließlich die linke Hand in die Luft und schlitzte sich gleichzeitig mit der Rechten symbolisch die Kehle auf. Es war die Aufforderung, dass sich alle augenblicklich still und reglos zu verhalten hatten. Dennis wandte sich wieder dem Wald zu, aber er gab noch keine Befehle.
Gregory lauschte eine Weile und entspannte sich schließlich. Er blickte Dennis an und nickte kurz, dann lächelte er.
Eine Gestalt huschte auf dem Pfad vor ihnen durch den dunklen Wald. Jetzt entspannte sich auch Dennis.
Die Gestalt trat hinter einem Baum hervor und hob die Hand. Dennis winkte als Zeichen, dass er den Kundschafter erkannt hatte, und der Mann lief zu ihm. Er trug eine weiße Tunika, auf der kreuz und quer graue und schwarze Linien verliefen – die Winteruniform der Plünderer, die Dennis eigens für ihren Aufenthalt im Wald entworfen hatte. Der Kundschafter lief so leichtfüßig, wie es nur ein Elb tun konnte. Es ging das Gerücht, dass sie manchmal nicht einmal im Schnee Spuren hinterließen.
Der Elb nickte Dennis zu und bedeutete ihm mit einer Handbewegung, ihm zu folgen.
Sein Verhalten war Teil eines Protokolls, das Dennis hin und wieder ärgerte. Der Kundschafter war eng mit Gregory befreundet und unterstand dem Kommando von Dennis nicht offiziell, daher erstattete er auch zuerst seinem Freund Bericht. Dies war einer der Gründe, weshalb Dennis lieber Gregory zur Erkundung des Geländes ausschickte; wenn der natalische Kundschafter von einer Mission zurückkehrte, musste er Dennis direkt Bericht erstatten. Dennis wusste zwar, dass es unnötig war, sich darüber zu ärgern, aber es gelang ihm nicht immer, sich gegen dieses Gefühl zu wehren.
»Tinuva«, seufzten mehrere Männer deutlich erleichtert, als der Elb auf die Lichtung trat. Sie entspannten sich und schoben die Klingen wieder zurück in die Scheiden.
Der Elb nickte zur Begrüßung. Er blickte auf das Grab, senkte den Kopf und schwieg einen Moment, während er der Gefallenen gedachte. Dann wandte er sich Gregory zu. »Du hattest Recht. Zwei von ihnen sind entkommen«, verkündete Tinuva.
»Und?«, fragte Gregory.
»Es sind gute und kräftige Kämpfer, und es war eine lange Jagd.«
»Dann hast du sie also gekriegt?«, wollte Dennis wissen.
Der Elb schüttelte den Kopf. Er war offensichtlich von der langen Verfolgungsjagd noch ganz außer Atem.
Dennis zog eine Flasche unter seiner Tunika hervor und reichte sie ihm. Der Elb nickte dankbar, trank und gab sie dann zurück.
»Ich bin mir nicht sicher«, erwiderte Tinuva. »Ihr Befehlshaber könnte einen Läufer zurückgeschickt haben, noch bevor der Kampf überhaupt begonnen hatte. Es waren zu viele Spuren auf dem Pfad, als dass ich es sicher hätte beurteilen können. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, wäre ich dem Weg gefolgt, den sie gekommen waren, dann hätte ich es vielleicht herausgefunden. Aber du wolltest, dass ich so schnell wie möglich wieder zurückkehre.«
Dennis fluchte im Stillen.
»Dann müssen wir davon ausgehen, dass jemand davongekommen ist«, erklärte Gregory.
»Davon gehe ich immer aus«, sagte Dennis kühl.
Gregory enthielt sich einer Antwort.
»Ich spüre aber noch etwas anderes«, sagte der Elb.
»Dunkle Brüder?«, fragte Gregory, und der Elb nickte.
»Hast du Hinweise auf sie gefunden?«, fragte Dennis.
Der Elb griff in den Beutel an seinem Gürtel und zog einen zerbrochenen Pfeil heraus. »Er entspricht der Machart des Rabenclans. Ich habe ihn etwa eine Wegstunde von hier gefunden, als ich schon wieder auf dem Rückweg war. Der Schnee dort war voller Blut. Jemand hat einen Hirsch getötet, gevierteilt und sich dann wieder nach Norden begeben. Es müssen vier gewesen sein, und das Ganze hat am frühen Morgen stattgefunden, etwa eine Stunde, nachdem es zu schneien begonnen hat.«
»Waren es wirklich nur vier?«, fragte Dennis.
Der Elb schüttelte den Kopf. »Es müssen sich noch mehr hier aufhalten. Ich bin lediglich auf die Spuren einer Jagdgruppe gestoßen, die auf der Suche nach Nahrung war. Man kann den Wald über sie flüstern hören. Sie sind da draußen, und es braut sich etwas zusammen.« Der Elb nickte in Richtung der Nordberge, die in der zunehmenden Dämmerung allerdings kaum noch zu sehen waren.
»Wie viele sind es?«
Der Elb schloss einen Moment die Augen, als könne er so besser nachdenken.
»Schwer zu sagen«, flüsterte er. »Wir Eledhel haben eine gemeinsame Geschichte mit den Moredhel.« Gregory schüttelte rasch den Kopf, um Dennis daran zu hindern, weiter nachzufragen. »Sie sind so schwer aufzuspüren wie wir, es sei denn, sie halten sich ganz in der Nähe auf oder kommen in großer Zahl.« Er blickte wieder nach Norden. »Ich nehme an, sie sind weit weg, aber sehr viele.«
»Wie kommt Ihr darauf?«, fragte der Priester, der am Rand der Gruppe stand.
Einige der Männer drehten sich um und blickten den Priester an, der plötzlich peinlich berührt wirkte und den Blick senkte.
Niemand antwortete. Schließlich rührte sich der Elb.
»Heiliger«, sagte Tinuva leise. »In der Bruderschaft des Dunklen Pfades – wie Ihr sie nennt – geht irgendetwas vor. Der Krieg gegen die Tsuranis lenkt uns von der Bedrohung ab, die die Dunklen Brüder im Norden darstellen. Vielleicht versprechen sie sich einen Vorteil davon, dass sich die Menschen gegenseitig abschlachten. Vielleicht haben sie auch vor, nach Süden zum Grünen Herzen und zu den Grauen Türmen zurückzukehren – es wäre nur zu verständlich, wenn sie nach neun Wintern bei den anderen Clans im Norden nicht mehr gut gelitten sind.«
»Marschieren sie in Richtung Süden?«, fragte Gregory.
Tinuva zuckte mit den Schultern. »Die Jäger, deren Spuren ich gesehen habe, marschieren entweder vor einer größeren Gruppe oder an deren Flanke. Es ist schwer zu sagen, ob sie sich nach Süden oder in eine andere Richtung wenden.«
»Ein Grund mehr, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden«, unterbrach ihn Dennis scharf. »Wir halten uns schon zu lange hinter den feindlichen Linien auf; die Männer verdienen es, den Rest des Winters in Tyr-Sog zu verbringen, wo sie sich betrinken und ihr Geld für Huren ausgeben können.«
Er blickte die Totengräber an. Sie waren jetzt so gut wie fertig mit der Arbeit; ein paar Männer zogen noch schnell Gestrüpp und Zweige über das Grab. Andere kehrten bereits in ihre Reihen zurück und schnallten die kurzen Schaufeln wieder an die Rucksäcke.
An diesem Tag war es noch einfach, mit einem geübten Blick die Grabstätte zu erkennen, aber wenn es so weiterschneite, würden das Grab und die auf der Lichtung liegenden toten Tsuranis schon bald unter einer Schneedecke verschwinden. Im Frühling jedoch, nach der Schneeschmelze, würde frisches Gras wachsen und das Grab vom Wald verschluckt werden.
»Alwin, führ die Männer weg.«
»Hauptmann, Ihr wolltet vorher noch mit dem Jungen sprechen«, erwiderte Alwin leise.
Dennis nickte und ließ dann seinen Blick die Reihen entlangschweifen, bis er Richard Kevinsson fand.
»Komm her, Junge«, blaffte Dennis.
Nervös trat Richard vor.
»Ihr übrigen marschiert schon mal los. Wir wollen morgen früh bei Fort Brendan und hinter unseren eigenen Linien sein.«
Zwei Männer, die als Fährtensucher dienten, eilten vor und schossen beiderseits des Pfads davon, sprangen leichtfüßig über abgebrochene Äste und um Baumstämme herum. Innerhalb weniger Sekunden waren sie im Wald verschwunden. Als Nächstes setzten sich die sechs Männer in Bewegung, die die Vorhut bildeten, und marschierten den Pfad entlang.
Richard Kevinsson näherte sich seinem Vorgesetzten; es war offensichtlich, dass er sich ziemlich unbehaglich fühlte. »Hauptmann?«, fragte er mit bebender Stimme.
Dennis blickte Gregory, Tinuva und den Priester auffordernd an; er wollte, dass sie sich zurückzogen. Tinuva trat beiseite, verbeugte sich respektvoll vor dem Grab und schloss sich der Kolonne an. Gregory und der Priester rührten sich jedoch nicht von der Stelle.
»Vater, geht bitte und kümmert Euch um die Verwundeten«, sagte Dennis scharf.
»Ich bin Euch sehr dankbar dafür, dass Ihr mich gerettet habt, Hauptmann«, erwiderte der Priester. »Aber ich fühle mich verantwortlich dafür, dass dieser Junge jetzt in Schwierigkeiten steckt, und ich möchte ihm gern zur Seite stehen.«
Dennis war kurz davor, einen wütenden Befehl von sich zu geben, doch ein Blick in Gregorys Gesicht hielt ihn davon ab. Er wandte seine Aufmerksamkeit daher Richard zu. »Sobald wir zum Lager von Baron Moyet zurückgekehrt sind, werde ich dich von der Liste der Kompanie streichen lassen.«
»Hauptmann?« Richards Stimme zitterte, als würde sie ihm jeden Augenblick den Dienst versagen.
»Ich habe dich in dieser Kompanie aufgenommen, weil du mir Leid getan hast, Junge. Der Verlust deiner Familie hat mich an meinen eigenen Verlust erinnert. Aber es war ein Fehler. In den letzten zwei Wochen bist du kaum in der Lage gewesen, mit uns Schritt zu halten. Ich habe gehört, dass du erst vor zwei Nächten während deiner Wache eingeschlafen bist.«
Er zögerte kurz. Es war Jurgen, der ihm das gesagt hatte, und er hatte diesen Jungen dann auch noch verteidigt. Er hatte Dennis vor Augen geführt, dass es ihm genauso ergangen war, als er vor vielen Jahren an seinem ersten Feldzug teilgenommen hatte.
»Du warst es, den der Priester vom Pfad aus gesehen hat, nicht wahr?«
Der Junge zögerte.
»Es war nicht sein Fehler«, sagte Vater Corwin aufgebracht. »Ich bin stehen geblieben, weil ich vom Laufen erschöpft war. Ich stand direkt vor ihm und konnte gar nicht anders als ihn sehen.«
»Das spielt keine Rolle«, erwiderte Dennis, und der Blick in seinen Augen machte nur zu deutlich, dass er sich kein weiteres Wort von dem Mann in der schwarzen Robe gefallen lassen würde.
»Nun?«
»Jawohl, Hauptmann«, erklärte Richard mit schwacher Stimme. »Das war ich.«
»Wie war das möglich?«
»Ich dachte, ich hätte mich gut verborgen.«
»Wenn dieser alte Mann dich sehen konnte, kannst du davon ausgehen, dass dich auch ein tsuranischer Kundschafter gesehen hätte. Du stellst für dich selbst und mein Kommando eine Gefahr dar. Ich schicke dich zurück. Du kannst deinen Freunden sagen, was du willst. Ich schlage vor, du suchst dir eine Position in einer schönen und bequemen berittenen Einheit unten in Krondor. Dort brauchst du dein Hirn nicht anzustrengen. Es genügt, wenn du reitest, deine Lanze vorstreckst und angreifst. Dann kannst du einer dieser Helden sein, von denen sie immer in den Liedern und Balladen singen.«
»Aber ich wollte doch so gern unter Euch dienen, Hauptmann«, flüsterte der Junge.
»Nun, das hast du ja auch getan. Aber jetzt ist damit Schluss.« Er zögerte noch einen Moment, dann brach seine Wut aus ihm heraus. »Geh und wirf einen letzten Blick auf das Grab, bevor wir aufbrechen«, befahl Dennis mit kaum verhohlener Abneigung. Seine leise Stimme war weit strafender, als es eine laut herausgeschriene Beleidigung je hätte sein können. »Und jetzt geh mir aus den Augen.«
Der Junge versteifte sich, das Gesicht so blass wie die ersten Schneeflocken, die neben ihm zu Boden fielen. Er nickte und drehte sich um, die Schultern tief herabhängend. Die anderen Männer sahen zur Seite, als er wieder zu ihnen stieß.
Der Priester trat einen Schritt vor.
Dennis’ Hand schnellte vor, und er streckte dem Priester den Zeigefinger vors Gesicht.
»Ich mag Euch nicht«, verkündete Dennis. »Ihr seid ein lästiger Narr und treibt Euch hier herum, wo Ihr nichts zu suchen habt. Verflucht, wisst Ihr denn nicht, dass hier ein Krieg geführt wird? Und zwar keiner von der Sorte, wie er den fetten Mönchen und Troubadouren beim Lagerfeuer als Gesprächsstoff dient. Ich hoffe nur, Ihr habt jetzt die Nase ordentlich voll davon.«
»Zwei meiner ›fetten Freunde‹, wie Ihr sie nennt, sind seit heute Gefangene der Tsuranis«, erwiderte Vater Corwin. Unterdrückte Wut färbte seine Stimme. »Ich habe mich bereit erklärt, der Armee als Heiler zu dienen. Ich bete darum, dass ich nicht eines Tages Euch zu versorgen habe. Es ist eine bittere Arbeit, Fleisch zusammenzuflicken, das keine Seele hat.«
Der Priester drehte sich um und stapfte davon. Inzwischen setzte sich der mittlere Teil der Kolonne, der aus den Trägern mit den Verwundeten bestand, in Bewegung. Corwin begleitete sie.
Gregory kicherte leise.
»Was ist daran denn so verflucht witzig?«, blaffte Dennis.
»Ich finde, er hat Recht. Du hast den Jungen ein bisschen zu hart rangenommen.«
»Das glaube ich nicht. Seinetwegen wären wir beinahe alle getötet worden.«
»Er hat keinen Fehler gemacht. Ich war nur zehn Fuß von ihm entfernt und habe dafür gesorgt, dass er gut versteckt war.« Dann schien ihm ein Gedanke zu kommen. »Dieser Priester hat ungewöhnlich scharfe Augen.«
»Trotzdem schicke ich den Jungen zurück.«
»Glaubst du, Jurgen hätte das auch getan?«
Dennis wirbelte herum, und seine Augen verdüsterten sich vor Verbitterung. »Ich möchte nicht, dass du mit mir über Jurgen sprichst.«
»Jemand muss das aber tun. Jeder einzelne Mann deiner Kompanie teilt deinen Schmerz – aber nicht nur deshalb, weil sie einen Mann verloren haben, den sie respektiert haben, sondern auch, weil sie dich lieben und deine Trauer mittragen.«
»Meine Trauer? Woher willst du wissen, was ich empfinde?«
»Ich weiß es einfach«, erklärte Gregory. »Auch ich habe gesehen, was geschehen ist. Jurgen hat seine Entscheidung getroffen, er hat seine Deckung aufgegeben, um den Jungen zu retten. Ich hätte es ebenfalls getan, und auch du hättest es getan.«
»Das glaube ich nicht.«
»Du und deine Plünderer, ihr seid im Laufe der Jahre zwar ziemlich hart geworden, Dennis, aber ihr seid nicht seelenlos. Du hättest sehr wohl versucht, ihn zu retten, auch wenn es dich das Leben gekostet hätte, genau wie Jurgen. In dem Jungen stecken Fähigkeiten. Du hast es vielleicht nicht bemerkt, und ich bin mir auch nicht sicher, ob er selbst sich daran erinnert, aber er hat den ersten Tsurani, der direkt auf ihn zukam, getötet. Der Tsurani, der ihn beinahe überwältigt hätte, ist von hinten gekommen.«
»Der Junge muss trotzdem gehen.«
»Es wird ihn umbringen. Wir beide kennen diese Sorte. In der nächsten Schlacht wird er etwas ziemlich Dummes tun, um seine Ehre wiederzuerlangen, und dabei wird er draufgehen.«
»Das ist dann sein Problem und nicht meins.«
»Und was ist, wenn er andere mit in den Tod zieht? Was würde Jurgen wohl dazu sagen?«
»Jurgen ist tot, verflucht noch mal«, zischte Dennis. »Sprich niemals wieder mit mir über ihn.«
Gregory trat zurück, hob die Hände und schüttelte traurig den Kopf.
Der natalische Kundschafter trat zum Grab. Er blickte auf die braune Erde, die jetzt von einer leichten Schneedecke bedeckt war. »Bis wir im Licht beisammenstehen«, flüsterte er.
Dann ging er zu der Kompanie. Tinuva gesellte sich zu ihm, und die beiden eilten den Pfad in die entgegengesetzte Richtung entlang, um sicherzustellen, dass niemand dieser Einheit folgte.
Dennis war allein – der letzte Mann, der die Lichtung verließ.
Es schneite, und dichte Flocken wirbelten zu Boden, berührten sein Gesicht, schmolzen und hinterließen kleine Rinnsale auf seinem goldenen Bart, der das erste Grau der mittleren Jahre zeigte.
»Verflucht«, seufzte er. »Wieso lässt du mich nur so allein, Jurgen?«
Jetzt war niemand mehr da. Eine Woge wehmütiger Erinnerungen überflutete ihn.
Die Besitztümer der Hartrafts waren nichts gewesen, dessen man sich wirklich hätte rühmen können, ein bisschen Waldland zwischen Tyr-Sog und Yabon, ein paar verstreute Dörfer im Grenzgebiet, ein ländlicher Junkerbesitz, den die hohen Grafen, Barone und Herzöge des Südens und Ostens baldmöglichst abgestoßen oder als Einsatz beim Würfeln aufs Spiel gesetzt hätten. Aber es war sein Heim gewesen, und es war das Heim seines Vaters und seines Großvaters gewesen.
Jurgen war ein sehr junger Soldat gewesen, als er bei dem alten Angus Hartraft – genannt Gabelbart – gedient hatte. Dennis’ Großvater hatte die Ländereien an der Grenze für seine treuen Dienste im Kampf gegen die dunklen Wesen erhalten, die im Norden lebten. Jurgen war auch der engste Freund seines Vaters gewesen. Und als sein Vater am ersten Tag des Spaltkrieges gestorben war, während die Tsuranis ihr Land überschwemmten, hatte Jurgen ihm das Leben gerettet, während die Festung erobert worden war.
Dennis starrte auf das Grab.
Es wäre besser gewesen, wenn ich in jener Nacht gestorben wäre, dachte er, und Groll flackerte bei dem Gedanken an den alten Jurgen kurz in ihm auf.
Gwenynth, die nur sechs Stunden lang seine Braut gewesen war, war in jener Nacht gestorben. Sein Vater hatte ihm befohlen, sie durch den Geheimgang aus dem brennenden Chaos zu schaffen, in das sich die Festung inzwischen verwandelt hatte. Er hatte bei seinem Vater bleiben wollen, einen Schlag auf den Kopf erhalten und sich mit Gwenynth außerhalb des Tunnels wiedergefunden. Doch kurz danach war sie von einem Armbrustbolzen getroffen worden, und ihr Herz hatte für immer zu schlagen aufgehört. Im flackernden Lichtschein der brennenden Festung hatte er einen kurzen Blick auf den Mörder erhascht, und das Bild eines sich umdrehenden und flüchtenden Mannes hatte sich in sein Gedächtnis eingegraben. Er hatte den leblosen Körper fest umklammert, hatte bei ihr bleiben wollen, doch schließlich hatte Jurgen ihn mit der flachen Seite seines Schwertes bewusstlos geschlagen und danach hinunter zum Fluss und in Sicherheit gebracht.
Insgesamt fünfzehn Männer der Garnison hatten in jener Nacht überlebt. Carlin, der Vorletzte, war erst einen Monat zuvor an Lungenschwund gestorben. Von diesen fünfzehn Männern war jetzt nur noch Dennis übrig. Einige der Männer waren seiner Kompanie beigetreten, als er sie gegründet hatte, aber es gab natürlich auch noch andere langjährige Kameraden. Doch von denen, die Dennis immer als das Herz und die Seele der Plünderer betrachtet hatte, war jetzt nur noch er übrig.
So bist du jetzt also tot, alter Mann. Gestorben, weil ein dummer Junge und ein fetter alter Priester einen Fehler gemacht haben. Es passt zu dir, so zu sterben. Ein trauriges Lächeln huschte über Dennis’ Gesicht.
Das »Glück der Hartrafts«, wie es immer geheißen hatte. Kein Ruhm, kein Geld, keine Berühmtheit. Nur der Angehörige einer Familie mit einem geringen Titel und sonst nichts. Und dann, am Ende, bekommst du wegen eines tollpatschigen Jungen einen Speer in den Rücken.
Doch er wusste, dass Jurgen, der alte, lachende Jurgen, es nicht anders hätte haben wollen, dass er schon immer behauptet hatte, lieber für einen dummen Junker als für einen König sterben zu wollen. Und tatsächlich hätte er sich vermutlich auch einfach nur auf sein Schwert gestützt und nichts getan, wäre es um den verrückten König in Rillanon gegangen – in der tiefen Überzeugung, dass solch hoch stehende und mächtige Personen wie der König sich um sich selbst kümmern sollten.
Eine Brise kam auf, fuhr leise stöhnend durch die Zweige. Der Schnee fiel jetzt stärker, längst nicht mehr so weich wie zuvor, und Dennis senkte den Kopf.
Er öffnete die Hand und ließ die Erde auf das Grab fallen. Er besaß jetzt von seiner Vergangenheit nichts anderes mehr als einen halb in Vergessenheit geratenen Namen und das Schwert an seiner Seite. Sein Vater, Jurgen, Gwenynth, sie alle lagen in ihren Gräbern.
»Dennis?«
Er blickte auf. Es war Gregory.
»Es folgt uns niemand, aber wir sollten uns trotzdem beeilen.«
Die Dunkelheit senkte sich herab. Tinuva war nur ein Dutzend Schritte entfernt, aber kaum zu sehen. Er wartete an der Stelle, wo der Pfad in den Wald führte.
Dennis blickte sich ein letztes Mal auf der Lichtung um. Schon bald würde der Wald sie verschlingen.
Der Wind blies heftig um seinen Körper, und er zitterte vor Kälte.
»Es gibt immer noch die Plünderer«, flüsterte Gregory.
Dennis nickte und blickte nach unten auf die Leichen der Tsuranis, die auf der Lichtung lagen. Alles haben sie mir genommen. Er warf einen Blick den Pfad entlang, wo seine Männer warteten, und wenn auch keiner von ihnen aus Valinar stammte, waren ihm ihre Gesichter doch so vertraut geworden wie jene, die er von zu Hause gekannt hatte. Die Plünderer lebten noch immer, und er hatte ihnen gegenüber eine Verantwortung.
Er nickte.
»Und den Krieg«, erwiderte Dennis kalt. »Es gibt immer noch den Krieg.«
Ohne einen weiteren Blick zurück wandte sich Hauptmann Dennis Hartraft vom Grab ab und verließ die Lichtung. Er verschwand in der Dunkelheit.
Gregory betrachtete ihn und schüttelte traurig den Kopf; dann folgte er ihm den Pfad entlang, der nach Fort Brendan führte.
Es war kalt.
Kommandeur Asayaga warf eine Hand voll Kohlen in die wärmende Kohlenpfanne, zog die Handschuhe aus und rieb sich die Hände über dem Feuer.
»Verfluchtes Land«, seufzte er.
Er hob die an ihn gerichteten Befehle auf und studierte die daran befestigte Karte.
Es war Wahnsinn. Inzwischen hatten die ersten richtigen Schneefälle eingesetzt, und doch erwartete man von ihm, dass er mit seinem Kommando sofort losmarschierte, um zusammen mit einer anderen Kolonne bei Morgendämmerung einen Außenposten des Königreichs anzugreifen.
Wieso ausgerechnet jetzt? Am Tag wäre es einfach gewesen, aber jetzt senkte sich bereits die Dämmerung herab. Draußen vor seinem Zelt stürmte es, und der vor Kälte starr gewordene Zeltstoff knisterte und ratterte ununterbrochen. Unüberhörbar krachten die schweren Schneemassen von den Ästen und Zweigen der das Lager umgebenden Bäume.
Das Spiel, immer geht es um das Große Spiel, erkannte er mit einem leichten Anflug von Fatalismus. Er war fest davon überzeugt, dass man ihn auf eine aussichtslose, zum Scheitern verurteilte Mission schickte, um so einem seiner Clanverwandten Schande anhängen zu können. Sein Haus Kodeko war nicht bedeutsam genug, als dass er selbst im Mittelpunkt des Interesses gestanden hätte, aber er war verwandt mit anderen Männern, die ebenfalls zum Kanazawai-Clan zählten. Asayaga legte die Zettel mit den Befehlen nieder und lehnte sich auf dem kleinen Zeltstuhl zurück, und nicht zum ersten Mal wünschte er sich, dass das Rückenteil etwas stabiler wäre. Noch mehr allerdings wünschte er sich, dass der gefrorene Boden wie zu Hause mit weichen, behaglichen Kissen ausgelegt wäre. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und schüttelte den Kopf. Er wurde zu misstrauisch. Das hier musste nicht zwangsläufig Teil einer weiteren Intrige der Minwanabi sein, die zu Hause einen politischen Feind beschämen wollten; es konnte sich sehr wohl um einen gut gemeinten, aber schlecht geplanten Angriff handeln. Was auch immer es sein mochte, seine Pflicht war eindeutig.
Asayaga rief nach Sugama, seinem erst kürzlich ernannten stellvertretenden Kommandeur.
»Die Männer sollen sich formieren. Vollständige Rüstung und Marschproviant für fünf Tage. Sorgt dafür, dass sie die neuen Felle und Fußwickel tragen. Wir müssen noch vor Sonnenuntergang losmarschieren.«
»Wohin, Hauptmann?«
Asayaga reichte ihm die Karte. Sugama studierte sie eingehend.
Asayaga unterließ es erst einmal, sich dazu zu äußern. Sugama begriff offensichtlich gar nicht, auf was er da starrte, aber er tat es mit einer solchen Intensität, als wäre er ein Gelehrter und würde sich tief schürfende Gedanken machen.
»Es geht um einen Außenposten des Königreichs. Er hätte heute eingenommen werden sollen, doch der Kommandeur hat in seinem großen Scharfsinn entschieden, dass er dazu noch weitere Männer benötigt. Die Wahl ist auf uns gefallen.«
»Es ist eine Ehre, dass unser Kommandeur uns erwählt hat.«
Asayaga schnaubte.
»Ja, es ist eine Ehre für uns. In der Sprache des Königreichs heißt unser Ziel ›Fort Brendan‹.«
Bei den letzten beiden Worten kam Asayaga ein bisschen ins Stolpern.
»Schon bald wird dieser Name im Kaiserreich von unserem Ruhm künden.«
»Natürlich«, sagte Asayaga, und seine Gesichtszüge erstarrten zu einer Maske, die nicht das Geringste preisgab. »Eine weitere Ruhmestat in einem glorreichen Krieg.«
2
Entdeckung
Eisiger Regen peitschte vom Himmel herab.
Vorsichtig und lautlos glitt Dennis Hartraft an der Kolonne seiner erschöpften Männer entlang. Sie standen in den Niederschlägen des frühen Morgens geduckt und absolut reglos da, und viele von ihnen hatten Pfeile an die Sehnen gelegt. Ihre Umhänge waren von einem solch schmutzigen Grau, dass sie mit dem Wald geradezu verschmolzen. Er konnte ihre Anspannung spüren; irgendetwas stimmte nicht. Ihre Blicke folgten ihm, als er geduckt von Baum zu Baum schlich.