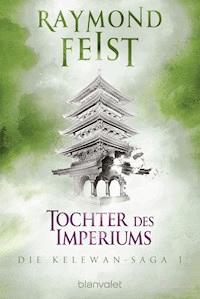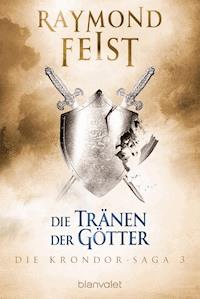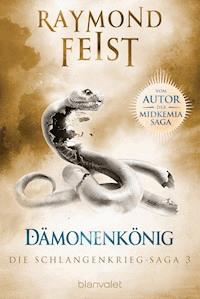9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DIE SCHLANGENKRIEG-SAGA
- Sprache: Deutsch
Komplett überarbeitete Neuausgabe der New-York-Times-Bestsellersaga.
Die Schattenkönigin sammelt eine Armee von unglaublicher Größe und Kraft um sich, um Midkemia dem Erdboden gleich zu machen. Sie hat eine Geheimwaffe: die schlangenartigen Panthatier, die überall Angst und Schrecken verbreiten. Der junge Adlige Erik von Darkmoor und sein Freund Roo geraten unfreiwillig in den Krieg mit den Reptilienwesen und befinden sich plötzlich im Herzen einer mörderischen Schlacht ...
- »Der perfekte Start für alle, die in Feists Fantasywelten eintauchen wollen.« (Locus Magazine)
- Heroische Fantasy – komplett überarbeitet und in edler Neuaustattung.
- Dieser Roman erschien bisher in zweigeteilter Ausgabe unter den Titeln »Die Blutroten Adler« und »Die Smaragdkönigin«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Die Schattenkönigin sammelt eine Armee von unglaublicher Größe und Kraft um sich, um Midkemia dem Erdboden gleichzumachen. Sie hat eine Geheimwaffe: die schlangenartigen Panthatier, die überall Angst und Schrecken verbreiten. Der junge Adlige Erik von Darkmoor und sein Freund Roo geraten unfreiwillig in den Krieg mit den Reptilienwesen und befinden sich plötzlich im Herzen einer mörderischen Schlacht … Ein großartiger Abenteuerroman voller Spannung, Überraschungen, Liebe, Action und faszinierender Figuren.
Autor
Raymond Feist wurde 1945 in Los Angeles geboren und lebt in San Diego im Süden Kaliforniens. Viele Jahre lang hat er Rollenspiele und Computerspiele entwickelt. Aus dieser Tätigkeit entstand auch die fantastische Welt seiner Romane: Midkemia. Die in den 80er-Jahren begonnene Saga ist bereits ein Klassiker des Fantasy-Genres, und Feist gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Fantasy in der Tradition Tolkiens.
Besuchen Sie uns auch auf
www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Raymond Feist
Die Schlangenkrieg-Saga 1
Schattenkönigin
Deutsch von Susanne Gerold
Tage, da’s Rund unsres Blickes
die Adler zur Sonne noch aufsteigen sah;
da der Griff unsrer Hände am Bogen
mit Pfeil und mit Auge eines war;
da die Wogen der Freuden noch stürmten,
und Wonne und Lust sich uns boten! –
Erfleh sie, sie schwinden, sie glimmen
wie Lichter auf Hügeln der Toten.
George Meredith
»Ode an die Jugend, in Erinnerung«
Prolog Die Erlösung
Die Trommeln dröhnten.
Die Krieger der Saaur sangen ihre Schlachtgesänge und bereiteten sich auf den Kampf vor. Zerrissene Kriegsbanner hingen von blutbefleckten Lanzen. Dichter Rauch bedeckte den Himmel von Horizont zu Horizont. Grüne Gesichter, mit gelber und roter Farbe bemalt, wandten sich dem Himmel im Westen zu, wo Feuer blutrot und ockerfarben vor schwarzen Rauchwolken loderten, welche die untergehende Sonne und den vertrauten Anblick der Abendsterne verhüllten.
Jarwa, Sha-shahan der Sieben Völker, Herrscher des Reiches von Grass, Herr der Neun Meere, konnte den Blick nicht von diesem Anblick der Zerstörung wenden. Den ganzen Tag hatte er die Feuer nicht aus den Augen gelassen, und selbst über die Entfernung hinweg waren das Geheul der Sieger und die Schreie der Verlierer an sein Ohr gedrungen. Der Wind, der einst den süßen Duft der Blumen und das Aroma der Gewürze vom Markt herangetragen hatte, brachte nun den beißenden Gestank verkohlten Holzes und verbrannten Fleisches mit sich. Jarwa wusste, dass sich seine Krieger auf einen letzten Verteidigungsversuch vorbereiteten, obwohl sie in ihren Herzen die Schlacht schon verloren gegeben hatten und ihr Volk ausgemerzt sahen.
»Herr«, sagte Kaba, Jarwas Schildträger und lebenslanger Begleiter.
Jarwa wandte sich seinem ältesten Freund zu und sah die Sorge in seinem Blick. Die Miene des Schildträgers war für andere eine undurchdringliche Maske, doch der Sha-shahan konnte sie enträtseln wie ein Schamane eine alte Schrift. »Was gibt es?«
»Der Pantathianer ist hier.«
Jarwa nickte. Entmutigt ließ er die Hände auf den Griff seines Schwertes sinken. Diese Waffe, Tual-masok – »Bluttrinker« in der alten Sprache –, symbolisierte sein Amt, und zwar viel mehr als die Krone, die er so selten und nur bei wichtigen Anlässen trug. Er stieß die Spitze der Waffe in die Erde seines geliebten Tabar, des ältesten Landes auf Shila. Siebzehn Jahre lang hatte er die Eindringlinge bekämpft, und dennoch waren seine Horden bis in die Mitte des Reiches von Grass zurückgedrängt worden.
Als Jarwa das Schwert des Sha-shahan übernommen hatte – damals war er noch ein junger Mann gewesen –, waren die Krieger der Saaur an ihm vorbeigezogen und hatten sich auf dem alten Steindamm aufgereiht, der die Takador-Meerenge überspannte, jenen Kanal, der das Meer von Takador und den Castakischen Ozean verband. In Zenturien-Einheiten von einhundert Mann waren sie an ihm vorbeigeritten. Einhundert Zenturien machten ein Jatar: zehntausend Krieger. Zehn Jatar waren ein Heer und zehn Heere eine Horde. Auf dem Höhepunkt seiner Macht waren sieben Horden seinen Kriegshörnern gefolgt. Sieben Millionen Krieger. Rastlos waren sie durch das Reich von Grass gezogen, hatten ihre Pferde geweidet, während ihre Kinder zwischen den Wagen und Zelten der Saaur aufgewachsen waren. Das Reich hatte sich von der Stadt Cibul bis zu den entferntesten Grenzen über zehntausend Meilen erstreckt. Ein Reiter, der unaufhörlich galoppierte, hätte einen Mondzyklus und einen halben gebraucht, um von der Hauptstadt zur Grenze zu gelangen.
Jedes Jahr hatte eine Horde in der Nähe der Hauptstadt gelagert, während die anderen an den Grenzen ihres großen Reiches entlanggezogen waren und den Frieden gesichert hatten, indem sie alles eroberten, was ihnen keinen Tribut zahlen wollte. Von den Küsten der neun Ozeane hatten tausend Städte Naturalien, Edelsteine, Gold und Sklaven zum Hof des Sha-shahan gesandt. Und einmal in zehn Jahren hatten sich die Besten aller sieben Völker zu den Großen Spielen in Cibul, der uralten Hauptstadt des Reiches von Grass, versammelt. Über Jahrhunderte hinweg waren die Saaur von Shila unter dem Banner des Sha-shahans vereint gewesen, alle außer den entferntesten Völkern auf der anderen Seite der Welt. Jarwa hatte gehofft, er könnte als Sha-shahan den Wunschtraum seiner Vorfahren erfüllen und selbst die letzte Stadt ins Reich holen; somit hätte er die ganze Welt regiert.
Vier große Städte waren von Jarwas Horden erobert worden, und weitere fünf hatten sich ohne Kampf ergeben. So waren nur noch weniger als ein Dutzend Städte außerhalb des Reichs verblieben. Schließlich hatten die Reiter der Panta-Horde vor den Toren von Ahsart, der Stadt der Priester, gestanden, und dann war die Katastrophe über sie alle hereingebrochen.
Jarwa verschloss sich den Todesschreien, die jetzt in der Dämmerung zu hören waren. Es waren die Schreie seiner Leute, die in die Schlachtgruben geführt wurden. Den Berichten jener wenigen nach, die hatten entkommen können, waren die Gefangenen, die schnell ermordet wurden, die glücklicheren. Die Eindringlinge, so wurde gesagt, konnten die Seelen der Sterbenden einfangen, behielten sie als Spielzeug und quälten sie nach Belieben, womit den Toten der verdiente Platz unter ihren Vorfahren in den Reihen der Himmlischen Horde verwehrt wurde.
Jarwa blickte von seinem Aussichtspunkt auf dem Plateau hinunter auf die Heimat seines Volkes. Hier, nicht weiter als einen halben Tagesritt von Cibul entfernt, lagerten die Überreste seiner einst so mächtigen Armee. Im Angesicht ihres Sha-shahan standen die Krieger aufrecht da und blickten dem fernen Feind mit Verachtung entgegen. Doch ganz gleich, wie aufrecht ihre Haltung sein mochte, in ihren Augen konnte der Sha-shahan etwas sehen, was zuvor kein Heer der Neun Meere je bei seinen Saaurkriegern hatte entdecken können: Angst.
Jarwa seufzte und ging wortlos zu seinem Zelt zurück. Er wusste nur zu gut, dass ihm keine andere Wahl blieb, und doch hasste er es, dem Fremden gegenübertreten zu müssen. Vor dem Zelt zögerte er und sagte: »Kaba, ich habe kein Vertrauen zu diesem … Priester« – er spuckte das Wort regelrecht aus – »aus einer anderen Welt.«
Kaba nickte. Seine Schuppen waren vom harten Leben auf dem Rücken der Pferde und im Dienste des Sha-shahan grau geworden. »Ich weiß, Ihr zweifelt, mein Herr. Doch der Träger des Bechers und auch der Meister des Wissens stimmen zu. Wir haben keine Wahl.«
»Man hat immer eine Wahl«, flüsterte Jarwa. »Wir könnten wählen, wie Krieger zu sterben.«
Kaba streckte die Hand aus und berührte Jarwa am Arm – eine Vertraulichkeit, die jeden anderen Krieger der Saaur das Leben gekostet hätte. »Alter Freund«, sagte er leise, »dieser Priester bietet unseren Kindern eine Zuflucht. Ja, wir könnten kämpfen und sterben. Doch dann würde der bittere Wind das Andenken an die Saaur in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Niemand wird übrig bleiben, um der Himmlischen Horde die Lieder über unsere Tapferkeit zu singen, während die Feinde unser Fleisch verspeisen. Oder wir bringen die letzten unserer Frauen und jungen Männer in Sicherheit. Haben wir eine andere Wahl?«
»Aber er ist nicht wie wir«, flüsterte Jarwa. »Sein Blut ist kalt.«
Kaba machte ein Zeichen. »Die mit dem kalten Blut sind die Wesen aus den Legenden.«
»Und was ist mit jenen?«, fragte Jarwa und deutete auf die Feuer, die in der Ferne die Hauptstadt umringten.
Kaba antwortete mit einem Schulterzucken.
Schweigend führte Jarwa seinen ältesten Freund in das Zelt.
Das Zelt des Sha-shahan war größer als jedes andere im Lager, es glich einem Pavillon, der aus mehreren Zelten zusammengenäht worden war. Jarwa sah sich um und spürte, wie ihm kalt ums Herz wurde. So viele seiner weisesten Berater und mächtigsten Meister des Wissens fehlten. Und dennoch blickten ihn die Verbliebenen voller Hoffnung an. Er war der Sha-shahan, und es war seine Pflicht, sein Volk zu befreien.
Dann fiel sein Blick auf den Fremden, und wieder fragte er sich, welche Wahl die weisere wäre. Die Kreatur sah einem Saaur sehr ähnlich. Grüne Schuppen bedeckten Arme und Gesicht. Der Priester trug eine den ganzen Körper verhüllende Robe mit großer Kapuze und nicht die Rüstung eines Kriegers oder das Gewand eines Meisters des Wissens. Nach den Maßstäben der Saaur war der Fremde klein, kaum zwei Armspannen hoch, während seine Schnauze entschieden zu groß war, und seine Augen waren schwarz wie bei den Saaur, bis auf die rote Iris auf weißem Grund. Wo dicke weiße Nägel hätten sein müssen, zeigten sich schwarze Klauen. Und wegen seiner gespaltenen Zunge klang seine Sprache zischend.
Jarwa nahm den verbeulten Helm vom Kopf und reichte ihn einem Diener. Mit lauter Stimme sprach er aus, was jeder Krieger und jeder Meister des Wissens dachte: »Schlange!«
Die Kreatur verneigte sich, als wäre es ein Gruß und keine Beleidigung. »Ja, Herr«, erwiderte sie.
Einige von Jarwas Kriegern hatten bereits die Hände an den Waffen, doch der alte Träger des Bechers, der in der Rangfolge gleich nach Kaba kam, mahnte: »Er ist unser Gast.«
Die Saaur, die Eidechsenmenschen von Shila, kannten die alten Legenden über das Schlangenvolk. Mit diesen Kreaturen drohten die Mütter ihren ungehorsamen Kindern. Man erzählte sich, sie würden ihre eigene Art fressen und Eier in heiße Quellen legen. Solange sich die Saaur zurückerinnern konnten, hatten sie das Schlangenvolk aus tiefster Seele gehasst. In den Legenden hieß es, beide Arten seien zu Anbeginn der Zeit von einer Göttin geschaffen worden, noch vor den ersten Reitern der Himmlischen Horde. Die Schlangen, die Diener der Grünen Herrin, der Göttin der Nacht, seien in deren Hause geblieben, während die Saaur mit den göttlichen Brüdern und Schwestern fortgezogen waren. Von ihrer Göttin auf dieser Welt allein gelassen, waren die Saaur ein reiches Volk geworden, doch die Erinnerung an die anderen, an die Schlangen, war nicht verloren gegangen. Nur die Meister des Wissens wussten, welche Geschichten wahr waren und welche in das Reich der Legenden gehörten, aber auch Jarwa wusste von Geburt an: Keiner Schlange durfte man blind vertrauen.
Der Schlangenpriester sagte: »Mein Herr, das Portal ist bereit. Die Zeit wird knapp. Das Festmahl mit dem Fleisch Eurer Landsleute wird sie bald langweilen, und wenn sich die Nacht herabsenkt, wird ihre Macht wachsen, und sie werden kommen.«
Jarwa beachtete den Priester nicht und wandte sich an seine Mitstreiter. »Wie viele Jatars haben überlebt?«
Tasko, der Shahan von Watiri, antwortete: »Vier und Teile einer fünften. Das ist alles, was von den Sieben Horden übrig geblieben ist.«
Jarwa gab dem Drang, seiner Verzweiflung Luft zu machen, nicht nach. Etwas über vierzigtausend Reiter. Mehr war von den Sieben Großen Horden der Saaur nicht geblieben.
Er fühlte sich, als würde ihm die Kehle zugeschnürt. Wie gut konnte er sich noch an seinen Wutausbruch erinnern, als man ihm die Nachricht von der Meuterei der Priester und ihrer Weigerung, Tribut zu zahlen, überbracht hatte. Jarwa hatte den letzten, sieben Monde währenden Angriff gegen Ahsart, die Stadt der Priester, persönlich angeführt. Für einen Moment packte ihn die Reue, dann aber schalt er sich selbst: Hätte irgendein Herrscher wissen können, dass die wahnsinnigen Priester von Ahsart eher bereit gewesen wären, alles zu zerstören, als sich unter die Herrschaft der Saaur zu stellen, die die Welt zu einem Reich vereinigen wollten? Es war der verrückte Hohepriester Myta gewesen, der das Portal entsiegelt und die Dämonen eingelassen hatte. Zwar hatten die ihm als Erstem den Kopf vom Körper gerissen und seine Seele gefangen und gefoltert, doch das war allenfalls ein schwacher Trost. Ein Überlebender aus Ahsart hatte behauptet, einhundert Kriegerpriester hätten den Dämon gleichzeitig angegriffen, während er sich an Mytas Fleisch gütlich tat, aber keiner hätte überlebt.
Zehntausend Priester und Meister des Wissens waren zusammen mit sieben Millionen Kriegern gestorben, als sie versucht hatten, die verfluchten Kreaturen auf ihrem Feldzug von der fernsten Grenze des Reiches zu dessen Mitte aufzuhalten. Der Krieg hatte die halbe Welt umspannt. Hunderttausende Dämonen waren gestorben, doch die Vernichtung eines jeden Einzelnen war mit Strömen von Blut bezahlt worden. Tausende von Kriegern hatten sich jeder einzelnen dieser grauenhaften Kreaturen entgegenstellen müssen. Die Meister des Wissens hatten mit ihren Künsten manches bewirkt, doch die Dämonen waren jedes Mal zurückgekehrt. Die Kämpfe hatten Jahre gedauert, eine endlose Schlacht, die sich über vier der Neun Meere erstreckt hatte. Kinder waren im Lager des Sha-shahan geboren worden, zu jungen Männern herangewachsen und schließlich im Kampf gefallen, als die Dämonen gekommen waren, und die Meister des Wissens hatten vergebens nach Mitteln gesucht, wie man das Portal schließen und so die Schlacht zugunsten der Saaur beenden konnte.
Zuletzt hatten sie sich zurück nach Cibul durchgekämpft, während die Armee der Dämonen weiter durch das Portal zwischen den Welten geströmt war, und jetzt wurde noch ein zweites Portal geöffnet, welches den Saaur eine kleine Hoffnung bot: die Flucht.
Kaba räusperte sich, und Jarwa verdrängte alles Bedauern aus seinen Gedanken. Denn das half ihm nun nicht weiter. Wie sein Schildträger schon gesagt hatte: Sie hatten keine Wahl.
»Jatuk«, sagte Jarwa, und ein junger Krieger trat vor. »Von meinen sieben Söhnen, die jeder eine Horde führten, bist du der letzte.« Bitterkeit lag in seiner Stimme. Der junge Krieger schwieg. »Du bist der Ja-shahan«, erklärte Jarwa und ernannte den jungen Mann damit zu seinem Thronfolger. Jatuk war vor zehn Tagen zu seinem Vater gestoßen. Mit seinen achtzehn Jahren gehörte er erst seit einem Jahr zu den Kriegern und hatte bislang an nur drei Schlachten teilgenommen. Jarwa sah, wie fremd ihm sein jüngster Sohn war. Jatuk war noch ein kleines Kind gewesen, als Jarwa aufgebrochen war, um Ahsart in die Knie zu zwingen. »Wer reitet zu deiner Linken?«
»Monis, mein Gefährte von Geburt an.« Jatuk zeigte auf einen ruhig wirkenden jungen Männlichen, an dessen Arm eine lange Narbe zu sehen war.
»Er sollte dein Schildträger sein.« An Monis gewandt fügte Jarwa hinzu: »Denke stets daran: Du hast die Pflicht, deinen Herrn mit deinem Leben zu schützen, und noch mehr: Du musst auch seine Ehre verteidigen. Niemand wird Jatuk jemals näherstehen als du, kein Weib, kein Kind, kein Meister des Wissens. Sage ihm immer die Wahrheit, selbst wenn er sie nicht zu hören wünscht.«
An Jatuk gerichtet fügte er hinzu: »Er ist dein Schild; beachte stets seinen Rat, denn wenn man nicht auf seinen Schildträger hört, ist es, als würde man mit einem gefesselten Arm, einem blinden Auge und einem tauben Ohr in die Schlacht ziehen.«
Jatuk nickte. Monis hatte gerade die höchste Ehre erfahren, die jemandem erwiesen werden konnte, der nicht in die Herrscherfamilie hineingeboren worden war; er durfte nun seine Meinung sagen, ohne dafür Strafe fürchten zu müssen.
Monis schlug die geballte rechte Faust gegen die linke Schulter. »Sha-shahan!«, sagte er, dann senkte er den Blick, um seinen Respekt zu bekunden.
»Wer wird deinen Tisch bewachen?«
»Chiga«, sagte Jatuk, »Gefährte von Geburt an.«
Jarwa stimmte zu. Aus der gleichen Krippe stammend, kannten diese drei einander so gut wie jeder sich selbst. Eine solche Bindung war fester als alle anderen. Jatuk sprach den jungen Krieger an: »Du wirst Waffen und Rüstung abgeben und hinter ihm bleiben.«
Es war eine zwiespältige Ehre, denn natürlich nahm der Träger des Bechers einen hohen Rang ein, doch dem Ruf der Schlacht nicht mehr folgen zu dürfen bedeutete für jeden Krieger einen schweren Verzicht.
»Beschütze deinen Herrn vor hinterhältigen Angriffen und falschen Freunden, die ihm nach zu viel Wein geheime Worte zu entlocken trachten.«
Chiga salutierte. Wie Monis durfte er jetzt frei zu seinem Herrn sprechen, ohne Strafe zu fürchten, denn als Träger des Bechers musste er geloben, Jatuk genauso vor allem Übel zu bewahren wie der Krieger, der auf der Schildseite des Ja-shahan ritt.
Jarwa wandte sich an seinen Meister des Wissens, der von Gefolgsleuten umgeben war. »Wer von euch ist der Begabteste?«
»Shadu«, antwortete der Meister des Wissens. »Er vergisst nie etwas.«
Jarwa wandte sich an den jungen Kriegerpriester. »Dann nimm die Tafeln und die Reliquien, denn von nun an bist du der oberste Hüter des Glaubens. Du wirst der Meister des Wissens werden.«
Der junge Gefolgsmann riss überrascht die Augen auf, als ihm sein Meister die alten Tafeln überreichte. Es waren große Pergamentbögen, die zwischen hölzernen Deckeln aufbewahrt wurden. Auf ihnen war in nahezu verblichener Schrift das gesamte Wissen der Saaur niedergeschrieben. Und nun wurde ihm die Verantwortung für dieses Wissen übertragen, für die Auslegungen und die Einhaltung der Bräuche. Für jedes Wort, welches vor Urzeiten mit Tinte festgehalten worden war, musste er tausend Deutungen im Gedächtnis behalten.
Jarwa fuhr fort: »Euch, die ihr mir von Anfang an gedient habt, will ich eine letzte Aufgabe übertragen. Bald wird der Feind erneut angreifen. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Singt die Totenlieder laut und seid gewiss, dass eure Namen im Gedächtnis eurer Kinder weiterleben werden, auf einer anderen Welt unter einem fremden Himmel. Ich weiß nicht, ob die Lieder das Nichts durchdringen werden, um die Erinnerung an die Himmlischen Horden am Leben zu halten, doch wenn die Dämonen kommen, lasst es jeden Krieger wissen: Euer Fleisch soll in einem fernen Land überleben.«
Was auch immer der Sha-shahan empfinden mochte, es blieb hinter der starren Maske seines Gesichts verborgen: »Jatuk, du bleibst bei mir. Der Rest von euch möge auf seine Plätze gehen.« An den Schlangenpriester gewandt sagte er: »Geht an die Stelle, an der Ihr Euren Zauber wirken lassen wollt, und wisst eins: Solltet Ihr ein falsches Spiel mit mir spielen, so wird mein Schatten aus der Hölle aufsteigen und Euch jagen, und möge es auch zehntausend Jahre dauern.«
Der Priester verneigte sich und zischte: »Herr, mein Leben und meine Ehre sind Euer. Ich bleibe, um Euch als Rückendeckung zu dienen. Auf diese bescheidene Weise möchte ich Euch den Respekt meines Volkes beweisen und die Saaur, die uns in so vielerlei Hinsicht gleichen, in unsere Heimat bringen.«
Falls Jarwa von diesem Opfer beeindruckt war, so zeigte er es nicht. Er bedeutete seinem jüngsten Sohn mit einer Geste, mit ihm vor das Zelt zu treten. Der junge Mann folgte seinem Vater bis an die Kante des Plateaus und sah auf die ferne Stadt hinunter, in der das Höllenfeuer der Dämonen loderte. Die Schreie aus den Kehlen der Sterbenden gellten durch die Abenddämmerung, und der junge Mann musste sich zwingen, den Blick nicht abzuwenden.
»Jatuk, morgen um diese Zeit wirst du auf einer fernen Welt der neue Sha-shahan der Saaur sein.«
Der junge Mann wusste, dass seine eigenen Wünsche nicht mehr wichtig waren, und sparte sich jedes Wort des Protests.
»Ich traue diesen Schlangenpriestern nicht«, flüsterte Jarwa. »Sie mögen uns zwar ähnlich sein, aber denk immer daran, dass ihr Blut kalt ist. Sie kennen keine Gefühle, und ihre Zunge ist gespalten. Erinnere dich also an das alte Wissen, daran, wie uns die Schlangen das letzte Mal besucht haben, und an alle die Geschichten vom Verrat, seit unser aller Mutter uns, den Warmblütigen und den Kaltblütigen, das Leben geschenkt hat.«
»Vater.«
Jarwa legte seinem Sohn die schwielige und vernarbte Hand auf die Schulter und drückte fest zu. Er fühlte harte Muskeln, und ein Fünkchen Hoffnung keimte in ihm auf. »Ich habe meinen Eid geleistet, und du musst dieses Gelöbnis halten. Tue nichts, was unseren Vorfahren und deinem Volke Schande bereiten würde, aber hüte dich vor Verrat. Wir haben gelobt, den Schlangen eine Generation lang zu dienen: dreißig Drehungen jener fremden Welt lang. Aber denke daran: Sollten die Schlangen den Eid ihrerseits brechen, dann bist du frei und kannst tun, was du für richtig hältst.«
Er nahm seine Hand von der Schulter seines Sohnes und winkte Kaba herbei. Der Schildträger näherte sich mit dem Helm seines Herrn, der kannelierten Kopfbedeckung des Sha-shahan, während ein Stalljunge ein frisches Pferd brachte. Die großen Herden waren verschwunden, und die besten Tiere, die ihnen noch geblieben waren, würden mit den Kindern der Saaur in die neue Welt gehen. Jarwa und seine Krieger würden mit den schlechteren Tieren auskommen müssen. Dieses nun war klein, maß allenfalls neunzehn Handbreit, kaum genug, um das Gewicht des Sha-shahan in Rüstung zu tragen. Aber der Kampf würde ohnehin nicht lange dauern.
Hinter ihnen im Osten flammte ein Energiefeuer auf, als würden sich tausend Blitze gleichzeitig vom Himmel lösen und die Nacht erhellen. Einen Augenblick später ertönte ein Donnerschlag, und alle drehten sich um und betrachteten das Leuchten im Himmel.
»Der Weg ist frei!«, sagte Jarwa.
Der Schlangenpriester eilte herbei und zeigte nach Westen. »Herr, seht!«
Jarwa blickte in die angezeigte Richtung. Im Licht der fernen Flammen konnte man Gestalten erkennen, die auf sie zuflogen. Jarwa wusste, was das bedeutete. Die Schreienden hatten die Größe von erwachsenen Saaur, und einige der Fliegenden waren sogar noch größer. Lederne Flügel knatterten in der Luft wie die Peitsche eines Fuhrmanns, und ein Kreischen, das selbst den tapfersten Krieger in die Verzweiflung treiben konnte, erfüllte die Umgebung. Jarwa blickte auf seine Hand, um festzustellen, ob sie zitterte, und sagte zu seinem Sohn: »Gib mir dein Schwert.«
Der junge Männliche tat es, und Jarwa reichte das Schwert an Kaba weiter. Dann zog er Tual-masok aus der Scheide und hielt es, den Griff voran, seinem Sohn entgegen. »Nimm es kraft deines Geburtsrechts und geh!«
Zunächst zögerte der junge Mann, dann packte er den Griff. Kein Meister des Wissens würde es aus dem Leichnam seines Vaters ziehen und ihm, dem Erben, überreichen können. Zum ersten Mal in der Geschichte der Saaur übergab ein Sha-shahan das Blutschwert an seinen Nachfolger, während sein Herz noch schlug.
Ohne ein weiteres Wort salutierte Jatuk und ging zu seinen wartenden Gefährten. Mit einer knappen Geste wies er sie an aufzusteigen, um mit ihm zusammen dorthin zu reiten, wo sich die Überlebenden des Volkes der Saaur sammelten, um gemeinsam in eine fremde Welt zu fliehen.
Vier Jatar würden durch dieses neue Portal reiten, während der verbliebene Teil der fünften sowie Jarwas Gefährten und die Meister des Wissens bleiben und den Dämonen möglichst lange Widerstand entgegenbringen würden. Gesänge erfüllten die Luft, während die Meister des Wissens ihren Zauber woben, und plötzlich erhob sich ein Wall aus Energie in den Himmel. Die Dämonen, die in diese Falle flogen, heulten auf vor Wut und Schmerz. Jene, die sofort umkehrten, überlebten, doch andere, die schon zu weit in das Energiefeld vorgedrungen waren, verschmorten und verbrannten, und schwarzer Rauch quoll aus ihren Wunden. Einige der mächtigeren Kreaturen erreichten das Plateau, wo sich die Saaurkrieger ohne Zögern auf sie warfen und sie zerhackten. Jarwa wusste, dass es nur ein kurzfristiger Sieg war, denn nur die Dämonen, die bereits durch die Kraft des magischen Walles geschwächt waren, konnten getötet werden.
Dann hörte man den Ruf des Schlangenpriesters. »Sie brechen auf, Herr!«
Jarwa blickte zurück und sah ein großes silbernes Portal in der Luft hängen. Die Schlangen nannten es einen Spalt. Durch ihn hindurch ritt die Vorhut der jungen Saaur, und einen Augenblick lang glaubte Jarwa, er könne seinen Sohn sehen – obwohl er wusste, dass das eine aus dem Wunsch geborene Illusion war. Die Entfernung war zu groß, um Einzelheiten zu erkennen.
Jarwa richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die magische Barriere, die nun an den Stellen, an denen die Dämonen ihre eigene Magie einsetzten, weiß glühte. Er wusste, dass die fliegenden Dämonen eher eine Plage denn eine Gefahr waren: Sie waren nur für einsame Reiter oder Schwache und Verwundete todbringend, ein starker Krieger hingegen konnte ihr Leben mit einem Hieb beenden.
Auf der Barriere wurden Risse sichtbar, und Jarwa konnte dunkle Gestalten erkennen, die sich hinter dem Wall näherten. Große Dämonen, die nicht fliegen konnten, es sei denn mittels Magie, eilten über den Boden, bewegten sich so schnell wie ein Saaurpferd und stimmten mit ihrem bösartigen Geheul in den Lärm der Schlacht ein. Der Schlangenpriester erhob die Hand, und wo ein Dämon durch einen Riss in der Barriere hatte eindringen wollen, loderten Flammen auf. Jarwa sah, wie der Schlangenpriester zu taumeln begann.
Das Ende war nahe. »Eins müsst Ihr mir noch verraten, Schlange«, sagte Jarwa. »Warum wolltet Ihr hier sterben? Wir hatten keine Wahl, aber Ihr hättet mit den Kindern gehen können. Fürchtet Ihr Euch nicht vor dem Tod durch die Hände jener?« Er zeigte auf die rasend schnell näher kommenden Dämonen.
Mit einem Lachen, das der Herrscher des Reiches von Grass nur als spöttisch bezeichnen konnte, sagte der Schlangenpriester: »Nein, mein Herr. Der Tod bedeutet Freiheit, und das werdet Ihr bald lernen. Wir, die wir im Palast der Smaragdkönigin dienen, wissen das.«
Jarwa schloss die Augen. Also waren die uralten Legenden wahr! Diese Kreatur war eine jener, die die Mutter Göttin geboren hatte. Und nun wusste Jarwa auch, dass sein Volk betrogen worden war. Diese Kreatur war ein genauso erbitterter Feind wie jene, die darauf brannten, seine Seele zu fressen. Verzweifelt schrie der Sha-shahan auf und hieb dem Pantathianer den Kopf mit dem Schwert seines Sohnes von den Schultern.
Und dann waren die Dämonen durchgebrochen, und Jarwa hatte keine Zeit mehr, an seinen Sohn und die Kinder seiner Gefährten zu denken, die jetzt in einer fremden Welt unter einer fremden Sonne waren. Während der Herr der Neun Meere seinem Feind das Gesicht zuwandte, schickte er ein stummes Gebet an seine Vorfahren, auf dass die Reiter der Himmlischen Horde über die Kinder der Saaur wachen würden.
Eine Gestalt erhob sich hinter den anderen Dämonen, und als würden die kleineren seine Ankunft spüren, wichen sie auseinander. Die Gestalt war zweimal so groß wie der größte Saaur, mehr als fünfundzwanzig Fuß hoch, und sie schritt zielstrebig auf Jarwa zu. Ihre kräftige Statur erinnerte an die eines Saaur – breite Schultern, schmale Taille, lange Arme und Beine –, doch auf dem Rücken hatte der Dämon riesige Flügel, welche aus zerknittertem Leder gemacht zu sein schienen. Und sein Kopf … Der dreieckige Schädel, der dem eines Pferdes ähnelte, war mit dünner Haut bedeckt, als hätte man Leder über Knochen gespannt. Die Gestalt fletschte die Zähne, und die Augen glichen glutroten Höhlen. Um den Kopf herum tanzte ein Ring von Flammen, und das Gelächter der Kreatur ließ Jarwa das Blut in den Adern gefrieren.
Der Dämon drängte sich durch seine geringeren Brüder und ignorierte die Saaur, die vorgestürmt waren, um den Sha-shahan zu verteidigen. Er schlug zu und riss mit seinen Pranken das Fleisch so leicht in Stücke wie ein Saaur sein Brot. Jarwa stand kampfbereit da. Er wusste, dass jeder Augenblick, den er jetzt standhielt, ein paar weiteren seiner Kinder die Flucht durch den Spalt ermöglichen würde.
Der Dämon baute sich vor Jarwa auf wie ein Krieger vor einem Kind. Der Sha-shahan schlug mit aller Kraft zu und zog die Klinge seines Sohnes über den ausgestreckten Arm der Kreatur. Der Dämon heulte vor Schmerz auf, beachtete jedoch die Wunde nicht weiter, sondern wurde nur für einen Augenblick langsamer. Dolchgroße schwarze Krallen spießten Jarwa auf, drangen durch seine Rüstung und seinen Körper, als die Kreatur den Sha-shahan um die Taille packte.
Der Dämon hob den Herrscher der Saaur zu seinem Gesicht, sodass sie sich in die Augen sahen. Als Jarwas Blick zu brechen begann, lachte der Dämon und sagte: »Du bist der Herrscher von gar nichts, du dummer Sterblicher! Deine Seele gehört mir, kleine Kreatur aus Fleisch! Und nachdem ich dich gefressen habe, wirst du mich zwischen den Mahlzeiten unterhalten!«
Zum ersten Mal seit seiner Geburt erfuhr Jarwa, Sha-shahan der Sieben Völker, Herrscher des Reiches von Grass, Herr der Neun Meere, was Grauen war. Und während sein Geist aufschrie und sein Körper schlaff wurde, fühlte er, wie seine Seele aufstieg, um sich zu den Himmlischen Horden zu gesellen. Aber etwas hielt ihn fest, und er konnte nicht loskommen. Er sah seinen eigenen Leib, der von dem Dämon gefressen wurde, und seine Seele hörte den Dämon sagen: »Ich bin Tugor, der erste Diener des Großen Maarg, Herrscher des Fünften Kreises, und du bist mein Spielzeug!«
Jarwa schrie, doch er hatte keine Stimme mehr, und er kämpfte, obwohl er keinen Körper mehr hatte. Seine Seele wurde von magischen Fesseln gehalten, die sie anketteten wie Eisen Fleisch. Andere Geisterstimmen verrieten ihm, dass seine Gefährten ebenfalls fielen. Mit aller Willenskraft, die ihm noch geblieben war, wandte er sich dem Spalt zu und sah die letzten seiner Kinder entkommen. Es war nur ein schwacher Trost, als der Spalt sich plötzlich schloss und in der Nacht verschwand. Jarwas Schatten wünschte seinem Sohn und seinem Volk eine sichere Zuflucht. Und vor allem Schutz vor der Falschheit der Schlangen auf jener fernen Welt, die die Pantathianer Midkemia nannten.
Die Herausforderung
Die Trompete erklang.
Erik wischte sich die Hände an seiner Schürze ab. Er hatte wenig zu tun, da er seine Arbeit schon am Morgen erledigt hatte, und er hielt das Feuer nur deshalb in Gang, um die Schmiede nicht kalt werden zu lassen, falls er später am Tage noch etwas zu tun bekäme. Er hielt das für unwahrscheinlich, da sich die Bewohner der Stadt auf dem Platz versammelt hatten und die Ankunft des Barons erwarteten, doch Pferde verloren ihre Hufeisen gern in den am wenigsten geeigneten Augenblicken, und manche Wagen brachen in höchst ungünstigen Momenten zusammen. Zumindest hatte er das in den fünf Jahren als Lehrjunge des Schmieds so gelernt.
Er sah zu dem schlafenden Tyndal hinüber, der verliebt einen Krug scharfen Brandys in den Armen hielt. Tyndal hatte schon nach dem Frühstück zu trinken begonnen, hatte »ein paar auf die Gesundheit des Barons« gehoben, wie er sagte. Er war eingeschlafen, während Erik seine Arbeit zu Ende geführt hatte. Glücklicherweise gab es für den Jungen wenig zu tun. Er war sehr groß für sein Alter und konnte die Unzulänglichkeit des Schmiedes ausgleichen.
Als Erik die Kohlen mit Asche bedeckt hatte, hörte er seine Mutter aus der Küche rufen. Er sollte schnell kommen, doch das beachtete er nicht; es war noch mehr als genug Zeit. Er brauchte sich nicht zu beeilen, der Baron hatte die Stadt noch nicht erreicht. Die Trompete hatte sein Nahen, nicht seine Ankunft verkündet.
Erik dachte selten über sein Äußeres nach, doch an diesem Tag würde ihn die Öffentlichkeit genau in Augenschein nehmen, und deshalb wollte er anständig aussehen. Er legte seine Schürze ab, hängte sie sorgfältig an einen Nagel und tauchte die Arme in einen Eimer mit Wasser. Er rieb sie gründlich ab, wodurch er den meisten Ruß und Schmutz entfernen konnte, dann spritzte er sich Wasser ins Gesicht. Er griff sich ein großes sauberes Tuch von einem Haufen Lumpen, die zum Polieren von Stahl benutzt wurden, trocknete sich ab und rieb dabei den Schmutz fort, den er mit Wasser alleine nicht abbekommen hatte.
Die tanzende Oberfläche des Wassers reflektierte sein Spiegelbild: tiefblaue Augen, dichte Augenbrauen, eine hohe Stirn, in die das schulterlange blonde Haar fiel. Niemand konnte anzweifeln, wessen Sohn er war. Seine Nase glich zwar eher der seiner Mutter, doch sein Kinn und sein breit lächelnder Mund machten ihn zu einem jüngeren Abbild seines Vaters. Im Gegensatz zu Erik war der allerdings ein eher schmächtiger Mann; in dieser Hinsicht war die schlanke Taille das Einzige, was Erik von ihm geerbt hatte. Ansonsten hatte er die breiten Schultern und kräftigen Arme seines Großvaters, und die waren von der Arbeit in der Schmiede seit seinem zehnten Lebensjahr noch gestählt worden. Erik konnte mit bloßen Händen Eisen biegen oder Walnüsse knacken. Auch seine Beine waren voller Kraft, weil er die Ackergäule festhalten musste, während der Schmied ihre Hufe schnitt, sie feilte und neu beschlug, und weil er oft helfen musste, Karren mit gebrochenen Rädern anzuheben.
Erik fuhr sich mit der Hand übers Kinn und fühlte die Stoppeln. So blond, wie er war, musste sich Erik nur jeden dritten Tag rasieren, da auch sein Bart hell war. Doch an diesem Tag würde seine Mutter darauf bestehen, dass er so gepflegt wie möglich aussah.
Er eilte zu seiner Pritsche hinter der Schmiede, achtete darauf, den Schmied nicht zu wecken, und holte Rasiermesser und Spiegel hervor. Eine Rasur mit kaltem Wasser war zwar kein Vergnügen, doch seine Mutter würde ihn ansonsten zurückschicken, um das Rasiermesser zu holen. Er machte sein Gesicht noch einmal nass und begann mit der Rasur. Als er fertig war, betrachtete er sich erneut im Wasser.
Keine Frau würde Erik je als gut aussehenden Mann bezeichnen, denn seine Gesichtszüge waren eher grob, doch er hatte diesen offenen, ehrlichen Blick, der Männer beruhigte und den Frauen bewunderten, hatten sie sich erst an sein fast brutales Aussehen gewöhnt. Mit fünfzehn hatte er bereits die Größe eines Mannes, und er war fast so kräftig wie der Schmied. Kein Junge besiegte ihn im Ringkampf, und nur noch wenige versuchten es überhaupt. Vielleicht wirkten seine Hände tollpatschig, wenn er im Wirtshaus Teller und Krüge aufstellte, doch wenn er in der Schmiede arbeitete, bewiesen sie ihre Geschicklichkeit.
Abermals gellte die Stimme seiner Mutter durch den ruhigen Morgen. Sie verlangte, er möge sofort kommen. Er verließ die Schmiede, ein kleines Gebäude, das gegen die Rückwand der Mietställe gebaut war, ging um die Scheune herum und warf durch die offene Stalltür einen Blick auf die Tiere, die seiner Obhut überlassen waren. Drei Reisende waren bei Milo zu Gast, und ihre Pferde fraßen ruhig ihr Heu. Das vierte Pferd lag wegen einer Verletzung auf dem Boden, und es nickte Erik wie zum Gruß zu. Er musste lächeln; in den Wochen, in denen er sich um die Stute gekümmert hatte, waren die morgendlichen Besuche zur Gewohnheit geworden.
»Ich werd später vorbeikommen und nach dir sehen, Mädchen«, rief er ihr leise zu.
Trotz seiner Jugend konnte Erik so gut mit Pferden umgehen, dass er sich in der Gegend von Düstermoor fast schon den Ruf eines Wunderwirkers erworben hatte. Die meisten Besitzer hätten der verletzten Stute schon längst den Gnadenstoß gegeben, doch für den Schwertmeister des Barons, Owen Greylock, war sie zu wertvoll. Er hatte die Stute in Eriks Obhut gegeben und gemeint, wenn er sie wieder so gesund machte, dass sie noch ein oder zwei Fohlen werfen könnte, hätten sich dessen Mühen gelohnt. Erik aber wollte, dass man sie nach seiner Pflege wieder reiten konnte.
Er entdeckte seine Mutter an der Tür, die von der Küche des Gasthauses Zur Spießente in den Hof führte. Freida war eine kleine, stahlharte, kräftige und entschlossene Frau, die einst schön gewesen war, von der die harte Arbeit und die Sorgen der Welt jedoch ihren Tribut gefordert hatten. Obwohl sie noch keine vierzig Jahre zählte, sah sie wie sechzig aus. Ihr einst braunes Haar war ergraut, und um ihre grünen Augen zogen sich tiefe Falten. »Schnell, schnell!«, verlangte sie.
»Er wird so bald noch nicht da sein«, antwortete Erik und konnte seine Gereiztheit kaum verbergen.
»Wir haben nur einen kurzen Augenblick«, erwiderte sie, »und sollten wir den verpassen, haben wir vielleicht nie wieder die Gelegenheit. Er ist krank und kommt womöglich nicht noch einmal hierher.«
Erik legte bei dieser Andeutung die Stirn in Falten, doch seine Mutter fügte nichts mehr hinzu. Der Baron ließ sich nur selten auf seinen kleineren Besitztümern blicken. Im Herbst bereiste er die Dörfer oder eine der Städte, die Düstermoor den Wohlstand bescherten, weil man dort die besten Trauben erntete und den besten Wein der Welt hervorbrachte. Doch stets besuchte der Baron immer nur das Haus eines Winzers, und das in der Stadt Ravensburg gehörte zu den weniger bedeutenden. Außerdem war Erik überzeugt davon, dass der Baron die Stadt in den letzten zehn Jahren mit Absicht gemieden hatte, und Erik kannte auch den Grund dafür.
Er erinnerte sich daran, wie ihn die Mutter vor zehn Jahren durch die Menge gezerrt hatte, die den Baron hatte begrüßen und bejubeln wollen, und sah wieder die erschreckten und erstaunten Gesichter der Amtsherren, Gildemeister, Winzer und Bauern vor sich, als sie gefordert hatte, der Baron möge Erik als Sohn anerkennen. Was ein fröhliches Fest hatte werden sollen, war für die Stadt eine peinliche Angelegenheit geworden, insbesondere für den kleinen Erik. Danach waren verschiedene hochgestellte Männer zu Freida gekommen und hatten sie darum gebeten, sich in Zukunft ruhig zu verhalten. Sie hatte ihren Reden höflich zugehört, jedoch nichts versprochen.
»Lass deine Tagträumereien und komm rein!« Freida drehte sich um, und er folgte ihr in die Küche.
Rosalyn lächelte, als Erik eintrat, und er nickte dem Schankmädchen zu. Sie waren gleich alt und seit ihrer Kindheit Freunde. Erik und die Tochter des Gastwirts waren fast so vertraut miteinander wie Geschwister. Erst kürzlich war ihm aufgefallen, wie etwas in ihr aufblühte, obwohl er nicht sicher war, was er davon halten sollte. Er liebte sie wie ein Bruder die Schwester, doch er hatte nie daran gedacht, sie zu seiner Frau zu machen.
Eine Heirat kam für ihn auch auf lange Sicht nicht infrage, und daran war Tyndal schuld, denn Erik war der einzige Junge in der Stadt, der nicht als Lehrling in die Listen der Gilde eingetragen war. Damit war seine Lehrzeit in der Schmiede nicht amtlich und er kein Mitglied der Gilde. Tyndal hatte es bisher schlichtweg versäumt, ihn bei der Gilde als Lehrjungen anzumelden. So würde er, obwohl mit der Schmiedekunst besser vertraut als jeder ältere Lehrjunge, zwei Jahre im Rückstand sein, falls Tyndal ihn im nächsten Frühjahr endlich offiziell als Lehrling annahm.
Seine Mutter, die ihm kaum bis ans Kinn reichte, sagte: »Lass dich ansehen.« Sie nahm sein Kinn in die Hand, als wäre er noch immer ein Kind und nicht fast schon ein Mann, und drehte seinen Kopf von einer Seite zur anderen. Unzufrieden schnalzte sie mit der Zunge und sagte: »Du hast immer noch überall Rußflecken.«
»Mutter, ich bin Schmied!«, wandte er ein.
»Wasch dich im Becken!«, befahl sie.
Erik schwieg. Seine Mutter hatte einen eisernen Willen und eine unbeugsame Entschlossenheit. Er hatte früh gelernt, es nicht auf einen Streit mit ihr ankommen zu lassen, und selbst dann, wenn er ungerechterweise eines Vergehens beschuldigt wurde, ließ er die Züchtigung stillschweigend über sich ergehen, denn Widerspruch hätte eine noch härtere Strafe nach sich gezogen.
Erik zog sich das Hemd aus und hängte es über die Lehne eines Stuhls am Tisch, auf dem Fleisch gesäubert und zubereitet wurde. Er bemerkte Rosalyns Belustigung und warf ihr einen gespielt bösen Blick zu. Sie lächelte nur noch breiter, nahm einen Korb mit geputztem Gemüse und trug ihn in den Gastraum. In der Tür wandte sie sich noch einmal um und streckte ihm die Zunge heraus.
Erik grinste, während er seinen Arm in das Wasser tauchte, in dem Rosalyn gerade das Gemüse geputzt hatte. Sie konnte ihn wie keine andere Person zum Lachen bringen. Er verstand die heftigen und verwirrenden Triebe nicht, die ihn tief in der Nacht aufwachen ließen, wenn er von einem Mädchen geträumt hatte. Wie jedes Kind, das mit Tieren aufgewachsen ist, wusste er, wie eine Paarung vor sich ging, doch diese Verwirrung der Gefühle war ihm neu. Zumindest irritierte ihn Rosalyn nicht so sehr wie einige der älteren Mädchen, und zudem sah er sie eher als Freundin. Ja, sie war für ihn die beste Freundin auf der ganzen Welt.
Als er sich das Wasser ins Gesicht spritzte, sagte seine Mutter: »Nimm die Seife!«
Er seufzte und nahm das stinkende Stück Seife, das auf dem Rand des Waschbeckens lag. Sie bestand aus einer scharfen Mischung von Lauge, Asche, Talg und Sand, und abends wurden die Servierplatten und Kochtöpfe damit gescheuert. Wenn man sie zu oft benutzte, ätzte sie die Haut von Gesicht und Händen, darum verwendete Erik sie so selten wie möglich. Als er fertig war, hatte sich eine große Menge Ruß im Wasser des Beckens gesammelt.
Er spülte sich die Seife von der Haut, bevor sie zu brennen begann, trocknete sich ab und zog sein Hemd wieder an.
Dann betrat er den Gastraum, wo Rosalyn das Gemüse in den großen Kessel gab. Der hing an einem Haken über der Feuerstelle, und der Eintopf darin würde den ganzen Nachmittag vor sich hin köcheln. Schon jetzt war der Raum mit einem appetitlichen Duft erfüllt. Rosalyn lächelte Erik zu, während er an ihr vorbeiging, doch trotz ihrer guten Laune sank seine Stimmung, als er an die bevorstehende öffentliche Szene dachte.
Am Eingang des Wirtshauses begegneten Erik und seine Mutter Milo, dem Gastwirt, der durch die Tür nach draußen spähte. Der beleibte Mann, dessen Nase wegen häufiger Raufhändel aussah wie ein zerdrückter Kohlkopf, sog an seiner langen Pfeife und beobachtete die stille Stadt. »Wird wohl ein ruhiger Nachmittag werden, Freida.«
»Aber ein stürmischer Abend, Vater«, sagte Rosalyn, die an Eriks Seite trat. »Wenn sich die Leute erst am Baron sattgesehen haben, werden sie alle hierherkommen.«
Milo drehte sich mit einem Lächeln auf den Lippen um und zwinkerte seiner Tochter zu. »Darum bete ich inständig. Ich vertraue darauf, dass die Göttin des Schicksals keine anderen Pläne hat.«
»Ruthia hat bessere Dinge zu tun, als ihre Aufmerksamkeit auf so etwas zu verschwenden, Milo.« Freida nahm ihren kräftigen Sohn wie ein Kleinkind bei der Hand und zog ihn zielstrebig durch die Tür hinaus.
Nachdem Erik und seine Mutter den Gastraum verlassen hatten, sagte Rosalyn: »Sie ist fest entschlossen, Vater.«
»Das ist sie immer gewesen«, sagte er, schüttelte den Kopf und zog wieder an seiner Pfeife. »Selbst als Kind hatte sie schon diesen Dickkopf …« Er legte seiner Tochter den Arm um die Schulter. »Anders als deine Mutter, glücklicherweise.«
»Wenn man dem Gerede der Leute glauben darf, hast auch du vor vielen Jahren um Freidas Hand angehalten.«
Milo kicherte in sich hinein. »Sagen das die Leute?« Er schnalzte mit der Zunge. »Nun, da haben sie ausnahmsweise recht. Allerdings haben das die meisten Männer meines Alters getan. Aber mir konnte nichts Besseres passieren, als dass sie Nein gesagt hat. Die meisten Jungen waren hinter Freida her. Sie war damals eine ausnehmend schöne Frau. Ihre grünen Augen strahlten, und ihr Haar war kastanienbraun, sie war schlank, und doch an den richtigen Stellen gut ausgestattet. Sie hatte diesen stolzen Gesichtsausdruck, der das Herz jedes Mannes rasen lässt, bewegte sich mit der Anmut eines Rassepferdes, und sie benahm sich wie eine Königin. Deshalb ist der Baron auch auf sie aufmerksam geworden.«
Eine Trompete erscholl vom Marktplatz her, und Rosalyn sagte: »Ich sollte besser wieder in die Küche gehen.«
Milo nickte. »Ich gehe auf den Markt und schau mir an, was da vor sich geht, aber ich bin bald zurück.«
Rosalyn drückte kurz seine Hand, und ihr Vater entdeckte in ihrem Blick die Sorge, die sie vor Erik verborgen hatte. Er nickte ihr verständnisvoll zu und erwiderte den Händedruck, drehte sich um, ging hinaus auf die Straße und folgte dem Weg, den Erik und Freida eingeschlagen hatten.
Wegen seiner Größe konnte Erik sich leicht durch die Menge drängen. Trotz seiner Kraft war er ein von Natur aus sanfter Bursche, doch allein bei seinem Anblick machten ihm die Leute den Weg frei. Der Breite seiner Schultern nach hätte er auch ein junger Krieger sein können, aber jeglicher Kampf stieß ihn ab. Still und in sich gekehrt genoss er nach getaner Arbeit einen Becher Brühe, während er auf das Abendessen wartete, und lauschte den Geschichten der alten Männer, die von ihrer Jugend erzählten, als sie den Mädchen nachgestiegen waren. Manchmal versuchte ein Mädchen, Eriks Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber er tat stets so, als würde er es nicht bemerken. Das lag allerdings mehr daran, dass er nicht wusste, was er bei solchen Gelegenheiten sagen sollte. Die Aussicht, allein mit einem Mädchen zu sein, erschreckte ihn.
Eine vertraute Stimme rief seinen Namen, und als er sich umwandte, sah er eine zerlumpte Gestalt, die sich flink einen Weg durch die Menge bahnte. »Hallo«, sagte Erik zum Gruß.
»Erik, Freida«, antwortete der junge Mann. Rupert Avery, den man in der Stadt nur Roo nannte, war der einzige Junge, mit dem zu spielen Freida Erik in seiner Kindheit verboten hatte, und der einzige Junge, mit dem Erik gern gespielt hatte.
Roos Vater war Fuhrmann, ein grober Kerl, der ebenso oft mit seinem Karren nach Krondor, Malacs Kreuz oder Durronys Tal unterwegs war, wie er betrunken in seinem Bett lag. So war Roo ohne feste Hand aufgewachsen, und er hatte einen gefährlichen, unberechenbaren Charakter, aber gerade deswegen mochte Erik ihn so. Wo Erik keine Worte fand, um die Mädchen zu betören, war Roo ein Meister der Verführung, zumindest wenn man seinen Reden glaubte. Er war ein Schurke und ein Lügner, und gelegentlich wurde er auch zum Dieb, trotzdem war er nach Rosalyn Eriks bester Freund.
Freida nickte ihm kaum wahrnehmbar zu. Sie mochte den jungen Kerl immer noch nicht und vermutete, dass er an jedem unehrlichen oder verbrecherischen Vorfall in Ravensburg beteiligt war. Und tatsächlich hatte sie meistens recht damit.
Mit seinen fünfzehn Jahren ließ sich Erik von seiner Mutter nicht mehr alles sagen, zumal er einen Großteil der Pflichten in der Schmiede übernommen hatte, da Tyndal an fünf von sieben Wochentagen seinen Rausch ausschlief.
»Also, ihr wollt mal wieder über den Baron herfallen?«, sagte Roo.
Freida bedachte ihn mit einem bösen Blick. Erik wirkte ganz verlegen, doch Roo grinste. Er hatte ein schmales Gesicht und kluge Augen, und er lächelte flüchtig, trotz seiner schiefen Zähne. Obwohl er nicht so stattlich war wie Erik, mochte man ihn wegen seiner lebhaften Intelligenz, die viele beeindruckend fanden. Erik jedoch kannte auch seine mörderischen Launen, und oftmals hatte Roo ihn schon als Schutzschild gegen die anderen Jungen benutzt. Nur wenige Jungen der Stadt hätten Erik herausgefordert: Er war einfach zu stark. Zwar war Erik nur schwer zu reizen, wurde jedoch zum wilden Stier, wenn er erst die Geduld verloren hatte. Einmal hatte er in seiner Wut einem Kerl derartig stark auf den Arm geboxt, dass der Schlag den Jungen durch den ganzen Hof geschleudert und ihm den Arm gebrochen hatte.
Roo zog seinen zerlumpten Mantel aus und enthüllte ein wesentlich besseres Gewand. Erik erblickte den langen Hals einer grünen Flasche. Und in den Hals war deutlich sichtbar das Wappen des Barons graviert.
Er verdrehte die Augen. »Du wirst noch deine Hand verlieren, Roo«, flüsterte er verzweifelt.
»Ich habe meinem Vater gestern Abend geholfen, den Wagen abzuladen.«
»Was ist das?«
»Beerenauslese.«
Erik schnitt eine Grimasse. Da Düstermoor das Zentrum des Weinhandels im Königreich war, wurde in Ravensburg ebenso wie in den anderen Ortschaften und Städten der Baronie vor allem Wein angebaut. Die Fassmacher im Norden stellten Fässer und Korken her, die zur Gärung und Lagerung des Weins gebraucht wurden, während im Süden die Glasbläser die Flaschen machten. In der Mitte des Landes wurde der Wein angebaut.
Während in den Freien Städten von Natal und in der Provinz Yabon im Westen durchaus gute Weine angebaut wurden, erreichte jedoch keiner die Güte und den Charakter jener Weine, die aus Düstermoor stammten. Selbst die schwer anzubauende Traube Pinot Noir, die ursprünglich aus Bas-Tyra eingeführt worden war, gedieh in Düstermoor besser als in jedem anderen Teil des Königreichs. Vollmundige Rote und erfrischende Weiße und Sekt für festliche Anlässe – Düstermoors feinste Erzeugnisse brachten auf allen Märkten, von den nördlichen Grenzen bis hin ins Herz von Groß-Kesh, die höchsten Preise. Und nur wenige Weine waren so wertvoll wie der süße Dessertwein, den man Beerenauslese nannte.
Er wurde aus rosinenartig geschrumpften Weintrauben hergestellt, die von einer Edelfäule befallen waren, und er war selten und teuer; der Wert der Flasche, die Roo unter seinem Mantel versteckte, entsprach dem halben Jahreseinkommen eines Bauern. Und dem Wappen nach stammte die Flasche aus dem Vorrat, der aus der Hauptstadt Düstermoors für den Besuch des Barons herbeigeschafft worden war. Zwar wurde Dieben nicht mehr die Hand abgeschlagen, Roo würde jedoch für fünf Jahre in den Strafkolonien des Königs verschwinden, falls man die Flasche bei ihm fand.
Die Trompeten erschollen abermals, und die berittenen Wachen des Barons kamen in Sicht. Die Banner knatterten im Wind, und die Hufeisen der Pferde schlugen Funken auf dem Steinpflaster des Platzes. Unwillkürlich suchte Erik ihre Beine nach Anzeichen von Verletzungen ab, aber er fand keine; was auch immer man über die Art und Weise, wie der Baron seine Besitzungen führte, sagen mochte, seine Reiterei kümmerte sich anständig um ihre Tiere.
Die Reiter trabten zur Mitte des Platzes, wendeten die Pferde und trieben die Menschen auseinander. Nach ein paar Minuten war der gesamte Bereich vor dem Winzerhaus frei für die Kutsche, die den Reitern folgte.
Weitere Reiter ritten vorbei, und jeder trug die graue Uniform mit dem Wappen von Düstermoor: ein roter Schild mit einem schwarzen Raben, der einen Palmzweig im Schnabel trug. Am goldenen Kranz um das Wappen konnte man sie als Leibwache des Barons erkennen.
Endlich rollte die Kutsche heran, und Erik merkte plötzlich, dass er die Luft anhielt. Er ärgerte sich darüber, dass ihm die seltsamen Ideen seiner Mutter sogar den Atem nahmen. Er holte leise Luft und versuchte, sich zu entspannen.
Er hörte die Kommentare der Leute in der Menge. Gerüchte über die schwindende Lebenskraft des Barons machten schon seit mehr als einem Jahr die Runde, und dass er neben seiner Frau in der Kutsche saß und nicht auf einem Pferd an der Spitze seiner Wachen ritt, bestätigte das Gerede über seine Krankheit.
Zwei Jungen zogen Eriks Aufmerksamkeit auf sich. Sie ritten zwei zum Verwechseln ähnliche Braune, und ihnen folgten zwei Soldaten, die die Insignien der Baronie von Düstermoor trugen. Den Wappen auf den Bannern nach war einer der Jungen Manfred von Düstermoor, der zweitgeborene Sohn des Barons, und der andere Stefan von Düstermoor, der Erstgeborene. Sie ähnelten sich wie Zwillinge, obwohl sie ein Jahr auseinander waren. Die Jungen hielten sich mit einer Haltung im Sattel, die Erik bewunderte.
Manfred ließ seinen Blick über die Menge schweifen, und als er schließlich Erik entdeckte, runzelte er die Stirn. Als Stefan merkte, wohin Manfred starrte, sagte er etwas zu seinem Bruder, der seine Aufmerksamkeit daraufhin wieder auf die Parade richtete. Die jungen Männer waren auf ähnliche Weise gekleidet: hohe Reitstiefel, enge lederverstärkte Reithosen, lange weiße Seidenhemden, darüber ärmellose Westen aus feinem Leder, und auf dem Kopf trugen beide große, mit rotgefärbten Adlerfedern geschmückte schwarze Filzbaretts, die mit goldenen Abzeichen der Baronie besetzt waren. An den Seiten trugen sie Rapiere, und es war bekannt, dass sie diese Waffen trotz ihrer Jugend meisterlich beherrschten.
Freida deutete mit dem Kinn auf Stefan und flüsterte zischelnd: »Das ist dein Platz, Erik.«
Erik spürte, wie er errötete, doch er wusste, das Schlimmste lag noch vor ihm. Die Kutsche kam zum Stehen, und die Kutscher sprangen herunter und öffneten die Tür, während zwei Bürger vortraten, um den Baron zu empfangen.
Zuerst stieg eine stolz wirkende Frau aus. Der Ausdruck hochmütiger Verachtung minderte die Schönheit ihres Gesichts. Ein Blick zu den beiden jungen Männern, die von ihren Pferden stiegen, zeigte deutlich, dass es sich um die Mutter der beiden handelte. Alle drei waren dunkel, schlank und groß gewachsen. Die beiden Jungen blieben vor ihrer Mutter stehen und verneigten sich zum Gruß. Die Baroness blickte suchend in die Menge, und als sie Erik entdeckte, der die Menschen um ihn herum überragte, wurde ihre Miene noch finsterer.
Ein Herold verkündete: »Seine Lordschaft, Otto Baron von Düstermoor, Lord von Ravensburg!«
Die Menge begann zunächst respektvoll, dann begeistert zu jubeln; der Baron war im Volke nicht besonders beliebt, aber dennoch war er den Menschen nicht gleichgültig. Die Steuern waren hoch, aber die Steuern waren immer hoch, und was die Soldaten des Barons dem Volke auch an Schutz vor Banditen und Räubern bieten mochten, war kaum zu spüren, denn das Land war weit von den Grenzen oder den unsicheren Gebieten des Westlichen Reiches entfernt, und nur wenige Schurken bereiteten den Reisenden in Düstermoor Sorgen. Kein Goblin oder Troll war je in diesen Bergen gesehen worden, soweit sich der älteste Mann entsinnen konnte, und daher sah man die Soldaten selten, es sei denn, sie eskortierten ihren Herrn in polierten Rüstungen. Dennoch, die Ernten waren gut, zu essen gab es reichlich für jeden, und die Ordnung verlangte eben von den Bürgern der Baronie ihren Tribut.
Als der Jubel verebbte, wandte sich der Baron an die Honoratioren der Stadt, um ihre Begrüßung entgegenzunehmen. Die Menge hielt hörbar den Atem an. Der Mann, der aus der Kutsche stieg, war einst genauso groß wie Erik gewesen, doch mittlerweile ging er gebeugt, als zählte er doppelt so viele wie seine fünfundvierzig Jahre. Obwohl er immer noch breite Schultern hatte, war seine Gestalt nun hager. Sein ehemals goldblondes Haar war dünn und grau, sein Gesicht aschfahl, und die Augen lagen tief in den Höhlen. Das kantige Kinn und die stolze Stirn waren knochig, was das kränkliche Aussehen noch verstärkte, und er wurde von seinem jüngsten Sohn gestützt. Seine Bewegungen waren unsicher, und es schien, als würde er jeden Augenblick stürzen.
Jemand in Eriks Nähe sagte: »Dann stimmt das also mit den Anfällen.«
Erik fragte sich, ob sich der Zustand des Barons verschlimmern würde, wenn Freida ihren Plan in die Tat umsetzte, und als hätte sie seine Gedanken erraten, sagte sie: »Ich muss es tun!«
Sie schob sich zwischen den vor ihr stehenden Leuten und zwei berittenen Wachen hindurch, die sie nicht rasch genug bemerkten. »Als freie Frau des Königreichs fordere ich mein Recht ein, angehört zu werden!«, rief sie mit lauter Stimme, die deutlich über den gesamten Platz schallte.
Niemand sagte ein Wort. Alle Augen waren auf die magere Frau gerichtet, die mit dem Zeigefinger auf den Baron wies. »Otto von Düstermoor, werdet Ihr Erik von Düstermoor als Euren Sohn anerkennen?«
Der offensichtlich kranke Baron blieb stehen, wandte sich um und blickte die Frau an, die ihm diese Frage jedes Mal stellte, wenn er nach Ravensburg kam. Seine Augen suchten die Menge hinter ihr ab und fanden ihren Sohn. Als er das Ebenbild seiner Jugend vor sich sah, ließ er den Blick auf Erik ruhen.
Die Baroness flüsterte ihm rasch etwas ins Ohr. Mit einem Ausdruck der Trauer im Gesicht schüttelte der Baron leicht den Kopf, wandte sich ohne ein Wort von Eriks Mutter ab und ging auf das größte Gebäude der Stadt zu, das Haus der Winzer. Die Baroness warf Freida und Erik einen scharfen Blick zu, der ihre Wut kaum verbarg, ehe sie ihrem Gemahl folgte.
Roo seufzte, und die ganze Menge schien aufzuatmen. »Nun, das wär’s dann wohl.«
Erik sagte: »Ich glaube, wir werden das nicht noch einmal machen.«
Während Freida zu ihnen zurückkehrte, fragte Roo: »Warum? Glaubst du, deine Mutter wird nicht die nächste Gelegenheit erneut wahrnehmen?«
»Sie wird keine mehr bekommen«, antwortete Erik. »Er wird sterben.«
»Woher weißt du das?«
Erik zuckte mit den Schultern. »Durch die Art und Weise, wie er mich angesehen hat. Er hat sich verabschiedet.«
Freida ging zu ihrem Sohn und Roo. Ihre Miene verriet keinerlei Gefühl. »Wir haben zu tun.«
Roo sah zu den beiden Brüdern, Manfred und Stefan, die Erik aufmerksam beobachteten und leise miteinander sprachen. Manfred hielt Stefan zurück, der offensichtlich erpicht darauf war, sich mit Erik anzulegen. »Deinen Halbbrüdern scheinst du auch nicht besonders viel zu bedeuten, was? Besonders diesem Stefan nicht.«
Erik zuckte abermals mit den Schultern, doch Freida erwiderte: »Ich weiß, dass er bald das erben wird, was rechtmäßig Erik zusteht.«
Roo und Erik sahen sich an. Beide wussten, dass es keinen Sinn hatte, sich mit Freida darüber zu streiten. Sie hatte immer behauptet, der Baron habe sie in einer Frühlingsnacht in einer Waldkapelle geheiratet, und zwar vor einem Mönch der Dala, dem Schild der Schwachen. Später hatte er dann eine Annullierung erwirkt, damit er die Tochter des Herzogs von Ran ehelichen konnte, und Freidas Heiratsurkunde war aus politischen Gründen unter Verschluss genommen worden.
»Dann war das wohl sicher das letzte Mal«, sagte Roo.
Erik blickte ihn fragend an. »Was meinst du damit?«
»Wenn du recht hast, wird nächstes Jahr Stefan Baron sein. Und der wird nicht lange zögern und deine Mutter öffentlich der Lüge bezichtigen.«
Freida blieb stehen. Ihre Miene zeigte eine Hoffnungslosigkeit, die Erik noch nie an ihr gesehen hatte. »Das wird er nicht wagen«, sagte sie, eher als Verteidigung denn als Herausforderung. Der Blick ihrer Augen verriet, wie recht Roo hatte.
»Komm, Mutter«, sagte Erik leise. »Wir wollen nach Hause gehen. Im Augenblick gibt es zwar nichts zu tun, doch ich muss das Feuer in Gang bringen, falls ich später noch zu tun bekomme. Tyndal wird vermutlich noch nicht wieder in der Lage dazu sein.« Er legte seiner Mutter sanft den Arm um die Schulter und wunderte sich, wie zerbrechlich sie plötzlich wirkte. Sie gestattete ihm wortlos, sie zu führen.
Die Städter traten zur Seite und machten dem jungen Schmied und seiner Mutter den Weg frei, und alle wussten, dass gerade etwas zu Ende gegangen war, jene Tradition nämlich, die vor fünfzehn Jahren begonnen hatte, als die junge, schöne und wütende Freida zum ersten Mal vorgetreten war, ihren brüllenden Säugling in die Höhe gehalten und von Otto von Düstermoor verlangt hatte, er solle das Kind als sein eigenes anerkennen. Fast jeder kannte die Geschichte. Freida hatte sich auch fünf Jahre später wieder vor ihn gestellt, und wieder hatte er ihrer Forderung nicht stattgegeben. Sein Schweigen verlieh ihrem Anspruch jedoch Glaubwürdigkeit, und seit Jahren wurde die Geschichte vom unehelichen Sohn des Barons den Reisenden zwischen dem Östlichen und Westlichen Reich zum Besten gegeben.
Doch der Baron behielt das Geheimnis für sich, denn einmal hatte er ihren Anspruch verneint, und von diesem Tag an trug Freida die Beweislast. Der Mönch war in der Gegend nie wieder gesehen worden, und sonst gab es keinen weiteren Zeugen. So war Freida bei einem Gastwirt Dienstmädchen geworden, während ihr Sohn bei einem Schmied aushalf.
Manche Leute behaupteten, der Baron schone Freida, weil er sie nicht in aller Öffentlichkeit als Lügnerin brandmarken wolle, denn obwohl er mit Sicherheit der Vater ihres Kindes war, stammte die Geschichte von der Heirat von einer offensichtlich verwirrten Frau. Oder gar von einer berechnenden, die sich ihren Vorteil erhoffte.
Andere hielten den Baron für zu feige, um Erik öffentlich zu verleugnen, denn jeder sah es: Erik war Ottos Ebenbild. Und der Baron trug selbst die Schuld daran, dass sein Ruf von einem solchen Makel befleckt wurde. Ein ehrbarer Mann hätte die Vaterschaft anerkannt, auch wenn dadurch das Erbrecht seiner anderen Kinder infrage gestellt und der Baron dem Zorn seiner Gemahlin ausgesetzt worden wäre.
Doch durch sein Schweigen ließ er den Anspruch offen. Und so konnte Erik zumindest den Namen »von Düstermoor« tragen, da ihm der Baron niemals das Recht dazu abgesprochen hatte.
Langsam gingen sie durch die Straßen zurück zum Gasthaus. Roo, der nie auch nur eine Minute lang den Mund halten konnte, fragte: »Hast du heute Abend irgendetwas Besonderes vor, Erik?«
Erik wusste, worauf Roo anspielte: Der Besuch des Barons galt als Feiertag, wenn auch weniger wichtig als die überlieferten Feste, und so würde das Gasthaus bis tief in die Nacht voller trinkender und spielender Männer sein, und viele der Mädchen würden sich am Brunnen herumtreiben, wo sie darauf warteten, dass sich die Burschen genug Mut antranken, um ihnen den Hof zu machen. Es würde genug Arbeit für Erik geben. Und das sagte er Roo auch.
Roo erwiderte: »Sie sind ohne Zweifel die Söhne ihrer Mutter.«