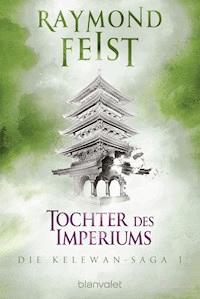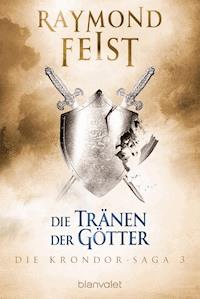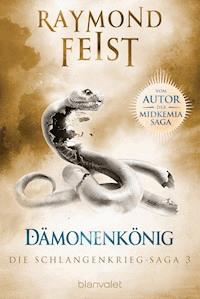
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DIE SCHLANGENKRIEG-SAGA
- Sprache: Deutsch
Ein Klassiker der heroischen Fantasy – komplett überarbeitet in edler Neuaustattung.
Die Smaragdkönigin ist zurück und bedroht den Frieden in Midkemia. Eine brutale Invasion der Schlangenmenschen von Novindus unter dem Befehl der mächtigen Königin steht kurz bevor. Die Angreifer sind auf der Suche nach dem magischen Stein des Lebens und wollen ihn um jeden Preis in ihre Gewalt bringen. Am Vorabend des Krieges entdeckt der Magier Pug zusammen mit dem befreundeten Krieger Tomas, dass weit mehr als nur der Frieden Midkemias auf dem Spiel steht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 999
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Die Smaragdkönigin ist zurück und bedroht den Frieden in Midkemia. Eine brutale Invasion der Schlangenmenschen von Novindus unter dem Befehl der mächtigen Königin steht kurz bevor. Die Angreifer sind auf der Suche nach dem magischen Stein des Lebens und wollen ihn um jeden Preis in ihre Gewalt bringen. Am Vorabend des Krieges entdeckt der Magier Pug zusammen mit dem befreundeten Krieger Tomas, dass weit mehr als nur der Frieden Midkemias auf dem Spiel steht …
Autor
Raymond Feist wurde 1945 in Los Angeles geboren und lebt in San Diego im Süden Kaliforniens. Viele Jahre lang hat er Rollenspiele und Computerspiele entwickelt. Aus dieser Tätigkeit entstand auch die fantastische Welt seiner Romane: Midkemia. Die in den 80er-Jahren begonnene Saga ist bereits ein Klassiker des Fantasy-Genres, und Feist gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Fantasy in der Tradition Tolkiens.
Besuchen Sie uns auch auf
www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Raymond Feist
Die
Schlangenkrieg-
Saga 3
Dämonenkönig
Deutsch von
Andreas Helweg
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Rage of a Demon King (The Serpentwar Saga, Book 3)« bei Avon Books, New York.
Copyright der Originalausgabe © 1997 by Raymond Elias Feist
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Deutsche Erstveröffentlichung © 1997 und 1998 unter den Titeln »Die Rückkehr des Schwarzen Zauberers« und »Der Zorn des Dämonen« by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Peter Thannisch
Covergestaltung und -illustration: Isabelle Hirtz, Inkcraft
JB · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-23299-3V002
www.blanvalet.de
Prolog Der Durchbruch
Die Wand schimmerte.
In dem Raum, der einst der Thronsaal von Jarwa, dem letzten Sha-Shahan der Sieben Völker der Saaur gewesen war, schwankte die dreißig Fuß hohe Steinwand gegenüber dem leeren Thron der Macht und verschwand dann, als sich eine schwarze Leere breitmachte. Albtraumhafte Wesen versammelten sich, Ungeheuer mit schrecklichen Hauern und giftigen Krallen. Manche hatten die Gesichter toter Tiere, während die anderer denen von Menschen ähnelten. Manche trugen stolze Flügel, Geweihe oder Hörner von Stieren. Allen jedoch waren die stahlharten Muskeln, die bösen Absichten, die finstere Magie und die mörderische Natur gemein. Und dennoch verharrten diese Ungeheuer reglos vor Entsetzen über das, was auf der anderen Seite des gerade geschaffenen Portals erschien. Baumhohe Dämonen duckten sich und gaben sich alle Mühe, unsichtbar zu werden.
Um ein Portal zu öffnen, war große Energie vonnöten, und jahrelang hatten die verfluchten Priester von Ahsart den Dämonen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Erst als der Hohepriester das Siegel des Portals gebrochen und dem ersten Dämonen Zugang zu seiner Stadt gewährt hatte, um dem angreifenden Heer der Saaur Einhalt zu gebieten, war die Barriere überwunden worden.
Nun lag die Welt Shila in Trümmern, das Leben war bis auf einige niedere Tiere auf dem Meeresboden vernichtet; auf den Felsen in den fernen Gebirgsgipfeln wuchsen noch ein paar Flechten, und winzige Geschöpfe krabbelten unter Steine, um der Entdeckung zu entgehen. Alles, was größer war als das kleinste Insekt, war verschlungen worden. Hunger war nun der ärgste Feind des Dämonenheers, und wieder einmal waren die Dämonen zu ihrer alten Gewohnheit zurückgekehrt, einander gegenseitig zu fressen. Doch dieser Kampf auf Leben und Tod unter den Besten des Heeres war zum Erliegen gekommen, als ein neues Portal vom Fünften Zirkel nach Shila hin geöffnet worden war, das es dem obersten Herrscher des Dämonenreichs ermöglichte, zu seinen Untertanen zu sprechen.
Der Dämon ohne Namen stand am Rand jener, die man in diese einst so prächtige Halle gerufen hatte. Vorsichtig spähte er hinter einer Steinsäule hervor, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dieser Dämon hatte eine einzigartige Seele gefangen, mit deren Hilfe er zu einem gefährlichen und verschlagenen Gegner für seine Brüder geworden war. Anders als diese war er zu der Erkenntnis gelangt, dass man sein Ziel, die Lebenskraft und Intelligenz zu steigern, mit List besser erreichte als mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Immer noch präsentierte er sich jenen, die über ihm standen, mit der erforderlichen Mischung aus Angst und Bedrohlichkeit – ängstlich genug, damit sie glaubten, ihn zu beherrschen, dennoch so bedrohlich, dass sie nicht versuchten, ihn zu verschlingen. Dies war eine gefährliche Position, denn ein einziger Fehler konnte seine Einzigartigkeit enthüllen, und die Hauptmänner würden ihn sofort vernichten. Allmählich wurde sein Denken fremdartig, und er war sich inzwischen seiner selbst so bewusst, dass er für sie alle eine Bedrohung darstellte.
Dieser Dämon wusste, wie leicht er sich gegen wenigstens vier seiner vorgesetzten Brüder, die hier vor ihm standen, würde durchsetzen können, doch mit einem solch raschen Aufstieg innerhalb des Heeres hätte er nur unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Während seines kurzen Lebens hatte er nicht weniger als ein halbes Dutzend anderer zu schnell aufsteigen sehen, und alle waren von einem der großen Hauptmänner vernichtet worden, damit sie diesen weder selbst eines Tages herausfordern konnten noch einem seiner bevorzugten Diener gefährlich wurden.
Der mächtigste dieser Hauptmänner war Tugor, der Erste Diener des Großen Maarg. Und der Große Maarg war es nun, der seinen Willen kundtun sollte. Tugor fiel auf die Knie und drückte die Stirn gegen den Boden. Die anderen folgten seinem Beispiel.
Der Dämon ohne Namen hörte die schwache Stimme, die der Seele gehörte, die er gefangen hatte, und er versuchte, sie zu ignorieren, doch ständig behauptete sie, sie wisse etwas Wichtiges. »Pass gut auf«, hörte er in seinem Kopf, als würde es ihm ins Ohr geflüstert oder als wäre es sein eigener Gedanke.
Ein starker Energiestrom ergoss sich in den Saal, als sich die schimmernde Wand zu kräuseln schien und schließlich verschwand, sodass sich das Portal zum Heimatreich öffnete. Ein Wind wehte durch die Halle, weil Luft in das Loch zwischen den beiden Welten gesaugt wurde, als sollte alles im Saal dazu gezwungen werden, nach Hause zurückzukehren. Instinktiv wurde den Dämonen die Gegenwart des Mächtigeren bewusst, doch allein die Nähe zu Tugor ließ den namenlosen Dämon vor Entsetzen fast in Ohnmacht fallen.
Alle Anwesenden verharrten auf den Knien und hielten die Stirn auf den Boden gedrückt, nur der namenlose Dämon nicht, weil er hinter einer Säule verborgen stand. Er beobachtete, wie sich Tugor erhob und dem Nichts entgegentrat. Aus dem Loch in der Wand ertönte eine Stimme, in der Zorn und Machtgefühl mitschwangen. »Habt ihr den Weg gefunden?«
»Das haben wir, Mächtigster!«, erwiderte Tugor. »Wir haben zwei unserer Hauptmänner durch den Spalt nach Midkemia geschickt.«
»Was haben sie berichtet?«, verlangte die Stimme von der anderen Seite zu wissen, und der namenlose Dämon hörte neben Zorn und Machtbewusstsein noch ein weiteres Gefühl aus ihr heraus, eine Spur Verzweiflung.
»Dogku und Jakan haben noch keinen Bericht erstattet«, antwortete Tugor. »Wir glauben, sie sind nicht in der Lage, das Portal zu halten.«
»Schickt jemand anders!«, befahl Maarg, Herrscher des Fünften Zirkels. »Ich werde nicht herüberkommen, ehe der Weg geebnet ist, denn ihr habt nichts auf der Welt zurückgelassen, was ich verschlingen könnte. Beim nächsten Mal, wenn ich das Portal öffne, werde ich jedoch hinüberkommen, und falls es dann nichts für mich zu fressen gibt, werde ich mich an deinem Herzen gütlich tun, Tugor!«
Das Zischen der Luft, die aus dem Saal gesaugt wurde, brach ab, als sich der Spalt schloss. Maargs Stimme hing noch im Raum, während das Schimmern der Luft aufhörte und die Wand wieder so massiv wurde wie zuvor.
Tugor stand auf und brüllte vor Wut und Niedergeschlagenheit. Ganz langsam erhoben sich die anderen, denn jetzt war nicht der rechte Zeitpunkt, die Aufmerksamkeit des Zweitmächtigsten ihres Volkes auf sich zu ziehen. Tugor war dafür bekannt, jenen die Köpfe abzureißen, die zu stark wurden, damit sich kein Rivale erheben und mit ihm um seinen Rang kämpfen konnte. Gerüchten zufolge sammelte Tugor seine Kraft für den Tag, an dem er Maarg zum Kampf um die Herrschaft herausfordern wollte.
Tugor wandte sich um. »Wer geht als Nächster?«
Ohne zu wissen warum, trat der namenlose Dämon vor. »Ich werde gehen, Lord.«
Tugors Gesicht, ein Pferdeschädel mit großen Hörnern, war nahezu ausdruckslos, dennoch war seine Verblüffung offensichtlich. »Wer bist du, kleiner Narr?«
»Ich habe noch keinen Namen, Meister«, erwiderte der Namenlose.
Tugor machte zwei große Schritte und drängte einige seiner Hauptmänner zur Seite, dann stand er hoch aufragend vor dem kleinen Dämon. »Ich habe Hauptmänner losgeschickt, denen die Rückkehr nicht gelungen ist. Warum solltest ausgerechnet du den Erfolg haben, der ihnen verwehrt blieb?«
»Weil ich bescheiden bin und nur beobachten werde, Meister«, gab der Namenlose ruhig zurück. »Ich werde die Lage auskundschaften und mich versteckt halten und solange Kraft sammeln, bis ich das Portal von der anderen Seite her wieder öffnen kann.«
Tugor hielt einen Augenblick inne, dann holte er mit der Hand aus, schlug dem kleinen Dämon ins Gesicht und schleuderte ihn damit durch den Raum gegen die Wand. Der Dämon hatte kleine Flügel, mit denen er allerdings noch nicht fliegen konnte, und sie brachen, als er gegen die Wand prallte.
»Das ist dafür, dass du so anmaßend warst«, schrie Tugor, dessen Wut jenen Punkt erreicht hatte, an dem nur noch Töten sie besänftigen konnte. »Ich werde dich schicken«, sagte er zu dem Hauptmann, der den nächsten Rang unter ihm einnahm. Dann fuhr er herum und schnappte sich einen anderen, riss dem unglückseligen Dämon die Kehle heraus und kreischte: »Und dies ist dafür, dass der Rest von euch nicht mehr Mut gezeigt hat!«
Einige der am Rand stehenden Dämonen flüchteten aus dem Saal, während sich andere auf den Steinboden warfen und um Gnade winselten. Tugor war jedoch damit zufrieden, einen seiner Brüder getötet zu haben, trank dessen Blut und Lebenskraft und warf dann die leere Fleischhülle achtlos beiseite.
»Geh!«, befahl Tugor dem Hauptmann. »Der Spalt befindet sich in den Fernen Bergen im Osten. Die, die ihn bewachen, werden dir sagen, was du wissen musst, um zurückzukehren – falls dir dies möglich sein wird. Kehrst du zurück, werde ich dich belohnen.«
Der Hauptmann eilte aus der Halle. Der kleine Dämon zögerte, dann folgte er ihm, ohne weiter auf den stechenden Schmerz in seinem Rücken zu achten. Er verließ den Palast, und draußen wurde er von zwei anderen Dämonen angefallen, die der Hunger trieb. Rasch tötete er sie. Nachdem er ihre Lebensenergie getrunken hatte, ließ der Schmerz in seinen Flügeln nach, und ein neuer Gedanke kam ihm in den Sinn. Plötzlich wusste er, weshalb er dem Hauptmann folgte, der damit beauftragt worden war, den Spalt abermals zu öffnen.
Die Stimme, die einst aus der Phiole um seinen Hals zu ihm gesprochen hatte und die er jetzt stets in seinem Kopf vernahm, sagte: »Wir werden es schon überstehen, wachsen und gedeihen und dann tun, was getan werden muss.«
Der kleine Dämon eilte zu der Stelle, wo sich der Spalt befand, der Ort jenes Risses, durch den die letzten der Saaur geflohen waren. Der kleine Dämon hatte vieles erfahren, und irgendwoher wusste er, dass ein Verbündeter die Dämonen betrogen hatte, dass das Portal eigentlich hätte offen bleiben sollen, stattdessen jedoch geschlossen worden war. Zweimal hatte man es mit großem Aufwand aufgestoßen, doch jedes Mal war es rasch wieder zugefallen, da es auf der anderen Seite durch Gegenzauber versiegelt worden war. Mindestens zwei Dutzend Dämonen waren von Tugors Hand gestorben, weil das Heer nicht hatte hinüberwechseln können.
Der Hauptmann erreichte das Portal, wo sich ein Dutzend anderer Dämonen um ihn versammelte. Sie sollten ihm beim Übergang helfen. Unbemerkt folgte der kleinere Dämon dem großen, als wäre er sein Begleiter.
Die Stelle, an der sich der Spalt befand, war wenig bemerkenswert, ein großes Stück aufgeweichten Bodens, das Gras von Tausenden Saaurpferden mit ihren Reitern und von deren Frauen und Kindern niedergetrampelt. Auch in der Umgebung war das meiste Gras verdorrt – die Dämonen hatten es niedergetreten –, doch hier und dort fanden sich noch vereinzelte grüne Flecken. Sollte der Spalt nicht bald geöffnet werden, würden selbst diese winzigen Quellen der Lebensenergie ausgesaugt werden.
Der kleine Dämon kniff die Augen zusammen und entdeckte in der Energie, die in der Luft hing, eine eigentümliche Krümmung, die jedoch kaum wahrzunehmen war, solange man nicht eigens danach suchte.
Was die Saaur und andere Sterbliche Magie nannten, war für die Dämonen nichts anderes als eine besondere Form der Lebensenergie, und einige von ihnen würden beim Öffnen des Spaltes sterben. Solange man die Schutzzauber auf der anderen Seite nicht entfernt hatte, wäre es unmöglich, den Spalt für länger als einige Sekunden offen zu halten, und selbst dabei würden mehrere Dämonen ihr Leben lassen müssen. Kein Dämon gab sein Leben freiwillig – das lag nicht in ihrer Natur –, doch alle fürchteten Tugor und Maarg und hegten die Hoffnung, dass es die anderen sein würden, die den Preis bezahlten, während sie überlebten und die Belohnung einstrichen.
»Öffnet das Portal!«, befahl der Hauptmann.
Die Dämonen, denen man diese Aufgabe übertragen hatte, blickten einander im Bewusstsein der Gefahr an, doch schließlich ließen sie die Energien fließen. Der kleine Dämon betrachtete die Luft und sah das Schimmern, als sich das Portal öffnete. Der Hauptmann duckte sich und wartete auf den richtigen Moment zum Sprung.
Während er sich bereit machte und neben ihm überall Dämonen aufschrien und zusammenbrachen, hüpfte der kleine Dämon auf seinen Rücken. Darauf nicht gefasst, brüllte der Hauptmann vor Schreck und Empörung auf, derweil sie in den Spalt fielen. Die Dringlichkeit, mit der der kleine Dämon sein Ziel erreichen wollte, half ihm, die Verwirrung zu ignorieren; die Überraschung des Hauptmanns nahm hingegen noch zu.
Sie landeten in einer dunklen und riesigen Halle, und der kleine Dämon biss dem Hauptmann, so fest er konnte, ins Genick, in die schwächste Stelle seines Körpers. Augenblicklich schoss ein energetischer Impuls in den kleinen Dämon, während sich die Empörung des Hauptmanns in Schrecken und Schmerz verwandelte. In der Dunkelheit schlug er wild um sich und versuchte verzweifelt, den Meuchler loszuwerden. Der kleine Dämon klammerte sich brutal an den Rücken seines Opfers.
Der Hauptmann warf sich zurück und wollte den kleineren Dämon an der Felswand der Höhle zermalmen, doch seine kräftigen Flügel waren ihm dabei im Weg.
Endlich fiel der Hauptmann auf die Knie, und in diesem Augenblick war sich der kleine Dämon seines Sieges gewiss. Energie strömte in ihn hinein, bis er glaubte, er würde buchstäblich explodieren; er hatte schon bis zur Bewusstlosigkeit gefressen, doch nie zuvor hatte er mit einem einzigen Opfer so viel Energie aufgenommen. Jetzt war er so mächtig wie derjenige, den er verspeist hatte. Seine Beine, länger und muskulöser als noch Momente zuvor, standen auf hartem Stein, und er hob sein sterbendes Opfer hoch, das nun, da ihm seine Lebenskraft entzogen war, kaum noch schwach protestieren konnte.
Bald war es vorbei, und der abermals siegreiche Dämon stand in der Halle, nahezu trunken von der neuen Kraft. Kein Fleisch, keine Frucht, kein Bier und kein Wein konnten einen seiner Art in diesen Zustand versetzen. Er wünschte sich einen dieser Spiegel der Saaur, denn er wusste, dass er mindestens einen Kopf größer war als noch einen Augenblick zuvor. Und er spürte, wie die Flügel auf seinem Rücken, die ihn eines Tages durch den Himmel tragen würden, erneut zu wachsen begannen.
Aber etwas lenkte ihn ab, und abermals bemerkte er diese fremden Gedanken in seinem Kopf. »Sieh dich um und pass gut auf!«
Er wandte sich um und richtete seine Sinne in die Dunkelheit.
Die riesige Halle war übersät mit Leichen von sterblichen Kreaturen. Er sah gleichermaßen Saaur und jene, die Pantathianer hießen, und dazu eine dritte Art, kleiner als die Saaur und größer als die Pantathianer. Von ihren Lebensenergien war nichts geblieben, also ließ er sie links liegen.
Die Schutzzauber, jene Barrieren, die den Tod der Dämonen verursacht hatten, die ohne Hilfe hatten passieren wollen, befanden sich noch an Ort und Stelle. Er untersuchte sie und sah, wie leicht die anderen Dämonen sie hätten beseitigen können.
Wieder betrachtete er das Gemetzel und bemerkte die große Magie, mit der man die Schutzzauber vor der Entdeckung durch die zuvor hier eingedrungenen Dämonen verborgen hatte. Dann fragte er sich, was mit seinen Brüdern geschehen sein mochte, denn falls sie in einem Kampf vernichtet worden wären, hätte er irgendwo ihre verbliebene Energie entdecken müssen, doch er sah keine.
Erschöpft von dem Kampf und noch immer von seiner neuen Lebenskraft berauscht, erreichte der Dämon den ersten Schutzzauber und wollte ihn entfernen, als die fremde Stimme sagte: »Warte!«
Der Dämon zögerte, dann langte er nach der Phiole, die er um den Hals trug. Ohne über die Folgen nachzudenken, öffnete der nun so viel mächtigere Dämon die Phiole, und die Seele, die darin gefangen war, wurde befreit. Doch anstatt davonzufliegen und sich zu den großen Seelen ihrer Vorfahren zu gesellen, drang die Seele aus der Phiole in den Dämon ein.
Der Dämon erschauerte, schloss die Augen, und ein anderer Verstand übernahm die Führung. Wäre der Dämon nicht so intensiv mit den Veränderungen nach dem Sieg beschäftigt gewesen, hätte er sich dem Befehl der Seele, sie zu befreien, niemals so leicht unterworfen, und diese andere Intelligenz hätte nicht die Oberhand gewinnen können. Der Geist, der jetzt den Dämon beherrschte, ließ eine Essenz in der Phiole zurück und schob den Stopfen wieder hinein. Ein Teil von ihm musste von dem Dämon getrennt bleiben, eine Art Rettungsanker gegen den Appetit des Dämons. Doch selbst mit diesem Anker würde es ein ständiger Kampf sein, der Natur des Dämons zu widerstehen.
Die nichtmenschlichen Augen der neu geschaffenen Kreatur untersuchten abermals die Schutzzauber, doch anstatt sie zu zerstören, beschwor sie alte Saaurmagie und verstärkte sie noch. Die Kreatur konnte sich vorstellen, wie Tugor vor Wut rasen würde, wenn der nächste Dämon, der versuchte, in dieses Reich zu gelangen, in einem Feuerball aufgehen würde. Doch der Rückschlag würde die Dämonen keinesfalls vom Eindringen in diese Welt abhalten, verschaffte der neuen Kreatur aber wertvolle Zeit.
Sie streckte die Krallen und dann die plötzlich so langen Arme aus, während sie über diese dritte Art nachdachte, deren Leichen auf dem Boden lagen. Waren es Verbündete oder Feinde der Pantathianer und Saaur?
Die Kreatur schob diese Gedanken beiseite. Der neue Verstand, der aus der Verschmelzung des kleinen Dämons und der gefangenen Seele entstanden war, nahm plötzlich etwas wahr. Mindestens ein oder zwei geistlose Dämonen strichen noch durch diese riesigen Hallen und Gänge aus Stein. Die Kreatur wusste, dass die Schutzzauber den kleinen Dämon nicht versehrt hatten, als dieser auf dem Rücken des Hauptmanns durch den Spalt geritten war, doch dem Hauptmann selbst war der Verstand geraubt worden, mochte er zuvor auch noch so mächtig gewesen sein. Die neue Kreatur allerdings, die einst ein Dämon gewesen war, wusste zudem, dass, wenn die anderen Dämonen hier fraßen und sowohl mächtiger als auch schlauer wurden, sich ihre Intelligenz wieder einstellen würde. Und dann würden sie sich erinnern, hierher zurückkehren, die Schutzzauber zerstören und den Weg frei machen.
Um das zu verhindern, musste die Kreatur also als Erstes diese Dämonen vernichten. Danach würde eine zweite Aufgabe auf ihn warten. »Jatuk.« Die Kreatur sprach den Namen leise aus. Der Sohn des letzten Herrschers der Saaur auf der Welt Shila würde hier über die Reste des letzten Saaurheeres herrschen, und die Kreatur hatte ihm viel mitzuteilen.
Während das Verschmelzen der beiden Wesen seinen Fortgang nahm, wurde der Verstand des Dämons zuerst unter Kontrolle gebracht und dann von der anderen Intelligenz vereinnahmt. Der Vater von Shadu – der nun Jatuk diente – übernahm das Kommando über diesen fremden Körper. Die Seele von Hanam, dem letzten großen Meister des Wissens der Saaur, hatte einen Weg gefunden, wie sie Tod und Verrat überlisten konnte, und sie würde nach den letzten Überlebenden ihres Volkes suchen, um sie vor dem großen Betrug zu warnen, der das Schicksal einer weiteren Welt besiegeln würde, wenn man ihm nicht Einhalt gebot.
Krondor
Erik machte ein Zeichen.
Die Soldaten knieten im Graben und beobachteten, wie er einen nach dem anderen von ihnen mit einer Geste auf seinen Posten schickte. Alfred, der inzwischen zum Korporal aufgestiegen war, winkte vom anderen Ende der Reihe her, und Erik nickte. Jeder Mann wusste, was er zu tun hatte.
Der Feind hatte sein Lager an einer relativ gut zu verteidigenden Stelle an der Straße nördlich von Krondor aufgeschlagen. Ungefähr drei Meilen weiter lag die kleine Stadt Eggly, das Ziel der Invasoren. Der Feind hatte noch vor Sonnenuntergang den Marsch unterbrochen, und Erik war sicher, dass der Angriff vor der Morgendämmerung erfolgen würde.
Erik hatte ihn von einem Versteck aus beobachtet. Seine Männer lagerten in der Nähe, während er darüber nachdachte, auf welche Weise er am besten vorgehen sollte. Er hatte zugesehen, wie der Feind sein Lager errichtete, und dort ging es erwartungsgemäß höchst ungeordnet zu. Die Posten waren schlecht platziert und zudem undiszipliniert, denn sie verbrachten mehr Zeit damit, mit den Kameraden zu schwatzen, als nach dem Feind Ausschau zu halten. Und da sie dauernd zu den Lagerfeuern hinblickten, würden sie im Dunkeln kaum etwas erkennen können.
Nachdem Erik Stärke und Position der Invasoren abgeschätzt hatte, wusste er, welche Möglichkeiten ihm offenstanden. Er hatte sich entschlossen, als Erster zuzuschlagen. Obwohl die anderen wenigstens fünffach überlegen waren, hätten seine Männer dann den Vorteil der Überraschung auf ihrer Seite. Zudem waren sie besser ausgebildet, das zumindest hoffte er.
Erik ließ sich noch einen Moment Zeit, um die Position des Feindes noch einmal zu begutachten. Die Posten schienen noch unaufmerksamer zu sein als zu dem Zeitpunkt, an dem Erik nach seiner Kompanie geschickt hatte. Offenbar sahen die Invasoren ihre Mission als nicht allzu wichtig an. Sie sollten lediglich eine abgelegene Stadt einnehmen, während sich die eigentliche Auseinandersetzung weiter im Süden nahe der Hauptstadt Krondor abspielte. Erik war entschlossen, ihnen zu zeigen, dass in einem Krieg jede Mission wichtig war.
Als seine Männer in Position waren, schlich Erik durch einen kleinen Hohlweg vorwärts, bis er eine der gelangweilten Wachen beinahe hätte berühren können. Er warf einen Stein hinter den Mann, der sich gedankenlos danach umdrehte. Wie Erik gehofft hatte, blickte der Mann ins Lager zurück, zum nächsten Feuer, was ihn für einen Augenblick blendete. Ein Soldat, der an dem Feuer saß, fragte: »Was gibt’s, Henry?«
Die Wache erwiderte: »Nichts.«
Er wandte sich wieder um, woraufhin Erik plötzlich direkt vor ihm stand, und noch ehe er Alarm geben konnte, traf ihn Erik mit der Faust, dann fing er ihn auf, als er fiel.
»Henry?«, fragte der Mann am Lagerfeuer und wollte sich schon erheben, während er in die Dunkelheit starrte.
Erik versuchte, die Stimme der Wache zu imitieren. »Ich hab dir doch gesagt, es ist nichts.«
Doch der Versuch scheiterte, der andere Soldat wollte sofort Alarm geben und zog das Schwert. Er hatte es noch nicht ganz aus der Scheide, als Erik schon über ihm war wie eine Katze über der Maus. Er packte den Mann am Waffenrock, zog ihn nach hinten und warf ihn hart zu Boden. Während er ihm einen Dolch an die Kehle setzte, zischte er: »Du bist tot. Keinen Laut!«
Der Mann blickte ihn säuerlich an, nickte jedoch. Leise sagte er: »Nun ja, zumindest kann ich jetzt in Ruhe zu Ende essen.« Er setzte sich auf und griff zu seinem Teller, während zwei andere Männer nur verständnislos blinzelten, als Erik das Lagerfeuer umkreiste und ihnen die Kehlen »durchschnitt«, ehe sie den Angriff auch nur bemerkt hatten.
Rufe überall im Lager verkündeten Erik, dass seine Kompanie nun insgesamt zuschlug, Kehlen durchschnitt, Zelte einriss und ganz allgemein Verwüstungen anrichtete. Nur ein einziges Verbot hatte Erik erteilt: kein Feuer. Obwohl die Versuchung groß war, würde der Baron von Tyr-Sog den Schaden an seiner Ausrüstung wohl kaum begrüßen.
Erik eilte durch das Kampfgetümmel und »tötete« im Vorbeilaufen verschlafene Soldaten, die aus ihren Zelten krochen. Er zerschnitt einige Zeltleinen, wodurch die Soldaten unter der zusammenfallenden Leinwand in der Falle saßen, und er hörte wütende Rufe darunter. Überall im Lager fluchten Männer, während sie »getötet« wurden, und Erik konnte seine Belustigung kaum verhehlen. Sie hatten schnell zugeschlagen, und innerhalb von zwei Minuten nach dem Beginn des Angriffs hatte er schon die Mitte des Lagers erreicht.
Dort angekommen trat gerade der Baron noch halb im Schlaf aus dem Kommandozelt, den Schwertgürtel um das Nachthemd geschnallt und ganz offensichtlich über die Störung höchst unerfreut. »Was soll das?«, verlangte er von Erik zu wissen.
»Eure Kompanie ist geschlagen, mein Lord«, meldete Erik und tippte dem Baron vorsichtig mit der Schwertspitze auf die Brust. »Und Ihr seid jetzt tot.«
Der Baron betrachtete den Mann, der nun sein Schwert in die Scheide zurückschob: Er war groß, ungewöhnlich breit um die Schultern, ohne dabei dick zu sein, wie ein junger Schmied, doch das Gesicht zeigte keine bemerkenswerten Züge. Dennoch, sein gewinnendes Lächeln war freundlich und offen. Im Licht des Feuers schimmerte das hellblonde Haar an manchen Stellen rubinrot.
»Unfug!«, entgegnete der gedrungene Baron. Sein säuberlich getrimmter Bart und sein seidenes Nachthemd erzählten Bände über seine Felderfahrung. »Wir sollten Eggly erst morgen angreifen. Niemand hat etwas von diesem« – er umfasste das Lager mit einer Handbewegung –, »diesem … Nachtangriff gesagt. Hätten wir davon gewusst, hätten wir Vorkehrungen getroffen.«
»Mein Lord«, erwiderte Erik, »wir sollten nur etwas unter Beweis stellen.«
Aus der Dunkelheit ertönte eine Stimme. »Und diesen Beweis habt Ihr sehr wohl geliefert.«
Owen Greylock, Hauptmann in der Fürstlichen Garnison des Prinzen von Krondor, trat ins Licht. In den tanzenden Schatten der Feuer hatte sein hageres Gesicht einen finsteren Zug. »Ich schätze, Ihr habt drei Viertel der Soldaten getötet oder kampfunfähig gemacht, Erik. Wie viele Männer hattet Ihr?«
»Sechzig«, antwortete Erik.
»Aber ich habe dreihundert!«, brauste der Baron sichtlich verstört auf. »Und zudem noch die Hilfstruppen der Hadatikrieger.«
Erik blickte sich um und meinte: »Ich sehe überhaupt keine Hadati.«
Eine Stimme mit deutlichem Akzent meldete sich aus dem Dunkel. »So soll es auch sein.«
Eine Gruppe Männer in Kilts und Plaids betrat das Lager. Sie trugen ihr Haar auf dem Kopf zusammengeknotet, von wo eine lange Strähne auf den Rücken fiel. »Wir haben gehört, wie sich Eure Männer angeschlichen haben«, erklärte der Anführer, indem er Erik anblickte, dessen schwarze Jacke keine Abzeichen trug, sodass er seinen Rang schätzen musste: »Hauptmann?«
»Feldwebel«, berichtigte Erik.
»Feldwebel«, wiederholte der Sprecher, ein großer Krieger, der über seinem Kilt nur ein einfaches, ärmelloses Hemd trug; in den Bergen würde ihn sein Plaid vor der Kälte schützen. Unter dem nachtschwarzen Haar befanden sich unauffällige ebenmäßige Gesichtszüge. Seine dunklen Augen erinnerten Erik allerdings an die eines Raubvogels. Im Licht des Lagerfeuers wirkte seine sonnengebräunte Haut fast rot.
Erik brauchte nicht erst zu sehen, wie der Mann sein Schwert zog, um zu wissen, dass er ein erfahrener Kämpfer war.
»Ihr habt uns gehört?«, fragte Erik.
»Ja. Eure Männer sind gut, Feldwebel, doch wir Hadati leben in den Bergen, wo wir oft auf dem nackten Boden neben unseren Herden schlafen, und wir wissen, wann wir einen Trupp Männer näher kommen hören.«
»Wie ist Euer Name?«, erkundigte sich Erik.
»Akee, Sohn des Bandur.«
Erik nickte. »Wir müssen uns unterhalten.«
»Ich protestiere, Hauptmann!«, wandte der Baron ein.
»Wie bitte, mein Lord?«, fragte Greylock.
»Ich protestiere gegen diesen unangekündigten Angriff. Uns wurde gesagt, wir sollen die Rolle der Invasoren spielen und hätten Widerstand von Milizen und Sondereinheiten aus Krondor in der Stadt Eggly zu erwarten. Über einen solchen nächtlichen Angriff hat man uns nicht unterrichtet. Hätten wir davon gewusst, wären wir vorbereitet gewesen!«, behauptete er abermals.
Erik blickte Owen an, der ihm ein Zeichen gab, er solle seine Kompanie formieren und abziehen. Der Hauptmann würde den gekränkten Baron von Tyr-Sog schon beruhigen. Erik winkte Akee zu sich. »Eure Männer sollen ihre Ausrüstung zusammenpacken und sich bei meinem Korporal melden. Das ist ein übel aussehender Kerl namens Alfred. Sagt ihm, Ihr würdet morgen mit uns nach Krondor ziehen.«
»Wird das dem Baron gefallen?«, wollte Akee wissen.
»Vermutlich nicht«, erwiderte Erik und wandte sich ab. »Aber seine Meinung ist nicht von Belang. Ich stehe im Dienst des Prinzen von Krondor.«
Der Hadati zuckte mit den Schultern und nickte seinen Gefährten zu. »Lasst die Männer frei.«
»Frei?«, fragte Erik.
Akee lächelte. »Wir haben einige von denen gefangen genommen, die Ihr nach Süden geschickt habt, Feldwebel. Ich glaube, der hässliche Kerl ist unter ihnen.«
Erik, sonst die Ruhe selbst, ließ sich von der Erschöpfung und Anspannung der Nachtübung übermannen und fluchte leise. »Wenn er tatsächlich unter ihnen ist, wird er es bedauern.« Er wandte sich an einen Mann aus seiner Kompanie, einen Soldaten mit Namen Shane. »Die Männer sollen sich am südlichen Rand des Lagers sammeln.«
Shane nickte und erteilte sofort die entsprechenden Befehle.
Erik folgte dem Hadati zu einer Stelle außerhalb des Lagers, wo zwei Hadatikrieger neben Korporal Alfred und einem halben Dutzend von Eriks besten Männern saßen.
»Was ist passiert?«, erkundigte sich Erik.
Alfred erhob sich und seufzte. »Sie sind gut, Feldwebel.« Er zeigte auf einen Hügel hinter ihnen. »Sie müssen sich in dem Moment in Bewegung gesetzt haben, als sie uns kommen gehört haben, denn wir waren schon oben auf dem Hügel, und ich hätte meine gesamten Besitztümer darauf verwettet, dass es unmöglich wäre, aus dem Lager zu kommen, über den Hügel zu schleichen, sich zu verstecken und uns dann von hinten anzugreifen, während wir den Hügel hinuntergestürmt sind.« Er schüttelte den Kopf. »Sie haben uns auf die Schultern getippt, ehe wir sie überhaupt gehört haben.«
Erik wandte sich an Akee. »Ihr müsst mir erzählen, wie Ihr das angestellt habt.«
Akee zuckte mit den Schultern, sagte jedoch nichts.
»Die Männer aus den Bergen«, sagte Erik zu Alfred, »kommen mit uns. Bring sie ins Lager und dann nichts wie zurück nach Krondor.«
Alfred lächelte und vergaß den Rüffel, der ihn erwartete, wenn sie wieder in der Garnison waren. »Warmes Essen«, meinte er nur.
Erik konnte nur zustimmen. Seit einer Woche waren sie im Manöver und hatten währenddessen nur kalte Rationen im Dunkeln zu sich genommen. Die Männer waren müde und hungrig. »An die Arbeit!«
Als er schließlich allein war, dachte Erik darüber nach, was in dem bevorstehenden Krieg alles auf dem Spiel stand, und er fragte sich, ob selbst hundert dieser Übungen die Männer des Königreichs auf das vorbereiten könnten, was auf sie zukommen würde.
Vermutlich konnte sie nichts voll und ganz darauf vorbereiten, doch welche Wahl hatten sie schon? Calis, Prinz Patrick, Marschall William und die anderen Offiziere befanden sich ebenfalls hier in den Bergen und führten ähnliche Übungen durch. Am Ende der Woche würde man Rat halten und überlegen, was zu tun sei.
»Es muss so viel getan werden wie nur möglich«, murmelte er in sich hinein.
Seine schlechte Laune, so erkannte er, rührte mehr von seiner Müdigkeit und seinem Hunger als von Alfreds Versagen. Dann lächelte er. Wenn die Männer aus den Bergen nördlich von Yabon so schnell waren, konnte man nur froh sein, dass sie auf der Seite des Königreichs standen und, was noch erfreulicher war, unter seinem eigenen Kommando.
Er ging zurück in Richtung Lager. Vermutlich war es besser, Greylock dabei zu unterstützen, den betrübten Baron von Tyr-Sog zu trösten.
Die Soldaten nahmen Haltung an, während der Hof noch vom Gleichschritt ihrer Stiefeltritte widerhallte, und sie standen reglos da, während der Prinz von Krondor das Podest betrat.
Roo sah zu seinem Freund Erik hinüber. »Gar nicht schlecht.«
Erik schüttelte den Kopf, um Roo zu verstehen zu geben, dass er ruhig sein sollte. Roo grinste, schwieg jedoch, während Prinz Patrick, Regent von Krondor, den Salut der versammelten Garnison des Palastes entgegennahm. Neben ihm stand Calis, Hauptmann jener Spezialeinheit des Prinzen, die als die »Blutroten Adler« bekannt war.
Erik trat von einem Fuß auf den anderen, denn die Aufmerksamkeit, die ihm und den anderen zuteilwurde, behagte ihm gar nicht. Die Überlebenden der letzten Expedition zum fernen Novindus sollten für ihre Tapferkeit ausgezeichnet werden, und Erik war sich nicht ganz klar darüber, was das mit sich brachte. Am liebsten hätte er sich um seine üblichen Pflichten gekümmert.
Nachdem er vom Manöver in den Bergen zurückgekommen war, hatte er eine baldige Ratsversammlung erwartet. Calis hatte ihn und die anderen jedoch darüber in Kenntnis gesetzt, dass Prinz Erlands Rückkehr von seinem Besuch bei seinem Bruder König Borric mit einer Zeremonie begangen werden sollte, bei der auch Auszeichnungen vergeben werden sollten. Mehr wusste Erik nicht.
Er blickte zur Seite und sah, dass Calis, seinem Hauptmann, ebenfalls die Ungeduld ins Gesicht geschrieben stand. Renaldo, einer der anderen Überlebenden der letzten Reise, stand neben Micha. Die beiden Soldaten hatten Calis während der Flucht aus den Höhlen der pantathianischen Schlangenpriester begleitet. Renaldo warf sich stolz in die Brust, als der Prinz von Krondor ihm die Weiße Kordel der Tapferkeit verlieh, die man am Ärmel trug und die allen verkündete, mit welchem Mut der Träger für König und Vaterland gekämpft hatte.
Roo war mit einem seiner größten Schiffe nach Novindus gesegelt, um die Soldaten des Königreichs nach Hause zu holen. Erik und seine Gefährten hatten sich während der Rückreise ausgeruht und ihre Wunden kuriert. Ihr Hauptmann, dieser rätselhafte Mann, von dem erzählt wurde, dass er ein Halbelb sei, hatte so schwere Verletzungen davongetragen, dass jeder Mann ihnen erlegen wäre. Zwei seiner alten Gefährten, Praji und Vaja, waren in dem magischen Feuerstoß umgekommen, der auch Calis getroffen hatte. Sein halber Körper war dabei verbrannt worden. Dennoch fand man kaum eine Narbe an ihm, allein die betroffenen Stellen an Gesicht und Hals waren ein wenig heller als der Rest der sonnengebräunten Haut. Erik fragte sich, ob er jemals die volle Wahrheit über jenen Mann erfahren würde, unter dem er diente.
Eriks Blick wanderte hinüber zu einem anderen Mann, der während der letzten Jahre sein Gefährte gewesen war, zu Nakor, diesem eigentümlichen Glücksritter. Er stand ein wenig abseits von denen, die geehrt werden sollten, und beobachtete die Zeremonie mit einem halb spöttischen Grinsen. An seiner Seite stand Sho Pi, der frühere Mönch, der sich mittlerweile als Nakors Schüler betrachtete. Im vergangenen Monat hatten sie als Gäste des Herzogs von Krondor im Palast gewohnt, und Nakor hatte keine Ambitionen gezeigt, seiner gewohnten Beschäftigung nachzugehen. Sonst pflegte er in den Hinterzimmern der Wirtshäuser des Königreiches Nichtsahnende beim Kartenspiel auszunehmen.
Während der Prinz einen nach dem anderen aufrief, fragte sich Erik, wer diejenigen ehren würde, die zurückgeblieben waren, an erster Stelle der eisenharte Feldwebel Bobby de Loungville, der mehr als jeder andere Erik zu jenem Soldaten geschmiedet hatte, der er nun war. Er spürte, wie sich Tränen in seinen Augen sammelten, als er sich an die eisig kalte Gebirgshöhle erinnerte, in der er Bobby im Arm gehalten hatte, während sich die durch einen Schwerthieb verletzte Lunge des Feldwebels mit Blut füllte. Aber wenigstens habe ich Calis lebend herausgebracht, sagte sich Erik.
Er kniff die Augen zu, drängte die Tränen zurück und warf abermals einen Blick auf Calis, der nun seinerseits ihn beobachtete. Mit kaum wahrnehmbarem Nicken schien Calis ihm mitzuteilen, dass er wusste, woran Erik dachte, und dass er sich ebenfalls an verlorene Freunde erinnerte.
Die Zeremonie zog sich dahin, dann war sie unversehens zu Ende, und die versammelte Garnison des Palastes von Krondor war entlassen. Marschall William, der militärische Oberbefehlshaber des Fürstentums, winkte Erik und die anderen zu sich. »Der Prinz bittet euch alle zu einem Treffen in seinem privaten Ratszimmer«, sagte er zu Calis.
Erik blickte Roo an, der nur mit den Schultern zuckte. Auf der Rückreise hatten die beiden Jugendfreunde einander alle Neuigkeiten erzählt. Erik hatte sich halb amüsiert, halb erstaunt über seinen Freund gezeigt, dem es in weniger als zwei Jahren gelungen war, einer der führenden Händler von Krondor und zudem einer der reichsten Männer des Königreichs zu werden. Als er jedoch gesehen hatte, wie der Schiffsmeister und seine Mannschaft jedem Befehl von Roo augenblicklich nachkamen, war ihm bewusst geworden, dass Rupert Avery, der in seiner Kindheit nicht viel mehr als ein Dieb gewesen war und heute kaum das Jungenalter hinter sich hatte, tatsächlich der Besitzer des Schiffes war.
Erik hatte Roo davon erzählt, was er und die anderen entdeckt hatten, und es hatte wenig Ausschmückung gebraucht, um ihm das Entsetzen und den Ekel zu vermitteln, die Erik verspürt hatte, als sie sich durch die Höhlen der Pantathianer gekämpft hatten. Von denen, die bei der letzten Reise von Calis nach Novindus nicht dabei gewesen waren, gehörten Roo, Nakor und Sho Pi zu denjenigen, die den Kontinent bereits zuvor besucht hatten, und sie wussten, was die anderen hatten mitansehen müssen. Langsam, über die ganze Fahrt verteilt, hatte Erik seinem Freund die grausigen Einzelheiten des Gemetzels an den pantathianischen Weibchen und Jungen erzählt. Auch von dem »dritten Mann im Spiel«, der mehr Tod hinterlassen hatte als Calis’ Soldaten zusammen, hatte er berichtet. Falls sich nicht noch irgendwo anders Zuchthöhlen der Pantathianer befanden – und das war höchst unwahrscheinlich –, waren die letzten lebenden Pantathianer die an der Seite der Smaragdkönigin. Wenn die Königin in der kommenden Schlacht besiegt werden würde, wäre die Zeit der Schlangenpriester endgültig vorbei, ein Schicksal, das ihnen die beiden Jugendfreunde aus Düstermoor inständig wünschten.
Roo und Erik hatten sich getrennt, nachdem das Schiff angelegt hatte, da Roo Geschäfte in Übersee zu erledigen hatte. Zwei Tage später war Erik ins Manöver aufgebrochen und hatte sich einen Eindruck davon verschafft, wie Jadow Shati die Ausbildung während der Abwesenheit von Calis fortgeführt hatte. Erik hatte mit Zufriedenheit festgestellt, dass die neuen Männer, die in der letzten Woche unter seinem Kommando gestanden hatten, genauso diszipliniert und verlässlich waren wie jene, die er – damals noch als gemeiner Soldat – gedrillt hatte.
Als er nun den Palast betrat, fühlte Erik wie schon früher ein starkes Unbehagen angesichts der Hallen der Macht und der Gegenwart jener, die sie ausübten. Er hatte ein Jahr in Krondor gedient, ehe er mit Calis zu ihrer letzten Reise aufgebrochen war, doch die meiste Zeit hatte er sich auf dem Ausbildungsgelände aufgehalten. In den eigentlichen Palast ging er nur, wenn er gerufen wurde oder wenn er sich von Marschall William ein Buch über Taktiken oder andere Gebiete der Kriegskunde auslieh. In Gegenwart des obersten Befehlshabers der Königlichen Armeen des Westens war ihm nie so recht wohl zumute, doch schließlich hatte er sich an die Stunden gewöhnt, in denen sie über einem Glas Wein oder Bier über das sprachen, was er gelesen und wie er es bei der Armee anzuwenden hatte, die er gerade ausbildete. Hätte man Erik die Wahl gelassen, hätte er seine Zeit ausschließlich auf dem Drillplatz, in den Werkstätten der Waffenschmiede, bei den Pferden oder am liebsten draußen im Feld verbracht, wo das Leben einen so vereinnahmte, dass man keinen Gedanken an den bevorstehenden Krieg verschwendete.
Im privaten Ratszimmer des Prinzen, einem kleinen Saal, warteten bereits andere Männer, darunter Lord James, Herzog von Krondor, und Jadow Shati, der andere Feldwebel in Calis’ Kompanie. Erik war sicher, dass man Jadow zum Hauptfeldwebel befördern würde, um Bobbys Stelle einzunehmen. Auf dem Tisch stand ein übervolles Tablett mit Käse, Früchten, Brot und Gemüse. Bier, Wein und Krüge mit gekühltem Obstsaft waren ebenfalls aufgetischt worden.
»Greift zu!«, lud der Prinz von Krondor sie ein, legte Krone und Amtsmantel ab und reichte sie wartenden Pagen. Calis schnappte sich einen Apfel und biss hinein, während die anderen noch ihre Plätze einnahmen.
Erik winkte Roo zu sich.
»Wie geht es zu Hause?«, fragte Erik.
»Die Kinder sind … erstaunlich«, gab Roo Auskunft. »Sie sind in den wenigen Monaten so rasch gewachsen, dass ich sie kaum wiedererkannt habe.« Auf seinem Gesicht machte sich ein nachdenklicher Ausdruck breit. »Meine Abwesenheit hat dem Geschäft nicht geschadet, aber es ist doch nicht alles so gut gelaufen, wie ich erwartet habe. Jacob Esterbrook hat mich dreimal übervorteilt, während ich nicht da war. Eines dieser Geschäfte hat mich ein kleines Vermögen gekostet.«
»Ich dachte, ihr beide wärt Freunde«, wunderte sich Erik und steckte sich etwas Brot und Käse in den Mund.
»Sozusagen«, erwiderte Roo. Er hatte es für besser gehalten, Erik nichts von seiner Beziehung zu Sylvia Esterbrook zu erzählen. Vielleicht hatte Erik ja etwas strengere Ansichten, was Familie und Treueschwüre anging.
»›Freundschaftliche Konkurrenten‹ wäre wohl die angemessenere Bezeichnung. Er hat den Handel mit Kesh fest im Griff und weigert sich standhaft, auch nur einen kleinen Teil davon abzutreten.«
Calis trat zu ihnen. »Roo, würdet Ihr uns bitte einen Augenblick entschuldigen?«
Rupert nickte. »Natürlich, Hauptmann.«
Calis führte Erik außer Hörweite der anderen, ehe er fragte: »Erik, hat Marschall William heute schon die Gelegenheit gehabt, mit dir zu sprechen?«
Erik schüttelte den Kopf. »Nein, Hauptmann. Ich hatte alle Hände voll zu tun, um zusammen mit Jadow die Dinge wieder in ihren gewohnten Gang zu bringen, jetzt, da Bobby nicht mehr unter uns weilt.«
»Ich verstehe.« Calis machte dem Marschall ein Zeichen, der sich daraufhin zu ihnen gesellte. Calis blickte Erik an. »Du musst dich entscheiden.«
William, ein kleiner, schlanker Mann, der, wie Erik wusste, trotz seines fortgeschrittenen Alters zu den besten Reitern und Fechtern des Königreichs zählte, ergriff das Wort: »Calis und ich haben über Euch gesprochen, junger Mann. So, wie die Dinge stehen, haben wir mehr offene Stellen als geeignete Männer, mit denen wir sie besetzen können.«
Erik wusste, was William mit »so, wie die Dinge stehen« meinte. Eine erschreckend große Armee würde das Königreich innerhalb der nächsten zwei Jahre angreifen. »Entscheiden?«
»Ich würde Euch gern einen Posten im Stab anbieten«, erklärte William. »Ihr würdet den Rang eines Leutnants in der Armee des Prinzen erhalten, und ich würde Euch den Befehl über die Lanzenreiter von Krondor übertragen. Ihr könnt gut mit Pferden umgehen. Nun, ich kann mir keinen besseren Mann für den Posten vorstellen.«
Erik blickte Calis an. »Herr?«
»Ich würde dich natürlich lieber bei den Blutroten Adlern behalten«, gab Calis zu verstehen.
»Dann bleibe ich bei den Adlern«, sagte Erik ohne zu zögern. »Ich habe jemandem ein Versprechen gegeben.«
William lächelte wehmütig. »Ich hatte mir das schon gedacht, aber ich wollte doch wenigstens fragen.«
»Vielen Dank für das Angebot, mein Lord«, antwortete Erik. »Ich fühle mich geschmeichelt.«
William grinste Calis an. »Du musst irgendeine Magie einsetzen. Er ist auf bestem Wege, einer der ausgezeichnetsten Strategen zu werden, die ich je kennengelernt habe – wenn er weiter so lernt, wird er der beste –, und du willst ihn als Feldwebel beim Drill verheizen.«
Calis lächelte schief; ein Ausdruck trockener Belustigung, wie Erik sehr wohl wusste. »Wir könnten gut noch mehr solche Strategen als Feldwebel für den Drill unserer Soldaten brauchen, Willy«, entgegnete der halbelbische Hauptmann.
William zuckte mit den Schultern. »Da hast du natürlich recht, aber wenn sie kommen, möchte jeder von uns die Besten an seiner Seite wissen.«
»Das kann ich nicht bestreiten.«
William ging, und Calis wandte sich wieder an Erik. »Ich danke dir.«
»Ich habe jemandem ein Versprechen gegeben«, wiederholte Erik.
»Bobby?«, fragte Calis.
Erik nickte.
Calis’ Miene verfinsterte sich. »Nun, da ich Bobby gut kannte, sollte ich dir am besten gleich sagen, dass ich einen Hauptfeldwebel brauche und kein Kindermädchen. Du hast mir einmal das Leben gerettet, Erik von Düstermoor, und damit ist dein Versprechen an Bobby de Loungville längst erfüllt. Wenn du eines Tages die Wahl zwischen meinem Leben und dem Überleben des Königreichs hast, sollst du die richtige Entscheidung treffen.«
Erik brauchte einen Augenblick, bis er begriff. »Hauptfeldwebel?«
»Du nimmst Bobbys Stelle ein«, erklärte Calis.
»Jadow ist doch schon viel länger bei Euch als …«, begann Erik.
»Aber du hast den Dreh raus«, unterbrach ihn Calis. »Und Jadow nicht. Er ist ein guter Feldwebel – du hast ja die Männer gesehen, die er ausgebildet hat –, aber wenn er noch höher befördert würde, wäre er eher eine Last denn eine Hilfe.« Er betrachtete Eriks Gesicht einen Moment lang eingehend. »William hat ein wenig übertrieben, was deine Fähigkeiten als Stratege angeht. Daran wirst du noch arbeiten müssen. Du weißt, was vor uns liegt, und du weißt zudem, dass du dich, wenn der Kampf einmal begonnen hat, dort draußen mit Hunderten von Männern wiederfinden wirst, deren Leben in deiner Hand liegt. Ein alter Isalani-General hat das einst den ›Nebel der Schlacht‹ genannt, und Männer, die anderen das Leben erhalten können, während um sie herum das Chaos ausbricht, sind ausgesprochen rar.«
Erik konnte nur nicken. Er und die anderen, die mit Calis unterwegs gewesen waren, hatten die Armee der Smaragdkönigin gesehen, waren sogar eine Zeitlang ein Teil davon gewesen. Wenn dieses Heer angeheuerter Meuchelmörder an der Küste des Königreichs erschiene, wäre tatsächlich großes Chaos die Folge. Und inmitten dieses Chaos würden nur gut ausgebildete, disziplinierte und harte Männer überleben. Und das Schicksal des Königreichs – und des Rests der Welt von Midkemia – würde von diesen Männern abhängen und nicht von traditionellen Armeen.
»Sehr wohl, Hauptmann«, sagte Erik. »Ich nehme an.«
Calis lächelte und legte Erik die Hand auf die Schulter. »Du hättest auch keine Wahl gehabt, Hauptfeldwebel. Als Nächstes wirst du ein paar Männer befördern müssen. Wir brauchen dieses Jahr noch einen Feldwebel und ein halbes Dutzend Korporäle.«
»Alfred aus Düstermoor«, platzte Erik heraus. »Er war schon Korporal und ein ziemlicher Schinder dazu, bis ich ihn mir vorgenommen habe. Er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, doch im Herzen ist er immer noch ein Raufbold, und solche Männer werden wir brauchen, wenn die Zeit gekommen ist.«
»Damit hast du recht«, bestätigte Calis. »Was das betrifft, sollte jeder von ihnen ein ausgesprochener Raufbold sein.«
»Ich denke, wir haben ausreichend Männer, die zum Korporal taugen. Ich werde heute Abend eine Liste aufstellen.«
Calis nickte. »Ich muss noch mit Patrick sprechen, bevor sich die Sache hier zu einem richtigen Empfang auswächst. Entschuldige mich.«
Als Calis gegangen war, kehrte Erik zu Roo zurück, und der fragte ihn: »Na, bist du befördert worden oder Jadow?«
»Ich«, antwortete Erik.
»Meinen Glückwunsch«, gratulierte Roo. Dann grinste er und schlug seinem Freund herzlich auf die Schulter. »Hauptfeldwebel.«
»Was ist nun mit dir?«, fragte Erik. »Du wolltest mir doch gerade erzählen, wie es bei euch zu Hause steht.«
Roo lächelte schwach und zuckte mit den Schultern. »Karli hat mir immer noch nicht verziehen, dass ich ihr nur eine kurze Mitteilung geschickt habe, als ich aufgebrochen bin, um euch zurückzuholen, und sie hat recht: Die Kinder erkennen mich nicht mehr, wenngleich Abigail mich Papa nennt und Helmut mich schüchtern angrinst.« Er seufzte. »Ehrlich gesagt bin ich von Helen Jacoby herzlicher begrüßt worden.«
»Nun, nach allem, was du mir erzählt hast, steht sie tief in deiner Schuld. Du hättest sie und ihre Kinder auch auf die Straße setzen können.«
Roo kaute auf einem Stück Obst. »Eigentlich nicht. Ihr Ehemann hatte mit dem Mord an meinem Schwiegervater nichts zu tun.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Jason, Duncan und Luis haben während meiner Abwesenheit sehr gut auf mein Unternehmen aufgepasst, und meine Partner bei der Bittermeer-Handelsgesellschaft haben mich nicht allzu sehr ausgenommen.« Er grinste. »Zumindest habe ich dafür noch keinen Hinweis gefunden.« Sein Gesicht nahm wieder einen ernsten Ausdruck an. »Und ich weiß auch, dass diese Armee, von der ihr der wichtigste Teil sein werdet, Proviant, Waffen und Rüstungen braucht. Und die sind nicht billig.«
Erik nickte. »Ich habe nur eine schwache Ahnung davon, wie wir der Smaragdkönigin begegnen werden, und da wir nie in der Lage sein werden, eine ähnlich große Streitmacht wie die ihre ins Feld zu führen, müssen wir einen Feldzug starten, wie man ihn seit dem Spaltkrieg nicht mehr gesehen hat, einen, wie es ihn noch nie gegeben hat.«
»Wie viele Männer werden dann unter Waffen stehen?«
»Das kann ich nur schätzen«, erwiderte Erik. »Doch zumindest sollten es fünfzig- oder sechzigtausend Männer mehr sein, als die gegenwärtigen Armeen des Ostens und des Westens aufbieten.«
»Dann wären es ja fast hunderttausend Mann!«, staunte Roo. »Haben wir so viele?«
»Nein.« Erik schüttelte den Kopf. »Wir haben zwanzigtausend in allen Armeen des Westens, die zehntausend Mann unter dem Befehl des Prinzen eingeschlossen. Die Armeen des Ostens sind die größten, aber einige von ihnen sind nur Ehrengarnisonen. Da jetzt schon so lange Frieden mit Roldem herrscht, ist es in den östlichen Königreichen ruhig, denn niemand wird es wagen, uns ohne Roldem auf seiner Seite zu reizen.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich habe zu oft mit Lord William über Strategie geplaudert, glaube ich … Wir müssen jetzt beginnen, uns für die Schlacht zu rüsten.« Mit einem Kopfschütteln fügte er leise hinzu: »Auf unserer letzten Reise nach Novindus haben wir zu viele unserer wichtigsten Männer verloren.«
Roo nickte. »Wir haben eine ganz schöne Rechnung mit der grünen Hure zu begleichen.« Dann seufzte er. »Und es wird nicht billig, das zu finanzieren.«
Erik lächelte. »Unser Herzog greift dir in die Tasche?«
Roo erwiderte das Lächeln. »Bis jetzt noch nicht. Doch er hat mir zu verstehen gegeben, dass die Steuern erträglich bleiben sollen, indem er sich von mir den größten Teil des Geldes für den bevorstehenden Krieg leihen will, und auch Jacob Esterbrook und die anderen will er davon überzeugen, dass sie aushelfen.«
Bei der Erwähnung von Esterbrook musste Roo abermals an dessen Tochter Sylvia denken, die seit nun fast einem Jahr seine Geliebte war. Er hatte sie nach der Rückkehr aus Novindus erst einmal gesehen und beabsichtigte, sie an diesem Abend zu besuchen; er sehnte sich nach ihr.
»Ich glaube, ich sollte mich bald einmal bei Jacob sehen lassen«, meinte er, als wäre ihm das gerade erst in den Sinn gekommen. »Wenn wir beide uns einverstanden erklären, den Krieg mitzufinanzieren, wird sich kein anderer Mann von Einfluss dem Ersuchen des Prinzen widersetzen.« Und er fügte noch hinzu: »Außerdem, sollte die Sache schiefgehen, wird die Rückzahlung unserer Darlehen unsere kleinste Sorge sein. Wenn wir uns dann überhaupt noch über irgendetwas Sorgen machen können.«
Erik nickte. Er musste zugeben, dass sich Roo weit besser mit Finanzangelegenheiten auskannte als er, seinem phänomenalen Erfolg nach sogar besser als die meisten anderen Geschäftsleute des Königreichs.
»Ich sollte mich beim Prinzen entschuldigen und mich um meine Geschäfte kümmern«, fuhr Roo fort. »Vermutlich werden jene von uns, die nicht zum inneren Kreis der Militärexperten gehören, sowieso bald entlassen.«
Erik nahm seine Hand. »Ich denke, du hast recht.«
Andere Adlige, die ebenfalls nicht zum Militär gehörten, verabschiedeten sich gerade vom Prinzen, und Roo reihte sich bei ihnen ein. Bald waren nur noch der Prinz, seine engsten Berater und die Mitglieder des Militärs anwesend.
Als Owen Greylock eintrat, verkündete Patrick: »Jetzt sind wir vollzählig.«
Marschall William bat alle mit einer Geste zu einem runden Tisch im hinteren Teil des Raums. Herzog James setzte sich rechts neben den Prinzen, William links daneben.
Es war der Herzog, der als Erster das Wort ergriff. »Nun, da das Gepränge vorbei ist, können wir uns wieder der vermaledeiten Aufgabe widmen, die vor uns liegt.«
Erik lehnte sich zurück und hörte zu, wie die Pläne für die letzte Verteidigung des Königreichs Form annahmen.
Roo ging zum Tor, wo sein Pferd wartete. Er hatte die Kutsche seiner Frau überlassen, denn seine Familie wohnte mittlerweile auf einem Anwesen vor den Toren der Stadt. Während er das Stadthaus bevorzugte, das gegenüber von Barrets Kaffeehaus lag, wo er den größten Teil seines Arbeitstages verbrachte, bot das Landhaus eine Ruhe, die er sich vor dem Umzug gar nicht hatte vorstellen können. Er konnte jagen, wenn ihm danach war, oder fischen, er konnte all die Annehmlichkeiten in Anspruch nehmen, die Adligen oder reichen Bürgern vorbehalten waren. Bald würde er sich etwas Zeit gönnen, um diese Vergnügungen zu genießen.
Mit noch nicht dreiundzwanzig Jahren war Roo Avery bereits Vater von zwei Kindern und einer der reichsten Geschäftsmänner des Königreichs. Zudem war er in Geheimnisse eingeweiht, die nur den wenigsten zugänglich waren. Das Landhaus war zudem ein Ort, wo seine Familie einigermaßen sicher war, wenn die bevorstehende Invasion begann und der Mob aus der Stadt fliehen und alles niedertrampeln würde, was ihm in den Weg geriet. Roo war beim Fall von Maharta dabei gewesen, jener fernen Stadt, die vor drei Jahren von den Armeen der Smaragdkönigin zerstört worden war. Er hatte sich durch das Gewühl panischer Bürger drängen müssen, hatte mit angesehen, wie Unschuldige starben, nur weil sie sich am falschen Ort aufgehalten hatten. Damals hatte er sich geschworen, seinen Kindern dieses Entsetzen zu ersparen, mochte da kommen, was wolle.
Vor Jahren schon hatte man ihm und dem Rest von Calis’ Kompanie an der Küste des fernen Landes namens Novindus erklärt, dass, sollte das Königreich der Inseln nicht den Sieg davontragen, alles Leben auf Midkemia vernichtet werden würde. Im tiefsten Innern konnte er sich noch immer nicht mit dem Gedanken abfinden, aber er traf die entsprechenden Vorbereitungen. Er hatte auf seiner Reise in den Süden zu viel gesehen und wusste daher, dass ihnen unter dem Joch der Armeen der Smaragdkönigin nur die Wahl zwischen Tod und Sklaverei bleiben würde, selbst wenn sich die Behauptungen des Hauptmanns als übertrieben herausstellen sollten. Sollte die angreifende Armee ein den Verteidigern unbekanntes Ziel ins Auge fassen, wären auch jegliche Vorsichtsmaßnahmen vergebens. Trotzdem war er entschlossen, alles zu tun, um seine Frau und seine Kinder vor jeder Gefahr zu schützen.
Er hatte ein Haus in Salador gekauft, das gegenwärtig von einem seiner Vertreter bewohnt wurde, der seine Geschäfte im Östlichen Reich leitete, und er würde vermutlich ein weiteres in Ran kaufen, an der Ostgrenze des Königreichs. Zusätzlich würde er in Kürze einen ausländischen Makler aufsuchen, um möglicherweise im fernen Roldem, jenem Inselkönigreich, das der engste Verbündete des Königreichs der Inseln war, Grund und Boden zu erwerben.
Als er aus diesen Gedanken auftauchte, bemerkte er, dass er schon auf halbem Weg zu seinem Geschäft war. Karli hatte er gesagt, er würde die Nacht im Stadthaus verbringen, weil ihn die Angelegenheiten im Palast angeblich zwängen, bis spät in die Nacht zu arbeiten. In Wahrheit jedoch wollte er Sylvia Esterbrook eine Nachricht schicken und anfragen, ob sie sich am Abend sehen könnten. Seit er zurückgekehrt war, hatte er kaum an etwas anderes denken können als an sie. Die Bilder ihres Körpers spukten durch seine Träume, und die Erinnerung an ihren Duft und ihre weiche Haut verdrängten all die wichtigeren Dinge aus seinem Kopf. Eine einzige Nacht hatte er nach seiner Rückkehr mit ihr verbracht, und diese hatte seine Sehnsucht eher noch angestachelt.
Er erreichte sein Geschäft und ritt durchs Tor, an Arbeitern vorbei, die dort Umbauten vornahmen, die er nach seiner Seereise als Erstes angeordnet hatte. Dem alten Lagerhaus wurde ein zweites Stockwerk aufgesetzt, eigentlich mehr ein Dachgeschoss, wo er seinen Geschäften nachgehen konnte, ohne von der Betriebsamkeit im Lagerhaus gestört zu werden. Die Zahl seiner Angestellten wuchs, und er brauchte mehr Platz. Er hatte bereits ein Angebot für ein Grundstück gemacht, das an die Hinterseite seines eigenen angrenzte. Die alten Wohnungen dort, in denen noch Arbeiter und ihre Familien lebten, würde er abbrechen und neue Geschäftsräume bauen lassen. Für das Grundstück hatte er zu viel gezahlt, das wusste er, doch er brauchte dringend mehr Platz.
Er stieg vom Pferd, winkte einen seiner Arbeiter zu sich und überließ ihm das Tier. »Gib ihm etwas Heu, keinen Hafer«, unterwies er den Mann, während er an den Fuhrwerken, die be- oder entladen wurden, vorbeiging. »Dann sattelst du ein anderes Pferd und hältst es für mich bereit.«
Der Lärm im Lagerhaus war ohrenbetäubend, überall wurde gehämmert, wurden gebrochene Räder repariert oder Pferde neu beschlagen.
Die Aufsicht über dieses Durcheinander lag in den Händen zweier Männer, Luis de Savona, Roos Gefährten aus den frühen Tagen von Calis’ »Kompanie zu allem bereiter Männer«, und Jason, der einst Kellner in Barrets Kaffeehaus gewesen war und wie kein anderer mit Zahlen jonglieren konnte.
Roo lächelte. »Wo ist Duncan?«
Luis zuckte mit den Schultern. »Vermutlich mit irgendeiner Hure im Bett.«
Es war Mittag, und Roo schüttelte den Kopf. In mancher Hinsicht konnte er sich auf seinen Cousin verlassen, doch in anderen Angelegenheiten zeigte dieser einfach kein Pflichtgefühl. Dennoch, auf dieser Welt gab es nur wenige Männer, denen Roo in einem Kampf blind die Deckung seines Rückens anvertrauen würde, und Duncan war einer davon.
»Was gibt’s Neues?«, fragte Roo.
Jason hielt ihm ein Dokument hin. »Unser Ersuchen, eine regelmäßige Handelsverbindung nach Groß-Kesh aufzubauen, wird ›bedacht‹, wie es so schön in diesem wortreichen Schreiben des Handelsgesandten von Kesh heißt. Wir sollen gelegentlich mitbieten, wenn wir auf Ausschreibungen aufmerksam werden.«
»Hat er das geschrieben?«
»In nicht ganz so wenigen Worten«, erwiderte Luis.
»Wo wir doch Jacoby und Söhne übernommen haben, dachte ich, wir würden regelmäßig Aufträge von ihnen bekommen.«
»Bekommen wir auch«, meinte Jason, »nur nicht von den Kaufleuten aus Kesh.« Er schüttelte den Kopf, und sein junges Gesicht wurde feierlich. »Nachdem bekannt geworden ist, dass du für Helen Jacoby das Geschäft führst, hat sich jeder Kaufmann aus Kesh so schnell wie möglich aus den Verträgen mit uns zurückgezogen.«
Roo runzelte die Stirn. Er tippte sich mit dem Finger ans Kinn und fragte: »Wer hat diese Verträge bekommen?«
»Esterbrook«, antwortete Luis. Roo drehte sich zu seinem alten Freund um, und der fuhr fort: »Jedenfalls die Gesellschaften, an denen er Anteile hält, oder Gesellschaften, auf deren Besitzer er großen Einfluss hat. Du weißt doch, er hat viele Geschäfte mit den Jacobys gemacht, bevor du mit ihnen abgerechnet hast.«
Roo blickte Jason an. »Was hast du herausgefunden, als du die Konten der Jacobys geprüft hast?«
Während Roo auf See gewesen war, hatte Jason diese Konten eingehend geprüft. Roo hatte Randolph und Timothy Jacoby getötet, als diese versucht hatten, sein Geschäft zu ruinieren, und anstatt Randolphs Ehefrau Helen auf die Straße zu setzen, hatte er ihr vorgeschlagen, Jacoby und Söhne für sie zu führen.
»Welche Geschäfte Esterbrook und Jacoby auch immer gemacht haben mögen, es gibt darüber nur wenige Belege. Ein paar kleinere Verträge, doch nichts Außergewöhnliches, nur ein paar gelegentliche persönliche Notizen, die für mich keinen Sinn ergeben. Aber eine Sache passt nicht ins Bild.«
»Und die wäre?«, fragte Roo.
»Die Jacobys waren zu reich. Sie hatten in verschiedenen Kontoren sehr viel Geld, und ich weiß nicht, wo es herkam. Manche dieser Konten bestehen schon zehn Jahre«, Jason deutete auf einen Stapel Hauptbücher, »doch ich konnte keine Quelle dafür finden.«
Roo nickte. »Schmuggel.« Er erinnerte sich an seine erste Auseinandersetzung mit Tim Jacoby, in der es um einen Ballen geschmuggelter Seide gegangen war, die Roo in seinen Besitz gebracht hatte. »Wie viel Gold?«
»Mehr als dreißigtausend Goldsovereigns«, antwortete Jason, »und ich habe noch nicht jeden Betrag aufgespürt.«
Roo dachte einen Augenblick lang schweigend nach. »Kein Sterbenswort zu irgendjemandem. Wenn du, aus welchem Grund auch immer, mit Helen Jacoby sprichst, sag ihr einfach nur, die Geschäfte würden besser laufen als erwartet. Bleib vage, verrat ihr nur genug, damit sie weiß, dass ihre Kinder ein Leben lang versorgt sein werden, egal, was mir zustoßen sollte. Und frag sie, ob sie irgendetwas braucht.«
»Willst du dich nicht mit ihr treffen?«, fragte Luis.
»Bald.« Roo sah sich um. »Wir brauchen mehr Mittel, also schaut euch nach Geschäften um, die wir kaufen können, und übernehmt sie sofort. Aber in aller Stille. Wenn ihr den Namen Avery und Sohn oder die Bittermeer-Handelsgesellschaft ins Spiel bringt, werden die Preise schneller steigen als eine Springflut.« Die anderen nahmen die Anweisungen zur Kenntnis, und Roo fuhr fort: »Ich gehe als Nächstes zu Barret, um meine Partner zu treffen, und falls ich hier gebraucht werde, findet ihr mich für den Rest des Tages dort.«
Roo ließ seine Gefährten allein und bestieg das frische Pferd. Während er noch über die Neuigkeiten nachdachte, war er schon bei Barrets Kaffeehaus angekommen.
Roo stieg ab und warf die Zügel einem der bereitstehenden Kellner zu. Er zog eine Silbermünze aus der Weste und gab sie dem Jungen. »Bring es in den Stall hinter meinem Haus, Richard.«
Lächelnd führte der junge Mann das Pferd davon. Roo hatte die Angewohnheit, sich alle Namen der Angestellten von Barret zu merken und stattliche Trinkgelder zu geben. Er hatte selbst noch vor drei Jahren hier gearbeitet und wusste, wie anstrengend die Arbeit sein konnte. Seine Großzügigkeit, wenn er die Dienste der Kellner brauchte, weil er eine Nachricht überbringen lassen wollte oder für einen seiner Partner eine ausgefallene Mahlzeit bestellte, wurde mit der raschen Erledigung seiner Aufträge belohnt.
Roo ging durch die erste Schranke, wo ein anderer Kellner ihm das Tor aufhielt, und stieg die Treppe nach oben zur Galerie im ersten Stock. Seine Partner, Jerome Masterson und Stanley Hume, warteten bereits auf ihn. Er nahm Platz. »Meine Herren?«
»Rupert!«, rief Jerome. »Einen wunderbaren Morgen wünsche ich.«
Hume begrüßte ihn ebenfalls, und dann gingen sie die anstehenden Geschäfte der Bittermeer-Handelsgesellschaft durch, der größten des Königreichs der Inseln.
Die Warnung
Erik schäumte vor Wut.