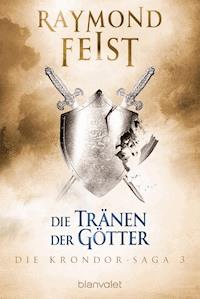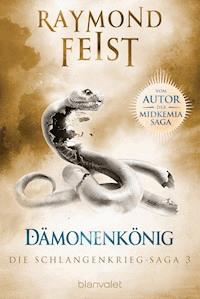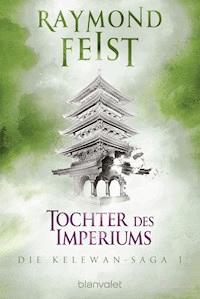
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DIE KELEWAN-SAGA
- Sprache: Deutsch
Im Reich Tsurani steht die junge Mara kurz vor einem entscheidenden Moment in ihrem Leben. Nur noch wenige Gongschläge trennen sie von ihrer offiziellen Aufnahme ins Kloster, wo sie den Rest ihres Lebens verbringen wird. Doch dann erfährt sie, dass ihr Vater und Bruder im Kampf getötet wurden und sie das neue Oberhaupt des Hauses Acoma ist. Unterstützt von einigen treuen Soldaten und Dienern muss sie sich der fast unmöglichen Herausforderung stellen – denn ihre Herrschaft wird von feindlichen Adelshäusern bedroht und Mara muss ein großes Opfer bringen um das Haus Acoma zu alter Macht zurückzuführen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Raymond Feist und Janny Wurts
Die Kelewan-Saga I
Tochter des Imperiums
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Gerold
Das Buch
Im Reich Tsurani steht die junge Mara kurz vor einem entscheidenden Moment in ihrem Leben. Nur noch wenige Gongschläge trennen sie von ihrer offiziellen Aufnahme ins Kloster, wo sie den Rest ihres Lebens verbringen wird. Doch dann erfährt sie, dass ihr Vater und Bruder im Kampf getötet wurden und sie das neue Oberhaupt des Hauses Acoma ist. Unterstützt von einigen treuen Soldaten und Dienern muss sie sich der fast unmöglichen Herausforderung stellen – denn ihre Herrschaft wird von feindlichen Adelshäusern bedroht und Mara muss ein großes Opfer bringen um das Haus Acoma zu alter Macht zurückzuführen.
Der Autor
Raymond Feist wurde 1945 in Los Angeles geboren und lebt in San Diego im Süden Kaliforniens. Viele Jahre lang hat er Rollenspiele und Computerspiele entwickelt. Aus dieser Tätigkeit entstand auch die fantastische Welt Midkemia seiner Romane. Die in den 80er Jahren begonnene Saga ist bereits ein Klassiker des Fantasy-Genres, und Feist gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Fantasy in der Tradition Tolkiens.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Daughter of the Empire« bei Doubleday, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe Juni 2016 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München Dieser Roman erschien bisher in zweigeteilter Ausgabe unter den Titeln »Die Auserwählte« und »Die Stunde der Wahrheit« Deutsche Erstveröffentlichung © 1998 bei Verlagsgruppe Random House GmbH, München Copyright © der Originalausgabe 1987 by Raymond Elias Feist
Dieses Buch ist intiefempfundener Wertschätzung
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den Personen bedanken, die auf irgendeine Weise – absichtlich oder nicht – zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben. Wir verdanken ihnen viel:
Der »Freitagnacht-Runde«, deren Begeisterung für Spiele R.E.E auf viele interessante Ideen brachte, die in zwei Welten eingeflossen sind, und den Autoren jener Spiele, vor allem denen bei Midkemia Press.
Kyung und Jon Conning, die in ihrem Heim in Korea für J.W den roten Teppich ausgerollt haben und auf diese Weise dem Buch zu bedeutend mehr Farbigkeit verholfen haben.
Virginia Kidd, die es für J.W leichtmachte, ja zu sagen, und deren Freundschaft und weise Ratschläge uns viele Jahre begleitet haben.
Unseren Lektoren Adrian Zackheim, mit dem alles begann, und Jim Moser, der die Sache mit uns zu Ende gebracht hat.
Richard C. Freese, der viel mehr als einfach nur seine Pflicht getan hat.
Elaine Chubb, die für unser gutes Aussehen gesorgt hat.
Daniel P. Mannix IV, der uns gezeigt hat, was es heißt, Schriftsteller zu sein, und uns einen wunderbaren Platz zum Arbeiten verschafft hat (ungeachtet der Enten).
Und Barbara A. Feist, die es mit einem von uns aushält.
Frazer, PennsylvaniaJuni 1986
Raymond E. Feist
Eins
Lady
Der Priester schlug den Gong.
Der Klang strömte durch die mit herrlichen Schnitzereien in den unterschiedlichsten Farben verzierte Kuppel des Tempels; sein Echo wurde von der Wölbung hin und her geworfen und verhallte schließlich ganz, bis nichts mehr übrig blieb außer der geisterhaften Erinnerung an einen einzelnen Ton.
Mara kniete auf den kalten Stufen des Tempels, die ihrem Körper jede Wärme zu entziehen schienen. Sie zitterte, wenn auch nicht vor Kälte, und warf einen flüchtigen Blick nach links, wo ein anderes Mädchen in ähnlicher Pose wartete; genau wie Mara erhob sie jetzt die weiße Kopfbedeckung einer Novizin des Ordens von Lashima, Göttin des Inneren Lichts. Der wie ein Zelt über ihrem Kopf drapierte Stoff zwang sie zu einer unangenehmen Haltung, und Mara konnte kaum den Augenblick erwarten, da sie die Kopfbedeckung würde herunter lassen und befestigen können. Obwohl sie das Ding erst ein kleines Stück erhoben hatte, schien es ihr bereits, als zerrte der Stoff wie Steingewichte an ihren Armen! Der Gong erklang wieder. Er erinnerte Mara an die ewigwährende Gegenwart der Göttin, und sie zuckte wegen ihrer respektlosen Gedanken innerlich zusammen. Gerade jetzt durfte ihre Aufmerksamkeit nicht nachlassen. Still bat sie die Göttin um Vergebung, flehte um Ruhe und Stärke; Müdigkeit und Aufregung hatten sich inzwischen mit Besorgnis gemischt. Mara betete zu ihr, um durch sie den inneren Frieden zu erhalten, den sie so inbrünstig herbeisehnte.
Wieder dröhnte der Gong. Es war der Dritte von insgesamt zweiundzwanzig Schlägen; zwanzig für die Götter, einer für das Licht des Himmels und einer für die unvollkommenen Kinder, die jetzt darauf warteten, in den Dienst der Göttin der Weisheit des Oberen Himmels zu treten. Mit siebzehn Jahren stand Mara kurz davor, dem weltlichen Dasein zu entsagen und – nach neunzehn weiteren Gongschlägen – das Mädchen links von ihr Schwester zu nennen, obwohl sie sich vor zwei Wochen zum ersten Mal begegnet waren.
Mara betrachtete ihre zukünftige Schwester: Ura war ein übellauniges Mädchen aus einer clanlosen, aber wohlhabenden Familie aus der Provinz Lash, während Mara zu einer alten und mächtigen Familie gehörte, den Acoma. Uras Beitritt war von ihrem Onkel befohlen worden, der sich selbst zum Familienoberhaupt ernannt hatte und dem es einzig darum ging, dass seine Familie in einen Clan – welchen auch immer – aufgenommen wurde. Uras Eintritt in den Orden war eine öffentliche Demonstration der Frömmigkeit ihrer Familie. Mara dagegen hatte sich beinahe ihrem Vater widersetzt, nur um von dem Orden aufgenommen zu werden. Als die beiden Mädchen zum ersten Mal ihre persönlichen Geschichten ausgetauscht hatten, war Ura zunächst ungläubig gewesen, hatte sich dann jedoch beinahe darüber empört, dass die Tochter eines so mächtigen Herrn hinter den Mauern eines Ordens ewigen Schutz suchte. Maras Herkunft garantierte ihr eine angesehene Stellung innerhalb ihres Clans, mächtige Verbündete, eine Reihe gutsituierter Freier und die Gewissheit, eines Tages den Sohn eines anderen mächtigen Hauses zu heiraten. Ura dagegen wurde ein solches Opfer abverlangt, damit in späteren Generationen ihrer Familie den Mädchen einmal all das zur Verfügung stehen würde, was Mara zurückweisen wollte. Nicht zum ersten Mal stellte Mara sich die Frage, ob Ura als Dienerin dieses Ordens wirklich geeignet war. Aber wie jedes Mal, so zweifelte sie auch jetzt an ihrer eigenen Eignung für die Schwesternschaft.
Ein weiterer voller, tiefer Ton erklang. Mara schloss einen Augenblick die Augen; sie erbat Trost und Rat von der Göttin. Wieso wurde sie immer noch von Zweifeln geschüttelt? Nach achtzehn weiteren Schlägen würde sie ihre Familie, ihre Freunde und das gesamte, vertraute Leben für immer verloren haben. Ihr ganzes Leben würde dann weit hinter ihr liegen, angefangen von den frühen Spielen ihrer Kindheit bis zu den Sorgen der vornehmen Tochter – über die Rolle, die ihre Familie in dem Spiel des Rates innehatte, oder über den niemals endenden Kampf um Macht und Einfluss, der das gesamte Leben der Tsurani beherrschte. Ura würde ihre Schwester werden, egal, wie groß die Unterschiede ihrer Herkunft auch sein mochten, denn in dem Orden Lashimas gab es keinen Raum für persönliche Ehre oder Familiennamen. Übrigbleiben würde nur ihr Dienst gegenüber der Göttin – ein Dienst, der Keuschheit und Gehorsamkeit verlangte.
Wieder ertönte der Gong, nunmehr zum fünften Mal. Mara warf einen verstohlenen Blick auf das Podest mit dem Altar. Eingerahmt von geschnitzten Bögen knieten sechs Priester und Priesterinnen vor der Statue Lashimas, deren Antlitz wegen der Zeremonie unverhüllt war. Die Morgendämmerung fiel durch spitzbögige Fenster hoch oben in der Kuppel und griff mit Fingern aus blassen Strahlen in das Innere des dunklen Tempels. Es war wie eine Liebkosung, als die aufgehende Sonne die Göttin berührte und das juwelenähnliche Funkeln der für die Zeremonie notwendigen Kerzen um sie herum milderte. Wie freundlich die Lady in der Morgenröte aussieht, dachte Mara. Die Göttin der Weisheit blickte mit einem sanften Lächeln auf den fein geschnittenen Lippen herab, als würde alles, was unter ihrer Fürsorge stand, geliebt und beschützt werden und inneren Frieden finden. Mara betete inbrünstig, dass es wahr sein möge. Nur ein einziger Priester kniete nicht; es war derjenige, der jetzt wieder den Gong schlug. Sonnenstrahlen trafen auf das Metall, eine Explosion von goldenem Licht vor dem dunklen Vorhang, der den Eingang zum inneren Tempel verbarg. Dann, als das blendende Funkeln wieder verschwunden war, ertönte der Gong ein weiteres Mal.
Noch fünfzehnmal würde er erklingen. Mara biss sich auf die Lippe, sie war sicher, dass die Göttin eine kurze Verfehlung verzeihen würde. Ihre Gedanken blitzten jäh auf wie das Licht in einem zerbrochenen Kristallstück, tanzten mal hierhin, mal dorthin, niemals länger an einem Ort verweilend. Ich eigne mich nicht gut für die Schwesternschaft, bekannte Mara innerlich und starrte an der Statue empor. Bitte, habe Geduld mit mir, Herrin des Inneren Lichts. Wieder warf sie einen Blick auf ihre Kameradin; Ura verhielt sich still und ruhig, ihre Augen waren geschlossen. Mara zwang sich, ihr Verhalten nachzuahmen, auch wenn sie die entsprechende innere Ruhe nicht finden konnte. Wieder erklang der Gong.
Mara suchte den verborgenen Mittelpunkt ihres inneren Seins, das Wallum, und bemühte sich, ihre Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Es gelang ihr einige Minuten. Dann riss ein erneuter Gongschlag sie abrupt in die Gegenwart zurück. Mara verlagerte ein wenig ihr Gewicht, unterdrückte die aufkommende Gereiztheit, als sie versuchte, den Schmerz in ihren Armen etwas zu lindern. Sie ignorierte das Bedürfnis, tief aufzuseufzen. Die innere Ruhe, die sie während ihrer Ausbildungszeit zur Novizin bei den Schwestern erlernt hatte, entglitt ihr wieder, obwohl sie bereits sechs Monate am Ordensleben teilgenommen hatte, bevor sie der Prüfung durch die Priester des Hohen Tempels in der Heiligen Stadt für würdig erachtet worden war.
Wieder wurde der Gong geschlagen, und der Klang erinnerte mit seiner Kraft an das Horn, das den Kriegern der Acoma das Zeichen gegeben hatte, sich in Kampfformation aufzustellen. Wie kühn sie in ihren grünlackierten Rüstungen ausgesehen hatten, damals, als sie mit den Truppen des Kriegsherrn in die Schlacht gezogen waren – besonders die Offiziere mit den stattlichen Federbüschen. Mara war besorgt über die Entwicklung des Krieges in der barbarischen Welt, wo ihr Vater und ihr Bruder kämpften. Beinahe sämtliche Streitkräfte der Familie waren dort gebunden. Der Clan war in seiner Loyalität im Hohen Rat gespalten, und da keine Familie eindeutig dominierte, trugen die Acoma die Last blutiger Politik. Die Familien des Hadama-Clans waren nur dem Namen nach vereinigt, und ein Verrat der Acoma durch einen entfernten Cousin, der nach der Gunst der Minwanabi trachtete, war nicht völlig ausgeschlossen. Hätte Mara eine Stimme im Rat ihres Vaters besessen, sie hätte auf Trennung von der Kriegspartei gedrängt, möglicherweise sogar auf eine Allianz mit der Partei des Blauen Rades, die vortäuschte, nur am Handel Interesse zu haben, während sie in aller Stille daran arbeitete, die Macht des Kriegsherrn einzuschränken …
Mara runzelte die Stirn. Wieder waren ihre Gedanken zu weltlichen Sorgen abgeschweift. Sie entschuldigte sich bei der Göttin dafür, dann drängte sie die Gedanken an die Welt, die sie hinter sich lassen würde, zurück.
Mara schaute sich verstohlen um, als der Gong erneut ertönte. Das steinerne Antlitz der Göttin schien jetzt einen leisen Tadel zu zeigen; Tugend begann in jedem einzelnen Menschen, erinnerte sie sich. Hilfe würde nur denen widerfahren, die wirklich nach Erleuchtung suchten. Mara senkte die Augen.
Der Gong hallte durch den Tempel, und ein anderes Geräusch mischte sich in das ersterbende Zittern des Klangs – eine Störung, die ganz und gar nicht hierher gehörte. Sandalen schlurften über den Steinboden des Vorraumes, begleitet vom gedämpften Klirren von Waffen und Rüstungen. »Haltet ein, Krieger! Ihr dürft jetzt nicht in den Inneren Tempel! Es ist verboten!«, forderte der wachhabende Priester jenseits des Vorhangs in energischem Flüsterton.
Mara erstarrte. Der fröstelnde Schauer einer Vorahnung durchströmte sie. Unter dem Schutz der aufgetürmten Kopfbedeckung hindurch sah sie, wie die Priester und Priesterinnen auf dem Podest sich beunruhigt erhoben. Sie wandten sich dem Eindringling zu, und der Gong verfehlte seinen Takt und verstummte.
Der Hohe Vater bewegte sich entschlossen auf den Vorhang zu, die Stirn argwöhnisch gerunzelt. Mara kniff ihre Augen fest zusammen. Wenn sie nur die Welt da draußen ebenso einfach in Dunkelheit tauchen könnte, dann würde niemand sie finden. Doch das Geräusch der Schritte brach ab, und stattdessen erklang die Stimme des Hohen Vaters. »Aus welchem Grund begeht Ihr einen solchen Frevel, Krieger! Ihr verletzt einen heiligen Ritus.«
Jetzt sprach eine andere Stimme. »Wir suchen die Lady der Acoma!«
Die Lady der Acoma. Die Worte schnitten durch Maras Seele, als würde ihr ein kaltes Messer mitten in den Bauch gestoßen. Dieser eine Satz würde ihr Leben für immer verändern. Ihre Gedanken begehrten auf, leugneten trotzig, doch sie zwang sich, ruhig zu bleiben. Niemals würde sie ihre Ahnen durch eine öffentliche Zurschaustellung ihrer Trauer beschämen. Mühsam brachte sie ihre Stimme unter Kontrolle, während sie langsam aufstand. »Ich bin hier, Keyoke.«
Als wären sie eins, starrten die Priester und Priesterinnen auf den Hohen Vater, der jetzt vor Mara trat. Die gestickten Symbole auf seiner Amtsrobe blitzten auf, als er eine Priesterin zu sich winkte. Dann blickte er in Maras Augen und sah den Schmerz, den sie verborgen hielt. »Tochter, es ist offensichtlich, dass Unsere Herrin der Weisheit einen anderen Weg für Euch bestimmt hat. Geht mit ihrer Liebe und Barmherzigkeit, Lady der Acoma.« Er verbeugte sich leicht.
Mara verneigte sich ebenfalls, dann reichte sie der Priesterin die Kopfbedeckung. Sie bemerkte Uras neidischen Seufzer nicht, als sie sich schließlich dem Überbringer jener Botschaft zuwandte, die ihr Leben verändert hatte.
Gleich auf der anderen Seite des Vorhangs stand Keyoke, Kommandeur der Acoma, und betrachtete seine Herrin mit müden Augen. Er war ein von vielen Schlachten gezeichneter alter Krieger, aufrecht und stolz trotz der vierzig Jahre, die er bereits in treuem Dienst stand. Er wartete, bereit, an die Seite des Mädchens zu eilen, ihr seinen stützenden Arm anzubieten, sie möglicherweise gar vor den Augen der Öffentlichkeit zu schützen, sollte der Druck zu groß für sie sein.
Armer, stets treuer Keyoke, dachte Mara. Es war auch für ihn nicht einfach gewesen. Sie würde ihn nicht dadurch enttäuschen, dass sie ihre Familie beschämte. Im Angesicht der Tragödie bewahrte sie die Haltung und Würde, die von der Herrin eines großen Hauses erwartet wurde.
Keyoke verbeugte sich, als seine Herrin sich näherte. Groß und schweigsam stand Papewaio hinter ihm, sein Gesicht wie immer eine unlesbare Maske. Als stärkster Krieger im Gefolge der Acoma diente er Keyoke nicht nur als Kamerad, sondern auch als persönlicher Diener. Er verbeugte sich ebenfalls und hielt den Vorhang auf, als Mara an ihnen vorbeischritt.
Mara hörte, wie sie rechts und links von ihr folgten, Papewaio einen Schritt zurück, bis ins letzte Detail durch und durch kokett. Wortlos führte sie die beiden fort vom inneren Tempel, unter das Dach des Gartenhofes, der den inneren vom äußeren Tempel trennte. Sie betraten den äußeren Tempel, passierten die riesigen Sandsteinsäulen, auf denen das Dach ruhte. Sie schritten an der langen Halle entlang, vorbei an den wunderbaren Fresken, die von den Taten der Göttin Lashima erzählten. In dem verzweifelten Bemühen, den Schmerz, der sie zu überwältigen drohte, zu unterdrücken, rief Mara die Geschichte jedes einzelnen Bildes in Erinnerung: wie die Göttin den Roten Gott Turakamu wegen des Lebens eines Kindes überlistet hatte; wie sie sich dem Zorn des Kaisers Inchonlonganbula entgegengestellt und die Stadt Migran vor der Vernichtung bewahrt hatte; wie sie dem ersten Scholar das Geheimnis des Schreibens enthüllt hatte. Mara schloss die Augen, als sie an ihrem Lieblingsbild vorbeikamen: Es zeigte, wie Lashima in der Verkleidung eines alten Weibes den Streit zwischen einem Bauern und seiner Frau schlichtete. Mara wandte ihren Blick von den Bildern ab, denn sie gehörten zu einem Leben, das ihr jetzt verschlossen bleiben würde.
Nur zu bald erreichte sie die Türen, die nach draußen führten. Einen Augenblick hielt sie auf der obersten Stufe der abgewetzten Marmortreppe inne. Im Hof unter ihr hatte sich eine halbe Kompanie Wachen in den strahlenden grünen Rüstungen der Acoma versammelt. Einige zeigten frisch verbundene Wunden, aber sie alle nahmen Haltung an und salutierten mit der Faust auf dem Herz, als ihre Herrin in Sicht kam. Mara schluckte ihre Angst hinunter: wenn verwundete Soldaten als ihre Eskorte dienten, musste der Kampf tatsächlich sehr heftig gewesen sein und vielen mutigen Kriegern das Leben gekostet haben. Maras Wangen röteten sich vor Wut darüber, dass die Acoma gezwungen waren, ein solches Zeichen der Schwäche zu liefern. Dankbar über die Tempelrobe, die ihre zitternden Knie verbarg, schritt sie die Stufen hinab. Am Fuß der Treppe stand eine Sänfte, bei der ein Dutzend Sklaven schweigend wartete. Als die Lady der Acoma Platz genommen hatte, bezogen Papewaio und Keyoke links und rechts der Sänfte Position. Auf Keyokes Kommando ergriffen die Sklaven die Stangen und hoben die Sänfte auf ihre schweißbedeckten Schultern. Maya saß starr da, umgeben von dem Schleier der leichten, bestickten Vorhänge, während die Soldaten sich vor und hinter ihrer Herrin aufstellten.
Die Sänfte schwankte leicht, als die Sklaven auf den Fluss zugingen. Vorsichtig wählten sie einen geeigneten Weg durch die Menschenmenge, die die Straßen der Heiligen Stadt bevölkerte. Sie überholten Wagen, die von trägen sechsbeinigen Needras gezogen wurden, und wurden wiederum selbst überholt von rennenden Boten und hastigen Trägern, die mit Bündeln auf Kopf und Schultern zu Kunden eilten, die bereit waren, für außergewöhnlich schnelle Lieferung einen besonderen Preis zu zahlen.
Der Lärm und das Gewirr des Marktes vor den Toren ließen Mara erneut zusammenschrecken; im Schutz des Tempels hatte sie den Schock über Keyokes Auftauchen noch nicht richtig wahrgenommen. Jetzt, da die Erkenntnis sie überwältigte, kämpfte sie gegen den Impuls an, Tränen auf den Polstern der Sänfte zu vergießen. Sie wollte noch nicht sprechen, als könnte die Stille die Wahrheit zurückhalten. Aber sie war eine Tsurani – und eine Acoma. Feigheit würde weder die Vergangenheit ändern noch die Zukunft für immer hinausschieben. Sie holte tief Luft. Dann, während sie den Vorhang zur Seite zog, um Keyoke sehen zu können, sprach sie aus, was niemals in Zweifel gestanden hatte.
»Sie sind beide tot.«
Keyoke bejahte mit einem kurzen Nicken. »Euer Vater und Bruder wurden zu einem sinnlosen Angriff gegen eine barbarische Streitmacht gezwungen. Es war Mord.« Sein Gesicht zeugte von Gelassenheit, doch seine Stimme verriet die Bitternis, während er forsch neben seiner Herrin herschritt.
Die Sänfte schaukelte, als die Sklaven einem Wagen mit hoch aufgetürmten Jomach-Früchten ausweichen mussten. Sie folgten jetzt einer Straße, die hinunter zum Kai führte. Mara betrachtete ihre geballten Hände. Mit all ihrer Konzentration zwang sie die Faust, sich langsam zu öffnen und zu entspannen. »Erzählt mir, was geschehen ist, Keyoke«, sagte sie nach einer Zeit des Schweigens.
»Als der Schnee in der barbarischen Welt schmolz, wurden wir ausgeschickt, um uns einem möglichen Angriff der Barbaren entgegenzustellen.« Die Rüstung quietschte, als der alte Krieger die Schultern straffte und gegen die Erinnerung an Erschöpfung und Niederlage ankämpfte. Doch seine Stimme blieb gelassen. »Die Soldaten der barbarischen Städte Zun und LaMut befanden sich bereits auf dem Schlachtfeld, viel früher als erwartet. Wir schickten unsere Läufer zum Kriegsherrn, der in einem Tal in jenen Bergen lagerte, die die Barbaren die Grauen Türme nennen. Der Kriegsherr war abwesend, und so befahl sein Unterkommandeur Eurem Vater, die Barbaren anzugreifen. Wir –«
Mara unterbrach ihn. »Dieser Unterkommandeur ist ein Minwanabi, nicht wahr?«
Keyokes wettergegerbtes Gesicht zeigte einen Hauch von Anerkennung, als würde er ihr anrechnen, dass sie trotz der Trauer ihren Verstand benutzte. »Ja. Es ist Tasaio, der Neffe von Lord Jingu von den Minwanabi, der einzige Sohn seines toten Bruders.« Mara kniff die Augen zusammen, als er mit seiner Erzählung fortfuhr. »Wir waren deutlich in der Unterzahl. Euer Vater wusste es – wir alle wussten es –, aber er verhielt sich ehrenhaft. Ohne Widerrede folgte er dem Befehl. Wir griffen an. Der Unterkommandeur hatte versprochen, uns an der rechten Flanke zu unterstützen, doch seine Truppen tauchten niemals auf. Statt einen koordinierten Angriff mit unseren Truppen durchzuführen, behaupteten die Krieger der Minwanabi ihre Stellung, als wollten sie sich auf einen Gegenangriff vorbereiten. Tasaio hatte es so befohlen. Doch genau in dem Augenblick, als wir von einem Gegenangriff fast überwältigt wurden, kam Unterstützung aus dem Tal. Es waren Teile der Streitkräfte unter dem Banner von Omechkel und Chimiriko. Sie hatten keine Ahnung von dem Verrat und kämpften tapfer, um uns aus dem Griff der Barbaren zu befreien. Dieses Mal griffen die Minwanabi an, als versuchten sie den Gegenangriff zurückzuschlagen. Sie trafen genau in dem Moment ein, als die Barbaren sich zurückzogen. Für alle, die nicht von Anfang an dabei gewesen waren, war es einfach nur ein missglückter Zusammenprall mit dem barbarischen Feind. Doch die Acoma wissen, dass die Minwanabi sie verraten haben.«
Mara kniff ihre Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, und ihr Mund verkrampfte sich. Für einen kurzen Augenblick verriet Keyokes Gesicht seine Sorge, das Mädchen könnte das Andenken ihres Vaters beschmutzen und zu weinen beginnen, bevor die Tradition es ihr gestattete. Aber als Mara dann sprach, hatte sie ihre Wut unter Kontrolle, und ihre Stimme klang ruhig. »Das heißt also, der Lord von Minwanabi nutzte die Gunst des Augenblicks und fädelte den Tod meines Vaters ein, trotz unserer Allianz in der Kriegspartei?«
Keyoke rückte seinen Helm zurecht. »In der Tat, Mylady. Jingu von den Minwanabi muss Tasaio befohlen haben, die Anweisungen des Kriegsherrn zu ändern. Jingu ist sehr kühn; der Zorn des Kriegsherrn und ein unehrenhafter Tod wären Tasaios Lohn gewesen, wenn unsere Armee die Position gegen die Barbaren verloren hätte. Doch Almecho braucht die Unterstützung der Minwanabi bei der Eroberung, und wenn er auch wütend auf Jingus Neffen ist, so verhält er sich doch ruhig. Er hat nichts verloren. Nach außen hin war es lediglich ein Unentschieden ohne Sieger und Besiegten. Aber innerhalb des Spiels des Rates war es der Triumph der Minwanabi über die Acoma.« Zum ersten Mal in ihrem Leben glaubte Mara einen Hauch von Gefühl in Keyokes Stimme zu hören. Beinahe bitter sagte er: »Auf Befehl Eures Vaters sollten Papewaio und ich nicht an dem Angriff teilnehmen. Er befahl uns, mit dieser kleinen Kompanie zurückzubleiben – und trug uns auf, Euch zu beschützen, sollten sich die Dinge so entwickeln, wie sie es dann taten.« Er zwang seiner Stimme wieder den gewohnt forschen Ton auf. »Lord Sezu wusste, dass er und Euer Bruder diesen Tag vermutlich nicht überleben würden.«
Mara sank in die Kissen zurück. Ein dicker Knoten bildete sich in ihrem Magen. Ihr Kopf schmerzte, und sie spürte, wie sich ihre Brust zuschnürte. Sie nahm einen tiefen, langen Atemzug und blickte durch die andere Öffnung der Sänfte, wo Papewaio mit einem bemüht ausdruckslosen Gesicht marschierte. »Und was sagt Ihr dazu, mein kühner Pape?«, fragte sie. »Wie sollen wir auf den Mordanschlag reagieren, den sie unserem Haus zugefügt haben?«
Papewaio kratzte sich geistesabwesend mit dem linken Daumen über die Narbe an seinem Kinn, wie er es oft in Zeiten großer Anspannung tat. »Wie Ihr wünscht, Mylady.«
Die Haltung des Truppenführers der Acoma war oberflächlich betrachtet ungezwungen, doch Mara spürte, dass er am liebsten seinen Speer und das blanke Schwert in den Händen gehalten hätte. Einen stürmischen, wütenden Augenblick dachte Mara an sofortige Vergeltung. Auf ihren Befehl hin würde Papewaio den Lord der Minwanabi in seiner eigenen Domäne angreifen, inmitten seiner Armee. Doch obwohl der Krieger es als Ehre auffassen würde, bei einer solchen Tat zu sterben, wischte sie den dummen Impuls beiseite. Weder Papewaio noch irgendein anderer in der grünen Rüstung der Acoma würde sich dem Lord der Minwanabi auch nur auf einen halben Tagesmarsch nähern können. Abgesehen davon sollte eine solche Treue, wie Papewaio sie besaß, streng bewacht, niemals jedoch verschwendet werden.
Nicht mehr den prüfenden Blicken der Priester ausgesetzt, studierte Keyoke Maras Gesicht. Sie begegnete seinem Blick und hielt ihm stand. Sie wusste, dass sie grimmig aussah, dass ihr Gesicht mitgenommen und blass war, aber sie wusste ebenfalls, dass sie sich angesichts dieser Neuigkeiten sehr gut gehalten hatte. Keyoke schaute wieder nach vorn, während er auf die nächste Frage oder einen weiteren Befehl seiner Herrin wartete.
Die Aufmerksamkeit eines Mannes, auch wenn es sich um ein langjähriges Mitglied des Hauses handelte, veranlasste Mara, Bilanz über sich zu ziehen, ohne Illusionen, weder besonders kritisch noch allzu schmeichelnd. Sie war eine gutaussehende junge Frau, nicht auffallend hübsch, besonders dann nicht, wenn sie ihre Brauen in Gedanken wölbte oder vor Ärger die Stirn runzelte. Aber ihr Lächeln konnte ziemlich entwaffnend sein – zumindest hatte ein Junge es einmal behauptet –, und sie besaß etwas eigenartig Gewinnendes, eine geistvolle Energie, die sie manchmal sehr lebhaft erscheinen ließ. Sie war schlank und bewegte sich mit einer gewissen Geschmeidigkeit, und ihr Körper hatte den Blick von mehr als nur einem Sohn benachbarter Häuser auf sich gezogen. Jetzt würde sie einen dieser Söhne zu ihrem Verbündeten machen müssen, um sich der Woge des Schicksals entgegenstellen zu können, die die Acoma auszulöschen drohte. Mit halbgeschlossenen Augen dachte sie an die ungeheuerliche Verantwortung, die jetzt auf ihr lastete. Sie begriff mit einem flauen Gefühl im Magen, dass ihre Vorzüge als Frau – Schönheit, Geist, Charme, Liebreiz – jetzt alle in den Dienst der Acoma gestellt werden mussten, zusammen mit dem, was immer die Götter ihr an Intelligenz mitgegeben haben mochten. Sie kämpfte gegen die Furcht an, dass ihre Fähigkeiten möglicherweise dieser Aufgabe nicht gewachsen waren; und dann, bevor sie es merkte, rief sie sich die Gesichter ihres Vaters und ihres Bruders in Erinnerung. Trauer stieg in ihr empor, aber sie zwang sie tief in ihr Inneres zurück. Schmerz und Trauer mussten bis später warten.
»Wir haben noch vieles zu besprechen, Keyoke, aber nicht jetzt«, sagte Mara weich. In dem Gewimmel, das auf den Straßen der Stadt herrschte, konnten sich überall Feinde verbergen: Spione, Attentäter oder verkleidete Informanten. Mara schloss wieder die Augen vor den Schrecknissen, die nicht nur ihre Einbildung, sondern auch die reale Welt bereithielt. »Wir werden uns unterhalten, wenn nur jene Ohren zuhören können, die den Acoma loyal gesonnen sind.« Keyoke grunzte Zustimmung. Still dankte Mara den Göttern, dass sie ihn verschont hatten. Er war ein Fels, und einen solchen würde sie an ihrer Seite benötigen.
Erschöpft ließ Mara sich wieder in die Kissen zurücksinken. Sie musste ihre Trauer beiseite schieben, um nachdenken zu können. Der mächtigste Feind ihres Vaters, Lord Jingu von den Minwanabi, hatte eines seiner Lebensziele, die Auslöschung der Acoma, beinahe erreicht. Die Blutfehde zwischen den Acoma und den Minwanabi existierte bereits seit Generationen, und wenn es auch keinem Haus gelang, das andere zu beherrschen, so musste doch immer wieder das eine oder andere darum kämpfen, sich selbst zu schützen. Aber jetzt waren die Acoma nachhaltig geschwächt worden, und die Minwanabi standen auf der Höhe ihrer Macht, maßen ihre Stärke sogar mit der Familie des Kriegsherrn. Jingu besaß bereits seine eigenen Vasallen. Einer der Ersten war der Lord der Kehotara, dessen Macht der von Maras Vater entsprochen hatte. Und je höher der Stern der Minwanabi stieg, desto mehr würden sich mit ihm verbünden.
Lange Zeit blieb Mara hinter den flatternden Vorhängen verborgen. Nach außen erschien es, als würde sie schlafen. Ihre Situation war von trauriger Eindeutigkeit. Alles, was dem Lord der Minwanabi noch im Weg stand, war sie, ein junges Mädchen, das nur zehn Schläge davon entfernt gewesen war, eine Dienerin Lashimas zu werden. Dieser Gedanke hinterließ einen bitteren Geschmack in ihrem Mund. Nun, wenn sie zumindest so lange überleben wollte, um die Ehre der Familie wieder herstellen zu können, würde sie über ihre Möglichkeiten, einen Plan und eine Strategie nachdenken müssen, und sie würde sich am Spiel des Rates beteiligen müssen. Irgendwie würde sie einen Weg finden müssen, wie sie den Lord einer der Fünf Großen Familien des Kaiserreiches von Tsuranuanni daran hindern konnte, seinen Willen durchzusetzen.
Mara blinzelte und zwang sich aufzuwachen. Sie hatte unruhig gedöst und versuchte ihre Anspannung zu mildern, während die Sänfte durch die geschäftigen Straßen von Kentosani, der Heiligen Stadt, getragen worden war. Jetzt ruckelte die Sänfte etwas, als sie am Kai abgesetzt wurde.
Mara warf einen Blick durch die Vorhänge, doch sie war zu benommen, um Vergnügen am Treiben der Leute bei den Docks zu finden. Als sie die Heilige Stadt zum ersten Mal gesehen hatte, war sie gefesselt gewesen von der farbenfrohen Vielfalt der Menge, von den vielen Menschen, die aus allen Ecken des Kaiserreiches zu kommen schienen. Schon der bloße Anblick der Hausboote, die von den Städten flussaufwärts und flussabwärts kamen, hatte sie erfreut. Mit Bannern geschmückt schaukelten sie an den Anlegestellen hin und her; zwischen den geschäftig an ihnen vorbeieilenden Handelskähnen hatten sie einen ebenso stolzen Eindruck hinterlassen wie aufgeputzte Vögel zwischen Hühnern auf einem Bauernhof. Alles, das Aussehen, die Geräusche, die Gerüche, war so anders gewesen, als sie es von den Ländereien ihres Vaters gewohnt war – ihren eigenen Ländereien jetzt, verbesserte sie sich still. Die Erkenntnis brachte den Schmerz zurück, und sie bemerkte die Sklaven nicht, die sich in der grellen Sonne plagten. Ihre schwitzenden, nahezu nackten Körper waren rußbedeckt, während sie große Ballen auf die Flusskähne hievten. Im Gegensatz zum ersten Mal, als sie in der Begleitung der Schwestern Lashimas hierhergekommen war, errötete sie jetzt nicht. Männliche Nacktheit war nichts Neues für sie gewesen; als Kind hatte sie in der Nähe der Unterkünfte der Soldaten gespielt, während die Männer badeten, und jahrelang war sie mit ihrem Bruder und Freunden in dem See oberhalb der Needra-Weide schwimmen gegangen. Doch der Anblick nackter Männer schien nun, nachdem sie der Welt des Fleisches entsagt hatte, etwas anderes zu sein. Und als die sie begleitende Schwester Lashimas befohlen hatte, nicht hinzuschauen, war der Wunsch, verstohlene Blicke auf die Männer zu werfen, nur umso stärker geworden. An diesem Tag hatte sie sich regelrecht zwingen müssen, nicht auf die schlanken, muskulösen Körper zu starren.
Heute jedoch vermochten die Körper der Sklaven keinen Reiz auf sie auszuüben, ebensowenig wie die Rufe der Bettler, die all denen die Segnungen der Götter versprachen, die sich entschieden, eine Münze mit den weniger Glücklichen zu teilen. Mara ignorierte auch die Flussschiffer, die in der hochmütigen Haltung derer vorbeibummelten, die ihr ganzes Leben auf dem Wasser verbracht hatten und die Landbewohner insgeheim verachteten; sie hatten laute, harte Stimmen und einen ungehobelten Humor. Alles schien viel weniger farbig, weniger lebhaft und längst nicht mehr so einnehmend, als sie jetzt mit schlagartig älter gewordenen Augen um sich blickte. Die Zeit, da sie einfach nur staunen und sich dem Wunder überlassen konnte, war vorbei. Jetzt warf jede sonnenbeschienene Fassade einen dunklen Schatten. Und in diesen Schatten schmiedeten die Feinde neue Pläne.
Mara stieg schnell aus der Sänfte. Trotz des weißen Umhangs, der sie als Novizin Lashimas kennzeichnete, behielt sie die Würde bei, die von der Herrin der Acoma erwartet wurde. Sie blickte unbeeindruckt nach vorn, während sie auf die Barke zuging, die sie flussabwärts nach Sulan-Qu bringen würde. Papewaio bahnte ihr den Weg, indem er ein paar gewöhnliche Arbeiter grob zur Seite drängte. Andere Soldaten strömten an ihnen vorbei, in strahlende Farben gekleidete Wächter, die ihre Herren auf dem Weg vom Anlegeplatz zur Stadt begleiteten. Keyoke behielt sie wachsam im Auge, als er neben Mara das Dock überquerte.
Als die beiden Offiziere sie die Laufplanke hinaufdrängten, sehnte Mara sich nach einem dunklen, ruhigen Ort, an dem sie sich ihrer Trauer hätte hingeben können. Aber im gleichen Augenblick, da sie ihren Fuß auf das Deck gesetzt hatte, eilte der Bootsmeister zu ihr, um sie zu begrüßen. Seine kurze, rotviolette Robe wirkte beinahe zu grell nach der nüchternen Kleidung der Priester und Schwestern in dem Orden. Jadeschmuck klimperte an den Handgelenken, als er sich unterwürfig verneigte und seiner vornehmen Passagierin die beste Unterbringung anbot, die sein bescheidenes Boot zu bieten hatte – ein Stapel Kissen unter einem runden Baldachin, von dessen Rand ein Gazevorhang herabhing. Mara ließ den Mann weiter katzbuckeln, bis sie sich gesetzt hatte, denn dies erforderte die Höflichkeit, sollte der Mann nicht unnötigerweise sein Gesicht verlieren. Nachdem sie sich niedergelassen hatte, ließ sie den Bootsmeister durch ihre Schweigsamkeit wissen, dass seine Gegenwart nicht länger benötigt wurde. Der Mann, der in ihr nur eine gleichgültige Zuhörerin für sein Geplauder fand, ließ den dünnen Vorhang herab, der Mara zumindest ein wenig private Atmosphäre verschaffte. Keyoke und Papewaio saßen ihr gegenüber, während die Wachen der Familie um den Baldachin herumstanden; zu ihrer üblichen Aufmerksamkeit hatte sich jetzt noch eine grimmige, kampfbereite Anspannung gesellt.
Mara schien auf das unruhig wirbelnde Wasser zu starren. »Keyoke, wo ist das Boot meines Vaters ... mein eigenes? Und wo sind meine Zofen?«, fragte sie.
»Euer Boot liegt im Hafen von Sulan-Qu, Mylady«, antwortete der alte Krieger. »Ich hielt das Risiko, von den Soldaten der Minwanabi oder ihrer Verbündeten angegriffen zu werden, für geringer, wenn wir einen öffentlichen Kahn benutzen. Der Gedanke, dass Zeugen überleben könnten, hindert sie vielleicht daran, uns als verkleidete Banditen zu überfallen. Und was Eure Zofen betrifft … ich fürchtete, sie könnten sich als Behinderung herausstellen, sollten wir dennoch Schwierigkeiten bekommen.« Keyoke ließ seinen Blick über das Hafengebiet schweifen, während er sprach. »Dieses Schiff wird in der Nacht auf andere Boote stoßen, und so werden wir niemals allein auf dem Fluss sein.«
Mara nickte, sie hielt ihre Augen ein paar Sekunden geschlossen. »Also gut«, sagte sie dann weich. Sie hatte sich danach gesehnt, sich zurückziehen zu können, und das war auf dieser öffentlichen Barke unmöglich, doch Keyokes Sorgen waren nur zu begründet.
Es war Lord Jingu zuzutrauen, dass er eine ganze Kompanie Soldaten opferte, nur um die Letzte der Acoma zu vernichten, und sicherlich wäre es kein Problem für ihn, genug Männer gegen Maras Wachen auszuschicken, um sie überwältigen zu können. Aber er würde es nur riskieren, wenn er sich des erfolgreichen Ausgangs ganz sicher sein und den anderen Lords im Hohen Rat vortäuschen könnte, von den Ereignissen nichts gewusst zu haben. Alle, die am Spiel des Rates beteiligt waren, würden zwar zu dem Schluss kommen können, wer einen solchen Mord angeordnet hatte, doch die Form musste gewahrt bleiben. Würde auch nur ein Reisender entkommen oder ein Krieger der Minwanabi erkannt werden oder würde der Bootsmann einer anderen Barke zufällig eine nicht für seine Ohren bestimmte Bemerkung aufschnappen – es wäre um Jingu geschehen. Wenn öffentlich enthüllt werden würde, dass er an einem solch verräterischen Hinterhalt beteiligt gewesen war, würde er im Rat viel Prestige verlieren. Möglicherweise würden seine »loyalen« Verbündeten sogar den Verdacht hegen, dass er auf dem Weg wäre, die Kontrolle zu verlieren. Dann jedoch hätte er von seinen Freunden genauso viel zu befürchten wie von seinen Feinden. Das waren die unausgesprochenen Regeln des Spiels des Rates. Keyokes Entscheidung für ein öffentliches Transportmittel war also im Grunde eine ebenso wirkungsvolle Abschreckung gegen einen möglichen verräterischen Angriff wie weitere hundert bewaffnete Männer.
Die Stimme des Bootsbesitzers zerriss die Luft, als er den Sklaven befahl, die Anlegeleinen zu lösen. Einen kurzen Moment holperte und stampfte das Boot, dann glitt es fort aus dem Hafen in die träge wirbelnde Strömung des Flusses. Mara lehnte sich zurück, es war jetzt nicht mehr unangemessen, wenn sie sich ganz offensichtlich entspannte. Die Sklaven trieben die Barke vorwärts; ihre dünnen, sonnengebräunten Körper bewegten sich gleichmäßig zu dem Takt eines einfachen Liedes.
»Haltet sie in der Mitte«, sang der Steuermann.
»Stoßt nicht ans Ufer«, antworteten die Ruderer.
Der Gesang entwickelte einen deutlichen Rhythmus, und der Steuermann ergänzte ihn mit schlichten Versen. »Ich kenne eine hässliche Frau!«, rief er.
»Stoßt nicht ans Ufer!«
»Ihre Zunge war scharf wie ein Messer!«
»Stoßt nicht ans Ufer!«
»Ich betrank mich eines Sommerabends!«
»Stoßt nicht ans Ufer!«
»Und nahm sie dann zur Frau!«
Das schlichte Lied beruhigte Mara, und sie ließ ihre Gedanken treiben. Ihr Vater hatte lange gegen ihren Wunsch, das Gelübde abzulegen, protestiert. Jetzt, wo Entschuldigungen nicht mehr möglich waren, bereute Mara bitterlich, wie nah sie offenem Trotz gekommen war. Ihr Vater hatte nur deshalb nachgegeben, weil die Liebe zu seiner Tochter größer gewesen war als sein Wunsch nach einer politisch sinnvollen Heirat. Ihr Abschied war hitzig gewesen. Lord Sezu, Herr der Acoma, war manchmal wie ein Harulth – das riesige Raubtier, das die Hirten und Jäger am meisten fürchteten –, und in einer Schlacht gegen Feinde konnte er sich wie ein Wahnsinniger gebärden. Niemals jedoch hatte er es fertiggebracht, seiner Tochter etwas abzuschlagen, wie unvernünftig ihre Forderungen auch gewesen sein mochten. Und wenn auch seine Beziehung zu ihrem Bruder in mancherlei Hinsicht viel intensiver und wichtiger gewesen war, so hatte er ihr gegenüber doch stets Nachsichtigkeit und Milde walten lassen. Nur ihre Amme Nacoya hatte sie während ihrer Kindheit bändigen können.
Mara schloss die Augen. Die Barke bot ein bisschen Sicherheit, und sie konnte sich nun in den dunklen Schutz des Schlafes zurückziehen. Diejenigen auf der anderen Seite der Vorhänge, die diesen winzigen Pavillon bildeten, würden annehmen, dass sie der Langeweile einer langen Fahrt entfloh. Aber nur schwer fand sie die ersehnte Ruhe, denn Erinnerungen an den Bruder, den sie geliebt hatte wie den Atem in ihrer Lunge, drängten sich in ihre Gedanken. Lanokota mit seinen funkelnden, dunklen Augen, der stets ein Lächeln für seine angebetete kleine Schwester bereitgehalten hatte. Lano, der schneller als jeder Krieger aus dem Haus seines Vaters rennen konnte und dreimal hintereinander die Sommerspiele in Sulan-Qu gewonnen hatte, eine Meisterleistung, die bis jetzt unübertroffen geblieben war. Lano hatte immer Zeit für Mara gehabt, hatte ihr sogar das Ringen beigebracht – und sich den Zorn ihrer Amme Nacoya zugezogen, weil er ein Mädchen zu solch unmädchenhaftem Zeitvertreib verführt hatte. Immer hatte Lano einen dummen – und gewöhnlich schmutzigen – Witz bereit, mit dem er seine Schwester zum Lachen und Erröten brachte. Mara wusste, dass jeder Bewerber an ihrem Bruder gemessen worden wäre, hätte sie nicht ein Leben der Besinnung gewählt. Lano, dessen glückliches Lachen nie mehr durch die Nacht hallen würde, wenn sie in der Halle zu Abend aßen. Selbst ihr Vater, ein durch und durch ernster Mann, hatte gelächelt – unfähig, sich dem ansteckenden Humor seines Sohnes zu entziehen. Mara hatte ihren Vater respektiert und bewundert, aber ihren Bruder hatte sie geliebt, und tiefe Trauer überschwemmte sie nun.
Mara bekämpfte die aufwallenden Gefühle. Dies war nicht der rechte Ort, sie durfte erst später trauern. Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf praktische Angelegenheiten. »Hat man die Leichen meines Vaters und meines Bruders geborgen?«, wollte sie von Keyoke wissen.
»Nein, Mylady, sie sind nicht gefunden worden«, antwortete Keyoke mit Bitterkeit in der Stimme.
Mara biss sich auf die Lippen. Sie hatte also nicht einmal ihre Asche, um sie im Heiligen Hain bestatten zu können, sondern musste stattdessen etwas auswählen, das an ihren Vater und ihren Bruder erinnerte, einen Gegenstand, den sie besonders liebgewonnen hatten. Sie würden dann neben dem heiligen Natami – so nannte man den Fels, der die Seele der Acoma enthielt – begraben werden, damit ihre Geister zurück zum Land der Acoma finden und dort neben ihren Ahnen die ersehnte Ruhe erhalten konnten, bis sich das Rad des Lebens von neuem drehte. Mara schloss wieder die Augen, zum Teil aus seelischer Erschöpfung, zum Teil, um die Tränen zurückzudrängen. Doch die Erinnerungen rüttelten sie immer wieder wach, und so versuchte sie erfolglos, sich auszuruhen. Dann, nach einigen Stunden, bekamen das Schaukeln des Bootes, der Gesang des Steuermanns und die antwortenden Verse der Sklaven etwas Vertrautes. Ihr Geist und ihr Körper passten sich dem Rhythmus an, und sie entspannte sich. Die Wärme des Tages und die Ruhe des Flusses verbündeten sich schließlich, um Mara in einen tiefen Schlaf zu wiegen.
Im topasfarbenen Licht der Morgendämmerung legte die Barke im Hafen von Sulan-Qu an. Nebel wirbelte in kleinen Spiralen vom Fluss auf, während Läden und Buden am Ufer ihre verhängten Fenster öffneten und sich auf den bevorstehenden Markt vorbereiteten. Keyoke sorgte dafür, dass Maras Sänfte zügig an Land getragen wurde, solange die Straßen noch frei von der erdrückenden Menge waren; schon bald würden Wagen und Träger, Käufer und Bettler durch die Marktstraßen drängen. In wenigen Minuten waren die Sklaven bereit. Immer noch in den weißen Umhang der Schwesternschaft Lashimas gekleidet, der mittlerweile vom sechstägigen Gebrauch reichlich zerknittert war, kletterte Mara müde in die Sänfte. Sie lehnte sich zurück gegen die Kissen, die mit dem Symbol ihrer Familie, dem Shatra-Vogel, bestickt waren, und begriff, wie sehr sie die Rückkehr nach Hause fürchtete. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie die luftigen Räume des großen Hauses jetzt ohne Lanos ausgelassener Stimme auskommen konnten, und sie mochte nicht an die Kissen und Pelze im Arbeitszimmer ihres Vaters denken. Niemals mehr würden dort Schriftrollen liegen, die ihr Vater achtlos fallen gelassen hatte, wenn er zu müde zum Lesen der Berichte geworden war. Mara lächelte leicht, als sie an die Abneigung ihres Vaters für alles Geschäftliche dachte, obwohl er darin sehr fähig gewesen war. Er hatte die Angelegenheiten der Kriegsführung vorgezogen, die Spiele, die Politik; doch sie erinnerte sich auch an seinen Ausspruch, dass alles Geld kostete und der Handel niemals vernachlässigt werden durfte.
Mara gestattete sich einen beinah hörbaren Seufzer, als die Sänfte emporgehoben wurde. Sie wünschte sich etwas mehr Schutz durch die Vorhänge, als sie im frühen Morgenlicht den Blicken der Bauern und Arbeiter auf den Straßen standhalten musste. Sie thronten hoch oben auf ihren Gemüsewagen und hinter Marktbuden mit aufgestapelten Waren und sahen zu, wie die große Lady und ihr Gefolge vorbeizogen. Das ständige Achten auf ihre Erscheinung ermüdete Mara, und nur mühsam ertrug sie die unruhige Reise durch die rasch voller werdenden Straßen. Ihre Gedanken schweiften ab, und sie begann zu grübeln, und wenn sie auch nach außen hin wachsam schien, so schenkte sie in Wirklichkeit dem sonst so unterhaltsamen Blick der Stadt keinerlei Aufmerksamkeit.
Die papiernen Fensterläden der Balkone über ihr wurden beiseite geschoben, als Händler ihre Waren hoch über den Köpfen der Käufer ausstellten. War das Feilschen beendet, wurde der vereinbarte Preis in einem Korb hinaufgezogen und dann im Gegenzug die Waren hinabgelassen. Die offiziell erlaubten Prostituierten schliefen noch, und so blieb jeder fünfte oder sechste Balkon geschlossen.
Mara lächelte leicht und erinnerte sich daran, wie sie die Frauen der Ried-Welt zum ersten Mal gesehen hatte. Seit Generationen war es üblich, dass die Prostituierten sich auf den Balkonen zeigten. Ihre Gewänder hingen in aufreizender Unordnung um ihre Schultern, wenn sie sich in der immer gegenwärtigen Hitze der Stadt Luft zufächelten. All die Frauen waren wunderschön gewesen, ihre Gesichter in lieblichen Farben bemalt und die Haare nahezu königlich hochgebunden. Selbst die dürftige Kleidung war von kostbarstem Stoff und mit feinster Stickerei versehen. Bei ihrem Anblick war der sechsjährigen Mara spontan ein Freudenschrei entfahren. Allen in Reichweite hatte sie verkündet, dass sie eine von den Frauen auf den Balkonen werden würde, wenn sie erwachsen wäre. Es war das einzige Mal in ihrem Leben, dass sie ihren Vater sprachlos erlebt hatte. Lano hatte sie wegen dieses Zwischenfalls bis zu dem Morgen, als sie zum Tempel aufgebrochen war, aufgezogen. Jetzt würden seine spielerisch-harmlosen Sticheleien sie nie mehr beschämen können.
Die Trauer rührte Mara beinahe zu Tränen, und sie wandte sich von den Erinnerungen ab. Sie suchte Ablenkung außerhalb der Sänfte, wo schlaue Straßenhändler an den Ecken ihre Waren von Schubkarren verkauften, Bettler ihre Geschichten voller unglücklicher Ereignisse den Vorbeigehenden aufdrängten, Jongleure lustige Kunststücke vorführten und Händler seltene, wunderschöne Seide anboten. Aber all dies reichte nicht, um ihre Seele vor dem Schmerz zu schützen.
Schließlich blieb das geschäftige Treiben des Marktes hinter ihnen zurück, und sie verließen die Stadt. Im Süden von Sulan-Qu erstreckte sich bebautes Acker- und Weideland bis zu den bläulichen Bergen am Horizont; die Kyamaka-Bergkette war zwar nicht so zerklüftet und auch nicht so hoch wie der Hohe Wall im Norden, doch die Täler waren wild genug, um Banditen und Gesetzlosen Unterschlupf bieten zu können.
Die Straße zu Maras Gütern führte durch einen Sumpf, der sich allen Versuchen, ihn trockenzulegen, hartnäckig widersetzt hatte. Ganze Schwärme von Insekten fielen hier über die Träger her, die ihrem Unmut lautstark Luft machten. Eine drastische Zurechtweisung von Keyoke brachte sie zum Schweigen.
Dann führte der Weg durch eine Gruppe von Ngaggi-Bäumen, deren große Äste ein Dach aus grünblauem Schatten formten. Die Reisenden kamen jetzt durch hügeligeres Land und überquerten immer wieder leuchtend bemalte Brücken, da der Strom, der den Sumpf mit Wasser versorgte, unablässig jeden Weg kreuzte, den die Menschen gebaut hatten. Sie kamen zu einem Gebetstor, einem herrlich bemalten Bogen, den wohlhabende Männer einst hatten errichten lassen; es war ein Zeichen des Dankes für den Segen der Götter. Als die Reisenden unter dem Bogen hindurchkamen, sprachen alle ein stilles Dankesgebet und wurden dafür mit einem kleinen Segen belohnt. Und als das Gebetstor hinter ihnen immer kleiner wurde, erkannte Mara, dass sie in der vor ihr liegenden Zeit auf die ganze Gnade der Götter angewiesen war, wenn die Acoma überleben sollten.
Die Gruppe verließ die Straße und wandte sich ihrem eigentlichen Ziel zu. Shatra-Vögel suchten in Thyza-Halmen nach Futter, pickten vornübergebeugt wie alte Männer nach Insekten und Larven. Weil die Schwärme für eine gute Ernte sorgten, wurden die leicht dümmlich aussehenden Geschöpfe als Zeichen des Glücks betrachtet. Als solches schätzten auch die Acoma sie, und so waren die Shatra zum zentralen Symbol auf dem First des Hauses geworden. Der vertraute Anblick der Shatra-Vögel mit den staksigen Beinen und den sich unaufhörlich bewegenden spitzen Ohren vermochte Mara jedoch nicht zu erheitern; sie empfand vielmehr eine tiefe Furcht, da die Vögel und Arbeiter ihr ankündigten, dass sie das Gebiet der Acoma erreicht hatten.
Die Träger wurden jetzt schneller. Oh, wie sehr wünschte Mara, sie würden langsamer werden oder sich umdrehen und sie an einen ganz anderen Ort bringen. Doch ihre Ankunft war bereits von den Arbeitern bemerkt worden, die in den Wäldchen zwischen den Feldern und den Wiesen in der Nähe des großen Hauses Reisigbündel sammelten. Einige riefen etwas oder winkten, während sie gebeugt von dem Gewicht der Holzbündel, die auf ihrem Rücken lagen und mit einem Band an ihrer Stirn befestigt waren, vorbeigingen. Wärme lag in ihrem Gruß, und trotz der Umstände ihrer Rückkehr verdienten sie mehr als nur Unnahbarkeit von ihrer neuen Herrin.
Mara riss sich zusammen und richtete sich auf; sie lächelte leicht und nickte ihnen zu. Um sie herum breiteten sich ihre Ländereien aus, die sie beim letzten Mal mit der Gewissheit betrachtet hatte, niemals wieder zurückzukehren. Die Hecken, die bearbeiteten Felder und die ordentlichen Nebengebäude, in denen die Arbeiter wohnten, waren unverändert. Allerdings war sie ja auch nur etwas weniger als ein Jahr fort gewesen, dachte sie dann.
Die Sänfte passierte die Needra-Wiesen. Die mittägliche Luft war erfüllt vom kläglichen Muhen der Herde und von den »Hoho-ho«-Rufen der Hirten, die mit ihren Stachelstöcken herumwedelten und die Tiere auf die Pferche zutrieben, wo sie nach Parasiten abgesucht werden würden. Mara betrachtete die grasenden Kühe. Die Sonne ließ ihr graues Fell goldgelb schimmern. Einige hoben ihre stumpfen Mäuler, als stämmige Bullenkälber Angriffe vortäuschten, dann aber auf ihren sechs kurzen Beinen davontrotteten und hinter ihren Müttern Schutz suchten. Mara schien es, als würden einige fragen, wann Lano käme, um seine wilden Spielchen mit den übellaunigen Zuchtbullen zu treiben. Der Schmerz des Verlustes wurde immer stärker, je näher sie ihrem Heim kam. Mara zwang sich zu einem tapferen Gesichtsausdruck, als die Sänftenträger in den weiten, von Bäumen gesäumten Weg einbogen, der zum Herzen ihrer Güter führte.
Vor ihr lag das große Herrenhaus, errichtet aus Balken und papierdünnen Läden, die jetzt genug zurückgeschoben waren, um in der Mittagshitze auch noch die kleinste Brise hereinzulassen. Mara fühlte, wie ihr der Atem stockte. Es sprangen keine Hunde zwischen den Akasi-Blumen umher. Sonst warteten sie mit heraushängenden Zungen und wedelnden Schwänzen auf die Rückkehr des Herrn des Hauses. In seiner Abwesenheit blieben die Tiere immer in der Hundehütte; jetzt war die Abwesenheit endgültig. Dennoch, so verzweifelt und leer ihr Heim auch ohne ihren geliebten Vater und Bruder schien, bedeutete es doch endlich die Ruhe der Abgeschiedenheit. Bald würde Mara sich in den Heiligen Hain zurückziehen und ihrer Trauer freien Lauf lassen können, die sie in diesen anstrengenden sieben Tagen so lange hatte in ihrem Innern verbergen müssen.
Als die Sänfte und ihr Gefolge an einer Baracke vorbeikamen, stellten sich die Soldaten der Heimatgarnison entlang des Weges auf und nahmen Haltung an. Ihre Rüstungen glänzten, die Waffen und Abzeichen waren tadellos, doch abgesehen von Keyoke und Papewaio wies nur noch ein einziger weiterer Federbusch auf die Anwesenheit eines Offiziers hin. Mara spürte Kälte in sich aufsteigen und blickte Keyoke an. »Warum sind hier so wenig Krieger, Kommandeur? Wo sind die anderen?«
Keyoke hielt den Blick nach vorn gerichtet, er ignorierte den Staub, der an seiner polierten Rüstung klebte, und den Schweiß, der unter seinem Helm hervortropfte. »Alle, die in der Lage dazu waren, sind zurückgekehrt, Mylady«, sagte er steif.
Mara schloss die Augen, sie war unfähig, den Schock zu verbergen. Keyokes einfache Bemerkung bedeutete, dass zweitausend Soldaten mit ihrem Vater und ihrem Bruder gestorben waren. Viele von ihnen waren dem Haus durch jahrelangen, treuen Dienst verbunden gewesen, einige hatten gar Wache an Maras Krippe gestanden. Die meisten waren ihren Vätern und Großvätern in den Dienst bei den Acoma gefolgt.
Betäubt und sprachlos zählte Mara die vor ihr stehenden Soldaten und rechnete jene hinzu, die als Leibwächter mit ihr gereist waren. Siebenunddreißig Krieger blieben in ihrem Dienst, ein trauriger Bruchteil der Garnison, die ihr Vater einst befehligt hatte. Von den zweitausendfünfhundert Kriegern, die einst das Grün der Acoma getragen hatten, waren fünfhundert abkommandiert, um die Besitztümer der Acoma in entfernten Städten und Provinzen zu schützen. Dreihundert waren bereits vor diesem Feldzug im Spaltkrieg gegen die Barbaren gefallen. Und jetzt, während bisher zweitausend Soldaten den Acoma auf der Höhe ihrer Macht gedient hatten, wurde das Gut nur noch von weniger als fünfzig Männern geschützt. Mara schüttelte traurig den Kopf. Viele Frauen außer ihr hatten Verluste im Spaltkrieg zu beklagen. Verzweiflung erfüllte ihr Herz, als sie begriff, dass die Streitkräfte der Acoma zu gering waren, um einem Angriff widerstehen zu können, nicht einmal einem Überfall durch Banditen, sollte eine kühne Bande sie von den Bergen her angreifen. Aber Mara wusste ebenfalls, warum Keyoke das Gut einem solchen Risiko ausgesetzt hatte und einen großen Teil – vierundzwanzig von siebenunddreißig – der verbliebenen Soldaten zu ihrer Bewachung mitgenommen hatte. Nicht ein einziger Spion der Minwanabi durfte erfahren, wie schwach die Acoma waren. Hoffnungslosigkeit umhüllte sie wie eine erstickende Decke.
ENDE DER LESEPROBE