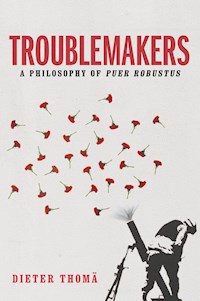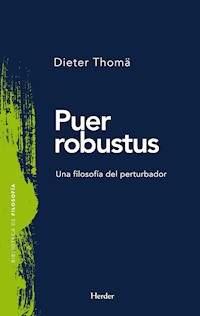Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Theoretiker hält sich dem Leben fern: Ihn interessieren abstrakte Begriffe und Argumente. Aber natürlich steckt hinter jedem Gedankengebäude auch ein Mensch, der es entworfen hat. Und dieser Mensch muss sich immer wieder eingestehen, dass seine Theorien der eigenen Lebenserfahrung möglicherweise widersprechen. Ist es dann überhaupt sinnvoll und möglich, eine solche Theorie zu konstruieren? „Der Einfall des Lebens“ porträtiert einflussreiche Philosophen, Soziologen, Ethnologen und Literaturwissenschaftler, deren Theorien eine „autobiographische Wende“ nahmen: Ein neuer, höchst inspirierender Zugang zur Ideengeschichte der Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Dieter ThomäUlrich Schmid | Vincent Kaufmann
Der Einfall des Lebens
Theorie als geheime Autobiographie
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-25010-9
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2015
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München
Motiv: René Magritte, La clef des champs / Der Schlüssel der Felder,
1936, © VG Bild-Kunst, Bonn 2015
unter Verwendung der Abbildung von akg-images
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Paul Valéry (1871–1945) | Ich mache meine Theorie
Georg Lukács (1885–1971) | Triumph der Totalität
Ludwig Wittgenstein (1889–1951) | Kristall und Chaos
Siegfried Kracauer (1889–1966) | Der Mensch als Loch
Walter Benjamin (1892–1940) | Der heiße und der kalte Erzähler
Viktor Šklovskij (1893–1984) | Der ausgesetzte Matrose
Michail Bachtin (1895–1975) | Das Nicht-Ich in mir
André Breton (1896–1966) | Das gläserne Bett
Georges Bataille (1897–1962) | Das schmutzige Bett
Michel Leiris (1901–1991) | Zwischen Stierkampf und Komödie
Theodor W. Adorno (1903–1969) | Der Händedruck der Wildsau
Jean-Paul Sartre (1905–1980) | Freiheit als Ersatz
Hannah Arendt (1906–1975) | Das Mädchen aus der Fremde
Maurice Blanchot (1907–2003) | Ich bin die Literatur
Claude Lévi-Strauss (1908–2009) | Wie wird man Strukturalist?
Roland Barthes (1915–1980) | Das unreine Subjekt
Jurij Lotman (1922–1993) | Der Aristokrat im Sowjetstaat
Michel Foucault (1926–1984) | Das Schwellenwesen
Stanley Cavell (*1926) | Die Stimme im Chor
Pierre Bourdieu (1930–2002) | Der arrivierte Häretiker
Jacques Derrida (1930–2004) | Verschlüsselungen und Krypten
Guy Debord (1931–1994) | Kein Recht auf Einsicht
Susan Sontag (1933–2004) | Schreiben und Orgasmus
Julia Kristeva (*1941) | Die Chinesin aus Bulgarien
Nadja Petöfskyi (1942–2013) | Das Ich ist nicht nur ein Anderer
Anmerkungen
Einleitung
Der Einfall des Lebens: Mit diesem Titel treiben wir ein doppeltes Spiel. Einerseits stellen wir uns vor, dass das Leben der Theorie auflauert, in ihr Reich ›einfällt‹ und für Wirbel sorgt. Andererseits denken wir an Theoretiker, denen ihr Leben ›einfällt‹ wie eine zauberhafte Melodie oder eine fast vergessene Affäre. Der Einfall steht für Attacke und Impromptu. Man ist von ihm betroffen oder beschwingt, gestört oder hingerissen. Man wird vom Leben heimgesucht oder kostet es aus. Das Verhältnis zwischen Theorie und Leben ist eine Affäre mit Gefahren und Genüssen.
Die meisten, die Theorie treiben, fassen das eigene Leben mit spitzen Fingern an und tun sich mit dem Reden und Schreiben darüber schwer. Viele Theoretiker reden gern über die Welt, wie sie ist, oder über das, was der Fall ist, aber ungern über sich. Sie sind wortgewaltig und wortkarg zugleich. Sie sehen ihre Aufgabe darin, Allgemeingültiges zu sagen und Persönliches auszublenden. Sie spannen ein engmaschiges Begriffsnetz und ziehen sich aus ihm zurück wie eine Spinne, die im Versteck auf Beute lauert. Sie wollen sich nicht selbst in der Sprache verfangen, die Beute, die ihnen ins Netz gehen soll, ist die Welt.
Diese Zurückhaltung, diese Lauerstellung ist von vielen Theoretikern des 20. Jahrhunderts aufgegeben worden. Sie bringen in dramatischer, manchmal geradezu obsessiver Weise ihr eigenes Leben zur Sprache, hadern mit sich und mit dem »Ich«, machen die Autobiographie oder allgemein die Biographie zu einem großen Thema. In diesem Buch wollen wir die Wege abschreiten, die diese Theoretiker gebahnt haben, und zeigen, wie Möglichkeit und Unmöglichkeit der Theorie mit der autobiographischen Wendung der Theoretiker zusammenhängen.
Es gibt zwei gängige Strategien, mit denen man dieses Verhältnisses zwischen Theorie und Autobiographie Herr zu werden sucht: die Strategien der Projektion und der Reduktion. Schlägt man sich auf die Seite der Projektion, dann sieht man in der Selbstinszenierung des Autors nichts als eine theoretische Fingerübung. Der Autor konstruiert sich selbst, er legt sich sein Leben zurecht, wie es seiner Theorie gefällt. Sein Ich ist ein Effekt, die Autobiographie wird zur Projektion der Theorie. Schlägt man sich dagegen auf die Seite der Reduktion, dann erscheint die Theorie, die ein Autor entwickelt, als Ausdruck privater Lebensnot oder -lust oder -kunst. Die Theorie wird auf Autobiographie reduziert.
Eine Pointe dieses Buches liegt darin, dass wir die Strategien der Projektion und der Reduktion gleichermaßen zurückweisen. Wir halten ebenso wenig davon, das »Ich« zum Kunstprodukt theoretischer Arbeit zu erklären, wie davon, die Theorie zum Nebenprodukt einer persönlichen Agenda zu erklären. Weder erklären wir den Lebensentwurf der Theoretiker, denen wir uns in diesem Buch zuwenden, zur abhängigen Variable ihrer theoretischen Prämissen, noch werfen wir den Blick durchs Schlüsselloch, um von deren persönlichen Lebensumständen auf theoretische Präferenzen zu schließen. Wir wenden uns vielmehr der Nahtstelle zwischen Leben und Schreiben zu, wir analysieren die Schwellensituation, in der sich diejenigen befinden, die immer aufs Neue mit sich zurechtkommen wollen, die sich über sich und die Welt verständigen. Wir treffen auf diejenigen, die Mensch sind und Theoretiker werden, oder auf diejenigen, die in der Theorie zu Hause sind und dabei zugleich versuchen, sich selbst zur Sprache zu bringen. Uns interessiert die Frage, wie sich Theorie und Autobiographie wechselseitig erhellen: Wie spiegeln sich allgemeine theoretische Einsichten in Autobiographien – und umgekehrt? Und warum bringen die Theoretiker überhaupt sich selbst ins Spiel und brechen das Schweigen über das eigene Leben?
Wenn sie dieses Schweigen brechen, so brechen sie auch mit dem Gesetz, das im Reich des Geistes über viele Jahrhunderte weithin gegolten hat: dass nämlich die Denker ihre Stimme erheben, jedoch nicht in eigener Sache sprechen, dass sie so tun sollten, als ginge es nicht um sie, als gäbe es sie eigentlich gar nicht.
Als David Hume seine Essays »Vom Geld« und »Von der Vielehe und der Scheidung« veröffentlichte, erwartete niemand Auskünfte über dessen eigenes Vermögen und Paarungsverhalten. Als Johann Gottlieb Fichte vom »Ich« (und vom »Nicht-Ich«) sprach, trat er nicht als professoraler Egomane auf, sondern meinte das »Ich« in uns allen. Als Émile Durkheim den Selbstmord analysierte, redete er sich nicht um Kopf und Kragen. Als Max Weber in der berühmten »Zwischenbetrachtung« seiner religionssoziologischen Aufsätze den »erotischen Rausch« und die »Grenzenlosigkeit der Hingabe« beschwor, tat er dies in unerregter Sachlichkeit. Als Henri Bergson über das Lachen schrieb, ging es ihm nicht um seine gute Laune.
Bevor das eherne Gesetz theoretischer Anonymität im 20. Jahrhundert massenhaft gebrochen wurde, gab es eine mehr oder minder friedliche Arbeitsteilung zwischen der akademischen Orthodoxie, die diesem Gesetz folgte, und einigen Einzelgängern und Außenseitern, die es sich doch nicht nehmen ließen, über das eigene Leben zu sprechen. Montaigne sagte: »Ich liebe Regen und Schlamm, wie die Enten.« Rousseau erzählte vom Zusammenprall mit einer »großen dänischen Dogge«. Kierkegaard ließ seine Leser wissen, er sei »auf wahnsinnige Weise erzogen« worden und habe sich »von Kindheit an […] in der Gewalt einer ungeheuerlichen Schwermut« befunden. Nietzsche teilte mit, dass er keine Zwischenmahlzeiten zu sich nehme und auf Kaffee verzichte, weil dieser »verdüstere«. Freud geriet bei der Traumdeutung tief in den eigenen Seelenhaushalt hinein: »Mit der Mitteilung meiner eigenen Träume […] erwies sich als untrennbar verbunden, dass ich von den Intimitäten meines psychischen Lebens mehr Einblicke eröffnete, als mir lieb sein konnte.«1 Von alldem wollten die akademischen Denker rein gar nichts wissen.
Man könnte sagen: Die Beziehungskrise zwischen akademischen Denkern und Außenseitern gipfelt im Streit um die Schreibweise eines einzigen Buchstabens, nämlich darum, ob es »Ich« oder »ich« heißen soll. Wer für Kleinschreibung plädiert, benutzt das Personalpronomen »ich«, also auf gut Deutsch: ein Fürwort. Es steht für einen bestimmten, einzelnen Menschen. Wer »ich« schreibt, will und darf auch über sich reden. Anders sieht die Sache aus, wenn man aus dem Pronomen ein Nomen macht – oder aus dem Fürwort das, was früher im Deutschunterricht Hauptwort hieß. Dann lanciert man ein Substantiv – »das Ich« – und macht es zum Subjekt im Satz. Dieses »Ich« sträubt sich gegen Personalisierung, es hat keine Hautfarbe, keine Lieblingsspeise, keinen Liebeskummer. Als Hauptwort genügt es sich selbst, es signalisiert: Ich bin die Hauptsache. Nicht das kleingeschriebene »ich«, sondern das großgeschriebene, verselbständigte »Ich«, das aus den Niederungen des Lebens emporgestiegen ist, ist von den akademischen Denkern geduldet oder gar gefeiert worden.
Wohlgemerkt: Auch unter diesen akademischen Denkern fanden sich solche, die den coup de force wagten, den Abbruch des Alten und den Anbruch des Neuen betrieben. Dass es auf sie ankam, dass sie auf sich allein gestellt waren, war ihnen akut bewusst. Wie sie dieses Bewusstsein zum Ausdruck brachten, das stand auf einem anderen Blatt – oder eben auf gar keinem Blatt, wenn ihre Theorie sich denn wortlos über das kleingeschriebene »ich« erhob. Zwischen akademischen Denkern und Außenseitern klaffte ein garstiger Graben. Hüben und drüben wurde jeweils anders geschrieben und gedacht. Die versteckte Gemeinsamkeit, das geteilte Bewusstsein ihrer besonderen Rolle führte dazu, dass der Graben, der sie trennte, tief war – und doch nur ganz schmal. So hatten Vertreter beider Seiten die Gelegenheit zum Austausch, gewissermaßen zu einem Händedruck mit Schwindelgefühl. Die berühmteste Begegnung dieser Art war wohl diejenige zwischen Rousseau und Kant. »Ich will vor meinesgleichen einen Menschen in aller Wahrheit der Natur zeigen, und dieser Mensch werde ich sein. Einzig und allein ich.« So schrieb Rousseau am Anfang seiner Bekenntnisse. »De nobis ipsis silemus«, »Von uns selbst schweigen wir« – diesen Satz Francis Bacons stellte Kant als Motto der Kritik der reinen Vernunft voran.2 Und doch reichte Kant, der große Schweiger, dem redseligen Franzosen die Hand zum Gruß und schrieb: »Rousseau hat mich zurecht gebracht.«3 Kants Lob galt Rousseaus Feier der Freiheit, doch dass für Rousseau zu dieser Freiheit gehörte, frei von sich zu sprechen und sich als Individuum zu entblößen, war aus Kants Sicht unnötig oder abwegig.
So sind Akademiker und Außenseiter als fremde Freunde oder auch als fremde Feinde nebeneinander her durch die Zeiten gewandelt. Der akademische Denker thronte auf seinem Hochsitz und genoss die Aussicht auf die Welt. Er war reines Auge, reiner Geist. Der Außenseiter fühlte sich unwohl auf diesem Hochsitz, stieg herab vom Gerüst und fand es vielleicht morsch. Er wehrte sich gegen die Lebenslüge der Theorie, dagegen, dass das schreibende Individuum spurlos in der Schrift verschwand.
Ende des 19. Jahrhunderts lancierte Wilhelm Dilthey einen einflussreichen Versuch, diese Spaltung zu überbrücken, also Theorie und Autobiographie zu versöhnen. Er behauptete, dass wir eigentlich immer das Gleiche tun, ob wir nun Theorie treiben oder eine Autobiographie schreiben. Auf der einen Seite haderte Dilthey mit der grauen Theorie des Rationalismus und verpflichtete die Philosophie auf die Aufgabe, die historische Totalität der Lebenszusammenhänge zu erschließen: »In den Adern des erkennenden Subjekts, das Locke, Hume und Kant konstruieren, rinnt nicht wirkliches Blut, sondern der verdünnte Saft von Vernunft als bloßer Denktätigkeit.«4 Neben diese Theorie, die sich mit dem Makrokosmos der historischen Wirklichkeit befasste, stellte er auf der anderen Seite die Autobiographie, die dem Mikrokosmos des einzelnen Lebens zugewandt war: »Die Selbstbiographie ist die höchste und am meisten instruktive Form, in welcher uns das Verstehen des Lebens entgegentritt. […] Hier faßt das Selbst seinen Lebensverlauf so auf, daß es sich die menschlichen Substrate, geschichtlichen Beziehungen, in die es verwebt ist, zum Bewußtsein bringt. So kann sich schließlich die Selbstbiographie zum historischen Gemälde erweitern.«5
Dilthey machte sich die Sache einfach. Er ging aus von einer Homologie zwischen großer und kleiner Geschichte, Welt- und Lebensgeschichte. Aber wer sagt denn, dass die Welt den von ihm beschworenen Sinnzusammenhang bildet? Und woher wusste Dilthey, dass das Leben in der Selbstbiographie ohne Naht und Bruch aufgeht? Die pathetische Replik auf Dilthey kam avant la lettre von Kierkegaard: »Man steckt den Finger in die Erde, um zu riechen, in welch einem Lande man ist, ich stecke den Finger ins Dasein – es riecht nach nichts. Wo bin ich? Was heißt denn das: die Welt? Was bedeutet dies Wort? Wer hat mich in das Ganze hineinbetrogen, und läßt mich nun dastehen? Wer bin ich? […] Wie bin ich Teilhaber geworden in dem großen Unternehmen, das man die Wirklichkeit nennt? Warum soll ich Teilhaber sein?«6
Dass Leben und Welt nicht unter dem einigenden Dach einer einzigen Methode harmonisch zueinanderfinden: diese kritische Überzeugung ist allen in diesem Buch verhandelten Autoren gemeinsam – sogar noch denjenigen, die Dilthey am nächsten stehen, nämlich Lukács und Arendt. Wie unterschiedlich sie auch sonst sein mögen, in der Abgrenzung von Dilthey sind sie alle geeint. Im 20. Jahrhundert wird die Theorie auf breiter Front autobiographisch – doch diese Bewegung folgt nicht Diltheys Vision einer großen Versöhnung zwischen Subjekt und Welt. Vom allseitigen Verstehen kann keine Rede mehr sein.
Der Einfall des Lebens, der die Theoretiker ereilt, verrückt alle Bezüge und lässt ihre überkommene professionelle Identität kollabieren. Beim versuchten Aufstieg zum reinen Geist werden sie das Leben einfach nicht los und stolpern darüber, dass sie Menschen aus Fleisch und Blut sind. Das Zutrauen zum begrifflichen Zugriff auf die Welt schwindet – und das Misstrauen wächst, dass man an sich vorbeiredet, wenn man große Worte macht, die angeblich die Welt bedeuten, und eine Sprache spricht, die nicht die eigene ist. Doch vielleicht gibt es diese Sprache, die dem Eigenen gerecht werden würde, gar nicht. Wohin verschlägt es die Theoretiker dann mit ihrem Leben und ihrem Sprechen?
Es liegt nahe, die autobiographische Wende der Theorie als Symptom einer Krise zu lesen, als Ausdruck von Unbehagen und Verunsicherung. Das Unbehagen richtet sich gegen das Ideal eines geschlossenen theoretischen Systems. Zum Sturm auf dieses Ideal hat jemand aufgerufen, der als früher Anstifter der autobiographischen Wende gelten darf, nämlich Friedrich Nietzsche: »Es ist […] eine Art Betrügerei, wenn jetzt ein Denker ein Ganzes von Erkenntnis, ein System hinstellt.«7 Die Frage lautet dann, wie im Lichte dieses Unbehagens Theorie zu treiben sei, wie man überhaupt zum Theoretiker wird und sich gewissermaßen als Theoretiker in Form bringt. – Die Verunsicherung rührt daher, dass – um eine berühmte Formulierung Max Schelers aufzugreifen – »der Mensch sich […] problematisch geworden ist«8, also mit seinem kleingeschriebenen »ich« ziemlich verloren dasteht.
Die These, wonach das Spannungsverhältnis zwischen Theorie und Autobiographie auf Unbehagen und Verunsicherung zurückzuführen ist, erklärt vieles, aber nicht alles. Ihre Schwäche ist zu erahnen, wenn man sich an die Silbe hält, die jene beiden großen Worte, auf die sich die Krisendiagnose stützt, gemeinsam haben: »un-«. Behauptet wird hier eine Negation, ein Mangel, ein Fehlen, ein Leiden. Das spannungsvolle, spannende Wechselspiel zwischen Theorie und Autobiographie erhält einen Trauerrand. Die Theoretiker wenden sich demnach ihrem eigenen kleinen Leben zu, weil sie zu nichts Besserem in der Lage sind. Umgekehrt wird damit auf einen Zustand angespielt, in dem sich die Theorie erholt und ihr Defizit getilgt haben wird. Wie dieser Zustand aussehen soll, ist indirekt auch schon vorgegeben und vorgeschrieben. Wenn man sich nämlich von ›Unbehagen‹ und ›Verunsicherung‹ die Negation wegdenkt, dann eröffnet sich die Aussicht auf zwei Gegenerfahrungen: Behagen und Sicherheit. Die Theoretiker-Autobiographen sind nach dieser Lesart nur Helden von der traurigen Gestalt, die sich in ihrer Not verrannt haben und insgeheim darauf warten, in einen Zustand behaglicher Sicherheit eintreten zu dürfen. Doch was wäre dies für ein Zustand? Die Sicherheit eines Systems, in dem man sich abschottet wie in einer Festung, oder die Sicherheit des juste milieu der akademischen Klasse?
Vielleicht sind die Theoretiker-Autobiographen nicht jene traurigen Helden, die aus ihrer Haut herauswollen – oder vielleicht sind sie jedenfalls nicht nur traurig. Zugegeben: Viele der Autoren, die in diesem Band versammelt sind, sind von äußerer und innerer Not gebeutelt worden. Und doch sind viele von ihnen imstande, ihre Not produktiv zu wenden und den Trauerrand vergessen zu machen, der die Liaison von Theorie und Autobiographie einrahmt. Sie folgen dabei wiederum Nietzsche, dem, als er das Ideal des Systems kritisierte, keine traurige, sondern eine »fröhliche Wissenschaft« vorschwebte. Entsprechend kann man in der theoretisch-autobiographischen Liaison – gut nietzscheanisch – nicht nur den Geist der Verneinung, sondern auch den Geist der Bejahung entdecken. Ergriffen wird damit die Chance, die zugleich innige und abgründige Verbindung zwischen Schreiben und Leben auszukosten. Die Frage, wie man lebt und (über sich) spricht, die Frage nach dem Verhältnis zwischen Lebensformen und Sprachspielen, Lebenshaltungen und Sprecherpositionen setzt schöpferische Energien frei. Wenn sich die Theorie auf die Autobiographie bezieht, reduziert sie sich nicht aufs Persönliche, sondern wird lebensnah und bricht mit ihrer falschen Selbstgenügsamkeit. Und umgekehrt: Wenn sich die Autobiographie von der Theorie instruieren lässt, wird sie nicht kopflastig, sondern bricht mit bornierter Selbstbespiegelung. Allen in diesem Buch versammelten Theoretikern ist gemeinsam, dass sie sich immer wieder gezwungen oder ermutigt sehen, der Kontingenz des Lebens die Stringenz des Gedankens entgegenzuhalten – und umgekehrt. Ihr Außenseitertum ist aus der Not geboren oder aus dem Übermut, aus der Fremdbestimmung oder aus dem Eigensinn. So oder so sind sie Grenzgänge und Grenzüberschreitungen gewöhnt.
Dass diese Autoren die Erfahrung der Befremdung und der inneren Fremdheit aushalten konnten, zeigt sich auch an ihrem Verhältnis zu akademischen Institutionen und politisch-kulturellen Ordnungen. Sie gehörten nicht zum akademischen Establishment, sondern kamen vom Rand, blieben vielleicht sogar am Rand und erlangten erst auf Umwegen den Status als Klassiker, der ihnen heute zuerkannt wird. Oft fanden sie zu Lebzeiten die universitäre Anerkennung nicht, die sie teilweise anstrebten, teilweise verachteten. Nachträglich wurden sie in disziplinäre Schubladen gepackt – insbesondere in diejenigen der Ethnologie, Literaturtheorie, Philosophie und Soziologie –, doch als sie antraten, befanden sie sich häufig zwischen den Stühlen oder arbeiteten auf Feldern, die kaum disziplinär gefestigt waren. Sie wechselten virtuos zwischen etablierten Wissenschaften, erfanden neue Forschungsgebiete und Methoden.
Da sie das Repertoire der verschiedenen Sprachformen, das ihnen zur Verfügung stand, neu sortierten und erweiterten, waren sie keine Freunde des Reinheitsgebots, wonach die Theorie sich jeder Vermischung mit anderen Formen des Sprechens peinlich zu enthalten hätte. So sahen sie insbesondere in der Literatur nicht den Hort phantastischer Willkür oder hemmungsloser Besonderheit, sondern den natürlichen Verbündeten bei der Ehrenrettung des kleingeschriebenen »ich«. Diesen wichtigen Punkt hat Maurice Merleau-Ponty genau markiert: »Alles wird anders, sobald eine […] Philosophie es sich zur Aufgabe macht, nicht etwa die Welt zu erklären oder deren ›Bedingungen der Möglichkeit‹ aufzudecken, sondern eine Erfahrung der Welt, eine Berührung mit der Welt zur Sprache zu bringen, die allem Nachdenken über die Welt vorausgeht. […] Die Aufgabe der Literatur und die der Philosophie sind demnach nicht mehr zu trennen.«9 Es ist alles andere als ein Zufall, dass viele der hier verhandelten Autoren nicht nur Theorie getrieben, sondern auch Romane oder andere literarische Texte geschrieben haben (Valéry, Kracauer, Breton, Bataille, Leiris, Sartre, Blanchot, Sontag, Kristeva).
Sie waren Außenseiter nicht nur im akademischen Milieu, sondern Fremde in den verschiedensten Hinsichten. Sie gehörten zu einer religiösen Minderheit (Lukács, Wittgenstein, Kracauer, Benjamin, Adorno, Arendt, Lévi-Strauss, Lotman, Cavell, Derrida und Sontag entstammen dem Judentum) oder zur Minderheit der Homosexuellen (Wittgenstein, Barthes, Foucault, Sontag), kamen aus der geographischen Peripherie (Kristeva als Bulgarin, Petöfskyi als Ungarin), waren Kinder sogenannter ›kleiner Leute‹ (Bourdieu und Barthes) oder aus fragmentierten Familien (Bataille, Barthes, Sartre, Sontag und Debord verloren früh ihre Väter).
Die Fremdheit, von der all diese Theoretiker heimgesucht wurden, entsprach – radikal verstanden – dem Gefühl, nicht in diese Welt zu passen. Dieses Gefühl zeitigte bei den hier verhandelten Autoren mal defensive, mal offensive Wirkungen. In der Defensive beschlich sie das Gefühl der Melancholie, die tiefe Trauer, dass die Welt – vielleicht nicht nur für sie, sondern überhaupt! – falsch eingerichtet sei (Wittgenstein, Benjamin, Bachtin, Leiris, Adorno, Blanchot, Lévi-Strauss, Barthes, Derrida, Debord, Sontag, Kristeva). In der Offensive setzten sie darauf, diese falsch eingerichtete Welt zu zerstören, auszuspielen oder zu überspielen: So entwickelten sie messianische Hoffnungen, mobilisierten revolutionäre Energien, die sich auf die eigenen Lebensverhältnisse resp. auf die Gesellschaft bezogen, oder sie errichteten kulturelle Gegenwelten (Benjamin, Breton, Sartre, Lotman, Foucault, Bourdieu, Debord).
In diesem Buch halten wir uns an Theoretiker, die die geistige Landschaft des 20. Jahrhunderts gestaltet und sich zugleich in der Theorie und/oder Praxis der (Auto-)Biographie hervorgetan haben. Manche von ihnen schreien geradezu danach, in einem Buch über Theorie und Autobiographie vorzukommen (wie z.B. Kracauer, Barthes oder Sartre). Bei anderen (wie z.B. bei Wittgenstein, Bachtin oder Sontag) ist dieser Zusammenhang eher versteckt, damit aber – wie sich zeigen wird – nicht minder wichtig. Wieder andere (wie Blanchot oder Derrida) haben das großgeschriebene »Ich«, also das Subjekt, zu Grabe getragen, scheinbar ohne dem kleingeschriebenen »ich« besonders zugetan zu sein. Doch der Furor, mit dem sie sich mit der Autobiographie herumschlagen, bezeugt nur die Bedeutung der Verbindung zwischen Theorie und Autobiographie, um die es in diesem Buch – und im 20. Jahrhundert – geht.
Die Theoretiker, die wir ausgewählt haben, werden in Kapiteln behandelt, die chronologisch nach deren Geburtsjahren geordnet sind. So spannt sich der Bogen von Frankreich bis Ungarn, vom wohlbekannten Paul Valéry, geboren 1871, bis zur weitgehend unbekannten Nadja Petöfskyi, geboren 1942. Unterwegs ergeben sich reizvolle Konvergenzen und Divergenzen zwischen den Altersgenossen Ludwig Wittgenstein und Siegfried Kracauer, Michel Foucault und Stanley Cavell, Jacques Derrida und Pierre Bourdieu.
Wir versteigen uns wohlgemerkt nicht zu der Behauptung, dass alle großen Denker des 20. Jahrhunderts vom Verhältnis zwischen Theorie und Autobiographie fasziniert gewesen sein müssten. Dass einige in diesem Band nicht vorkommen, hat teils kontingente, teils systematische Gründe. Manche (wie z.B. Maurice Merleau-Ponty) sind vielleicht nur durch ihren frühen Tod daran gehindert worden, sich mit dieser Frage ausführlicher zu befassen. Andere haben sich dem Interesse an der Verbindung zwischen Theorie und Autobiographie aus systematischen Gründen verweigert – wobei diese Gründe sehr verschieden ausfallen können. (Man denke nur an Martin Heidegger einerseits, John Rawls andererseits.10) Man mag darüber rechten, ob gleichwohl noch naheliegende Namen fehlen, ob weitere Autoren hätten berücksichtigt werden können. Doch manchmal ist weniger mehr, und mit 25 Porträts wird bereits ein breites Spektrum eröffnet.
***
Die einzelnen Kapitel dieses Buches werden von allen drei Autoren dieses Buches gemeinsam verantwortet. Sie sind in enger Zusammenarbeit, im Zuge langer Diskussionen und beim spielerischen Hin und Her immer neu veränderter und ergänzter Textversionen entstanden. Hauptautor der Kapitel über Valéry, Breton, Bataille, Leiris, Blanchot, Lévi-Strauss, Derrida und Debord ist Vincent Kaufmann; Hauptautor der Kapitel über Lukács, Šklovskij, Bachtin, Barthes, Lotman, Bourdieu und Kristeva ist Ulrich Schmid; Hauptautor der Kapitel über Wittgenstein, Kracauer, Benjamin, Adorno, Sartre, Arendt, Foucault, Cavell, Sontag und Petöfskyi ist Dieter Thomä.
Die Arbeit an diesem Buch ist dankenswerterweise von dem Forschungs-Profilbereich »Kulturen – Institutionen – Märkte« der Universität St. Gallen unterstützt worden. Wir danken Noémie Christen, Barbara Jungclaus und Maria Tagangaeva für vielfältige redaktionelle Hilfe.
Paul Valéry(1871–1945)
Ich mache meine Theorie
Paul Valéry zählt zu den berühmtesten Schriftstellern der französischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Aber warum eigentlich? Sein Werk gilt als unüberschaubar und widersprüchlich, genau wie sein ziemlich unspektakuläres Leben, in dem Einsamkeit und Zurückgezogenheit sehr wohl mit Salonfähigkeit und zahlreichen Ehrungen vereinbar sind. Er wird in einer bürgerlichen Familie in Sète am Mittelmeer geboren, studiert Jura in Montpellier und zieht anschließend nach Paris, wo er als Sekretär des Direktors der Havas-Agentur arbeitet, bis er sich ausschließlich seinen literarischen Arbeiten zuwendet. Seine bekanntesten Werke sind extrem abstrakt und sehr kurz: ein Dutzend Seiten für die berühmte Soirée avec Monsieur Teste (1896) und kaum mehr für das ebenso berühmte Gedicht »La Jeune Parque« (1917). Er ist der Autor eines riesigen Werkes, das aber ohne klaren Fokus und Identität sowie auch ohne ein bedeutendes »Meisterwerk« auskommen muss.
Valéry war ein Mann der Zerstreuung und des Experiments, für den die Literatur eher ein Mittel als ein Zweck war, was mit den zahlreichen von ihm erprobten Gattungen unterstrichen wird: Dichtungen, Erzählungen, Essays, Literaturkritik, Aphorismen, Dramen, Dialoge, Philosophie, Psychologie und Linguistik gehören zu seinem Werk sowie Schriften, die möglicherweise nirgends einzuordnen sind. Seine zahlreichen, meist kurzen Texte waren für ihn eher Spuren intellektueller Aktivität als tatsächliche literarische Werke. Schreiben hatte für ihn den Sinn einer mentalen Übung, genau wie die mathematischen Spekulationen, die er parallel über Jahrzehnte betrieben hat. Zwischen 1897 und 1917 schreibt er praktisch nur für sich selbst, ohne etwas zu veröffentlichen. Über dieses lange Schweigen wurde fast so wortreich spekuliert wie über Arthur Rimbauds Schweigen und Verschwinden ein paar Jahrzehnte früher.
Trotz oder gerade wegen dieser Zerstreuung ist in Valérys Werk eine kohärente und nachhaltige Fragestellung zu erkennen, die sich zu jener berühmten Frage verdichtet, welche Valéry Edmond Teste, seinem fiktionalen Doppel, in den Mund legt: »Que peut un homme?« – »Was vermag ein Mensch?«1 Teste wird von Valéry als »Dämon der Möglichkeit«2 beschrieben, der sich nur auf das bezieht, was er machen kann: Ich bin, was ich machen kann, und folglich erschöpft sich meine Autobiographie in der Inszenierung meines Potentials: »Ich beging, halb wissentlich, den Irrtum, das Sein durch das Machen zu ersetzen – so als hätte man sich selbst herstellen können – womit?«3 Valéry/Teste bezieht sich auf sich selbst als Möglichkeit, was auch erklärt, warum er nicht eine Romangestalt sein kann: seine Geschichte und seine Identität bleiben virtuell. Eine auf ihren Kopf (Teste ist das alte Wort für »tête«) reduzierte Gestalt ist nicht mehr romantauglich. Wie seine Vorgänger Louis Lambert (Balzac) und Des Esseintes (in Huysmans’ A Rebours) besteht Teste-Valéry aus Projekten und Programmen, die nie zwingend umgesetzt werden müssen: Die Überzeugung, dass sie umsetzbar wären, genügt ihm. Entsprechend haben die wirklich vollendeten Werke, wie zum Beispiel die 1917 erschienene »Jeune Parque« den Sinn, Valérys Können zu demonstrieren. Im Fall der »Jeune Parque« wird diese Dimension noch durch die Unzeitgemäßheit des Unternehmens verstärkt:4 Ein unendliches postsymbolistisches Gedicht im kulturellen Chaos von 1917 zu schreiben ist eine reine Herausforderung, entspricht einem »es ist noch möglich«, obschon es sinnlos geworden ist.
Mit der Frage »Que peut un homme?« wird auch Valérys Beziehung zur Literaturtheorie programmiert. In den französischen Versionen der Literaturgeschichte wird Valéry oft die Rolle eines Erfinders oder zumindest eines Vermittlers der Literaturtheorie zugeschrieben. Gemäß dieser Lesart tritt er als (selbsterklärter) Erbe des 1898 gestorbenen Mallarmé an und gibt dessen Konzept literarischer Reflexivität, welches ursprünglich eine Erfindung der deutschen Romantik ist, eine dezidiert theoretische Wendung. Der 1937 speziell für ihn eingerichtete Lehrstuhl für Poetik am Collège de France soll dafür der Lohn gewesen sein. Damit entsteht der Eindruck, es gebe eine theoretische Kontinuität zwischen Mallarmé, Valéry und dann der strukturalistischen Poetik sowie z.B. den theoretischen Spekulationen um den Nouveau Roman in den 1960er und 70er Jahren – man denke hier insbesondere an mehrere Aufsätze des radikalsten Theoretikers des Nouveau Roman, Jean Ricardou, der auf Valéry zurückgreift.5 In den strukturalistischen Jahren wird Valéry sozusagen zum missing link zwischen dem Urgroßvater Mallarmé und den strukturalistischen Vätern (Lévi-Strauss, Jakobson) befördert.
Dies ist jedoch eine nicht ganz unproblematische Rekonstruktion. Nichts deutet darauf hin, dass sich Jakobson je ernsthaft mit Valéry befasst hat, und Lévi-Strauss hat ihn anscheinend weitgehend ignoriert, was auch nachvollziehbar ist, wenn man ins Auge fasst, dass Valéry spätestens seit seiner Wahl in die Académie Française (1925) zu den etabliertesten Figuren des grundsätzlich konservativen kulturellen Milieus in Frankreich gehört – eines Milieus, das sich auch etwas später mit der Nazi-Besetzung grundsätzlich arrangieren konnte. Valéry, mittlerweile zum Sekretär der Académie Française befördert, rettet zwar seine Ehre mit seiner Lobrede für den 1941 verstorbenen »Juif Bergson«, wird dafür 1945 durch De Gaulle mit einer nationalen Bestattungsfeier belohnt, aber mehr liegt nicht drin: Mit den russischen Formalisten, mit den Avantgarden und mit ins Exil getriebenen jüdischen Ethnologen hat Valéry nach wie vor wenig zu tun. The missing link is missing there.
Eigentlich beruht die Eingliederung von Valéry in die Geschichte der französischen Literaturtheorie wenigstens zum Teil auf einem Missverständnis: Zwischen dem deskriptiven-systematischen Projekt der Strukturalisten sowie ihren formalistischen Verbündeten und Valérys Poetik, die er oft auch als eine (nie wirklich umgesetzte) Poïétique beschrieben hat und die durch das Motiv des »Machen-Könnens« geprägt ist, bestehen zumindest so viele Unterschiede wie Gemeinsamkeiten. Man könnte auch sagen – was als Widerspruch wahrgenommen werden mag –, dass Valéry in diesem Sinne ein egozentrischer Theoretiker gewesen ist, zumal er die Theorie nur auf sein eigenes Können bezogen hat. Seine Rolle in der Geschichte der französischen Literaturtheorie steht somit eher für eine Unterbrechung, ein Nicht-Vermitteln. Dies hat nicht nur mit der ambivalenten Positionierung des Dichters in der kulturellen Öffentlichkeit zu tun bzw. mit der Tatsache, dass die strukturalistische Poetik sich in der französischen Kultur eigentlich wie ein Fremdkörper entwickelt hat (was sich gerade auch an Lévi-Strauss zeigen lässt), sondern auch mit der Essenz der durch Valéry erfundenen Poïétique, die man sorgfältig von ihren strukturalistischen Nachfolgern unterscheiden muss. Während es eine strukturalistische »Schule« gegeben hat – oder genauer sogar mehrere –, während also die strukturalistische Aktivität klar den Sinn einer theoretischen Vermittlung hat, was sehr wahrscheinlich zur Essenz der Theorie gehört, lässt sich von Valéry sagen, dass er der Erfinder einer Theorie ist, deren Ziel es war, nicht vermittelt zu werden.6
Viele wichtige Theoretiker waren auch große »Vermittler«, haben nicht nur Werke, sondern Kreise, Schulen, Vermittlungsstrukturen und -institutionen hinterlassen: Werke wie diejenigen von Lacan, Derrida, Althusser, Foucault, Bourdieu oder noch Paul de Man in den USA umfassen grundsätzlich auch eine Vermittlungsstrategie, haben eine rhetorisch-strategische Dimension, die ab origine zur jeweiligen Theorie gehört, also keineswegs als nachträglicher Erfolgsfaktor einzustufen ist; ohne sie würde der theoretische Effekt, d.h. die Reproduzierbarkeit und die Etablierung eines »Vokabulars«, ausbleiben. Im Sinne einer Differenzierung verschiedener theoretischer Positionen müsste man also nicht nur auf die Beziehungen zwischen Theorie und Autobiographie eingehen, sondern auch auf das Verhältnis zwischen Theorie und Vermittlung: es wäre dann mindestens möglich, zwischen Theorien, die auf Vermittlung ausgerichtet sind (Foucault, Derrida, Lacan usw.), und Theorien, die Vermittlung mehr oder weniger ausdrücklich ablehnen (Debord, Benjamin und eben Valéry), zu unterscheiden.
Freilich hat der ›späte‹ Valéry insbesondere ab 1925, nach seinen verschiedenen Ehrungen, jede Menge an kritischen Aufsätzen verfasst, die sich ohne große Schwierigkeiten in Kategorien wie Literaturkritik, Kunstkritik, Ästhetik oder Poetik einordnen lassen und auch so eingeteilt in der Pléiade-Ausgabe bei Gallimard veröffentlicht worden sind. Und neben den streng komponierten Aufsätzen kann man unter anderem noch auf die zwei Bände Tel Quel – ein Name mit Zukunft im Bereich der Literaturtheorie! – verweisen, die aus zahlreichen für Valérys theoretisches Denken typischen Fragmenten bestehen. Aber gerade mit Tel Quel stößt man auf den vielleicht größten Widerspruch in Valérys theoretischem Werk, denn diese zwei Bände sind eigentlich als eine kaum retouchierte Anthologie seiner zwischen 1894 und 1945 ununterbrochen geführten Cahiers zu betrachten. Hinter dem offiziellen, zwischen 1925 und 1945 sehr produktiven Valéry der Salons und der Akademien, der auch während des Krieges nicht unter allzu starken Berührungsängsten leidet (Tel Quel erscheint 1941 und 1943 in der durch die Nazis kontrollierten Nouvelle Revue Française), verbirgt sich ein Valéry, dessen »Werk« – d.h. die mehr als 30.000 Seiten der Cahiers – zu circa 90 Prozent ›privat‹ geblieben ist, als hätte Valéry nur für sich selbst geschrieben.7 Und damit stellt sich die Frage, wo eigentlich der ›wirkliche‹ Valéry zu suchen ist, oder zumindest die Frage, ob es Valéry, den Theoretiker, überhaupt gibt: Ist eine Theorie, die man grundsätzlich für sich selbst behält, die wenigstens anscheinend ohne Vermittlungsabsicht geschrieben wird, noch eine Theorie?
Wo ist der ›wirkliche‹ Valéry zu suchen, wer ist er? Es kann uns hier nicht entgehen, dass sich die Frage, ob Theorie ohne Vermittlung noch Theorie ist, auf den Bereich des Autobiographischen beziehen lässt, zumal die Cahiers tatsächlich auch als ein riesiges Selbstporträt zu lesen sind, gemäß Valérys eigener Wahrnehmung seines Schreibens: »Wenn je dies Suchen hier an die Öffentlichkeit soll, dann noch am ehesten in der Form: ich habe dies gemacht und das. Einen Roman, wenn man will, und wenn man will, auch eine Theorie. Die Theorie von einem selbst.«8 Ein Roman, eine Theorie, beides, wenn man will, oder noch genauer eine autobiographische Theorie, eine Theorie von sich selbst. Die Cahiers werden von einem Standpunkt aus geschrieben, wo Theorie und Autobiographie das Gleiche – oder genauer: noch das Gleiche – sind und sich deshalb auch von sich selbst unterscheiden: Theorie und Autobiographie, aber auch weder Theorie noch Autobiographie, höchstens ein Roman, aber ohne Gestalten und ohne Handlung, mit dem sich der Wahrheitsanspruch der Autobiographie aufhebt, oder eine Theorie von sich selbst, mit der sich der Universalitätsanspruch der Theorie auflöst.
In diesem Sinne lassen sich Valérys Cahiers – also eigentlich der größte Teil seines Werkes – als zugleich infra-theoretisch und infra-autobiographisch bezeichnen. Es geht um eine Schreibpraxis, die vorher kommt, vor den mehr oder weniger etablierten Gattungen Autobiographie und Theorie (die dann bei Valéry umso mehr als Gattungen oder Artefakte erscheinen: für sein »rhetorisches« Bewusstsein, seine Wahrnehmung der kulturellen Artefakte ist er bekannt). Fast alles, was Valéry schreibt, steht unter dem Zeichen eines »noch nicht«, eines Zurückhaltens. Dazu passen zahlreiche Äußerungen: »Was immer in diesen meinen Heften steht, hat das Charakteristikum, niemals endgültig sein zu wollen.«9 »Ich vermerke hier die Gedanken, die mir kommen. Aber es ist nicht so, dass ich sie akzeptiere. Das ist ihr Rohzustand. Noch schlaftrunken.«10 – usw. Und mit diesem »noch nicht« lässt sich auch ein anderer für die Problematik der Autobiographie und der Theorie wichtiger Aspekt von Valérys Praxis verbinden: der Anspruch auf Widersprüchlichkeit oder das Misstrauen bezüglich Identität: Es ist immer möglich, dass ich ein anderer oder sogar mehrere andere bin als derjenige, der sich äußert oder inszeniert. Es ist immer möglich, dass ich auch genau das Gegenteil dessen denke, was ich jetzt gerade aufschreibe, oder das Gegenteil gedacht habe oder denken werde. Jedes Fragment ist klar, aber die Summe geht nicht auf: »Ich empfinde all dies, was ich hier niederschreibe – diese Beobachtungen, diese Annäherungen, als einen Versuch, einen Text zu lesen, und dieser Text enthält eine Menge klarer Fragmente. Das Ganze ist schwarz.«11 Wie kann man bei einer solchen Selbstwahrnehmung zur Gattung Autobiographie oder zur Theorie stehen?
Freilich schließt dieses »noch nicht« eine spätere Veröffentlichung, bei der dann der Autor auch die ihn als Autor konstituierende Verantwortung übernimmt, nicht aus, und Valéry ist weder der erste noch der einzige Schriftsteller, bei dem die Beschäftigung mit Skizzen oder vorläufigen Gedanken einen wichtigen Platz einnimmt. Aber so systematisch und jahrelang? Und geht es nur um ein »noch nicht«, um die Möglichkeit, ein anderer zu sein, wenn Valéry z.B. das folgende schreibt: »Wenn meine Arbeit nicht wertlos ist – dann ist sie sehr kostbar: und ich behalte sie für mich. Taugt sie nichts – hat sie für keinen irgendwelchen Wert, und ich behalte sie – für niemanden.«12 Ein Psychoanalytiker würde hier sofort an Freuds Beobachtungen zur Analerotik denken und bei Valéry ein zwanghaftes »Nicht-Loslassen-Können« diagnostizieren. Eine solche Interpretation ist in Valérys Fall umso verlockender, als bei ihm tatsächlich auch zahlreiche Äußerungen über die Wertlosigkeit der veröffentlichten Werke zu finden sind: Was ich veröffentliche, ist Abfall, wird von mir nicht nur ab-, sondern eben auch aufgegeben oder ausgeschieden: Poubellication (gemäß Lacans Ausdruck13), it’s not me, I am not there.
Wie ist aber dieses »Nicht-loslassen-Wollen« mit Valérys Sichtbarkeit und Berühmtheit zu vereinbaren? Lässt es sich überhaupt damit vereinbaren? Wieso wird gerade der Schriftsteller, der über 20 Jahre auf das Publizieren verzichtet hat und sich auch später gegenüber der Öffentlichkeit stets passiv verhält, zur offiziellen Koryphäe der französischen Kultur, mit ehrenvollen Wahlen in die Académie Française und das Collège de France? Die Antwort lautet wohl: Valéry kommt diese Funktion gerade zu, weil er nicht wirklich »da« ist, was ihm erlaubt, seine öffentliche Existenz als eine Rolle zu betrachten, mit der sein wirkliches »Ich« letztlich kaum etwas zu tun hat. Für die Öffentlichkeit ist Valéry gesegnetes Brot, er tritt insbesondere mit der Praxis der Cahiers als Inhaber einer reinen Intelligenz auf, eines reinen »savoir-faire« oder »pouvoir-faire«, das sich meistens konkreten Anwendungen entzieht. Ich bin nicht da, wo ihr mich seht, ich bin im geheimen Schatz meiner Cahiers, die ich für mich behalte, die ich nur für mich schreibe. In diesem Sinne überlässt Valéry grundsätzlich das Management seines öffentlichen Ichs der Öffentlichkeit und deren ehrenvollen Institutionen: Wenn sie mich wählen wollen, mache ich schon mit; dann gebe ich ihnen, was sie wollen, es betrifft mich ja eigentlich nicht, es ist nur mein Abfall.
Mit anderen Worten: Was bei Valéry nicht oder kaum vorkommt, ist der Moment der Subjektivierung im Schreiben. Was fehlt, ist der Moment, in dem man sich als Subjekt einem öffentlichen Blick unterwirft (gemäß der Etymologie des Wortes »Subjekt«). Und dies ist auch der Moment, in dem man zu seiner Subjektivierung-Veröffentlichung stehen muss, wenigstens wenn man theoretische Ansprüche hat. Theorie ist ohne Subjektivierung nicht möglich und genau aus diesem Grund auch nicht ohne Veröffentlichung, ohne Vermittlungsstrategie. Ohne Subjektivierung im Schreiben bleibt man im Infra-Theoretischen wie im Infra-Autobiographischen. Es sei hier auf eine eher überraschende Analogie mit Guy Debord hingewiesen: Es ist bemerkenswert, dass Debord, der den theoretischen Wert seiner Schriften ausdrücklich bestreitet, jedenfalls sofern Theorie im üblichen Sinn verstanden wird, auch derjenige ist, der grundsätzlich und natürlich auf widersprüchliche Weise in seinen autobiographischen Schriften alles unternimmt, um sich dem Blick der Öffentlichkeit – dem Spektakel, würde er sagen – zu entziehen, um sich diesem Blick nicht zu unterwerfen. Auch hier gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen einer bestimmten Form der Subjektivierung – Selbstporträt als Herausforderung der Öffentlichkeit – und einem spezifischen Verhältnis zur Theorie, die sich in Debords Absicht als Theorie aufheben soll.
Aber zurück zu Valéry, dessen Grundproblem noch auf die folgende Weise formuliert werden kann: Mein Ich bzw. dessen Inszenierungen und Gedanken bleiben grundsätzlich willkürlich. Was ich bin, was ich denke, kann sich immer noch ändern, und deshalb bin ich es noch nicht oder schon nicht mehr. Das Subjekt ist subject to change. Wie entgehe ich der Willkür, sei es derjenigen der Romankonstruktion (wo die berühmte Marquise ohne Grund um fünf Uhr auf der Straße erscheint), derjenigen des Selbstporträts (jedermann, sagt Valéry, kann wie Montaigne »so Sachen schreiben«14) oder derjenigen der Theorie, die gegenteilige Aussagen ausschließt. In diesem Sinne ist im gesamten Werk Valérys eine kritische Einstellung sowohl gegen Autobiographie wie auch gegen Theorie zu spüren. Im Lichte der Cahiers erscheint alles andere, inklusive Valérys eigene Veröffentlichungen, als willkürlich, als Abfall, Poubellication.
Was bleibt dann von Valéry als Theoretiker? Neben zahllosen theoretischen Fragmenten, die nur bedingt in einer Theorie zusammengefasst werden können, ist vor allem auf den Mythos des Theoretikers hinzuweisen: auf den Mythos eines perfekten Theoretikers, der sich selbst und seine Gedanken so gut im Griff hat, dass er nichts oder so wenig wie möglich davon vergibt, um der Willkür der Subjektivität zu entgehen; auf den Mythos eines Theoretikers, der virtuell bleibt, von dem nichts anderes als Skizzen, Programme, Hypothesen zu erwarten sind, die er noch nicht unterzeichnet hat und auch nie unterzeichnen wird, zumal er die Unterschrift beim veröffentlichten Material grundsätzlich der Öffentlichkeit überlässt. Zusammengefasst kann man sagen, dass Valéry jahrzehntelang als der Theoretiker posiert hat, der er nicht hatte sein wollen oder können. Deshalb auch die zahlreichen Aufsätze über Schriftsteller oder Künstler, von Descartes bis Mallarmé oder da Vinci, die sich Valéry sozusagen als Strohmänner zum Aufbau seines eigenen Mythos, seines Selbstporträts als Theoretiker angeeignet hat. Keine Theorie, sondern eine Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, deren programmatische Dimension in diesem Titel deutlich wird: keine Theorie, sondern eine Einführung zu einer »Methode«, die allerdings schwer zu identifizieren, geschweige denn umzusetzen ist, zumal die Methode selbst ein Mythos bleibt, was schließlich dazu führt, dass in Valérys Werk kaum zwischen Figuren wie da Vinci, Descartes oder Mallarmé einerseits und dem fiktiven Monsieur Teste andererseits unterschieden wird.
Stellt man nun abschließend noch einmal die Frage, wie es dazu kommt, dass Valéry von der strukturalistischen Generation als Vorgänger begrüßt worden ist, stößt man vielleicht, neben anderen wohlfeilen Möglichkeiten (Missverständnis, Förderung der nationalen Größen usw.), auf folgende Antwort: Mit seinem weitgehend ungelesenen Werk, das sich in eine esoterische Unangreifbarkeit zurückzieht, entsteht der Mythos einer Aufhebung der Willkür durch die theoretische Systematik, und damit sind wir zurück beim Kerngeschäft des Strukturalismus, den Saussure grundsätzlich erfindet, indem er das Zeichen als arbitraire, d.h. willkürlich bezüglich der Referenz definiert, im Gegensatz zu anderen Theorien bzw. philosophischen und poetischen Spekulationen, die von einer Motivation des Zeichens etwa in dem Sinne ausgehen, dass die Sachen die sie bezeichnenden Wörter prägen. Das ist freilich eine uralte Diskussion: Die Kontroverse zwischen konventionalistischen und naturalistischen Sprachtheorien ist auf höchstem Niveau schon in Platons Kratylos durchgespielt worden.15
Der Strukturalismus entsteht, via Saussure, indem er das Zeichen in seiner Beziehung zur Referenz (und damit auch zur Geschichte, zum Sozialen sowie zum Subjektiven) ent-motiviert, es dann aber sofort wieder strukturell motiviert, d.h. seine Beziehungen zu anderen Zeichen als die einzig relevanten aufzeichnet. Strukturalismus untersucht Zeichensysteme (Texte, Gesellschaften usw.) auf ihre interne Systematik oder Motivation, was nicht zufällig in seinen Blütejahren zur Ausschließung des ganzen Bereichs der Subjektivität und deren literarischer Umsetzung in autobiographischen Schriften führt; eine Einstellung, die durch Barthes’ und Foucaults – wie auch immer gebrochene – Verkündung des Todes des Autors16 oder durch die damals weit verbreitete Faszination für selbstreflexive Literatur (z.B. für den Nouveau Roman) unterstützt oder verstärkt wird: Ein guter Text ist ein Text, der ausschließlich auf sich selbst beruht, der sich sozusagen ex nihilo dank seiner internen Systematik durchzusetzen vermag. Der Strukturalismus träumt von einer Theorie, mit der die Willkürlichkeit des Subjekts – und damit seiner konkreten Lebenskontexte – beseitigt werden kann. Bei Valéry ist zwar diese Theorie nicht zu finden, hingegen aber das unmögliche Subjekt dazu: ein mythisches, auf sich selbst bezogenes Subjekt, das sich von seinen Beziehungen zur Wirklichkeit loszulösen vermag. Theorie als Absolutes.
Georg Lukács(1885–1971)
Triumph der Totalität
Georg Lukács stellte einen hohen Anspruch an sein eigenes Leben: Es sollte sich ihm in einer Form präsentieren, die nicht nur ihm selbst, sondern auch allen anderen verständlich war. Seine Biographie war deshalb letztlich nichts anderes als ein großes Deutungsprojekt, das aus Kontingentem Notwendiges und aus erlittenem Schicksal bewusste Lebenspraxis erzeugen sollte. Persönliches Scheitern musste die Würde des Tragischen erhalten. Das moralische Leben des Individuums in der Gesellschaft wurde durch eine große Synthese der deutschen Philosophie begründet. Am Ende seines Lebens blickte Lukács auf seine Biographie zurück, die ihm – in gut Hegelscher Manier – als faktische Bestätigung der Richtigkeit seines Denkens erschien.
Bereits die verstörende Liebesbeziehung des jungen Lukács zu Irma Seidler stand im Zeichen der Sinngebung. Zwar war Lukács vor Liebe nachgerade von Sinnen und konnte Irma Seidlers erotischer Attraktion kaum widerstehen, gleichzeitig zögerte er aber immer wieder, eine feste Beziehung mit ihr einzugehen – und zwar vor allem, weil er sein eigenes, noch zu errichtendes intellektuelles Lebenswerk gefährdet sah. Letztlich machte Lukács jedoch aus der Not eine Tugend – oder vielleicht eine Untugend. Er analysierte seine eigenen Gefühlszustände und verwandelte seine persönliche Liebestragödie in eine anthropologische Fallstudie. Dabei sind seine Bewusstseinsprotokolle nicht frei von Larmoyanz. So entwarf Lukács im Jahr 1908, nachdem Irma Seidler eine unglückliche Ehe mit einem Rivalen eingegangen war, einen melodramatischen Abschiedsbrief (»Ich muss jetzt schreiben, jetzt, da du diesen Brief zusammen mit der Nachricht meines Todes erhältst«).1 In dieser Phantasie findet Lukács eine knappe Formel für sein Dilemma zwischen Emotion und Intellekt: Ein Leben, das sich selbst nicht in den Griff bekommt, muss beendet werden, damit es sich verstehen kann – der Preis des Selbstmordes erscheint für eine solche Leistung durchaus angemessen.
Allerdings wich Lukács’ Todessehnsucht bald dem Drang nach schriftstellerischem Ausdruck. Der Gegensatz Leben–Tod bekam Konkurrenz vom Gegensatz Leben–Kunst. Sein früher Essayband Die Seele und die Formen (1910/11) ist zwar äußerlich eine Sammlung von literaturkritischen und philosophischen Essays, letztlich muss dieses Buch jedoch als Lukács’ autobiographische Auseinandersetzung mit seiner Faszination für Irma Seidler gelesen werden.
Lukács richtete seine ganze Energie darauf, die Affäre mit Irma Seidler dem Bereich des Privaten zu entreißen und ihr eine gesamtmenschliche Dimension zu verleihen.2 So notiert er etwa am 8. Mai 1910 in seinem Tagebuch: »Letzte Nacht fühlte ich wieder: Irma ist das Leben.«3 Diese Überhöhung signalisiert in aller Deutlichkeit, dass eine Analyse der Liebesbeziehung zu Irma für Lukács keine persönliche Abschweifung darstellte, sondern eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Phänomen des Lebens selbst bedeutete. An Irma Seidler schreibt er explizit in einem Brief: »Dieses Buch ist, wie Sie vielleicht noch wissen, die wissenschaftliche Zusammenfassung meines Lebens, der Abschluss meiner sogenannten Jugend.«4
Die einzelnen Tagebucheinträge aus dem Frühling 1910 bezeugen deutlich, dass Lukács die Texte für Die Seele und die Formen ganz sub specie Irmae schreibt. Am 20. Mai notiert er: »Der Essay über [Charles-Louis] Philippe reift auf seltsame Weise. Es scheint, als werde er der deutlichste Irma-Essay. Die Lyrik seines gegenwärtigen Stadiums … Auf diese Weise wird die wahre lyrische Reihenfolge vervollständigt: George, Beer-Hofmann, Kierkegaard, Philippe. Die Beziehung der anderen ist viel lockerer; Novalis: die Stimmung des ersten Treffens; Kassner: Florenz, Ravenna; Storm: Briefe von Nagybánya.« Und am 29. Mai heißt es: »Der Essay über [Paul] Ernst wird ebenfalls ein Essay über Irma.«5
Allerdings befallen Lukács auch Zweifel, ob seine Arbeitsweise die richtige ist. Am 27. Juli 1910 sinniert er im Tagebuch: »Ihr Portrait steht auf meinem Schreibtisch – aus stilistischen Gründen – für den Essay über Philippe. […] Der Essay über Ernst ist vielleicht verdorben worden (oder pathetischer geworden) durch ihre ständige Anwesenheit; sie passte nicht immer organisch in die Parameter des Essays.«6
Die einzelnen Essays aus Die Seele und die Formen verfügen damit letztlich über drei Dimensionen. Zunächst einmal sind sie Interpretationen des Werks jener Autoren, die im Titel genannt werden. Dann spiegelt sich in ihnen Lukács’ Werben um Irma und sein Verzicht. Schließlich behandeln sie die grundsätzliche Frage, wie das Leben sinnvolle Formen annehmen kann oder genauer: wie Lebensvollzug zu formgebender Sinnstiftung werden kann?
Lukács spiegelt sein eigenes Leben immer wieder in der Biographie anderer – eine prominente Stellung kommt dabei Kierkegaard zu, der sein Verhältnis zu Regine Olsen »gedichtet« habe – diese Art des Dichtens diene aber nicht dazu, die Wahrheit zu verbergen, sondern sie überhaupt erst zu sagen. Es ist bezeichnend, dass Lukács hier nicht direkt auf Kierkegaard Bezug nimmt, sondern indirekt Rudolf Kassner zitiert und so die Deutung einer Deutung, also eine Interpretation zweiten Grades vornimmt.7 Gerade diese gesteigerte Distanz von der kruden Wirklichkeit verbürgt für Lukács die höhere Wahrheit der Kunst. Lukács unterstreicht, dass die Trennung von Regine Olsen für Kierkegaard Untergang und Rettung zugleich bedeutet habe – er sei auf der einen Seite ein »bizarrer Sonderling« geworden, auf der anderen Seite habe er seine schöpferische Schwermut bewahren können: »Vielleicht fürchtete er sich davor, dass das Glück nicht unerreichbar wäre, dass Regines Leichtigkeit seine große Schwermut doch hätte erlösen können, und dass sie beide hätten glücklich werden können. Aber was wäre aus ihm geworden, hätte ihm das Leben die Schwermut genommen?« Lebensglück und Lebenssinn erscheinen hier als unversöhnliche Gegensätze – ein bürgerliches Eheglück hätte in Kierkegaard (und damit auch in Lukács selbst) das Sensorium für die »unkörperlichen Erscheinungen« des Lebens erdrückt.8
In einem Brief aus dem Jahr 1910 erklärt Lukács, dass Die Seele und die Formen nicht nur die Literatur in ihren Formproblemen behandle, sondern zugleich auch die »Lebenskunst«, »das Verhältnis von Form und Leben«.9 So heißt es auch im »Novalis«-Essay des Buches: »Eine scheinbar bewußte Abkehr vom Leben war der Preis der romantischen Lebenskunst.«10 Der Zusammenhang von Form und Leben wird in einer berühmten Gegenüberstellung adressiert: Lukács unterscheidet das Leben vom Leben; also die biologische Existenz vom geistigen Dasein.11 Das erstere lohnt sich aus Lukács’ – gut platonischer – Sicht erst dann, wenn das letztere gewährleistet ist. Dabei erweist sich gerade das Leben als äußerst fragile Angelegenheit: Nachdem die ungarische Ausgabe der Seele und die Formen bereits 1910 erschienen ist, wird das Jahr 1911 zum annus horribilis für Lukács. Am 18. Mai nimmt sich Irma Seidler das Leben, am 21. Oktober stirbt der Freund Leo Popper an Tuberkulose. Beide Todesfälle lassen sich aber in Lukács’ ambitiöses Sinnstiftungsprojekt integrieren: Irma Seidler nimmt sich das Leben aus Enttäuschung darüber, dass ihr Leben mit dem ungeliebten Ehemann keine befriedigende Sinnperspektive aufweist. Leo Popper erleidet einen sinnlosen Tod durch eine körperverzehrende Krankheit, bleibt aber als unsichtbarer Gesprächspartner erhalten. Am 18. Dezember 1911 erscheint im Pester Lloyd Lukács’ Nachruf auf Popper, der als tragische Negativfolie für sein eigenes Lebensprojekt gelesen werden kann:
Seine Musik und Malerei konnte sein kranker Körper nicht bis zu Taten bringen, was aber in seinen Essays niedergelegt ist, das ist blühend, mächtig und reich und in sich geschlossen, das verläßt das sinnlos Brüchige seines Lebens, des Lebens; es lebt ein eigenes Leben, es ist zur Form erlöst.
Die Form ist der Gedanke Leo Poppers. Jeder wesentliche Mensch hat nur einen Gedanken; ja es fragt sich, ob der Gedanke überhaupt ein Plural haben kann, ob der wohlfeile Reichtum der Vielheit nicht nur der Oberfläche, dem Ausfüll zukommt. Die Form ist das Bindende und Bannende, das Lösende und Erlösende seiner Welt. Die Kluft zwischen Leben und Werk, zwischen Welt und Form, zwischen Schaffenden, Gestaltung, Gestalt und Aufnehmer hat noch nie jemand soweit aufgerissen, wie er. Die grauenvolle Inadäquatheit des Lebens, wo alles von blinden Kräften getrieben und von verfälschenden Fiktionen aufgefangen wird, war die Voraussetzung dieser Formenwelt, das notwendige, irreparable Mißverständnis jeder Äußerung, ihre Wiege und ihr Weg; die trennende Einheit von Sein und Form. […] Die Form ist die letzte und stärkste Wirklichkeit des Seins.12
Lukács kann Poppers Tod noch im Rahmen seiner Kunstphilosophie bewältigen. Die Wunde, die Irmas Tod hinterlässt, ist tiefer. Am 24. Mai 1911 notiert Lukács in seinem Tagebuch: »Ich habe mein Recht zu leben verloren.«13 Die deutsche Ausgabe von Die Seele und die Formen, die im November 1911 erscheint, verkehrt sich von einer Lebens- in eine Todesschrift. Irma, die für das Leben stand, gehört nun dem Tod. Ursprünglich hatte Lukács eine ausführliche Widmung an Irma Seidler geplant, die als eigentlicher spiritus rector des Buchs auftrat. Er erwog folgende Varianten: »Ich lege dieses Buch in deine Hände, weil du mir mehr gegeben hast, als ich je wiedergeben könnte, alles, was ich bekommen und gewonnen habe. Und sogar, wenn du diesen Ausdruck von Dankbarkeit nicht brauchst oder nicht erträgst, wird er still auf deinen Kopf fallen wie welke Blätter im Herbst«, »Im Andenken an meine ersten Tage in Florenz«, »Ich vertraue dieses Buch jenen Händen an, die es mir gaben«.14 Nach Irmas Selbstmord verkürzt Lukács diese Danksagungen auf eine schlichte Widmung; auch der tote Freund Leo Popper ist als Adressat des in Briefform abgefassten ersten Kapitels präsent. Für den unwissenden Leser ist Lukács’ einschneidendes biographisches Erlebnis nicht erkennbar – Irmas Selbstmord und Poppers Tod haben im literarischen Medium nicht stattgefunden. Lukács weigert sich also in hegelianischer Manier, die Herrschaft der Praxis über die Theorie anzuerkennen. Im Gegenteil: Er unterstreicht den Primat des literarischen Sinns über die Kontingenz des Alltagslebens und verwandelt die Absenz der Toten in eine Präsenz der Lebenden.
1912 entsteht mit dem Text »Von der Armut am Geiste« ein merkwürdiges Gesprächsprotokoll, in dem zwei Selbstmorde thematisiert werden. Geschildert wird aus der Perspektive der Schwester der Selbstmörderin die Geistesverfassung eines Intellektuellen, der eng der Toten verbunden war und sich kurz darauf selbst erschießt. Dabei erscheint der Selbstmord des Intellektuellen nur als konsequente Umsetzung seines seelischen Gestorbenseins: »Selbstmord ist eine Kategorie des Lebens, ich aber bin schon lange gestorben.«15 Ein wenig später heißt es mit einem durchaus altklugen Unterton:
Die Armut am Geiste ist bloß eine Voraussetzung, bloß ein Anfangsstadium der wahren Lebensführung […]. Armut am Geiste ist: sich von der eignen psychologischen Bedingtheit freimachen, um sich der tiefer eignen metaphysischen und metapsychischen Notwendigkeit preiszugeben. Sich aufzugeben, um dadurch das Werk, das von mir aus gesehn nur zufällig mir gehört, wodurch aber ich mir selber notwendig werde, zu realisieren. […] Der Sinn unseres Lebens ist stets von seinen Motiven verdeckt, seine Teleologie von seiner Kausalität, unser Schicksal von unseren Schicksalen.16
In dieser Passage kündigt sich das ebenso utopische wie selbstzerstörerische Ideal der intellektuellen Existenz an, das Lukács anstrebt: Es geht ihm darum, als Urheber in seinem Werk aufzugehen und die zunächst nur zufällige Verbindung von Autor und Text zu einer notwendigen zu machen. Das aber kann nur durch die physische Elimination des Autors gelingen, der so nur noch als Werk präsent ist und sich nicht durch Deutungsvorschläge in die Absolutheit seines Texts einmischen kann.
»Von der Armut am Geiste« ist aber mehr als eine literarische Selbstmordphantasie. Noch im hohen Alter wies Lukács auf die Wichtigkeit dieses kurzen Texts hin und unterstrich seine ethische Schuld an Irmas Selbstmord:
Ich hatte mit Irma Seidler 1907 eine außerordentlich bedeutende Begegnung. Ob man dies nun als Liebe deklariert oder nicht, das ist ein späteres Problem. Aber sie hatte auf meine Entwicklung zwischen 1907 und 1911 einen außerordentlich starken Einfluß. 1911 beging sie Selbstmord. Danach erschien meine Studie Über die seelische Armut. Das ist die Beschreibung ihres Todes und Ausdruck meines Schuldbewußtseins.17
In einer kurzen Notiz aus dem Jahr 1970 stilisiert Lukács die Affäre Seidler zum Wendepunkt in seiner eigenen weltanschaulichen Entwicklung:
Dialog »Armut am Geiste«: Versuch einer ethischen Abrechnung mit meiner Mitschuld am Selbstmord. Hintergrund: Differenzierung der Möglichkeiten ethischer Stellungnahme als geistige Erneuerung des Kastenwesens. Hier Sackgasse deutlich sichtbar.18
Die Zäsur von Irmas Selbstmord, die auch Lukács’ frühen Idealismus mit ins Grab reißt, ist aber keine absolute. Irmas Tod hat durchaus auch eine mäeutische Funktion: Es zeigt für Lukács die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen seines Denkens auf. In einem Gespräch aus dem Jahr 1970 bekennt er:
Im Rückblick ging es mir um zweierlei: einen Weg zu finden, meine eigenen Gefühle und Ideen auszudrücken; einen Weg zu finden, wie ich der sozialistischen Bewegung dienen könnte; dies waren die beiden konvergierenden Tendenzen in meinem Leben. In dieser Hinsicht gab es nie einen Konflikt.19
Lukács betrachtet seine eigene Biographie als konsequente Formleistung, die alle einzelnen Ereignisse in einen größeren Zusammenhang einbindet:
Bei mir ist jede Sache die Fortsetzung von etwas. Ich glaube, in meiner Entwicklung gibt es keine anorganischen Elemente.20
Diese Selbstcharakterisierung ist umso erstaunlicher, als es in Lukács’ Leben in der Tat eine große Zäsur gibt – die Hinwendung zum Kommunismus. Sogar für die Mitglieder des Budapester Sonntagskreises kam diese Konversion überraschend. Anna Lesznai fasste Lukács’ Verwandlung in lapidare Worte: »Lukács’ Auftritt als Kommunist kam als völlige Überraschung für seine Freunde […]. Seine Bekehrung fand in der Pause zwischen zwei Sonntagen statt: Saulus wurde Paulus.«21
Möglicherweise war diese Konversion die ideologische Konsequenz auf Lukács’ biographische Erfahrungen in Heidelberg während des Ersten Weltkriegs. 1914 hatte er die russische Anarchistin Jelena Grabenko geheiratet, die ihm als die inkarnierte Synthese von Dostoevskijs Romanwelt und dem revolutionären Russland erschien.22 Die Ehe mündete jedoch bald in eine Ménage-à-trois mit dem Pianisten Bruno Steinbach. Lukács’ Rolle in dieser Dreiecksbeziehung beschränkte sich bald nur noch auf Aufräumarbeiten – vom Abwasch bis zum Schwangerschaftsabbruch. Im Februar 1915 wandte er sich an Karl Jaspers, den Hausarzt dieser Lebensgemeinschaft, und bat ihn um die Durchführung einer Abtreibung.
Jaspers diagnostizierte im März 1915 bei Steinbach eine »Dementia praecox im Anfangsstadium«, die sich bis 1920 zu einer »schweren geistigen Erkrankung verschlimmerte«. Für Lukács selbst schrieb Jaspers im Herbst 1914 ein Attest zuhanden der österreichisch-ungarischen Militärbehörden. Darin stellte Jaspers bei Lukács einen »neurasthenischen bzw. psychasthenischen Symptomkomplex« fest. In einem zweiten Gutachten vom Juni 1915 hieß es:
Im gesamten psychischen Habitus macht sich bei Herrn v. L. die bei gewissen nervösen Konstitutionen typische übermäßige Bewußtheit und Reflektiertheit in allem Tun geltend, die die augenblickliche Orientierungsfähigkeit in der räumlichen und realen Welt sehr erheblich stört und bei jeder Gelegenheit sowohl körperlich als auch im Verkehr mit Menschen ihn erstaunlich ungeschickt sein läßt.23
Eine wichtige Rolle bei Lukács’ Hinwendung zum Kommunismus spielte auch die Stabilisierung seines Privatlebens durch die Beziehung mit seiner späteren Frau Gertrud Bortstieber im Jahr 1917. Die Gründung einer Lebensgemeinschaft mit der überzeugten Marxistin und ihren beiden Söhnen aus erster Ehe erschien Lukács als Präfiguration eines neuen Gesellschaftsmodells.
Im Dezember 1918 trat Lukács der kommunistischen Partei bei, 1922 erschien sein erstes marxistisches Buch Geschichte und Klassenbewusstsein, das er Gertrud Bortstieber widmete.24 Man kann Lukács’ kommunistische Wende als eine Art biographische Synthese seiner beiden großen Vorbilder Hegel und Marx betrachten. 1916 hatte Lukács in seiner berühmten Theorie des Romans versucht, in der Nachfolge Hegels eine Entwicklungsgeschichte des Verhältnisses von Ich und Welt in den »Formen der großen Epik« nachzuzeichnen. Lukács geht dialektisch vor: Auf den geordneten Kosmos der klassischen Antike, in dem sich selbst noch das tragisch scheiternde Ich in der symbolischen Weltordnung aufgehoben weiß, folgt die Ernüchterung im neuzeitlichen Roman: Das Ich ist zum bloßen »Aufnahmeorgan« der Welt verkommen; »mit dem Zusammenbrechen der Objektwelt ist auch das Subjekt zum Fragment geworden«. Der Held des Romans ist der »transzendentalen Obdachlosigkeit« ausgeliefert. Eine Synthese kündigt sich erst in Dostoevskijs Werken an, die ein neues Verhältnis von Ich und Welt gestalten.25 Lukács nimmt hier Gedanken vorweg, die wenig später von Michail Bachtin aufgegriffen werden. Bachtin konzentriert sich allerdings auf die autonome Stimme, mit denen Dostoevskij seine Handlungsfiguren ausstattet. Bei Bachtin steht das Ich nicht der Welt, sondern dem Anderen gegenüber.
Wie aus den Fragmenten des Dostoevskij-Buchs zu entnehmen ist, glaubt der junge Lukács, die gültige Form der neuen »Erzähl- und Lebensform« in Dostoevskijs Spielart des »Abenteuerromans« zu erkennen – hier ist die bürgerliche Entfaltung des Subjekts in der Zeit überwunden und in einer »anti-westlichen, anti-individualistischen Form von Gemeinschaft« aufgehoben.26 Diese quasikommunistische Vision vor Lukács’ marxistischer Bekehrung findet ihren Vorläufer im kurzen Text »Von der Armut am Geiste«, wo ebenfalls von Dostoevskij als Gestalter einer moralischen Gemeinschaft die Rede ist: »Fürst Myschkin [aus dem Idiot, d. Verf.] und Aljoscha [aus den Brüdern Karamasow] sind gut; was bedeutet das? Ich kann es nicht anders sagen: ihre Erkenntnis ist zur Tat geworden, ihr Denken hat das bloß Diskursive der Erkenntnis verlassen, ihre Betrachtung des Menschen ist eine intellektuelle Anschauung geworden: sie sind Gnostiker der Tat.«27
Ähnlich begeistert äußert sich Lukács in einer Rezension aus dem Jahr 1918 über Dostoevskijs epochale Abstraktionskraft von einer rein materialistischen Betrachtungsweise:
Auf dem Niveau der Seelenwirklichkeit lösen sich alle Bindungen von der Seele, die sie sonst mit ihrer gesellschaftlichen Lage, ihrer Klasse, Abstammung usw. verknüpfen, und an ihre Stelle treten neue, konkrete, Seele mit Seele verbindende Beziehungen. Die Entdeckung dieser neuen Welt war Dostojewskis große Tat.28
Die Theorie des Romans ist für Lukács’ autobiographische Selbstwahrnehmung wichtig, weil er hier im Medium der Literaturtheorie sein eigenes Weltverhältnis reflektiert. Deshalb ist es eigentlich nur folgerichtig, dass Lukács aus diesem Essay, der eigentlich nur ein völlig aus dem Ruder gelaufenes Vorwort zu einem Dostoevskij-Buch darstellt, eine lebenspraktische Folgerung zieht. Das Verhältnis Ich–Welt ist nicht nur ein Problem der Kunst, sondern ein Problem des Lebens. Die Krise, in die es geraten ist, hat ihre reale Wurzel in der kapitalistischen »Verdinglichung«. Lukács sieht sich selbst als Vollender der unterschiedlichen Herangehensweisen an dieses Problem, die von Hegel und Marx vorgeschlagen worden sind: Marx sah die Produktionsverhältnisse als Ausgangspunkt für die totalitäre Eingebundenheit des Ichs in die Welt, bei Hegel sind es die geistigen Verhältnisse. Lukács kombiniert diese beiden Positionen und bringt Hegel und Marx in einer neuen Synthese zusammen. Mit anderen Worten: Was im Bereich der Literatur Dostoevskij ist, das ist im Bereich der Philosophie Lukács.
Deutlich lässt sich diese Selbststilisierung an Lukács’ Biographie des jungen Hegel ablesen. Dieses Buch wurde im Jahr 1938 abgeschlossen. In der Einleitung ruft Lukács immer wieder Marx als Kronzeugen für die Richtigkeit seiner eigenen Hegel-Deutung auf. Gleichzeitig lässt er aber auch keinen Zweifel daran, dass Marx die »spezifisch historische Größe Hegels«29 nur unzureichend gewürdigt hat. Erst Lukács bringt Hegels Idealismus mit Marx’ ökonomischer Gesellschaftsanalyse zusammen.
Der junge Hegel ist deshalb für Lukács sowohl ein Spiegel für seine eigene intellektuelle Biographie als auch ein philosophiegeschichtliches Objekt. In einzelnen Formulierungen des Hegel-Buchs macht sich die autobiographische Relevanz deutlich bemerkbar. So schreibt Lukács etwa:
Das historische Problem des jungen Hegel ist, in der Antike den demokratischen Subjektivismus der Gesellschaft in seiner höchsten und entwickeltsten Form konkret nachzuzeichnen, dann den Untergang dieser Welt, die Entstehung der toten, menschenfremden, despotischen Periode der positiven Religion in düsteren Farben zu schildern, um aus diesem Kontrast die Perspektive der zukünftigen Befreiung zu gewinnen.30
Das aber ist genau Lukács’ eigenes Problem. Er zeichnet den idealistischen Subjektivismus Hegels in seiner höchsten Form nach, dann den Untergang dieser Welt im bürgerlichen Positivismus, um aus diesem Kontrast die zukünftige Befreiung durch eine marxistische Philosophie in seiner eigenen Auslegung zu skizzieren.
In einer späten Aufzeichnung betont Lukács sowohl das Abrupte als auch das Kontinuierliche seiner ideellen Entwicklung. Entscheidend ist die Bezeichnung »Entwicklungsergebnis« – damit wird die Hinwendung zum Kommunismus nicht als plötzliche Erleuchtung, sondern als notwendiges Resultat seiner hegelianischen Jugend präsentiert.
Die Entwicklung zum Kommunisten ist schon die größte Wendung, Entwicklungsergebnis in meinem Leben.31
Dabei ist es gerade die durch Irmas Tod ausgelöste ethische Reflexion, die Lukács – immer aus seiner eigenen Sicht – vor den Gewaltexzessen revolutionärer Aktivitäten bewahrt. Der späte Lukács unterscheidet zwei Phasen in seiner Anhängerschaft zum Kommunismus. Die erste Phase nennt er selbstkritisch »messianisches Sektierertum«, das mit einem Glauben an die unmittelbar bevorstehende Weltrevolution verbunden ist. Die zweite Phase bezeichnet er als politischen Realismus, den er mit den Blum-Thesen von 1928 eingeleitet habe.32 Unter dem Pseudonym Blum hatte Lukács damals statt einer »proletarischen Parteidiktatur« eine »demokratische« Diktatur der Arbeiter und Bauern gefordert.