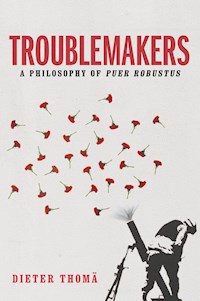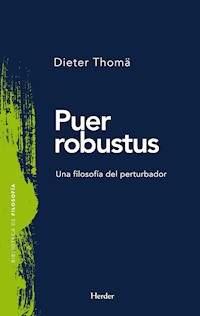19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Demokratie steckt in der schwersten Krise ihrer Geschichte. Menschen sehnen sich seit jeher nach Lichtgestalten. Passt das heute noch in unser aufgeklärtes Weltbild? Ja, sagt Dieter Thomä. Er wendet sich gegen diejenigen, die sich in einer postheroischen Gesellschaft einrichten, und zeigt, wie leblos eine Demokratie ist, in der alle gleich sind. Thomä erklärt, warum heute Menschen gefragt sind, die über sich hinauswachsen und andere motivieren, es ihnen gleich zu tun. Die Demokratie tut gut daran, das Heldentum nicht denen zu überlassen, die autoritär oder fundamentalistisch denken. Denn sie wird nicht nur von Institutionen zusammengehalten, sondern auch von Individuen, die sich für eine Sache einsetzen, die größer ist als sie selbst. Sie machen aus der Kampfeslust eine Tugend und wagen neue Wege. In der Suche nach den richtigen Helden – und im Streit um sie – schärft eine demokratische Gesellschaft ihr Profil. Gerade in Zeiten, in denen sie unter Druck steht, ist dies unverzichtbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Warum Demokratien Helden brauchen.
Der Autor
Dieter Thomä, geboren 1959, ist Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen und leitet dort das Masterprogramm »Management-Organisation- Kultur«. Er war u. a. Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin und am Institute for Advanced Study in Princeton sowie Gastprofessor an der Brown University/USA. Er schreibt regelmäßig für die FrankfurterAllgemeine Zeitung und andere Zeitungen und Zeitschriften. Zu seinen Buchveröffentlichungenzählen Puer robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds, Der Einfall des Lebens und Väter. Eine moderne Heldengeschichte.
Das Buch
»Der Marsch zählte mehr als Hunderttausend, unterm Banner von Refugees Welcome die Mariahilfer hinab, zur Ringstraße, zum Parlament. Um uns Plakate, Europa ohne Mauer, per Megafon postulierte Forderungen, Es ist genug für alle da. Elena neigte sich vor, die rechte Hand um das schwarze Gehäuse der Kamera geschlossen, die Finger der linken am Objektiv. Ein blitzschnelles Ergreifen der Gegenwart, als würde sie mit ihrem ganzen Denken und Fühlen aus der Linse heraus den Moment am Genick packen. Ein dunkelgrünes Schlauchboot wurde vorbeigetragen, daran die Aufschrift: Keine Toten im Mittelmeer. Warst du auch auf so einem?, fragte ich Z. Nein, erwiderte er, meines war kleiner.«
Dieter Thomä
Warum Demokratien Helden brauchen.
Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
ISBN 978-3-8437-2152-3
© 2019 Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinLektorat: Uta RüenauverUmschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, HamburgAutorenfoto: juergen-bauer.comE-Book Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Einleitung
Heldentum und Gefahr
Heldentum und die große Sache
Heldentum und der Höhenunterschied
Dank
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Einleitung
»Wirf den Helden in deiner Seele nicht weg!«
Friedrich Nietzsche
Also sprach Zarathustra
Widmung
Für Gustav Martinsons
und
Otto Thoma-Walford
Einleitung
Heldenplatz
In vielen Städten gibt es Heldenplätze. In Brüssel und Rom dienen sie der Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, in Krakau dem Gedenken an den jüdischen Widerstand gegen die Naziherrschaft. Auf dem Wiener Heldenplatz stehen Statuen von Prinz Eugen, »dem ruhmreichen Sieger über Österreichs Feinde«, und Erzherzog Karl, »dem heldenmüthigen Führer der Heere Österreichs«. Jede Zeit wählt ihre Helden, aber an denen, die verewigt werden sollen, nagt der Zahn der Zeit. Die kürzeste Verweildauer eines Nationalhelden im Pariser Panthéon war fünf Monate.1 Während der rund hundert Jahre seines Bestehens ist auf dem Heldenplatz in Budapest ein Drittel der Denkmäler ausgetauscht worden. Vor wenigen Jahren wurden die faschistischen Symbole auf der Plaza Héroes de España in Melilla beseitigt. Seit einiger Zeit wird in amerikanischen Städten darum gestritten, ob Statuen von Südstaaten-Generälen demontiert werden sollen: Fünfzig von knapp 800 solcher Denkmäler sind zwischen 2015 und 2018 entfernt worden.2
Neben der Umbesetzung oder Absetzung der Helden kommt auch die Umbenennung des ihnen gewidmeten Platzes infrage. Die Bemühungen, den Wiener Heldenplatz in »Platz der Demokratie« umzubenennen, sind freilich im Sande verlaufen. Gegen diese Umbenennung wäre ich auch gewesen – und zwar deshalb, weil sie nahegelegt hätte, dass Helden durch Demokratie ersetzbar wären und in ihr nichts mehr zu suchen hätten. Das stimmt nicht. Nicht jeder Held ist demokratisch, aber jede Demokratie braucht Helden. Welchen Platz Helden in unserer Gesellschaft einnehmen, möchte ich in diesem Buch herausfinden.
Die Helden, die ich suche, sind quicklebendig – anders als jene, derer an Heldenplätzen oder anderen Erinnerungsorten gedacht wird. Und doch lohnt es sich, diese Orte aufzusuchen, an denen Gesellschaften ihre Vorbilder versammeln und ihre Selbstbilder bestimmen. An ihnen wird nämlich deutlich, was für unseren Umgang mit Helden überhaupt gilt: Wenn wir mit ihnen zu tun haben, sind wir immer spät dran.
Nicht immer werden Helden erst von der Nachwelt gekürt, nicht immer kommt der Tod der Ehrung zuvor. Manchmal werden Helden live und in Farbe gefeiert. Aber immer geschieht dies nachträglich, nach ihrer Großtat. Die zu ihnen passende Zeitform ist das Futur zwei: Sie werden Helden gewesen sein. Sie sind früher dran als andere, machen den ersten Zug im Spiel, tun etwas, was nicht erwartet, eingefordert oder angeordnet werden kann. Sie kommen nicht oft, aber unverhofft. Menschen, die Helden gewesen sein werden, gehen in Vorleistung, und die Umwelt, die zur Nachhut wird, schenkt ihnen erst später Aufmerksamkeit und Bewunderung. Helden werden nicht geboren, sie werden gemacht – und zwar rückwirkend.
Der – mehr oder minder große – zeitliche Abstand zwischen einer Großtat und ihrer Heroisierung spiegelt sich in einem – mehr oder minder großen – räumlichen Abstand zwischen Helden und dem Rest der Welt. Gerne stellt man sie auf ein Podest, auf dass sie sich von der Menge abheben. Erkaltet schauen sie auf uns herab. Diese Erhöhung kann aber auch in Form eines spielerischen Rituals erfolgen. So werden Sportler, denen eine vermeintliche Heldentat gelungen ist, von Teammitgliedern oder Fans auf Händen getragen und hoch in der Luft balanciert. Man hebt sie heraus – und zugleich demonstriert man auf diese Weise Verbundenheit mit ihnen.
Das genau ist spannend am Umgang mit Helden: Sie laden ein zu einem Spiel mit Nähe und Ferne. Wir sagen zu ihnen nicht: »Hallo, Nachbarn!« Sie verziehen sich aber auch nicht in den Himmel oder verrammeln sich in Palästen. Helden stehen in der Öffentlichkeit. Sie drücken sich nicht. Zur Not nehmen sie es mit der ganzen Welt auf. Im Glücksfall ziehen sie die ganze Welt auf ihre Seite.
Riesengroß und klitzeklein
Wie geht unsere Gesellschaft mit Helden um? Prominent sind zwei Strategien: Verfremdung und Verniedlichung. Man versetzt Helden in die Ferne oder zieht sie in die nächste Nähe. Man lässt sie nur in Randgrößen zu: entweder riesengroß oder klitzeklein.
XXL-Helden gibt es in rauen Mengen – freilich nur im Film. Die wundersame Vermehrung der Superhelden belegt nicht nur die Geschäftstüchtigkeit von Marvel & Co., sondern auch, dass in den Zuschauern – also in uns – ein unstillbares Bedürfnis nach Heldentum steckt. Dieses Bedürfnis schnellt deshalb in die Höhe, weil Helden außerhalb der Traumfabrik einen schweren Stand haben. Wenn sie in der Wirklichkeit auftreten, machen sie sich klein. Eine Berliner Webseite stellt »Kiezhelden« vor, die zum Beispiel Naturkosmetik oder Secondhand-Mode verkaufen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sucht in einer Anzeige »echte Alltagshelden«, die »Nerven aus Stahl und Herzen aus Gold« haben. Eine Spielzeugfirma verkauft vier Plastikfiguren – Polizistin, Sanitäterin, Feuerwehrmann und Bauarbeiter – als Set von »Alltagshelden« für zwanzig Euro.
Liebling, sie haben die Helden geschrumpft – oder aufgeblasen. Das Heldentum versickert in der Alltagswelt oder verzieht sich in die Scheinwelt. Diese Aufteilung ist bequem für die Seele. Auf der einen Seite erscheint das alltägliche Heldentum nah und greifbar – so, als ob man es sich im Handumdrehen aneignen könnte. Auf der anderen Seite sieht man die Superhelden in einer anderen Liga spielen, lässt sich von ihnen auf eine fantastische Reise mitnehmen und feiert Urlaub vom Ich. Heldentum ist entweder ganz nah oder ganz fern, allgegenwärtig oder nicht von dieser Welt. So haben wir uns das zurechtgelegt ‒ falsch zurechtgelegt.
Unsereins sieht Helden nicht auf Schritt und Tritt und auch nicht morgens im Spiegel. Sie sind keine Menschen wie du und ich, aber Menschen sind sie durchaus – nicht Wunderwesen. Das ist auch gut so, denn deshalb kann man mit ihnen echt etwas anfangen – wenn, ja, wenn man sie denn antrifft.
Krise der Helden
Gerade hieß es: Jede Zeit wählt ihre Helden. Wirklich jede Zeit? Es sieht so aus, als lebten wir in einer Zeit der Heldendämmerung.3 Wenn die moderne Gesellschaft Helden im Alltag verniedlicht oder in eine Scheinwelt abschiebt, dann scheint sie mit ihnen ein grundsätzliches Problem zu haben. Es gibt eine ziemlich große Koalition von Intellektuellen, die glaubt, dass es zurzeit schlecht um Helden bestellt und ihre Existenzgrundlage gefährdet sei. Das Wort »postheroisch« geht immer wieder frisch gezapft über den Tresen der Ideen – wahlweise bezogen auf Politik, Wirtschaft, Kunst, Kriegsführung oder (was wohl nicht das Gleiche ist) Erziehung.4
Die Vertreter dieser großen Koalition können sich nicht recht entscheiden, was vom besagten Verschwinden der Helden zu halten sei. Sie schwanken zwischen Verlusterfahrung und Gewinnerwartung. Mal führt ihr Befund, wir lebten in einer postheroischen Gesellschaft, dazu, dass sie sich trotzig in Heldensehnsucht ergehen, mal finden sie es gerade gut, dass die Welt angeblich in eine postheroische Phase eingetreten ist. Der Abgesang auf den Helden ertönt also in einer traurigen oder einer fröhlichen Version, mit einem Seufzer der Sorge oder einem Seufzer der Erleichterung. Die zwei Arten von Seufzern sind oft kaum auseinanderzuhalten – und das ist kein Zufall.
Die Unschlüssigkeit ist nämlich typisch für alle Zeitdiagnosen, die mit der Vorsilbe »Post-« operieren. Über diese Vorsilbe muss ich ein paar Worte verlieren, denn bei ihr handelt es sich um eine der erfolgreichsten und schlechtesten Erfindungen der neueren Geistesgeschichte. Das Postheroische gehört auf eine Kette, auf der auch Postmoderne, Posthistorie, Postmaterialismus, Poststrukturalismus, Postkolonialismus, Postdemokratie, Posthumanismus, Postkapitalismus, Postdramatisches, Postfaktisches und anderes mehr aufgefädelt sind. Offenbar ist die Menschheit – oder nur ein kleiner, vorwiegend aus Intellektuellen bestehender Teil von ihr – darauf versessen, sich in eine Nachzeit zu versetzen.
Bevor das »Post-« populär wurde, hatte es einen schlechten Ruf. Man erinnere sich an den Spruch Post coitum omne animal triste: Unabhängig davon, ob Tiere oder Menschen nach dem Geschlechtsverkehr wirklich traurig sind, ist jedenfalls klar, dass sie zum »Post«-Zeitpunkt den Höhepunkt hinter sich haben. Warum ist die Vorsilbe »Post-« gleichwohl so attraktiv? Und warum ist diese Attraktion fatal?
Eigentlich ist mit »Post-« nicht furchtbar viel gesagt. Bezeichnet wird damit allgemein eine Phase nach einem Einschnitt oder Ereignis. So spricht man zum Beispiel von postnataler Medizin. Manchmal ist die Verwendung von »Post-« auch Ausdruck einer gewissen Verlegenheit – so etwa, wenn man die disparaten Entwicklungen in der bildenden Kunst um 1900 unter der Überschrift »Postimpressionismus« zusammenfasst.
Die Anziehungskraft des »Post«-Gefühls wächst, wenn Menschen von der schieren Tatsache, dass etwas vorbei ist, ergriffen sind. Es ist kein Zufall, dass die Karriere des »Post-« in einer Nachkriegszeit begann, nämlich in der post-war period nach 1945. Dass der Krieg vorbei war, wurde als Geschenk empfunden. So ist das Gefühl der Befreiung in den frühen Verwendungen des Wortes Postmoderne deutlich zu spüren.
Doch unweigerlich liefert die Vorsilbe »Post-« die Kehrseite zum Gefühl der Befreiung mit, nämlich die Abhängigkeit vom Vorher. Anders als bei früheren Befreiungsschlägen – etwa beim Streit zwischen den Anciens und den Modernes im 17. Jahrhundert oder zwischen Klassik und Romantik – findet sich dieses Mal kein positives Wort, das die neue Phase bezeichnet. So wird die Entlastung, einer Zeit entronnen zu sein, entwertet. Man hängt ihr noch an, bleibt gedanklich unselbstständig und sagt über sich selbst eigentlich nur eins: dass man hinterherkommt.
Die Befreiung ist scheinbar. Alle »Post«-Bewegungen sind unrettbar nostalgisch, und Nostalgie ist der sichere Weg in die Knechtschaft der Geschichte. Wenn man an dem, was davor war, gedanklich festklebt, kann man nicht im Ernst für sich in Anspruch nehmen, in eine andere Zeit vorgerückt zu sein. Der Schuster bleibt dann bei seinen Leisten, die Postmoderne bleibt bei der Moderne. Die Lockerungsübung ist ein Bluff.
Jeder »Post«-Kombination haftet diese Unschärfe an: Sie bietet eine Spielwiese für Unentschiedene, die zwischen Jubel und Trauer, Abkehr und Anhänglichkeit, Gewinn und Verlust schwanken. Mal klingt der Jubel lauter (zum Beispiel bei den frühen Vertretern der Postmoderne), mal überwiegt die Klage (etwa bei den Diagnostikern der Postdemokratie). Doch aus der Ambivalenz gibt es so oder so kein Entkommen.
Angesichts des Erfolges der »Post«-Komposita darf man sagen: Genau diese Unentschlossenheit scheint auf viele Meinungsführer – was für ein grausiges Wort! – einen großen Reiz auszuüben. Sie können stolz behaupten, etwas hinter sich gelassen zu haben, und gleichzeitig auf die Botschaft, wohin die Reise geht, verzichten. Sie wollen sich einen Vorsprung sichern, bewegen sich aber mit starrem Blick auf die Herkunft und wenden der Zukunft den Rücken zu. Doch wer rückwärtsgeht, kann leicht stolpern.
Den »Post«-Ideologen ist zugutegehalten worden, dass sie sich – im Unterschied etwa zu den Vertretern der Moderne oder der Avantgarde – mit großen Gesten des Neuanfangs zurückhielten, also von vornherein zugäben, dass sie in die Geschichte eingebettet seien. Wer sie dafür lobt, tut ihnen aber zu viel des Guten. Dass jemand bekennt, zu den Nachgeborenen zu gehören, ist zum Gähnen.
Auch die Theoretiker des Postheroischen machen es sich in der Halbdistanz zum Heroischen bequem und lassen alles unschön in der Schwebe. Sie üben sich im kleinen Abschied und kommen von den Helden, die sie der Vorzeit zuschlagen, doch nicht los. Sie behaupten, dass wir in einer postheroischen Gesellschaft lebten, und fügen hinzu, dass wir »ohne Rückgriff auf einen Restbestand des Heroischen nicht überlebensfähig« seien.5 Die Vorstellung von einer postheroischen Zeit, die bei Bedarf ein bisschen heroisch agiert, ist fast so absurd wie das postnatale Bild einer jungen Mutter, die noch ein bisschen schwanger ist. Es ergibt keinen Sinn, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Man kann nicht die Helden zugleich abschaffen und für sich anschaffen lassen.
Ich gehöre nicht zu den Anhängern der These von der postheroischen Gesellschaft. Vielmehr glaube ich an die Wirklichkeit und Wirksamkeit von Helden heute. Sie haben sich nicht aus dem Staub gemacht und sind auch nicht zu Staub zerfallen. Dabei will ich die Schwierigkeiten mit dem Heroismus, an denen wir laborieren, keineswegs leugnen. Mir ist es recht, wenn die Latte für Helden hoch gelegt wird. Dann ist es am Ende auch keine Lappalie, wenn sie drüberspringen. Von Schwierigkeiten lassen sich Helden sowieso nicht ins Bockshorn jagen ‒ sie sind daran gewöhnt, es nicht leicht zu haben.
Wir leben in einer Zeit der Heldendämmerung? Das mag wohl sein, aber dieses Wort mache ich mir gern zu eigen, denn ihm merkt man nicht an, ob die Abend- oder Morgendämmerung gemeint ist, ob es Nacht wird oder der Tag anbricht. In Anlehnung an die berühmte Gedichtzeile von Stefan George möchte ich ausrufen: »Komm zu dem totgesagten Helden und schau.«6
Krise der Demokratie
Der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson schrieb im Jahre 1841: »Wer heldenhaft ist, wird immer Krisen finden, um an seine Grenzen zu gehen.«7 Eine Krise zu finden ist heute eine leichte Übung. Bekanntlich ist unsere Gesellschaft gleich mehrfach in der Krise – ökologisch, ökonomisch und politisch. Eine Krise überwindet man, indem man handelt, und wenn dieses Handeln nicht von privater Willkür getrieben sein soll, dann muss es im politischen Raum stattfinden. Damit rückt die Frage ins Zentrum, ob die Form von Politik, die in unserer Gesellschaft etabliert ist, Zukunft hat: die Demokratie. Es hat keinen Sinn, darum herumzureden: Die Demokratie befindet sich in ihrer tiefsten Krise seit 1945.
Zum einen ist der Absatz für das Exportgut Demokratie ins Stocken geraten. Seit dem 18. Jahrhundert wurde die Demokratie im Paket angeboten. Damals lancierte Europa das vermeintlich unschlagbare und untrennbare Tandem politischer und ökonomischer Freiheit. Vielleicht war dieses Tandem immer schon eine Scheinehe, doch dessen ungeachtet wurde es nach Ende des Kalten Kriegs als globales Erfolgsmodell propagiert. Nun ist es arg lädiert. Das derzeit bevölkerungsreichste Land der Welt, China, nutzt die Freiheit des Marktes und pfeift auf die Regeln der Demokratie. Weltweit brummt der Kapitalismus, und die Demokratie lahmt.
Zum anderen bröckelt die Binnennachfrage nach Demokratie. Im derzeit mächtigsten Land der Welt, den USA, wird die Demokratie innerlich ausgehöhlt, in vielen Ländern herrscht Demokratiemüdigkeit.8 Während der Kapitalismus aus der Finanzkrise wie aus einer Verjüngungskur hervorgegangen ist, steht die Demokratie als Verlierer da. Die Menschen machen Verlusterfahrungen und schließen die Reihen. Der Populismus ist ein Kind der Wall Street. Im Juni 2018 wurden 125 000 Personen aus fünfzig Ländern zu ihrer Einschätzung der Demokratie befragt, und die Ergebnisse fielen reichlich ernüchternd aus. Auf die Frage »Denken Sie, dass die Stimme von Leuten wie Ihnen in der Politik gehört wird?« antworteten 51 Prozent der Befragten in sogenannten freien Ländern (wie Norwegen oder Deutschland), dies sei nie oder selten der Fall. In sogenannten unfreien Ländern (wie Vietnam oder Algerien) verneinten dies 46 Prozent. Noch krasser waren die Antworten auf die Frage: »Denken Sie, dass Ihre Regierung in Ihrem Interesse handelt?« Hier waren es in den freien Ländern 58 Prozent, die mit »nie« oder »selten« antworteten, in den unfreien Ländern nur 41 Prozent.9 Der britische Historiker Timothy Garton Ash erklärt: »Es gibt heute mehr Demokratie in der Welt als jemals zuvor. Aber jetzt kommt die antiliberale Konterrevolution, und zwar von allen Seiten gleichzeitig.« Die amerikanischen Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Ziblatt sagen: »Die Demokratie scheint weltweit in Gefahr zu sein – selbst dort, wo sie seit Langem als selbstverständlich gilt.« Und der österreichische Schriftsteller Robert Menasse warnt: »Wenn wir aus dieser Krise, die die Entwicklung der europäischen Demokratie infrage stellt, nicht herauskommen, dann wird es Trümmer geben.«10
Im Äußeren wie im Inneren ist die Demokratie in die Defensive geraten. Ihre Strahlkraft und Widerstandsfähigkeit sind auf einem Tiefpunkt. Ob in der Gefahr das Rettende wächst, weiß niemand. Von Helden jedoch weiß man, dass sie ins Handeln und »ins Gelingen verliebt« sind,11 und deshalb wäre es in der aktuellen Situation ein bisschen leichtfertig, sie im toten Winkel der Geschichte verstauben zu lassen. Die Demokratie könnte sich in schwerer Zeit auf deren besondere Geistesgegenwart stützen. Mein Interesse an Helden rührt nicht daher, dass ich ein Faible für sie habe und ihnen den roten Teppich ausrolle, egal wie sie sich aufführen. Von vielen Helden – nicht nur von Maul-, Pantoffel- oder Weiberhelden – halte ich nichts. Ich habe eine ganz bestimmte Erwartung an sie: Helden können helfen, die politische Krise zu überwinden – und zwar nicht, indem sie die Demokratie abwickeln, sondern indem sie sie stärken. Gesucht sind demokratische Helden.
Das Verhältnis zwischen Heldentum und Demokratie ist keine Liebe auf den ersten Blick. Das hat einen einfachen Grund. Helden sind früh dran, Demokraten sind Spätlinge der Geschichte. Sie treffen – wenn überhaupt – erst nach langem Vorlauf zusammen. Als sich die Bürger Athens vor gut 2500 Jahren in einem demokratischen Club zusammentaten, war die Heroenzeit bereits Vergangenheit. Von ihr blieben Geschichten früherer oder auch nur erfundener Großtaten. Als die Amerikaner und Franzosen vor rund 250 Jahren ihre Revolutionen anzettelten, hatten die Ritter längst ihre heldenhaften Abenteuer mehr oder minder erfolgreich bestanden und waren zu Folklore geworden. Der kolossale Herkules, den die Revolutionäre in Paris zu ihrer Symbolfigur kürten, hatte bereits ein paar Jahrtausende auf dem Buckel. Dass die Demokratie mit Helden fremdelt, liegt zunächst daran, dass beide nicht Kinder derselben Zeit sind. Der historische Abstand sorgt für Verständigungsprobleme. Er schließt aber nicht aus, dass Helden zu Zeit- und Bundesgenossen der Demokratie werden können.
Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sagte in einem Gespräch mit dem Spiegel im Herbst 2017: »Warum darf es denn kein demokratisches Heldentum geben? Vielleicht ist ja genau das unsere Aufgabe: so etwas für das 21. Jahrhundert gemeinsam neu zu erfinden.«12 Man kann sich darüber amüsieren, dass er damals eilig beteuerte: »Damit meine ich nicht, dass ich hier den Helden spielen will.« Seit Macron dieses Interview gegeben hat, ist es ihm gelungen, jeden Heldenverdacht von sich abzulenken. Das ändert nichts daran, dass man die Frage, wie es die Demokratie mit den Helden hält, ernst nehmen sollte.
In dieser Frage vermischen sich Wirklichkeit und Wunsch oder Sein und Sollen. Zum einen geht es darum, ob es in der Demokratie überhaupt Helden gibt, ob diese Staats- und Gesellschaftsform so etwas wie Helden ermöglicht oder zulässt. Zum anderen geht es darum, was Menschen in der Demokratie von Helden halten ‒ ob sie sie wollen, gut finden und willkommen heißen. Daraus ergibt sich ein einfaches Schema mit vier Optionen, die für den Umgang mit Helden zur Wahl stehen.
Zunächst kann man zu dem Befund gelangen, dass es heutzutage gar keine Helden mehr gibt. Ihre Abwesenheit wird man dann in einem nächsten Schritt gut oder schlecht finden. Man wird sagen: Das soll so sein – oder eben nicht. Diese zwei Optionen lassen sich den verschiedenen Verfechtern der These von der postheroischen Gesellschaft zuordnen. Sie loben oder hassen die Demokratie dafür, das Heldentum abgeschafft zu haben. Und wenn sie sich nicht entscheiden können, pflegen sie ihre Hassliebe.
Die Vertreter der dritten Option gehen davon aus, dass es heutzutage in der Tat Helden gibt, meinen aber, sie könnten der Demokratie gefährlich werden. Für sie stehen Helden unter dem Verdacht, übertriebene Machtansprüche oder autoritäre Denkmuster zu vertreten. Demnach gilt: Helden gibt es wirklich, aber es wäre besser, sie loszuwerden.
Schließlich bleibt die Option, Helden sowohl für wirklich als auch für wünschenswert zu halten. Dieser Auffassung möchte ich mich anschließen.
Wer von Helden spricht, muss wissen, was sie treiben und wie sie ticken. Er muss sie erkennen, wenn sie ihm über den Weg laufen. Deshalb möchte ich sie nicht einfach hochleben lassen, sondern zuerst eine nüchterne Frage stellen: Was ist überhaupt ein Held? Der Philosoph Maurice Merleau-Ponty schrieb 1948 (also wohlgemerkt zu einer Zeit, als der Kurs des Heldentums auf ein Rekordtief gesunken war): »Wie soll man ein Loblied auf den Heroismus anstimmen, wenn man ein Held ist? Und wie soll man es tun, wenn man keiner ist? Es wäre also besser, man wüsste, was hinter diesem großen Wort steckt.«13
Meiner kleinen Heldenkunde muss ich eine Bemerkung zur Wortwahl vorausschicken. Wenn hier und im Folgenden von Helden die Rede ist, soll damit nichts über ihr Geschlecht gesagt sein. Die geschlechtliche Offenheit, die den Worten »Heldentum«, »heldenhaft« oder – sowieso – »Heroismus« zukommt, möchte ich auch für »Helden« beanspruchen. Es liegt mir freilich fern, mich auf diesem Wort, als sei es neutral, auszuruhen. Vielmehr soll in der Rede vom Helden auch so etwas wie eine historische Gewissenhaftigkeit oder ein historisches Gewissen mit Blick auf die Geschlechterfrage zum Ausdruck kommen.
Es ist bekannt, dass das Heldentum in der Geschichte – manchmal stillschweigend, meist lautschreierisch – zur männlichen Domäne erklärt wurde. Das machte es nicht einfach für Männer, die keine männlichen, sondern einfach menschliche Helden sein wollten. Richtig bitter war jedoch die Lage der Frauen. Ihnen standen drei Wege offen. Zum Ersten konnten sie eine speziell definierte Rolle als Heldin spielen, die der des Helden geradewegs entgegengesetzt war. Peter Burke schreibt: »Die meisten populären Heldinnen waren eher Objekte als aktive Menschen; man bewunderte sie nicht, weil sie etwas taten, sondern weil sie viel erlitten.«14 Als typische, bei genauerem Hinsehen ziemlich deprimierende Beispiele aus der Märchenwelt mögen Aschenputtel und Schneewittchen dienen, die in einer unschuldigen, ahnungslosen, verletzlichen, passiven Haltung verharrten. Zum Zweiten konnten Frauen versuchen, in die männliche Heldendomäne einzubrechen, mussten dann aber das vergiftete Kompliment ertragen, sie würden handeln wie »richtige Männer«. Die Rede war dann etwa von Mannweibern. Zum Dritten blieb Frauen noch, sowohl dem passiven Heldinnen- wie auch dem aktiven Heldenmodell zu entsagen und sich auf einen durch und durch unheroischen Alltag zurückzuziehen. Dreht man diese letzte Variante ins Offensive, landet man bei der zeitgenössischen Position, die Heroismus in all seinen Spielarten für überholt hält, oder bei einem postheroischen Feminismus. Der Gegenentwurf dazu bestünde darin, dass Frauen und Männer die Geschlechterklischees überwinden und sich an Heldinnen und Helden in einem neuen Sinne erfreuen. Ich würde mich freuen, wenn sie dies täten.
Noch heute gibt es Theoretiker der Männlichkeit,15 die glauben, dass wahre Männer Helden sein müssten und – vor allem – dass wahre Helden nur Männer sein könnten. Wer ihnen glaubt, legt Wert darauf, im Stehen zu pinkeln,16 und kauft sich beim Versand The Art of Manliness ein T-Shirt, das ein von einem Zylinder gekrönter Totenkopf und die Aufschrift »Gentleman/Barbarian« schmückt. Als Kanye West im Oktober 2018 Donald Trump im Weißen Haus besuchte, hielt er einen der irrsten Monologe der neueren Geschichte und sprach unter anderem darüber, wie ihm seine »Make America Great Again«-Kappe beim Wiederfinden seiner Männlichkeit half: »Diese Kappe, sie gibt mir Kraft. […] Bei mir zu Hause gab es nicht viel männliche Energie. […] Als ich diese Kappe aufsetzte, fühlte ich mich wie Superman. Du [Donald Trump] hast uns in Superman verwandelt, und der ist mein Lieblingssuperheld.«17
Statt die Held-Mann-Gleichung hinzunehmen, werde ich aus ihr machen, was sie ist: ein echtes Problem. Um dieses Problem behandeln und den Helden auf die Finger schauen zu können, bleibt nichts anderes, als weiterhin von ihnen zu reden. Auch wenn ich im Turnunterricht nie einen Spagat geschafft habe, werde ich ihn im Feld der Sprache kräftig üben, also versuchen, die Spannung zwischen dem Heldentum der Menschen und dem Heldentum der Männer auszuhalten. Umstritten ist Heldentum so oder so.
Was ist überhaupt ein Held?
Während des Ersten Weltkriegs bot eine Fabrik in Deutschland »fertige Denkmalsrosse mit nach Wahl aufschraubbaren Helden« an.18 Zwar gibt es für Waren dieser Art heute keine Nachfrage mehr, doch vielleicht lässt sich in Anlehnung daran ein neues Geschäftsmodell entwickeln: eine Heldenherstellung mit 3-D-Druckern. Da diese Geräte enorm variabel sind, könnte jeder seinen Helden mitsamt personalisierten Zutaten auswählen und wenig später eine stattliche Statue in Empfang nehmen. Eine feine Sache!
Ich lade dazu ein, sich eine Ausstellung vorzustellen, in der all diese Statuen in bunter Mischung präsentiert würden. In solch einer Heldenschau würde es hoch hergehen. Viele Besucher würden mit einem Helden nach ihrer Façon glücklich werden, sich aber darüber aufregen, was dort sonst noch für Typen hochgejubelt werden. Was dem einen sein Held, ist dem anderen sein Unhold. Einige würden mit allen Exemplaren fremdeln und darauf beharren, dass Helden viel mit Dinosauriern gemeinsam hätten: Sie seien übergroß und ausgestorben.
So oder so würden die Ausstellungsbesucher nicht nur Vorlieben oder Abneigungen gegenüber einzelnen Figuren zum Ausdruck bringen, sie würden ihre Urteile auch auf starke Meinungen darüber stützen, was einen Helden eigentlich ausmacht – und diese Meinungen wären sehr unterschiedlich. Wer die Diskussion von außen betrachtete, müsste achselzuckend zu dem Schluss kommen: Heldentum ist Ansichtssache.
Auskünfte dieser Art hört man auch sonst oft. Was ist Glück? Das sei, so heißt es, sehr subjektiv. Was ist Liebe? Das bleibe, bitte schön, Privatsache. Was ist Kunst? Das liege im Auge des Betrachters. Philosophen hassen solche Aussagen, denn sie verderben ihnen das Geschäft, nämlich die Arbeit am Begriff.
Bei Philosophen, die schwer greifbaren Phänomenen gegenüberstehen, sind zwei entgegengesetzte Reaktionen zu beobachten: Entweder sie rümpfen die Nase, oder ihnen läuft das Wasser im Mund zusammen. Entweder sie lassen ihren Hass gegen Ansichtssachen an den Sachen aus, die für verschiedene Deutungen anfällig sind, und beschließen, sich mit so unzuverlässigem Zeug nicht mehr zu befassen, oder aber die Philosophen entwickeln einen besonderen Ehrgeiz, just über solche Phänomene etwas Haltbares herauszufinden, das sich nicht im Allerlei der Sichtweisen auflöst. So stürzen sie sich auf Glück, Liebe, Kunst – oder eben Heldentum.
Die meisten Philosophen der Vergangenheit gehören zur zweiten, die meisten Philosophen der Gegenwart zur ersten Gruppe. Letztere überlassen das Heldenthema gern anderen: Historikern, Psychologen, Literaturwissenschaftlern. Zu den großen Geistern, die sich mit dem Heldentum befasst haben, gehören immerhin Platon, Giordano Bruno, Giambattista Vico, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Søren Kierkegaard, Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche, Max Weber, William James, Walter Benjamin, Hannah Arendt, der Phänomenologe Maurice Merleau-Ponty, der analytische Philosoph James O. Urmson, der Moralphilosoph Alasdair MacIntyre und noch viele andere. Diese stattliche Versammlung ist Ermutigung genug, Heldentum nicht als Ansichtssache abzutun.19
Wer den Helden bestimmen will, darf nicht ignorieren, dass über ihn verschiedene Sichtweisen im Umlauf sind. Frustrierend ist das nicht – im Gegenteil. Solche Sichtweisen setzen bei bestimmten Eigenschaften des Helden an und geben ihnen einen speziellen Dreh. Das heißt: Sie lösen den Begriff des Helden nicht in Luft auf, sondern sind auf ihn als Vorlage angewiesen. Ute Frevert schreibt: »Was bleibt, ist der Begriff. Gerade hier aber liegt das Sperrige. Dass er nach wie vor in Gebrauch ist und nicht, was naheläge, durch den des Idols, des Stars, des Vorbilds ersetzt wurde, lässt auf eine besondere Strahlkraft schließen.«20
Was also ist ein Held? Er weist drei Merkmale auf.
1.Helden stellen sich der Gefahr. Helden setzen sich widrigen Umständen aus, geben sich einen Ruck, überwinden ihre Angst und wissen nicht, ob sie ungeschoren davonkommen. Man könnte sagen, dass sie sich aufs Spiel setzen, wenn es sich denn nur um ein Spiel handelte. Damit unterscheiden sie sich von Alleskönnern, die die erstaunlichsten Großtaten vollbringen, ohne je auf Widerstand zu stoßen oder in die Bredouille zu geraten. Solche Typen kennt man: Sie heißen Götter. »Wenn der Held gottgleich wäre, wenn er, wie die Götter, von Alter und Tod ausgenommen wäre, dann wäre er überhaupt kein Held.«21 Bei der Schilderung der Scharmützel zwischen Göttern muss man gelegentlich ein Gähnen unterdrücken, und es hat wohl mit dieser gepflegten Langeweile zu tun, dass sich Helden über Jahrtausende hinweg erfolgreich gegen Götter behauptet haben.
Die anonymen Dichter des Gilgamesch-Epos machten neben Gilgamesch (ein Drittel Mensch, zwei Drittel Gott) den sterblichen, verletzlichen König Enkidu zur Hauptfigur und erkannten in ihm den »Ur-Menschen« und »Helden«.22 Homer erzählte von Achill und Odysseus und hatte für die Götter nur Nebenrollen übrig. Richard Wagner bot Helden auf, um die Welt »von der erlahmten und verkrampften Herrschaft der Götter [zu] erlösen«.23 Stan Lee, der legendäre, 2018 verstorbene Begründer des Marvel-Imperiums, legte Wert darauf, dass seine Superhelden wie »Menschen aus Fleisch und Blut« wirkten und von Schwächen und Unsicherheiten geplagt wurden.
Warum unfehlbaren Überfliegern der ganz große Erfolg versagt bleibt, erklärte Umberto Eco schon vor mehr als fünfzig Jahren:
Superman […] befindet sich in der bedenklichen […] Situation, ein Held ohne Gegner und damit ohne Entwicklungsmöglichkeiten zu sein. […] Ein unsterblicher Superman wäre kein Mensch, sondern ein Gott, und die Identifikation des Publikums mit seiner […] Persönlichkeit […] ginge ins Leere.24
Helden haben wunde Punkte. Wie die Helden den Allmächtigen fernstehen, die keine Gefahr kennen, so unterscheiden sie sich auch von den Ohnmächtigen, die gleich klein beigeben und jeder Gefahr aus dem Weg gehen, indem sie sich unterwerfen, anpassen oder verkriechen. Neben die Unverwundbaren treten jene, die einfach deshalb ohne Verwundung davonkommen, weil sie vor jeder Schere, jedem Messer und jedem scharfen Wort Reißaus nehmen. Das sind die Leute, die schon ihr Brot geschnitten kaufen. Es gibt eine Koalition der Gefahrlosen, der Allmächtige und Ohnmächtige gleichermaßen angehören. Aus ihr brechen Helden aus.
Welcher Art die Gefahr ist, der sich Helden zu stellen haben, darüber gehen die Ansichten auseinander. Umstritten ist, ob die Stunde der Helden nur dann schlägt, wenn sie auf äußere Hindernisse oder Gegner treffen, oder ob sie sich auch im Kampf gegen sich selbst, also gegen innere Widerstände, bewähren können. Umstritten ist vor allem, ob es beim Heldentum immer um Leben und Tod gehen muss. Viele Beispiele weisen in diese Richtung, doch hier trifft man auf erhebliche kulturelle Unterschiede. So ist zum Beispiel in den USA der Kurzschluss zwischen Helden- und Kriegertum als Männerfantasie besonders verbreitet, aber gerade dort betreibt man die Verehrung von Helden ziemlich großzügig25 und schreibt ihnen keineswegs ins Pflichtenheft, dem Tod ins Auge sehen zu müssen. Wenn dort von heroes die Rede ist, kann sich die deutsche Übersetzung oft mit »Vorbildern« begnügen.
Welcher Art die Gefahr auch immer sein mag, der sich Helden stellen, sie müssen im Umgang mit ihr jedenfalls ihre Tatkraft beweisen. Wer sich als Alleskönner ausgibt, aber die Beine baumeln lässt, ist nur ein Angeber. Ins Zeug legen muss sich schon, wer heldenhaft sein will.
2.Helden widmen sich einer Sache, die größer ist als sie selbst. Nicht jeder, der sich Gefahren aussetzt, ist schon ein Held. Hier sind zwei Beispiele: Ich erinnere an den Österreicher Felix Baumgartner, der am 14. Oktober 2012 mit einem Heliumballon in die Stratosphäre aufstieg, sich aus fast vierzig Kilometer Höhe nach unten stürzte und im freien Fall eine Geschwindigkeit von 1357,6 Kilometer pro Stunde erreichte, bis dann sein Fallschirm aufsprang. Oder man denke an die Französin Tatiana-Mosio Bongonga, die am 21. Juli 2018 an der Pariser Kirche Sacré-Cœur in fast vierzig Meter Höhe ohne schützendes Netz einen Drahtseilakt aufführte. Beide haben Besonderes geleistet, doch man sträubt sich, ihnen Heldentum zuzuschreiben. Das liegt daran, dass das, was sie tun, Privatsache bleibt. Solche Ausnahmekönner machen obsessiv ihr Ding; häufig entwickeln sie ein Geschäftsmodell, mit dem sie ihre extremen Leistungen vermarkten. Indem sie sich von privaten Motiven leiten lassen, wahren sie Distanz zum Publikum, dem sie den Atem rauben.
Bei Helden ist das anders. Sie widmen sich einer Sache, die größer ist als sie selbst, und stellen diese Sache über ihr eigenes Wohl. Deshalb muss ihnen auch eine Eigenschaft wesensfremd sein, die bei Scheinhelden häufig auftritt: Eitelkeit. Helden zeigen unbedingtes Engagement oder gar die Bereitschaft, sich zu opfern. Sie tun sich dadurch hervor, dass sie sich als Individuen zurücknehmen. So wirken sie einladend. Sie eröffnen einen Raum, den andere betreten können, die nicht nur zahlende Zuschauer oder ferne Zeugen sind, sondern sich mit einer großen Sache identifizieren. Diese bleibt Kopfgeburt und Totgeburt, wenn sie bei niemandem Anklang findet. Helden sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass jener Raum tatsächlich von anderen betreten wird.
Zwei Bewegungen müssen also zusammenspielen: Ein Mensch wächst als Held über sich hinaus und steht für etwas, bei dem es sich nicht nur um seine Privatsache handelt. Es geht nicht nur um ihn. Genau davon können andere Menschen sich angezogen fühlen. Es geht nicht nur um sie.