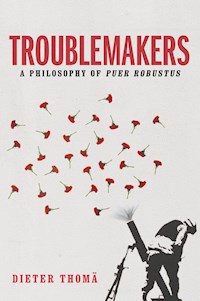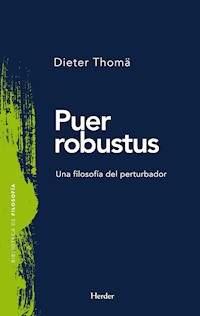23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bei der Vorsilbe Post- handelt es sich um die erfolgreichste Erfindung der Geistes- und Sozialwissenschaften seit 1945. Zum weltweiten Einsatz kommt sie in Großwörtern wie Posthistoire, Postmoderne oder Postkolonialismus sowie in zahllosen weiteren Kombinationen. Offensichtlich ist es Trend geworden, sich in die Nachzeit einer Vorzeit zu versetzen. Doch nicht hinter jedem Erfolg steckt eine gute Idee. Das ist auch hier der Fall, wie Dieter Thomä in seiner aufregenden Kritik jener Geistes- und Lebenshaltung zeigt, die auf den Post-Weg geraten ist.
Nicht nur zeugt es laut Thomä von epochaler Einfallslosigkeit, ein altes Wort mit Post- zu schmücken und als letzten Schrei auszugeben. Darüber hinaus haben die Post-Theoretiker ein grundsätzliches Problem: Sie lassen etwas hinter sich und schleppen es doch weiter mit. Sie fahren in die Zukunft, schauen dabei aber dauernd in den Rückspiegel. Sie bleiben in der Ambivalenz zwischen Anhänglichkeit und Aufbruch stecken. Höchste Zeit also für die Verabschiedung der Postismen unserer Zeit. Dieses Buch ist ihr Nachruf und zugleich ein Plädoyer für etwas von ihnen Verschiedenes: Geistesgegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
3Dieter Thomä
Post-
Nachruf auf eine Vorsilbe
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth, Berlin
eISBN 978-3-518-78234-7
www.suhrkamp.de
Widmung
7»Für immer und dich«,
für Daniela
Il n'y a plus d'après.
Juliette Gréco, Guy Béart (1960)
Well, baby, baby, baby, you're out of time.
Mick Jagger, Keith Richards (1966)
Where are we now?
David Bowie (2013)
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
I
. Einleitung
1. Drall zurück
2. Erfolgsgeschichte
3. Einfallslosigkeit
4. Spiel mit Zeit
5. Double Bind
6. Nachträglichkeit
7. Neue Wissenschaft von den Vorsilben
8. Nachkrieg
9. Nachruf
10. Die großen Drei
II
. Posthistoire
1. Fußnote
2. Paraphrase und Propaganda: Kojève als Hegel-Leser
3. Schaffen bis zur Erschöpfung, Kämpfen bis zum Sieg
4. Ruhe nach dem Sturm: Heute ist der beste Tag, genau wie morgen
5. Tiere unter Aufsicht: Die Spaltung der Menschheit in Elite und Masse
6. Napoleon oder Stalin:
Whodunnit?
7. Pferdewette: Kojève als käuflicher Geist
8. Graue Eminenz: Kojève als Verwalter Europas
9. Paradies als Konzentrationslager
10. Überraschungslosigkeit: Gehlens stationäre Zivilisation
11. Sieg des Videorecorders: Fukuyamas liberale Demokratie
12. Triumph und Trauer: Fukuyamas Etikettenschwindel
13. Zur Zeit wird hier der Raum
Anhang Postheroisch: Scheuklappen oder schöne Anstrengung
III
. Postmoderne
1. Am Fuß der Black Mountains: Charles Olson als Archäologe des Morgens
2. Am Fuß des Schwarzwalds: Leslie Fiedler will raus aus der Wüste der Langeweile
3. Auf dem Strip in Las Vegas: Charles Jencks setzt die Welt in Anführungszeichen
4. Am Rande des Sumpfs von Paris: Jean-François Lyotard will ja nur spielen
5. Die Moderne, gevierteilt
6. Ein Postmoderner, der keiner sein will: Jacques Derrida
7. Ein Postmoderner, der keiner ist: Michel Foucault
Anhang
I
Posthumanismus und der Ekel vor der
wet ware
Anhang
II
Posttraumatisch: Hanya Yanagihara oder Parul Sehgal
Anhang
III
Post-Truth: Donald Trump oder David Foster Wallace
IV
. Postkolonialismus
1. Moralthermometer
2. Sprung nach vorn und Rückzieher: Frantz Fanon
3.
Post-
zwischen
Neo-
und
De-
4. Dolorismus
5. Indigen: Kultur des Lebens versus Kultur des Todes
6. Subaltern, intersektional: Vorsprung durch Betroffenheit
7. Hybrid: Haben sie gut gemischt?
8. Sind Menschen »Menschen«?
9. Ist der Mensch ein »Individuum«?
10. Israel/Palästina: Die Ökonomie des Opfers und die Irrelevanz der Schuld
V
. Schluss
1. Lücke
2. Heimspiel
3. Heilstätte oder Drohkulisse
4. Schwellenlust
Anmerkungen
I
. Einleitung
II
. Posthistoire
III
. Postmoderne
IV
. Postkolonialismus
V
. Schluss
Nachbemerkung und Dank
Namenregister
Informationen zum Buch
3
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
233
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
9
I. Einleitung
11
1. Drall zurück
Nur wenige Sätze aus dem 20. Jahrhundert haben Eingang in die Schatzkammer gefunden, in der Denkwürdiges für alle Zeit aufbewahrt wird. Zu ihnen zählt einer, den Michail Gorbatschow, damals mächtigster Mann der Sowjetunion, kurz vor dem Mauerfall 1989 gesagt haben soll: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.« Wer die rechte Gelegenheit verpasst, hat demnach nicht nur Pech gehabt, sondern bringt sich in Gefahr. Dringend wird empfohlen, die Zeit bei den Hörnern zu packen oder, weniger kämpferisch ausgedrückt, bereit zu sein, wenn etwas ansteht. Jener Satz erklärt die Geistesgegenwart zur Tugend.
Sie lässt sich nicht ausleben, wenn man dem, was war, nachhängt. Wer einer verflossenen Liebe nachtrauert, verpasst den Augenaufschlag im Hier und Jetzt. Wer sich im Groll verbeißt, kann nur nachkarten. Wer in Nostalgie schwelgt, tummelt sich in einem ewiggestrigen Paradies. Ist der Geist der Vergangenheit verfallen, verwandelt sich »Dasein« in »Gewesensein«.1
Wer zu spät kommt, vertut sich in der Zeit. Und seine Strafe besteht darin, dass er die Feier, das Spiel, das Rendezvous, den Sonnenaufgang, die gute Gelegenheit verpasst. Besser scheint davonzukommen, wer die Vorsilbe Post- benutzt. Wer danach kommt, wird nicht bestraft, sondern sogar vom Zeitgeist belohnt. Dabei kann auch er mit Geistesgegenwart nicht glänzen. Wenn die Gegenwart als Nachzeit einer Vorzeit ausgeflaggt wird, bekommt sie das, was beim Tischtennis und bei anderen Sportarten backspin oder Unterschnitt heißt: einen Drall zurück. Dass es sich empfiehlt, den Drall zu wechseln, wusste schon Sepp Herberger: 12Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wer darauf pocht, sich in einer Zeit danach zu befinden, muss dauernd auf die Zeit davor schielen – und hat für die Zukunft womöglich kein Auge mehr.
2. Erfolgsgeschichte
Seit mehr als einem halben Jahrhundert sind unzählige Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftler mit Schielen beschäftigt. Mit dem einen Auge blicken sie auf das, was ist, mit dem anderen auf das, was war oder gewesen sein mag. Sie interessieren sich für die verschiedensten Gegenstände und Themen, sind aber geeint durch die Überzeugung, dass ihre Gegenwart als Nachzeit aufzufassen sei. Ihre Botschaft gilt oft als letzter Schrei – aber nicht als Todesschrei, sondern gerade umgekehrt als Ausdruck dafür, auf dem Quivive zu sein. Das ist deshalb eigenartig, weil die Zeit, die in Gedanken gefasst werden soll, jeweils von einer Vergangenheit abhängig gemacht wird. Wären die Wissenschaftler, die sich auf den Post-Weg begeben, Autofahrer, würden sie Vollgas geben und die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen. Wären sie Seeleute, würden sie die Segel setzen und den Anker nicht lichten. Über ihr Markenzeichen, die Vorsilbe Post-, schrieb im Jahre 1971 der Soziologe Daniel Bell:
Früher war »jenseits« [beyond] das große sprachliche Attribut [modifier]: Jenseits der Tragödie, jenseits der Kultur, jenseits der Gesellschaft, jenseits des Kapitalismus – so lauteten die Titel der Bücher, in denen Philosophen oder Literaturkritiker die Zukunft zu erfassen suchten. Wie auch immer nun dieses kulturelle oder gesellschaftliche Phänomen zu deuten ist, das Wörtchen »post« scheint zum neuen Attribut geworden zu sein.2
13Damals schon konnte Bell eine Liste mit 19 Beispielen zum Besten geben. Sie ist seitdem viel, viel, viel länger geworden. Ja, bei der Vorsilbe Post- handelt es sich um die erfolgreichste Erfindung im Bereich der Ideengeschichte und Begriffspolitik seit 1945. Zum weltweiten Einsatz kommt sie in Großwörtern. Zu diesen gehören: postsäkulare, postideologische, posttraditionale, postindustrielle, postsozialistische, postkapitalistische und postheroische Gesellschaften, aber auch Posthistoire, Postmoderne, Poststrukturalismus, Posthumanismus, Postmaterialismus, Postkolonialismus, Postfeminismus, Postdemokratie, Postpolitik, Postliberalismus, Postromantik und Posthegemonie sowie postdramatisches und postmigrantisches Theater, postödipal, postmetaphysisch, postdigital, postfaktisch, postethnisch, postanthropozentrisch, postmaskulinistisch und postnormal. Die Liste ist natürlich unvollständig und kennt auch englische Einträge wie post-culture, post-growth, post-critique, post-theory, post-truth, post-identity, post-soul, post-Black und post-continental realism. Selbst die aktuelle Form der Adelung – nämlich die Abkürzung – kommt zum Einsatz. Die Rede ist von »the whole pomo thing«3 oder von »poco«, wenn »postmodern« beziehungsweise »postcolonial« gemeint sind. Längst ist die Lage unüberschaubar geworden – und in Vergessenheit ist geraten, dass das Wort »Postismus« ursprünglich für eine 1945 in Spanien gegründete literarische Bewegung stand, die immerhin vier Manifiestos del Postismo hervorgebracht hat.
Post- geht irgendwie immer, jedenfalls legt ihre breit streuende Verwendungsweise dies nahe. Flexibel zeigt sich diese Vorsilbe sogar gegenüber politischer Lagerbildung. Manche Postismen sind im konservativen (Posthistoire) oder sogar im rechtsextremen (Postliberalismus) Lager angesiedelt, andere mehr oder minder weit links (Postkolonialismus). Wieder andere sind politisch gesehen für alles offen, also nicht ganz dicht (Posthumanismus). So oder so scheint Post- unverwüstlich. Kaum ist ein Stern gesunken (etwa der postmoderne), steigt ein anderer empor (etwa der 14postkoloniale). Und selbst jener gesunkene Stern wurde jüngst zum Leuchtmittel verklärt, das »erstaunlicherweise viel über uns und unsere Gegenwart verrät«.4
Der stattlichen Karriere der Vorsilbe Post- will ich in diesem Buch auf den Grund gehen. Mich leitet dabei die Annahme, dass die Postismen ihre Erfolge nicht nur den Einzelleistungen irgendwelcher Denkschulen verdanken, sondern maßgeblich von der Anziehungskraft der Vorsilbe Post- profitieren. Deshalb rücke ich sie hier in den Mittelpunkt und hoffe, nicht »eine Vogelscheuche« zu »demolieren«, die ich »selbst aufgepflanzt« habe.5 Ganze Bibliotheken lassen sich mit Literatur über einzelne Postismen sowie auch über naheliegende Querverbindungen (beispielsweise zwischen Postmoderne und Postkolonialismus) füllen, aber Deutungen des Post-Phänomens selbst sind Mangelware.6
Dass Post- zur Sehnsuchtssilbe geworden ist, gibt Auskunft über die Zeit, in der sie Karriere gemacht hat. Auffällig ist, dass die Post-Wörter erst nach 1945 Fahrt aufgenommen haben, auch wenn manche von ihnen schon früher im Sprachschatz vorkamen. Welche historischen Motive dahinterstecken, möchte ich herausfinden. Aber nicht nur das. Ich will der Vorsilbe Post- den Kultstatus streitig machen, über den sie – in welcher Kombination auch immer – zu verfügen scheint. Dazu genügt es nicht, auf der Benutzeroberfläche dieses Kults herumzurutschen, sondern zu klären ist, welche Botschaft hinter ihm steckt, ob der Post-Dienst etwas taugt und was auf dem Post-Weg womöglich verlorengegangen ist. Er ist sowohl als Symptom interessant als auch in der Sache von Belang. Mir liegt es fern, die Vorsilbe Post- nur abzuwatschen, wie dies gelegentlich unter großer öffentlicher Anteilnahme geschehen ist.7 Stimmungsmache ist meine Sache nicht, aber der Untertitel dieses Buches deutet an, dass ich die Erfolgsgeschichte dieser Vorsilbe eher mit Verwunderung als mit Bewunderung mustere. So zählebig die Postismen auch zu sein scheinen: Nicht hinter allem, was sich lange hält, steckt eine gute Idee.
15Da sich auf dem Feld, das ich erkunde, die Postismen drängeln, ist es ziemlich unübersichtlich. Dazu kommt: Diverse Theoretiker haben sich mit der Vorsilbe Post- geschmückt, andere – wie etwa Michel Foucault – wurden damit dekoriert, ob sie wollten oder nicht. Ich werde mich nicht bei dem Versuch verzetteln, die Ideen aller selbsternannten oder fremdbestimmten Post-Theoretiker auf den Prüfstand zu stellen. Nicht enzyklopädisch möchte ich vorgehen, sondern exemplarisch. Dabei leitet mich die Annahme, dass sich bei den Einsätzen der Vorsilbe Post- bestimmte Muster wiederholen, die querbeet anzutreffen sind. Diese Muster untersuche ich, indem ich mich vor allem – freilich nicht ausschließlich – auf drei Großbaustellen des Post-Betriebs herumtreibe. Sie heißen Posthistoire, Postmoderne und Postkolonialismus.
3. Einfallslosigkeit
Der große Kulturtheoretiker Stuart Hall sagt über das »Postkoloniale«: »Es ist, was es ist, weil vorher etwas anderes passiert ist, aber es ist auch etwas Neues.«8 Mit diesem Satz ist leider nicht viel gesagt, denn er passt fast auf alles, was irgendwo irgendwann passiert. Ein bisschen mehr Mühe mit dem, was »vorher« war, und mit dem »Neuen« müssen sich Post-Theoretiker schon geben. Ihr Geschäft jedenfalls sind Nachfolgeregelungen. Ein Epochenwechsel wird dekretiert, indem ein Name aus dem Fundus gefischt und ihm eine Vorsilbe verpasst wird. Indem die Post-Theoretiker sich hinter Vorläufern verstecken, unterscheiden sie sich von all denen, die eine Zeit oder Bewegung mit einem eigenen, einem neuen Namen versehen. Man kennt solche Taufen von der berühmten Querelle des Anciens et des Modernes im 17. Jahrhundert, von feindlichen Geschwistern wie Klassik und 16Romantik oder vom Hin und Her zwischen Idealismus einerseits, Empirismus, Realismus und Materialismus andererseits.
Im Lauf der Jahrhunderte sind viele Großwörter aufgetreten, die Epoche gemacht und stilbildend gewirkt haben. Historiker des Sozialen, der Kultur und der Kunst können ein Lied davon singen, und Bildungsbürger haben dieses Lied brav auswendig gelernt, das lange vor der Gotik einsetzt und sich weit über den Jugendstil hinaus fortsetzt. Manche dieser Wörter oder Begriffe klingen inzwischen befremdlich, doch aus der Inflation der Postismen darf man nicht den Schluss ziehen, das epochale name dropping sei erschöpft und Innovation auf diesem Gebiet sei nur per Vorsilbe möglich. Dagegen spricht – nicht nur – die Karriere des Anthropozäns.
In früheren Jahren sind Post-Wörter auf keinen grünen Zweig gekommen.9 Kopernikus ist nicht für die Entdeckung des »postptolemäischen« Weltbilds gerühmt worden, die citoyens haben 1789 nicht »Es lebe der Postfeudalismus!« gerufen, Karl Marx und Friedrich Engels waren klug genug, sich 1848 nicht für den Titel »Manifest der Postkapitalistischen Partei« zu entscheiden. Die Leute damals hätten wohl gegähnt ob solch epochaler Einfallslosigkeit. Theoretiker und Aktivisten der Vergangenheit wären nicht auf die Idee gekommen, ein Post-Wort in den Mund zu nehmen und sich dabei im Vollgefühl einer Großtat zu ergehen. Eher wäre ihnen ein Arm abgefallen, als dass sie der neuen Welt ein Schild mit einem alten Wort umgehängt hätten.
Das ist bei vielen Theoretikern und Aktivisten der Gegenwart anders. Sie sehen eine Großtat darin, sich beim Weg in die Zukunft einen Klotz ans Bein zu binden. Selbst denjenigen, die eines bestimmten Post-Worts überdrüssig sind, fällt manchmal nichts Besseres ein, als ihre proaktive Rolle mit doppelter Vorsilbe zu unterstreichen. So verkündet der Architekt Tom Turner stolz: »Lasst uns die Post-Postmoderne begrüßen«, fügt aber dankenswerterweise hinzu, er werde »für einen besseren Namen« für seine neue Bewegung »beten«. Nicoline Timmer bewundert den 17Schriftsteller David Foster Wallace dafür, eine »post-postmoderne Wende« eingeleitet zu haben, wogegen dieser, wenn er denn noch lebte, wohl scharf protestieren würde. »Terms like ›postmodernist‹ […] send me straight to the bathroom«, hat Wallace mal gesagt, und würde man dies übersetzen, käme man um das Wort »Kotzen« wohl leider nicht herum. Nicole Simek behauptet, es sei eine »›post-postkoloniale‹ Wende« im Gang. Rosalind Gill »bedauer[t]«, »vom Post-Postfeminismus noch weit entfernt« zu sein.10
Unter Akademikern ist das Spiel beliebt, etwas mit einem Poststempel zu versehen. »›Posting‹ things« lautet das entsprechende Wortspiel im Englischen, und dazu passt der Kommentar: »Zweifellos weist diese populäre Praxis einen Mangel an Erfindungsgabe auf.« Da Postismen nichts anderes tun, als dem Vorgegebenen einen Schritt voraus zu sein, müssen sie damit rechnen, ihrerseits überholt werden. Daher bietet sich ein weiteres Wortspiel mit der guten alten Post an: »Ideologische Richtungen und Bewegungen, die mit der Vorsilbe ›post‹ versehen sind, enden häufig im Lagerhaus für nicht zugestellte Post.«11
Dass diverse Postismen ihr Verfallsdatum rasch erreichen, haben sie mit anderen zeitdiagnostischen Fehlversuchen gemeinsam. Dazu gehört die Sequenz der Generationen X, Y, Z und α ebenso wie die sogenannten turns (linguistic, performative, spatial, iconic, affective, ontological etc.), bei denen sich Kulturwissenschaftler so lange um die eigene Achse drehen, bis ihnen schwindlig wird. Auch Zahlenspiele helfen vor Abnutzung nicht, wie Digitalisierung 3.0, Industrie 4.0 oder Marketing 6.0 belegen.
Gelegentlich ist den Post-Theoretikern der Verzicht, die eigene Agenda positiv zu bezeichnen, als Vorzug ausgelegt worden: Sie würden sich der Kraftmeierei des totalen Neuanfangs enthalten oder die Macht einer alles überstrahlenden beziehungsweise überschattenden Vorzeit spürbar machen. An die Stelle des Tadels der Einfallslosigkeit tritt das Lob der Bescheidenheit, zu dem wiederum neigt, wer utopische Energien für verbraucht hält 18und »Zukunftsmüdigkeit« verspürt.12 Hans Ulrich Gumbrecht schreibt:
Die Zukunft [scheint] gegen alle Prognosen und gegen alles handelnde Disponieren verschlossen, während die Vergangenheit im intellektuellen und selbst im materiellen Sinn – etwa als Möglichkeitenüberschuss – präsent bleibt. […] Statt in beständigem Übergang befindlich fühlen wir uns eingeschlossen in eine komplexe, alle Vergangenheiten beinhaltende und die Zukunft verweigernde breite Gegenwärtigkeit.
Dazu passt ein Satz Paul Valérys, »l'avenir est comme le reste: il n'est plus ce qu'il était«, den Alexander Kluge recht frei übersetzt hat: »Auch die Zukunft ist leider nicht mehr das, was sie einmal war.« Als Valéry seinen Satz 1937 niederschreibt, hat er nicht Erwartungsverlust im Sinn, sondern umgekehrt eine unheimliche Aufblähung der Zukunft. Weil so vieles denkbar erscheine, seien seriöse »Vorhersagen« nicht mehr möglich und Verunsicherung sowie Desorientierung die Folge. Valéry hätte Friedrich Nietzsche zitieren können: »Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?«13
Nicht nur die Abschließung, auch die Öffnung der Zukunft kann auf verdrehte Weise die Nachfrage nach der Vorsilbe Post- in die Höhe treiben. Dann nämlich entnimmt man ihr die beruhigende Botschaft, dass man sich um all das Unbekannte und Unheimliche, was kommen mag, nicht eigens kümmern muss, weil die Zukunft einfach irgendwann als Nachzeit eintreten wird. Mit Post- weiß man, was man hat – oder meint es zu wissen. Schon Valéry kennt diese Strategie – und nimmt sie auf den Arm: »Wir gehen rückwärts in die Zukunft, und diese Art der Fortbewegung hat einstens ihren Nutzen gebracht und einige glückliche Ergebnisse; doch der Krebs selbst hat davon ablassen müssen.«14
19Das Motiv der Rückwärtsgewandtheit geistert – weit entfernt von Valéry – in der Post-Welt herum. Zygmunt Bauman schreibt: »Das ist es letztlich, wofür die Idee der Postmoderne steht: eine Existenz, die völlig durch die Tatsache bestimmt und definiert ist, dass sie post ist (hinterher kommt) und überwältigt ist vom Bewusstsein, sich in einer solchen Lage zu befinden.« Anne McClintock sieht diese Haltung in ihrer Analyse des Postkolonialismus wesentlich kritischer: »Wir laufen Gefahr, in einem geschichtlich leeren Raum stillgestellt zu werden, in dem uns eine einzige Richtung offen steht, wir gebannt auf die vergangene Epoche blicken und in einer auf Dauer gestellten Gegenwart gefangen sind, die nur als ›post‹ gekennzeichnet ist.«15 Im Extremfall führt dies zu einer defensiven Haltung, mit der man den Forderungen des Tags entgeht und der Unsicherheit über das Kommende ein Schnippchen schlägt. Nur eine Freiheit interessiert in diesem Zusammenhang: die Überraschungsfreiheit.
Grundsätzlich ist an dem Befund, dass die Vorsilbe Post- ein Symptom für Einfallslosigkeit ist, nicht zu rütteln. Etwas, was längst da ist, herzunehmen und mittels Post- im Spiel, aber auch auf Distanz zu halten: damit reißt man eigentlich niemanden vom Hocker. Aber es kann nicht stimmen, dass die Postisten nur einfallslos sind – und nichts sonst. Das Lob für Bescheidenheit kann ihnen auch nicht genügen. Vielmehr muss es etwas geben, womit sich ihre Erfolgsgeschichte erklären lässt. Offenbar kennen sie so etwas wie eine Öffnungsklausel, mit der sie sich Luft verschaffen und ihren Bewegungsspielraum vergrößern.
4. Spiel mit Zeit
Normalerweise ist die Vorsilbe Post- immer dann zur Stelle, wenn Geschehnisse zu sortieren sind und etwas Nachgeordnetes be20zeichnet wird. So redet man von postnataler Medizin, dem Post-COVID-Syndrom oder der Postproduktion im Filmwesen. Nachgeordnet sind diese Bereiche sowohl im zeitlichen wie im hierarchischen Sinn. Sie beziehen sich auf eine Hauptsache – in den genannten Fällen eben Geburt, COVID oder (Film-)Produktion – und bezeichnen etwas, was darauf folgt. Manchmal wird Post- auch provisorisch verwendet, und das ist ähnlich harmlos. Als man zum Beispiel nicht recht wusste, wie die bildende Kunst des späten 19. Jahrhunderts einzuordnen sei, ging man vom Status quo ante aus und verstaute sie vorerst in der Schublade des Postimpressionismus. Der Anwendungsbereich all dieser Bezeichnungen ist durchweg begrenzt. Niemand würde auf die Idee kommen, die Medizin für Kinder und Erwachsene insgesamt als postnatal zu bezeichnen, denn es würde zu weit führen, die Zeit nach der Geburt jahrzehntelang auszudehnen. Oder soll Palliativmedizin auch noch als postnatal gelten? Da ist doch zu viel Leben verstrichen.
Ein weiteres Beispiel für harmlose Verwendungsweisen von Post- ist ein Wort aus der Juristensprache: post-marital oder »nachehelich«. Anders als die Auskunft, eine Person sei geschieden, bezeichnet dieses Wort nicht den Akt der Trennung oder das formale Ende einer Ehe, sondern ihr Leben danach. Es wird nahegelegt, dass diese Phase wesentlich dadurch bestimmt sei, Folgezeit zu sein. Offen bleibt, wie es dieser Person ergeht, ob sie also bedrückt oder erleichtert ist. Bei den Postismen geht es ähnlich unbestimmt zu. Da die Vorsilbe Post- prinzipiell nur eine zeitliche Festlegung trifft, sind ihr keine Geheimnisse darüber zu entlocken, wie es um das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart steht, ob es bergauf oder bergab geht, ob das Alte wie ein Alb auf den Gehirnen der Lebenden lastet oder diese sich auf den Schultern von Riesen stolz in die Höhe recken. Nach dem Kummer kommt der Kuss. Nach dem Krieg der Frieden. Nach dem Tag die Nacht – oder aber umgekehrt.
Natürlich gibt es Sonderfälle, in denen die Verbindung zwi21schen Davor und Danach zur Eindeutigkeit verdonnert wird. Ein Beispiel dafür ist der Satz: Post coitum omne animal triste. Ob er zutrifft, wage ich zu bezweifeln, aber dass es nach »heiligen Übertreibungen«, mit denen »der Mensch ins kurze Leben eine noch kürzere Freude einwebt«,16 irgendwann bergab geht, ist kaum zu vermeiden. Man kennt das vom Nacht- und Geistesleben gleichermaßen. Doch nicht jedem Morgen geht ein Fest voraus. Eine Nachzeit ist nicht immer und überall die Zeit nach einer Hochzeit. Ein Tag danach kann auch ein Tag der Erleichterung sein. Das »Glück« des »Entronnensein[s]« sei nicht das schlechteste, meint Theodor W. Adorno.17 Wenn man von Sonderfällen absieht, tut man sich also schwer damit, in die Vorsilbe Post- eine Stellungnahme hineinzulegen. »Die Position des ›nach‹ ist keine haltbare Position. Solange sie keine eigene Position zu den Sachen enthält, […] hat sie keine, von der aus sie freundlich oder feindlich grüßen könnte«, bemerkt Martin Seel.18
Die semantische Sparsamkeit der Vorsilbe Post- steht in einem krassen Missverhältnis zu den von Post-Theoretikern ausgelösten Spekulationen darüber, was von Vor- und Nachzeit zu halten ist. Sie versuchen, sich Bewegungsspielraum zu verschaffen, indem sie mit der Zeit zu spielen beginnen. Sie machen aus dem Danachkommen eine Geisteshaltung und bemühen sich um eine inhaltliche Aufladung ihres Vorhabens. Meist geht es ihnen nicht nur um die Beschreibung einer Lage, sondern um die Behauptung einer Haltung.19 Manchmal geht Ersteres in Letzteres über. So nutzt die indisch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak den Ausdruck »postkolonial« in ihren ersten Veröffentlichungen nur zur sachlichen Kennzeichnung ihrer biographischen Herkunft (sie wurde kurz vor der Unabhängigkeit Indiens im damaligen Kalkutta geboren). Daneben stellt sie eine zweite Genealogie, eine selbstgewählte intellektuelle Herkunft, mit der sie sich als Anhängerin von Jacques Derridas »Dekonstruktion« identifiziert. Erst in späteren Publikationen wird 22Spivak den Ausdruck »postkolonial« mit einer eigenen inhaltlichen Agenda füllen.20
Zu den Ambitionen der Post-Theoretiker gehört, die Zeitrechnung selbst in die Hand nehmen. Während bei den erwähnten harmlosen Verwendungsweisen, etwa der postnatalen oder postmortalen Phase, der Stichtag feststeht, der das Davor vom Danach trennt, beanspruchen sie einen Spielraum zur Entscheidung darüber, was wann wie vergangen ist. Wenn die Post-Theoretiker in einem scharfen Schnitt Zeiten voneinander absetzen, ist das alles andere als trivial. Denn damit überführen sie das Werden und Vergehen, den zeitlichen Verlauf in eine neue Struktur, die aus zwei Zuständen besteht: X und Post-X. Wie der Ausdruck »Zustand« nahelegt, bekommt die Betrachtung damit etwas Statisches und auch Räumliches. X und Post-X wirken wie Bereiche, wie geschlossene Anstalten, in die eine zweigeteilte Welt eingewiesen wird. Ich werde noch darauf zurückkommen,21 warum die Freunde des Werdens, zu denen auch ich mich zähle, mit dieser Zeit- und Weltordnung hadern.
Die Postisten gehen bei ihrer Zeiteinteilung in drei Schritten vor. Erstens treten sie als Namensgeber auf, bringen also den Zustand X auf den Begriff. (So reden sie zum Beispiel von »Moderne«.) Zweitens verwandeln sie den Einblick in das, was ist, in einen Rückblick. (Beispielsweise überbringen sie die Botschaft, mit der Moderne sei es aus und vorbei.) Drittens definieren sie das, was jetzt kommt, als etwas, was danach kommt, also als Zustand Post-X. (Dieser heißt dann zum Beispiel Postmoderne.) Terry Eagleton meint, Postismen würden einen sprechakttheoretischen Trick anwenden, nämlich so tun, als stellten sie das Ende einer Ära nur »konstativ« fest, während sie in Wahrheit dieses Ende mittels Verkündung »performativ« herbeiführen oder nur herbeireden.22
Mit dem Aufstieg der Postismen wächst die Verhandlungsmasse stark an, die auf der Vorsilbe Post- lastet. Mit ihr wird dick aufgetragen. Nicht nur steht auf dem Spiel, wann die Vorzeit 23in die Nachzeit umkippt, sondern gerungen wird um die Last- und Machtverteilung zwischen Vor- und Nachzeit. Die Postismen nutzen Großwörter als Kampfbegriffe, laden das Verhältnis zwischen den Zeiten mit Bewertungen auf und gelangen dabei zu weit auseinanderliegenden Lesarten.
Viele Post-Theoretiker sehen ihre Aufgabe darin, die Macht der Vergangenheit zu betonen und dagegen anzugehen, dass sie vernachlässigt oder verhehlt wird. Im Extremfall wird die Nachgeschichte dann zur Leidensgeschichte. Als besondere Leistung der Vorsilbe Post- gilt demnach, die Übergriffigkeit oder Übermacht dessen, was war, umstandslos deutlich zu machen. Gegen diese Art der Post-Rede ist eingewandt worden, sie bleibe an dem, was war, hängen und erschwere die Ablösung. Insoweit ähneln die Post-Theoretiker denjenigen, die das »Sein […] schlechthinnig nur als Gewesen-Sein« kennen und, wie Ernst Bloch gesagt hat, dem »Anamnesis-Bann« erliegen. Bodenständiger klingt dies bei Terry Eagleton: »Wenn das Wort ›post‹ überhaupt eine Bedeutung hat, dann steht es für business as usual, nur noch mehr als vorher.«23 Diese Art von Kritik begleitet die Karriere der Vorsilbe Post- von Anfang an. Ein frühes Beispiel dafür findet sich in einem der erfolgreichsten soziologischen Bücher des späten 20. Jahrhunderts, Ulrich Becks Risikogesellschaft von 1986. Das Vorwort dieses Buches beginnt mit den folgenden Sätzen:
Thema dieses Buches ist die unscheinbare Vorsilbe »post«. Sie ist das Schlüsselwort unserer Zeit. Alles ist »post«. […] »Post« ist das Codewort für Ratlosigkeit, die sich im Modischen verfängt. Es deutet auf ein Darüberhinaus, das es nicht benennen kann, und verbleibt in den Inhalten, die es nennt und negiert, in der Erstarrung des Bekannten. Vergangenheit plus »post« – das ist das Grundrezept, mit dem wir in wortreicher, begriffsstutziger Verständnislosigkeit einer Wirklichkeit gegenüberstehen, die aus den Fugen zu geraten scheint. Dieses Buch ist ein Versuch, dem Wörtchen »post« […] auf die Spur zu kommen.24
24Das klingt so, als wäre mir damit schon vorab der Wind aus den Segeln genommen, denn auch ich versuche nichts anderes, als »dem Wörtchen ›post‹ auf die Spur zu kommen«. Aber seltsamerweise hat Ulrich Beck seiner Ankündigung keine Taten folgen lassen: Das ominöse »Wörtchen« kommt in Risikogesellschaft so gut wie gar nicht mehr vor. Sein Versuch, die Post-Rede als etwas »Modisches« abzutun, wirkt überdies arg herablassend, und seit sie zum Dauerbrenner geworden ist, ergibt dieser Vorwurf erst recht keinen Sinn mehr. Weiterhin zur Kenntnis zu nehmen ist jedoch Becks Einwand, die Vorsilbe Post- stehe für ein vages »Darüberhinaus« und bleibe in den Inhalten stecken, von denen sie sich abzuheben scheint. Der Spielraum, den sich die Post-Theoretiker erarbeiten, zeigt sich freilich daran, dass es ihnen nicht nur Minus-, sondern auch Pluspunkte einbringt, die Macht der Vergangenheit anzuzeigen. So schreibt die Politikwissenschaftlerin Wendy Brown:
Die Vorsilbe »post« zeigt […] eine Formation an, die dem, dem sie vorangestellt wird, zwar zeitlich nachgeordnet, aber nicht enthoben ist. »Post« signalisiert eine sehr konkrete Situation des Vorüberseins, in der das, was vergangen ist, nicht zurückgelassen wird, sondern im Gegenteil eine Gegenwart unweigerlich prägt oder sogar dominiert, die trotzdem auch in irgendeiner Weise mit dieser Vergangenheit gebrochen hat. Anders gesagt, wir gebrauchen den Ausdruck »post« nur für eine Gegenwart, deren Vergangenheit sie weiterhin im Griff hat und sie strukturiert.25
Beck und Brown liegen bei der Beschreibung nah beieinander, doch ihre Wege trennen sich, wenn es um das Verteilen von Tadel und Lob für die Vorsilbe Post- geht. Während Beck in ihr ein Symptom für Einfallslosigkeit sieht, meint Brown, sie gebe den »langen Schatten« der Vergangenheit angemessen wieder, und hält sie für nützlich, um historische Zwänge und Machtverhältnisse zu reflektieren.
Strittig ist nicht nur, wie die Last der Vergangenheit zu gewich25ten ist, sondern auch, ob die Vorsilbe Post- sich damit begnügt, diese Last anzuzeigen, oder dabei hilft, sie abzuschütteln. Das deutet sich schon bei Beck und Brown an. Während Beck die »Erstarrung« in alten Inhalten beklagt, hält Brown es – wie zitiert – für möglich, mit Post-Hilfe den Bruch mit der Vergangenheit einzuleiten. Zwar ist den Postismen die Vergangenheit nicht auszureden, sie sollen aber dabei helfen, von ihr abzurücken. Ähnlich wie Brown deutet Kwame Anthony Appiah die Vorsilbe Post- als eine »Geste, die Platz schafft«, die also eher ermächtigend als entmachtend wirkt.26
Andere Post-Theoretiker gehen über diese Lesart hinaus und sehen in der Vorsilbe Post- geradewegs ein Werkzeug zum »Triumph« über die Vergangenheit.27 Ihab Hassan vertritt ein agonales Verständnis von Post- und sagt: »Das Wort Postmoderne […] ruft in Erinnerung, was es doch zu überwinden oder abzuschaffen sucht – nämlich die Moderne selbst. Jener Begriff trägt also den Feind in seinem Inneren, ganz anders als die Begriffe Romantik und Klassik, Barock und Rokoko.« Allerdings kommt Hassan die Unschlüssigkeit der Vorsilbe Post- in die Quere, denn er muss zugeben, dass sie »ein Zu-spät-Kommen oder sogar eine Dekadenz andeutet, die doch jeder Postmodernist von sich weisen würde. Aber welchen besseren Namen gibt es für dieses seltsame Zeitalter?«28 Die Vorsilbe wird hier jedenfalls nicht als Unterwerfungsgeste gelesen, sondern mit einem befreienden Dreh versehen. Ihr wird der Sieg über den inneren »Feind« – über das Wort, das sie mitschleppt und vor das sie sich spannt – zugetraut. Ungeschoren kommen auch Post-Optimisten wie Hassan nicht davon. Ihnen wird vorgehalten, sie würden sich mit der Vorsilbe Post- wie mit einem »Verdienstorden« schmücken und so tun, als seien sie damit schon den Zwängen der Geschichte entkommen. Bezweifelt wird, dass mit ihr das »feierliche Freiräumen eines begrifflichen Raumes«, der Schritt über das Alte »hinaus« und der Eintritt in die Zeit »danach« erfolgen können.29
Da die Vorsilbe Post- von sich aus fast nichtssagend ist, scheint 26sie all das, was in sie hineingelegt wird, verkraften zu können, mag es sich auch gegenseitig ausschließen. Ihr Spielraum ist in der Tat beträchtlich. Vielleicht liegt das Geheimnis des Post-Erfolgs gerade darin, dass es mal ein Versprechen (wie bei »postideologisch«), mal ein Verhängnis (wie bei »postfaktisch« oder »postdemokratisch«), mal beides zugleich (wie bei »Posthistoire« und »Postkolonialismus«) vermittelt. Nichts ist unmöglich, alles scheint erlaubt.
Ganz so leger geht es beim Spiel mit der Zeit aber nicht zu. Es ist zwar richtig, dass die Vorsilbe Post- dazu einlädt, mit Deutungen zu wuchern. Und doch haben all diese Deutungen, um eine Pathosformel Friedrich Hölderlins auszuleihen, »ein Schiksaal«.30 Der semantische Kern, der in den Postismen steckt, ist zwar klein, aber dafür hart: Die Jetztzeit wird als Nachzeit bestimmt.
5. Double Bind
Seltsamerweise hält die Post-Begeisterung seit Jahrzehnten an, obwohl ihr das Unglück gewissermaßen ins Gesicht geschrieben ist. Bei diesem Unglück handelt es sich um das »unglückliche Bewusstsein«, also um eine Geistes- und Lebenshaltung, die von Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Søren Kierkegaard beschrieben worden ist. Bei Kierkegaard heißt es: »Der Unglückliche ist abwesend. Abwesend aber ist man, wenn man entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist.«31 Für Post-Theoretiker gilt, dass sie der Vergangenheit voraus sein wollen und doch an ihr hängen bleiben. Sie sind nie ganz bei sich. Deshalb taugt Gregory Batesons klassische Beschreibung des Double Bind als Schlüssel zu ihrem Verständnis.32 Sie müssen sich zu etwas verhalten, was ihnen vorausliegt, und sind »in einer Situation gefan27gen«, in der sie mit gemischten Signalen oder »widersprüchlichen Mitteilungen konfrontiert« werden, die nicht unter einen Hut zu bringen sind. Sie sind hin- und hergerissen, sie wollen gehen und bleiben, von etwas loskommen und sich an ihm abarbeiten. Aus dieser Ambivalenz gibt es kein Entrinnen, denn nur zwei für sie gleichermaßen ruinöse Szenarien sind denkbar. Entweder müssen sie versuchen, die Vorsilbe Post- von der inhaltlichen Vorgabe zu lösen, doch dann wirkt sie wie eine Praline ohne Füllung. Oder sie streichen die Vorsilbe, aber dann bleiben sie auf dem, wovon sie ausgehen, sitzen und verlieren die Solldistanz zur Herkunft.
Die Post-Spielregeln lassen nur – oder immerhin – zu, Abhängigkeit und Freisetzung unterschiedlich zu gewichten. Wie zuvor geschildert, stehen manche Post-Theoretiker stark unter dem Eindruck des Gewesenen, wohingegen andere sich in einem offenen Raum wähnen. Manche lassen sich fesseln, andere lassen sich gehen. Besonders einflussreich sind diejenigen, die das eine tun, ohne das andere zu lassen. Weil sie die jeweils andere Seite ihrer selbst nicht abschütteln können, sind sie freilich im Wortsinne gebrochene Existenzen. Auf den drei Großbaustellen der Vorsilbe Post-, die in diesem Buch besichtigt werden, lässt sich dies rasch verdeutlichen.
Bei den Theoretikern des Posthistoire schlägt das Double Bind voll zu. Sie geraten bei der Auskunft ins Schlingern, ob sie das Ende der Geschichte betrüblich oder erfreulich finden. Mal verfallen sie in Nostalgie, mal können sie die Zukunft kaum erwarten. Demgegenüber locken die Vertreter der Postmoderne mit der großen Lockerung nach dem Ende der großen Erzählungen. Stärker als ihre posthistorischen Verwandten frönen sie der Lust am Abwerfen von Ballast. Und doch sind sie auf die Moderne, die sie zum alten Eisen werfen, angewiesen und verhalten sich zu ihr parasitär. In ihrem Double Bind sind sie nach Linda Hutcheon gefangen zwischen »ödipaler Opposition« und »kindlicher Treue«.33 Eine derartige Ambivalenz im Umgang mit der histori28schen Vorgabe ist beim Postkolonialismus natürlich nicht zu finden. Der Kolonialismus ist untendurch. Und doch fällt das Double Bind, die Spannung zwischen Abhängigkeit und Freisetzung, hier mindestens so scharf aus wie bei seinen beiden Verwandten. Auf der einen Seite wird der Kolonialismus in die Gegenwart verlängert, auf der anderen Seite soll dessen Macht ein für alle Mal gebrochen werden. Dabei verbirgt sich hinter diesem Angriff auf die Macht eine verschleppte Abhängigkeit. Denn wie würde sich die Zeitrechnung verschieben, wenn sich herausstellte, dass der Kolonialist von vorgestern wäre? Dann wäre der Postkolonialist, der ihm einen Schritt voraus ist, zwar nicht vorgestrig, aber gestrig.
In allen drei Fällen zwingt das Double Bind dazu, in einem engen Bezugsrahmen zu verharren, auf den man positiv und/oder negativ fixiert ist. Auch wenn die Postismen frische Luft versprechen, schrumpft ihre Welt – um erneut Hölderlin zu zitieren – zum »kleinen Raum« zusammen.34 Da Gegenwart und Vergangenheit aufeinander fixiert sind, rückt die Zukunft in weite Ferne. Das höchste der Gefühle ist, dem, was war, zuzurufen, was schon den unheimlichen Besen in Goethes Ballade Der Zauberlehrling ruhiggestellt hat: »Seid's gewesen!«
6. Nachträglichkeit
Eng verwandt mit dem Double Bind ist ein Wort aus dem Vokabular der Psychoanalyse: Nachträglichkeit. Die sprachliche Nähe zu Post- liegt auf der Hand, und so kann man mit ihrer Hilfe den Bewegungsspielraum der zwischen Anhänglichkeit und Freisetzung schwankenden Postismen genauer ausmessen. Jean Laplanche gebührt Dank dafür, die weit verstreuten Auftritte der Nachträglichkeit im Werk Sigmund Freuds systematisiert 29und weiterentwickelt zu haben. Sein Befund lautet, dass die Nachträglichkeit in zwei Richtungen gedreht werden kann, die übrigens an Kierkegaards Einsicht erinnern, dass das Leben »vorwärts gelebt« und »rückwärts verstanden« wird.35
Nach Laplanche besagt Nachträglichkeit auf der einen Seite, dass ein frühes biografisches Ereignis in Form einer verspäteten, »aufgeschobenen Handlung« auf das Seelenleben eines Menschen durchschlägt. Gelegentlich wirkt es wie eine »Zeitbombe«. Auf der anderen Seite kommt es bei der Nachträglichkeit zu einer Umkehrung der zeitlichen Perspektive, zu einer – wie Freud schon 1896 an Wilhelm Fließ schreibt – »Umordnung« oder »Umschrift« des »vorhandene[n] Materials von Erinnerungsspuren« gemäß »neue[r] Beziehungen«.36 Im ersten Fall wirkt sich die Vergangenheit prospektiv auf die Folgezeit aus, im zweiten Fall wird die Vergangenheit retrospektiv umgedeutet. In der therapeutischen Situation kommt es zu einem »Dilemma«, das scheinbar »unmöglich zu lösen ist«: Wie lässt sich entscheiden, ob die Vergangenheit die Folgezeit »determiniert« oder gerade umgekehrt von dieser »umgedeutet« wird?37 Wie beim Double Bind stehen auch bei der Nachträglichkeit Abhängigkeit und Freisetzung, Unterordnung und Überwindung gegeneinander. Laplanches Vorschlag, wie aus dem »Dilemma« herauszufinden ist, läuft darauf hinaus, die Auskunftsquellen auszuweiten, also die Geschichte nicht »nur aus der Perspektive dieses einen Menschen zu verstehen, der erst ein Kind war und dann ein Erwachsener wird«, sondern Dritte zu berücksichtigen.38 Durch die Ausweitung der Perspektive lässt sich der Zwang der Vergangenheit überprüfen, der auf die Gegenwart durchschlagen soll, und die Willkür mindern, mit der man sich die Vergangenheit zurechtlegt.
Postismen tun sich schwer, dem geschilderten Dilemma der Nachträglichkeit zu entkommen, weil sie im Verkehr und Gegenverkehr zwischen Vergangenheit und Gegenwart steckenbleiben und der Ambivalenz, die in diesem Verhältnis steckt, ausgesetzt sind. Ihnen ist der Zugang zu der Einsicht verwehrt, dass es nicht 30nur ein Davor und Danach, sondern im Sinne von Laplanches Dritten auch ein Daneben geben könnte. Und doch liefert die Nachträglichkeit eine gute, zusätzliche Erklärung für den Spielraum, über den die Postismen verfügen, und für die Anziehungskraft, die sie ausüben. Zwar agieren sie parasitär, das heißt einfallslos, indem sie ein Wort aus dem Bestand übernehmen. Aber es hat sich bereits gezeigt, dass sie sich die Deutungshoheit bezüglich der Datierung und Bewertung der Post-Zeit vorbehalten. Anhand der Nachträglichkeit wird nun noch deutlicher, dass dieser Spielraum sich nicht nur auf die aktuelle Lagebeschreibung, sondern auch auf die rückwirkende Umdeutung der Vorzeit erstreckt. Ein sachdienlicher Hinweis hierauf ergibt sich aus einer Beobachtung des Publizisten Roger de Weck:
Die kleine, allgegenwärtige und recht elegante Vorsilbe »post« verrät die generelle Unsicherheit […]. Wir haben […] kaum Vorstellungen von dem, was wir anstreben. Eigenschaftswörter wie »postmodern«, »postfaktisch«, »postdemokratisch« stehen weniger für eine Eigenschaft als für das Fehlen derselben, jedenfalls für ihr Ausklingen und eine Art Schwebezustand. Sie suggerieren, dass die Modernität, die Fakten und die Demokratie scheinbar bzw. ansatzweise schon Vergangenheit seien. Diese »Post-Adjektive« beschreiben, was angeblich nicht mehr ist, aber nicht, was ist, und noch weniger, was sein soll.39
De Weck nimmt Wortmeldungen von Post-Theoretikern aufs Korn, denen zufolge es so etwas wie Demokratie »angeblich« nicht mehr gibt. Er wehrt sich dagegen, etwas mit dem Stempel des Vergangenen oder Überholten zu versehen, was gar nicht auf dem Sterbebett liegt oder liegen sollte. Überdies lädt er zu einer weiterführenden Überlegung ein. Post-Theoretiker können nämlich nicht nur behaupten, dass etwas »angeblich« nicht mehr ist, sondern auch alles Mögliche darüber sagen, was »angeblich« mal war. Mit anderen Worten: Sie können anfangen, die Vergangenheit zu bearbeiten. Wenn sie diese »Umschrift«, um Freuds Wort 31aufzugreifen, vornehmen, dann heißt dies nichts anderes, als dass sich das Machtspiel ausdehnt. Es bezieht sich nicht nur auf die aktuelle Agenda und darauf, welche distanzierende Kraft ins Post- hineingelegt wird, sondern auch auf den Versuch, dem Vergangenen ein neues Gesicht zu geben. Mit Postismen lässt sich ein epochales retrofitting betreiben. Sie sind »nicht nur durch ihr vergangenes anderes bestimmt, sondern bringen dieses andere auch hervor«.40 Beobachten lässt sich dies auch auf den drei Großbaustellen dieses Buches: Diejenigen, die das Posthistoire ausrufen, datieren seinen Beginn auf die Herrschaft Napoleons oder aber Stalins, auf das Ende des Zweiten Weltkriegs oder aber den Fall der Berliner Mauer. Dass damit je andere Vorstellungen dessen, was als »Geschichte« gelten darf, verbunden sind, versteht sich von selbst. Diejenigen, die die Postmoderne ausrufen, wollen die Moderne nicht nur zu etwas Vergangenem erklären, sondern machen sie retrospektiv oder retroaktiv erst zu dem, was sie war, um sich dann erfolgreich von ihr abheben zu können. Beliebt als negative Vorlage ist eine Kombination aus Naturzerstörung und Judenvernichtung. Und diejenigen, die den Postkolonialismus ausrufen, geben der Weltgeschichte rückwirkend eine geschlossene Form, für die ein einziges Wort genügt: eben das Wort »Kolonialismus«. Wer andere Dinge erwähnt, lenkt ab von dem, worauf es zuallererst ankommt.
Dass die Vergangenheit im Sinne der hier skizzierten Beispiele nicht schlicht beschrieben, sondern umgeschrieben wird, ist spielentscheidend für den Erfolg der Postismen. Die passende Kontrastfolie ist wichtig, damit sich die Konturen der Post-Zeit deutlich abzeichnen. Den Vorwurf, dass mit dem Aufstieg der Vorsilbe Post- die Eigeninitiative in der Gegenwart zum Erliegen komme, muss ich also abschwächen. Die Postismen können durchaus Macht ausüben, aber sie kommt in der Gegenwart erst nach einem Umweg an. Um der Nachzeit einen neuen Dreh zu geben, muss die Vorzeit ein anderes Gesicht bekommen. Streit gibt es um die Frage, mit welcher Berechtigung solche Umdeu32tungen erfolgen. Einerseits drohen mit den Geschichten darüber, was »angeblich« mal war, Verzerrungen und Zurichtungen, andererseits wird der Anspruch erhoben, blinde Flecken auszuleuchten und das Bild der Vergangenheit zurechtzurücken oder rundzuerneuern.
Double Bind und Nachträglichkeit geben Hinweise auf Spielregeln und Spielzüge, die beim Einsatz von Post- Anwendung finden. Nun aber wird es Zeit, das Spielfeld zu betreten, auf dem sich diese Vorsilbe bewähren will und durchschlagen muss. Genau besehen sind es sogar zwei, denn das eine Spiel findet auf dem Feld der Sprache statt, das andere auf dem der Geschichte. Dem ersten widme ich mich im nächsten, dem zweiten im übernächsten Abschnitt.
7. Neue Wissenschaft von den Vorsilben
Ergiebige Sammelwerke gibt es über geschichtliche und ästhetische Grundbegriffe, über das semantische und rhetorische Arsenal, mit dem in Geschichte und Gegenwart gefochten worden ist.41 Beim Blick auf Großwörter bleibt jedoch der Kleinkram unbeachtet, der oft mehr über Menschen und Theorien verrät, als ihnen lieb ist. Das gilt auch und gerade für Vorsilben. Im Falle von Post- kommt es sogar zu einer Verkehrung der sprachlichen Machtverhältnisse. Statt eine eher beiläufige, modulierende Rolle zu spielen, scheint diese Vorsilbe zur Hauptsache zu werden, während das Hauptwort, das an ihr hängt, zum Nebendarsteller degradiert wird.
Die Tatsache, dass sich eine Flut von Postismen über die Welt ergossen hat, reizt zur Eröffnung eines neuen Forschungsgebiets, das man – wider den tierischen Ernst – Prefix Studies nennen könnte. Dort ist unsere Vorsilbe natürlich nicht auf sich allein ge33stellt, sondern sie trifft auf zahlreiche Vorgänger und Widersacher, die ebenfalls in nur scheinbar unscheinbarer Weise auf Weltsichten und Handlungsmuster durchschlagen. Wie also verhält sich Post- zu Avant-, Anti-, Re-, Trans-, Ko-, De-, Neo-, Spät- und Meta-? Welche Logiken sind bei diesen Präfixen am Werk, für welche Bereiche sind sie zuständig und zu welchen Macht- und Wachwechseln zwischen ihnen ist es gekommen? Beim nun folgenden Marsch durch den Vorsilbenwald versuche ich, mich in Richtung Post- durchzuschlagen.
Avant-. Der Aufstieg von Post- ist eng verbunden mit dem Abstieg von Avant-: mit dem Ende der Avantgarde, deren Karriere beim Militär begann und um 1900 in Politik und Kunst mächtig in Schwung kam. Post- und Avant- sind Gegenspieler, die einiges gemeinsam haben. Auf Nuancen kommt es hier an. Der Postist ist sich mit dem Avantgardisten darin einig, nicht zur Nachhut oder Arrièregarde zu gehören. Keineswegs sieht er sich als jemanden, der notorisch hinterherhinkt. Sein Danach erscheint als Schritt in ebenjene Richtung, die auch der Avantgardist einschlägt. Dieser sagt, er sei den anderen voraus. Jener sagt, er komme nach dem, was war oder gerade noch ist. Es ist demnach eine Frage der Perspektive, ob etwas vor uns liegt oder nach dem kommt, was gerade läuft. Angenommen, die Turmuhr schlägt zwölf Mal und der Minutenzeiger rückt weiter vor: Dann zeigt die Uhr bald zehn nach zwölf.
Und doch ticken Avantgardist und Postist unterschiedlich. So ergibt es – anders als bei einer Post-Zeit – keinen Sinn zu sagen, dass man »in« der Avantgarde lebt, denn sie ist kein Zustand, sondern eine Bewegung. Der Avantgardist blickt nach vorn, will wissen, wo's langgeht, und geht schon mal vor. Er ist stolz darauf, als Erster zu sehen, was sich hinter der nächsten Ecke tut. Er sieht seine Expertise bei hehren Zielen. Gedanklich versetzt er sich in die Zukunft, die er für sich gepachtet hat, er gleicht also einer Uhr, die tüchtig vorgeht. Faktisch bleibt er freilich Zeitgenosse derer, die in der Gegenwart befangen sind. Ihnen schaut er gele34gentlich beim »irdischen Gewühle« zu (Schiller), je nach Stimmung herablassend oder aufmunternd. Für den elitären Dünkel mag der Avantgardist anfällig sein, aber vollends erliegen kann er ihm nicht, denn seine Rolle ergäbe ohne Nachrücker keinen Sinn. Durch seinen Vorsprung will er zum Vorbild werden für diejenigen, die sich in seinen Windschatten begeben und später dort landen sollen, wo er schon ist. Dann läuft die Geschichte glatt und die Dynamik zieht sich durch: Alle liegen auf einem Zeitstrahl, Zukunft und Ziel werden von vorne nach hinten durchgereicht. So lautet eine typische Beschreibung Peter Kropotkins aus dem Jahr 1885:
Mutige Männer und Frauen, die wissen, daß man etwas wagen muß, um zu siegen – dies waren die verlorenen Vorposten, welche in der Geschichte der Revolutionen den Kampf begannen, lange bevor die Massen genügend erregt waren, um offen die Fahne des Kampfes zu erheben und zur Erkämpfung ihrer Rechte überzugehen.42
Der Postist ist kein Vorposten, der bei der Zeit an das Vorrücken eines Zeigers oder an den Fortschritt denkt. Er sagt nicht, wohin die Reise geht – und könnte es auch nicht sagen, denn sein Blick richtet sich nicht nach vorn, sondern zurück. Wenn der Postist auf das Zurückliegende blickt, hat er es, anders als der Avantgardist, nicht darauf abgesehen, es auf Zack zu bringen. Sondern er will Abstand zu ihm halten und es letztlich hinter sich lassen. Wenn er einen Vorsprung herausarbeitet, dann treibt ihn nicht die Neugier auf das, was kommt, sondern der Verdruss über das, was war.
Wenn man die Avantgarde näher besichtigt, entwickelt man ein gewisses Verständnis dafür, dass Menschen vor ihr Reißaus nehmen. Avantgardisten oder solche, die sich dafür halten, neigen dazu, sich selbst ganz großartig zu finden, und das muss man nicht mögen. Da es an der Spitze – auch an der Speerspitze der Geschichte – eng zugeht, kommt es dort zum Gedränge, also 35zum Zank um Deutungshoheit. Das setzt die Avantgardisten dem Verdacht der Besserwisserei aus und mindert ihre Strahlkraft. Ungelenke Neuerfindungen wie »Trans-Avantgarde« führen da nicht weiter.43 Eine Vorreiterrolle zu spielen – das funktioniert eigentlich nur, wenn der ganze Tross hinterher in die gleiche Richtung marschiert, und ein solch geschlossenes Bild der historischen Entwicklung hat etwas Eintöniges. Vielleicht ist das der Grund, warum sich Post-Theoretiker – und nicht nur sie – von der Avantgarde abwenden.
Anti-. Während mit Post- nicht furchtbar viel gesagt ist, ist Anti- an Entschiedenheit kaum zu überbieten und taugt deshalb als Post-Gegner. Anders als Avant- ist Anti- eine Mehrzweckwaffe. Unter den vielen Worten, die sich mit ihr bilden lassen, gebührt der Antithese wohl ein Spitzenplatz. Zusammen mit ihren Verwandten, dem Widerspruch und dem Gegensatz, ist die Antithese all denen geläufig, die in Philosophie und Gesellschaftstheorie der dialektischen Methode verpflichtet sind. Während Post- betont lässig und auch ein bisschen bequem auf Distanz geht, steht Anti- für eine klare Gegenstellung mit inhaltlicher Absicht. Dialektiker legen überdies Wert darauf, nicht in einer Antihaltung stecken zu bleiben, sondern den Nahkampf zwischen These und Antithese auf einer höheren Ebene zu befrieden, nämlich dort, wo die Synthese lockt. Wenn es sich bei der Synthese nicht um einen faulen Kompromiss handeln soll, dann muss sie aus der Hitze der Auseinandersetzung hervorgehen. These und Antithese arbeiten sich aneinander ab, bis sich eine neue Gemeinsamkeit ergibt. Diese Option ist bei Post- nicht vorgesehen.
In ihren verschiedenen Einsatzbereichen entfaltet die Vorsilbe Anti- – im Guten, aber auch im Schlechten – eine hohe mobilisierende Kraft. Man denke an Antifaschismus, Antiimperialismus, Antikommunismus oder Antisemitismus. Wiederum anders als im Fall von Post- darf die Gegenwart als die Domäne von Anti- gelten. Jetzt gilt's! Damit man gegen etwas sein kann, muss es einen Gegner geben, sonst wirkt der eigene Einsatz wie das Spiel 36auf einer Luftgitarre. Gelegentlich neigen Anti-Typen dazu, ihren Gegner krampfhaft am Leben zu erhalten, um zu verhindern, dass die Kampfmoral schwindet. Man denke an die Rede vom »antifaschistischen Schutzwall« in der DDR.
Bekanntlich erzeugen gemeinsame Feindbilder soziale Kohäsion. Dass diese Einigkeit sich dem Gegenspieler verdankt, ist freilich peinlich, denn damit verkeilen sich die Menschen in dem, wogegen sie sich wenden. Auch deshalb heißt es in einem Zeitungsartikel aus dem Oktober 1848, den – vielleicht – Charles Baudelaire verfasst hat, der »Antagonismus« sei eine »böse Idee«.44 Gelegentlich treten Anti-Typen als Schwächlinge in der Schale von Kraftmeiern auf. Wie die Post-Haltung, so steht die Anti-Haltung unter dem Verdacht der Einfallslosigkeit. Es ist schwierig, allein damit ein abendfüllendes Programm zu gestalten.
Denen, die der Antagonismen müde sind, verbinden mit der Vorsilbe Post- die Erwartung, auf das offene Feld einer Nachzeit flüchten zu können. Umgekehrt schlägt den Post-Anbietern von den Anti-Kämpfern der Vorwurf entgegen, dass sie Gegensätzen aus dem Weg gehen oder sie mit Weichspüler behandeln. Anders als der Antialkoholiker wüsste der Postalkoholiker (wenn es ihn gäbe) keine Antwort auf die Frage, welches Ziel er verfolgt. Drastisch und folgenschwer ist der Unterschied zwischen Antifaschisten und Postfaschisten. Letztere machen sich die Post-Unschärfe zunutze, um Traditionen zu pflegen, ohne sich ausdrücklich zu ihnen bekennen zu müssen.
Re-. An der Vorsilbe Re- führt kein Weg vorbei, denn sie hat sich in vielen Begriffen festgesetzt, die bei der Gliederung der neueren Geschichte eine führende Rolle spielen. Zu ihnen gehören Renaissance, Reformation, Revolution, Rebellion, Restauration und Widerstand (Résistance) ebenso wie Reaktionäre, Revisionisten und Reformer. Jenseits des historisch-politischen Bereichs gibt es weitere gängige Verwendungen wie zum Beispiel Reflexion, Repetition, Reprise und Remake.
Re- meint zurück-, wieder-, wider-, herum- und sonst noch 37manches. Mit ihrer Elastizität kann diese Vorsilbe ein breites Spektrum von Konflikten abdecken. Die wichtigsten semantischen Gehalte, die mit Re- transportiert werden, liegen in dem Bereich, wo sich Wieder und Wider berühren, denn hier zeigt sich, dass beim Re- etwas wiederkommen, aber auch anders weitergehen kann. Wenn etwas wiedergegeben (oder nochmal gespielt) wird, schlägt eben nicht nur die Stunde des Immergleichen, sondern es eröffnet sich die Chance der Abweichung. Selbst beim Widerspiegeln bleibt nicht alles gleich, vielmehr dreht sich alles um. So schillert Re- zwischen der Wiederherstellung eines alten Zustands einerseits, Widerspenstigkeit und Widerstand andererseits. Dieses Schillern weist mit der zuvor erörterten Ambivalenz des Post- durchaus Ähnlichkeiten auf, weshalb Jean-François Lyotard sogar damit geliebäugelt hat, auf das Re- zurückzugehen.45
Ein auffälliges Beispiel für die semantische Breite von Re- ist das Wort Revolution, dessen Bedeutung sich im Lauf der Jahrhunderte von Wieder zu Wider verschoben hat. Erst meinte es eine Umdrehung, dann eine Umkehrung. Erst bezeichnete es die Umlaufbahn der Planeten, dann den Umsturz von Gesellschaften. Ein ähnliches, weniger auffälliges Beispiel ist die Revision, denn sie taugt für bescheidende Anknüpfung und ambitionierte Abweichung gleichermaßen. Die Redewendung, man gehe (noch einmal) über die Bücher, kann besagen, dass man nur erneut prüft, ob die Zahlen stimmen. Sie kann aber auch – wie etwa bei einer umfassenden Gesetzesrevision – über die bloße Durchsicht hinaus einschneidende Veränderungen mit sich bringen. Man sieht alles ein weiteres Mal – oder: Man sieht alles anders. Im Übrigen haben uns Heraklit, Kierkegaard, Freud, Warhol und viele andere gelehrt, dass bei Wiederholung oder Repetition nicht alles gleichbleibt. Das sollten auch die Deutschen irgendwann lernen, die die schlechte Angewohnheit haben, Neuentwicklungen als kalten Kaffee zu servieren, also als Wiederkehr von etwas kleinzureden: »Wiederaufbau«, »Wiedervereinigung«.
38Grob kann man sagen, dass Re- zwischen Anti- und Post- angesiedelt ist. Wie bei Anti-, aber schwächer ausgeprägt, kommt es bei Re- zur Abweichung oder Gegenstellung mit Bezug auf eine Vorgabe. Wie bei Post-, aber weniger markant, eröffnet sich bei Re- eine zeitliche Differenz zwischen dem, was war, und dem, was als Repetition oder Reaktion folgt. Die Vorsilbe Re- hat bis heute ihre treuen Anhänger,46 doch zwei Gründe haben wohl dazu geführt, dass die Unterstützung nachlässt. Sie haben mit Ermüdung oder – schlimmer noch – mit Vergiftung zu tun.
»Man hat das Wort revolutionär zu oft missbraucht«,47 schrieb Condorcet schon 1793. Er konnte seinerzeit nicht wissen, was diesem Wort in der Folgezeit noch zugemutet werden würde (und auch nicht, dass die Revolution ihn ums Leben bringen würde). Zur Ermüdung der Vorsilbe Re- kommt es aber nicht nur durch Abnutzung, sondern auch durch eine besondere sprachliche Vorgabe, die ihre Verwendung steuert. Anders als Post- stellt die Vorsilbe Re- nämlich eine Forderung an die Wörter, mit denen sie Verbindungen eingeht. Diese müssen – kurz gesagt – für Aktionen oder Prozesse stehen, Zustände hingegen sind nicht erlaubt. Es gibt Renaturierung, aber keine Renatur, es gibt Resozialisierung, aber keine Resozialität. Den tätigen Elan, der bei Re- unter Beweis gestellt wird, sucht man im Kontext von Post- vergebens. Vielleicht hat das Versprechen der Stressvermeidung zur Massentauglichkeit von Post- beigetragen.
Die Vorsilbe Re- kann auch Gift absondern. Egal ob das Re- nun einer Wiederholung oder einem Widerruf zuarbeitet, es bleibt auf eine Vorgabe fixiert; und ähnlich wie bei Anti- kann diese Fixierung obsessive Züge annehmen. Nirgends zeigt sich das deutlicher als am Ressentiment. Mit ihm erreicht die Vorsilbe Re- ihren Tiefpunkt. Unübertroffen ist Friedrich Nietzsches Kritik am »unsinnigen Wüthen des Ressentiments« und seine Analyse der »reaktiven Affekte« in Bezug auf die »Gegen- und Aussenwelt«. Zur breiten Palette dieser Affekte gehören »der Ärger, die krankhafte Verletzlichkeit, die Ohnmacht zur Rache, die Lust, 39der Durst nach der Rache, das Giftmischen in jedem Sinne«.48 Man lebt sein Ressentiment aus, wenn man etwas schlechtmacht, um sich gut zu fühlen, und vergiftet damit die Beziehung zu anderen und letztlich zu sich selbst.
Gewiss verfangen sich nicht alle Verwendungsweisen von Re- in dieser Abwärtsspirale. Doch jene negative Fixierung erklärt zumindest teilweise, warum es in der Liga der Vorsilben eine Wachablösung an der Tabellenspitze gegeben hat: die Menschen sind von Re- zu Post- gewechselt. Ähnlich wie bei Anti- verspricht man sich von diesem Wechsel einen schnellen Schritt ins Freie – und übersieht, dass Post- sich seinerseits im Double Bind von Einbettung und Entbettung verfängt.
Trans-. Die Vorsilbe Trans- ist im Verlauf ihrer langen und bewegten Geschichte Beziehungen zu wechselnden Partnern eingegangen. Der Bogen reicht von Tradition, Transzendenz, Transparenz, Übersetzung (translation), Übertragung (transference), Transgression, Transformation über Transkulturalität und Transhumanismus zu transnational, transsexuell, transsektional und auch zu einer Zeitschrift namens Transmodernity. Die historische Konjunktur dieser Vorsilbe zeigt zu keinem Zeitpunkt eindeutig nach oben oder unten. Während etwa die Berufung auf Tradition ewiggestrig wirkt, geht der Einsatz des Begriffs »Transparenz« in der Politik zwar auf das 18. Jahrhundert zurück, sein Aufstieg zum Ruhm beginnt aber erst im 21.49 Aktuell hat die Transkulturalität der Interkulturalität und hat der Transhumanismus dem Posthumanismus den Rang abgelaufen. Wie Re- und andere Konkurrenten, so wird auch Trans- für verschiedene Vorhaben mobilisiert: Neben dem Plädoyer für Überwindung oder Transgression (Nietzsche, Bataille, Foucault) stehen die kritische Analyse der »Great Transformation« (Karl Polanyí) oder die eher technokratisch angelegte Transformationsforschung.
Die zuletzt genannten Begriffsprägungen zielen in der einen oder anderen Weise auf Überschreitung oder Umgestaltung. Hier wird mit Gegebenem gerungen. Anders als die Vorsilbe 40Anti- setzt Trans- auf eine Bewegung ins Offene, und anders als bei Post- geht es hier nicht um eine Abgrenzung und Abtrennung, sondern um einen Prozess. Wer sich daran stört, dass beim Trans- der Altbestand zur Abstoßung genutzt wird, beruft sich auf Martin Heidegger, der mit Bezug auf die »Metaphysik« empfohlen hat, »vom Überwinden abzulassen« und sie »sich selbst zu überlassen«.50 Diese Empfehlung entspricht dem Wechsel von Trans- zu Post-, denn damit wird das – wie auch immer irreführende – Signal gesetzt, man gehe nicht mehr nur über etwas hinaus, sondern lasse es hinter sich. Der Post-Erfolg lebt von der Suggestion, diesen Schritt getan zu haben, und er krankt daran, ihn laufend zurückzunehmen. Im Vergleich hierzu ist Trans- wunderbar eindeutig.
Ko- (Kon-, Kom-). Die Ausbreitung der Vorsilbe Ko- ist groß und umfasst communitas mit ihren Ableitungen (Kommune, Kommunion, Kommunismus, Common Sense etc.) sowie auch Konservatismus, Kooperation, Kombinat, Komplex, Kontext und Konsens. Nimmt man das griechische Pendant hinzu, wird die Liste durch Synthese, System, Synergie etc. verlängert. Willy Brandts Ausspruch aus dem Jahr 1989 »Es wächst zusammen, was zusammengehört« ist ein Beispiel, das die Bandbreite der Bedeutungen von Ko- voll auskostet: In der ersten Hälfte des Satzes geht es nämlich darum, einen Zusammenhang herzustellen, in der zweiten Hälfte gilt dieser als bereits gegeben.
Sichtbar wird diese Bandbreite an den zwei erfolgreichsten Einsätzen dieser Vorsilbe in der neueren Begriffsgeschichte. Für die Herstellung eines Zusammenhangs steht der Konstruktivismus, für die Einbettung der Individuen in eine gegebene Gemeinschaft der Kommunitarismus. Mit dem Konstruktivismus ist hier nicht eine Kunstrichtung gemeint (Malewitsch! Mondrian!), sondern das dominante methodische Paradigma in den Sozialwissenschaften, das von der »sozialen Konstruktion der Wirklichkeit« bis zur Rede vom Geschlecht als Konstrukt51 reicht. Die Einwände, die dem Konstruktivismus entgegengehalten wor41den sind,52 haben seinen Einfluss nicht geschmälert. Drastisch anders sieht das Bild der Welt aus, wenn man vom Konstruktivismus zum Kommunitarismus wechselt. An die Stelle von Kontingenz und Künstlichkeit treten dann die Einbettung und Verortung des Individuums in einer Gemeinschaft, die ihm vorausgeht.53
Beide Denkschulen stehen der Wendung zum Post-