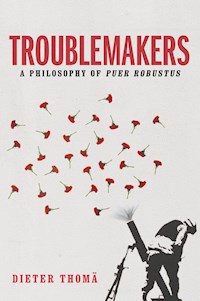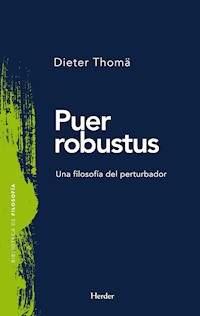27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieter Thomäs großes Buch verhilft einem in Vergessenheit geratenen Störenfried zu einem Comeback: dem puer robustus, dem kräftigen Knaben, der sich nicht an die Regeln hält, der aneckt, aufbegehrt und auch mal zuschlägt. Jahrhundertelang hat er die Gemüter erhitzt. Hobbes und Rousseau, Schiller und Diderot, Marx, Freud, Carl Schmitt und viele andere sahen in ihm eine Schlüsselfigur, an der sich ein Zentralproblem der politischen Philosophie entscheidet: das Verhältnis von Ordnung und Störung. Auch heute tummeln sich an den gesellschaftlichen Rändern –aber auch zunehmend in den Zentren der Macht, wie Thomä im Nachwort zu dieser Ausgabe am Beispiel Donald Trumps zeigt – Trittbrettfahrer und Quertreiber, Eigenbrötler und Rebellen, und hinter ihnen allen steckt der puer robustus. Höchste Zeit, ihn wiederzuentdecken!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1184
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Dieses Buch verhilft einem in Vergessenheit geratenen Störenfried – vielleicht dem Störenfried par excellence – zu einem großen Comeback: dem puer robustus, dem kräftigen Knaben, der auf eigene Faust handelt, sich nicht an die Regeln hält, der aneckt, aufbegehrt und auch mal zuschlägt. Als Unhold oder Held, Schreck- oder Leitbild hat er über drei Jahrhunderte hinweg die Gemüter großer Dichter und Denker erhitzt. Bei Hobbes und Rousseau, Schiller und Hugo, Diderot und Tocqueville, Marx, Freud, Carl Schmitt und vielen anderen tritt er als Schlüsselfigur auf, an der sich ein Zentralproblem der politischen Philosophie entscheidet: das Verhältnis von Ordnung und Störung.
Auch heute steht die Zukunft der modernen Gesellschaft auf dem Spiel. Und nach wie vor entscheidet sie sich nicht im Zentrum der Macht, sondern an den Rändern, wo die Krisen ausgefochten werden. Dort – an der Schwelle zur Ordnung – tummeln sich Trittbrettfahrer und Quertreiber, Eigenbrötler und Rebellen, und hinter ihnen allen steckt der puer robustus. Höchste Zeit also, ihn mit Dieter Thomä wiederzuentdecken, der in seiner fabelhaften philosophischen Abenteuergeschichte zeigt, was von diesem Kerl zu halten ist.
Dieter Thomä, geboren 1959, ist Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen.
Im Suhrkamp Verlag sind zuletzt erschienen: Erzähle dich selbst. Lebensgeschichte als philosophisches Problem (stw 1817), Totalität und Mitleid. Richard Wagner, Sergej Eisenstein und unsere ethisch-ästhetische Moderne (stw 1765) und Vaterlosigkeit. Geschichte und Gegenwart einer fixen Idee (Hg., stw 1947).
Dieter Thomä
Puer robustus
Eine Philosophie des Störenfrieds
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
© Dieter Thomä
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Für
Petra und Christoph
in Freundschaft
The man is […] a misfit from the start.
Ralph Waldo Emerson
Man möcht halt über sich hinaus
Inhalt
Einleitung
I. Der puer robustus als böser Mensch: Thomas Hobbes
1. Das Schwellenwesen im Spannungsfeld von Macht, Moral und Geschichte
2. Eigeninteresse und Vernunft
3. Die egozentrischen Störenfriede nach Hobbes: Narren, Epileptiker, Tollwütige, Arme und Reiche
4. Die Author-actor-audience-Theorie: Der exzentrische Störenfried im Bauch des Leviathan
5. Der puer robustus bei Horaz – ein Vorbild für Hobbes?
II. Der puer robustus als guter Mensch: Jean-Jacques Rousseau
1. Macht und Moral des Wilden
2. Die Verwandlung des puer robustus in den Staatsbürger
3. Was macht Rousseaus puer robustus nach seinem Sieg? Demokratie und Ruhestörung
III. Rameaus Neffe als puer robustus: Denis Diderot
1. Hobbes' erhabene Definition
2. Der puer robustus als soziales Problem oder als ambivalente Figur: Diderot jenseits von Helvétius, Hobbes und Rousseau
3. Leben auf der Schwelle: Rameaus Neffe
4. Hegels und Foucaults Neffe
IV. Unzärtliches Kind, böser Sohn, starker Retter: Friedrich Schiller
1. Der puer robustus als »Freigelassener der Schöpfung«
2. Franz und Karl Moor: Alle Macht für mich – oder eine andere Macht für alle?
3. Wilhelm Tells Weg vom Einzelgänger zum Stifter des Bundes
V. Der puer robustus als Opfer und Held: Victor Hugo
1. Quasimodo als verpfuschter Affe
2. Die Geburt der Bosheit aus der Demütigung
3. Moralische Emanzipation
4. Der Straßenjunge als puer robustus
5. Die Verwandten des Straßenjungen: Der ganze Kerl Balzacs und der kleine Wilde Baudelaires
VI. Siegfried, dummes Kind: Richard Wagner
1. Der Vertrag als Verbrechen gegen die Natur
2. Rettung von außen
3. Der Held als Kind und Dummkopf: Siegfrieds Erfolgsrezept
VII. Der puer robustus zwischen Europa und Amerika: Alexis de Tocqueville
1. Die Geburt des puer robustus unter dem Joch des Despotismus: Tocquevilles erste Einsicht
2. Lob für Amerika, Warnung vor dem Wilden Westen
3. Die Geburt des puer robustus aus dem Geist des Kapitalismus: Tocquevilles zweite Einsicht
4. Leben als Revolution und Experiment: Tocqueville, Mill, Nietzsche
VIII. Der puer robustus als Revolutionär: Karl Marx und Friedrich Engels
1. Das Volk ist das Allergefährlichste
2. Der Kampf gegen Abhängigkeit und Absonderung
3. Das Lumpenproletariat als Spielverderber der Revolution
4. Das revolutionäre Subjekt als Gattungswesen oder als Gemeinwesen
IX. Der puer robustus als Ödipus: Sigmund Freud
1. Der kleine Wilde
2. Demokratie und Diktatur
3. Ödipus und seine Brüder: Die Theorien des puer robustus im Spiegel der Psychoanalyse
4. Politik nach Freud: Ein Streit zwischen Walter Lippmann, Paul Federn, Hans Blüher, Thomas Mann und Hans Kelsen
X. Anarchisten, Abenteurer, Halbstarke und kleine Wilde: Carl Schmitt, Leo Strauss, Helmut Schelsky und Max Horkheimer
1. Blütezeit in finsterer Zeit: Hobbes da capo
2. Carl Schmitt über den totalen Staat und seine Feinde
3. Leo Strauss über die geschlossene Gesellschaft und die Abenteurer
4. Helmut Schelsky über die Macht und die Halbstarken
5. Max Horkheimer über den autoritären Staat und die kleinen Wilden
XI. Guter Geist und giftiges Unkraut: Der puer robustus in Italien 1949 und in China 1957
1. Togliattis Neujahrsbotschaft an die Genossen
2. Mao Zedong und Tan Tianrong über duftende Blumen und giftiges Unkraut
3. Von China zurück nach Europa: Alain Badiou kann man vergessen
XII. Der puer robustus heute
1. Kein Ende der Geschichte
2. Der egozentrische Störenfried und die Finanzkrise
3. Exzentrischer und nomozentrischer Störenfried – und das demokratische Paradox
4. Der massive Störenfried und der Fundamentalismus
5. Die Wahrheit liegt an der Schwelle
Anmerkungen
Dank
Siglenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Namenregister
Einleitung
Der puer robustus schlägt zu, eckt an, begehrt auf. Er spielt nicht mit, gibt nicht klein bei, handelt auf eigene Faust, verstößt gegen Regeln. Er ist unartig, unverschämt, unbequem, unbehaust, unbekümmert. Er wird gefürchtet, ausgegrenzt, abgestraft, aber auch bewundert und gefeiert. Der puer robustus – der kräftige Knabe, der starke Kerl – ist ein Störenfried.
Der Störenfried stört den Frieden. Er ist also nicht gerne gesehen – es sei denn, er wendete sich gegen einen faulen, falschen Frieden. Dann dankt man ihm für den Bruch mit der bleiernen Zeit. Mit seinem abstoßend-anziehenden Gesicht passt er auf eines jener ›Wackelbilder‹, mit denen ich als Kind gespielt habe: Wenn man sie nur ein bisschen zur Seite kippte, verwandelte sich die grimmige in eine freundliche Miene – oder umgekehrt. So kennt man den puer robustus als Unhold oder Held, Schreck- oder Wunschbild, Angstgegner oder Leitfigur.
Besser gesagt: Man kannte ihn. Heute ist er vergessen, doch über drei Jahrhunderte hinweg hat er die Gemüter erhitzt. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Victor Hugo, Alexis de Tocqueville, Karl Marx und viele andere haben ihm ihre Aufmerksamkeit geschenkt und sich über der Frage entzweit, was von ihm zu halten sei. Dem puer robustus ist ein neuer Auftritt auf der Bühne der politischen Philosophie zu gönnen. Er hat das Zeug dazu, eingespielte Denk- und Handlungsmuster zu verschieben und die ganze Szene zu verwandeln. Käme er nicht so burschikos daher, könnte man ihn zu den grauen Eminenzen der Ideengeschichte zählen.
Der Streit, der sich am puer robustus entzündet hat, betrifft nicht irgendein, sondern das Problem der politischen Philosophie: die Frage, wie sich eine Ordnung etabliert und legitimiert, wie sie kritisiert, transformiert oder attackiert wird, wie Menschen von dieser Ordnung einbezogen oder ausgeschlossen werden, sich anpassen oder quertreiben. Zum Thema der Ordnung gehört notwendigerweise das der Störung, also auch die Rolle von Außenseitern und Randfiguren, Querulanten und Quertreibern. Die politischen Aufbrüche und Umbrüche der Moderne stehen, so meine ich, für Krisen, die nicht vom Zentrum der Macht, sondern vom Rand her zu verstehen sind. Entsprechend kann auch nur dort der Umgang mit diesen Krisen gelernt und ihre Lösung gesucht werden.
Die Initialzündung für das intellektuelle Feuerwerk, das mit dem puer robustus entfacht worden ist, erfolgte im 17. Jahrhundert. Thomas Hobbes verhalf ihm zum ersten Auftritt auf der Bühne der Neuzeit. 1647 erschien die zweite Auflage von De cive (Vom Bürger), Hobbes ergänzte sie durch ein Vorwort, in dem es hieß, der »vir malus« sei fast dasselbe wie ein »puer robustus, vel vir animo puerili«. Die zu Hobbes' Lebzeiten angefertigte englische Version lautete: »A wicked man is almost the same thing with a childe growne strong and sturdy, or a man of a childish disposition.« Oder auf Deutsch: »Ein böser Mann [gleicht] so ziemlich einem kräftigen Knaben oder einem Manne mit kindischem Sinn.« Dieser puer robustus stand für die ultimative Bedrohung der staatlichen Ordnung, Hobbes hielt ihn für den bösen Störenfried schlechthin.
Den vorerst letzten auffälligen Auftritt hatte der puer robustus in China, während einer kurzen Phase politischer Liberalisierung im Frühjahr 1957. »Lasst hundert Blumen blühen« – dazu hatte Mao zuvor aufgerufen. Die Studenten der Universität Peking nahmen ihn beim Wort, gründeten eine »Hundert-Blumen-Gesellschaft« und taten auf Wandzeitungen ihre Meinung kund. Tan Tianrong, einer der studentischen Wortführer, ließ seine Botschaft vom 20. Mai 1957 mit einem Heraklit-Zitat beginnen, wonach die »Regierung der Stadt an bartlose junge Männer übergeben werden« solle, und unterschrieb sie mit der lateinischen Formel »Puer robustus sed malitiosus«. Dieser puer trat – ganz anders als bei Hobbes – als demokratischer Aktivist auf: als guter Störenfried.
Hierhin und dorthin hat es den puer robustus verschlagen, er gelangt vom London des 17. ins Peking des 20. Jahrhunderts – und überdies an zahlreiche andere Orte. Niemand hat der verwickelten, verblüffenden Geschichte dieses enfant terrible bislang Beachtung geschenkt und ihren Ertrag für die Theorie von Ordnung und Störung geerntet. Mein Buch ist der Wiederentdeckung, Vergegenwärtigung und Beurteilung des puer robustus gewidmet.1
Man kann das Bauprinzip dieses Buches mit einer Drehbühne vergleichen. Mit jedem Akt zeigen sich ein neues Bühnenbild und ein anderer puer robustus. Er ändert sich im Sauseschritt, er ist Dickschädel oder Leichtfuß, Barbar oder Narr, Trittbrettfahrer oder Künstler, Räuber oder Retter, Siegfried oder Ödipus. Trauergesänge und Jubelstürme brausen um ihn herum auf. Natürlich geht es in diesem Buch um eine Geschichte nach Hobbes, also um die langwierige, ergiebige Auseinandersetzung mit ihm, die von Rousseau bis Leo Strauss reicht – und darüber hinaus. Aber es ist nicht nur schmückendes Beiwerk, dass zwei der ungewöhnlichsten Helden der französischen Literatur, Rameaus Neffe und der Glöckner von Notre Dame, als Verkörperungen des puer robustus ins Spiel kommen. Neben sie treten die Pariser Straßenjungen, die europäischen Proletarier, die kalifornischen Pioniere des 19. Jahrhunderts, die Jugendbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die deutschen Halbstarken, die italienischen Kommunisten, die bereits erwähnten chinesischen Studenten der 1950er Jahre und viele andere mehr. Die Denker, die dem puer robustus die Ehre erweisen, setzen ihn einem wilden Spiel von Konflikten aus. Es ist ein Tanz ums Subjekt oder um mehrere Subjekte der Geschichte, der von ihnen aufgeführt wird.
Zu diesem Tanz passt es nicht, einfach einen Lobgesang oder Abgesang auf den Störenfried anzustimmen. Vielleicht wünscht man sich, nur den Siegeszug von Freiheitshelden zu schildern oder umgekehrt ein für alle Mal mit Schmarotzern, Querulanten und Provokateuren aufzuräumen. Solche sauberen Lösungen und Trennungen verbieten sich angesichts des widersprüchlichen, widerspenstigen puer robustus. Er lässt sich nicht in einen Bildungsroman hineinzwingen, in dem sich »das Subjekt« langsam, aber sicher »die Hörner abläuft« (Hegel, WA 14, 220).
Wenn dieses Buch lebendig wäre, dann schlügen wohl zwei Herzen in seiner Brust. Es ist eine philosophische Abhandlung – und auch so etwas wie eine Abenteuergeschichte. Zugegeben: Ich konkurriere nicht mit den Reportern, die sich in der Hip-Hop-Szene, bei den Testamentsverwaltern von Occupy Wall Street, bei Revoluzzern oder Randalierern herumtreiben. Aber ich wiege mich in dem Glauben, dass es auch geistige Abenteuer gibt, und stürze mich in sie. Man könnte dieses Buch probeweise so charakterisieren, dass darin ein Bogen von Hobbes bis zur Gegenwart geschlagen wird, doch das wäre schon schief. Ein Bogen ist eine ununterbrochene, ungebrochene Linie. Wer sie durchläuft, kennt seinen Kurs. Wer dagegen in einen »Abenteuerroman« hineingerät, verfügt über diese Sicherheit nicht. Als literarische Gattung handelt er von einem Helden, der keinen festen »Platz […] im Leben einnimmt«, und zeigt, »wie aus einem Menschen ein anderer wird« (Michail Bachtin).2
Mein Held – der puer robustus – ist unterwegs. Er weiß nicht, wo er morgen sein wird und wer er morgen sein wird. Statt seine Erfahrungen wie Perlen auf eine Schnur aufzufädeln, bis alles fest sitzt und passt, schlägt er sich durch und hofft, dass alles am Ende gut ausgeht. Er kann nur zugeben: »Ich kenne mich nicht aus.« Der Abenteuerroman wird zu Unrecht als eine Gattung angesehen, die anachronistische Züge hat. Er ist die Gattung einer Welt – unserer Welt –, in der man aufgerufen ist, »ins Chaos hinab[zu]steigen, und sich dort wohl[zu]fühlen« (Ludwig Wittgenstein).3 Dazu gehört eine Auffassung von Geschichte, wonach einzelne Situationen einen Überschuss, ein Überraschungsmoment behalten und sich der Einordnung widersetzen. »Das Abenteuer ist die Exklave des Lebenszusammenhanges« (Georg Simmel).4 Das Unvollendete wird Ereignis. Deshalb gehört derjenige, der eine Abenteuergeschichte erzählt, auch zu den Verehrern des Aphorismus. »Wir, die wir nicht aphoristisch denken und sprechen, sondern aphoristisch leben, wir, die wir aphorismenoi und segregati (ausgesondert und abgetrennt) im Leben stehen« (Søren Kierkegaard),5 lernen mit dem puer robustus einen neuen Nachbarn kennen.
Hinter der Neigung zum Abenteuerroman steckt ein Misstrauen gegen Theorie. Ich glaube nicht, dass man in der politischen Philosophie gut daran tut, die Frage nach Ordnung und Störung am Reißbrett zu bearbeiten. Es genügt nicht, Argumente zu prüfen und Regeln aufzustellen, es genügt auch nicht, Fälle zu simulieren oder Gedankenexperimente durchzuführen, mit denen sich solche Regeln anwenden und erproben lassen. In der Annahme, dass man sein Thema auf diese Weise in den Griff bekommen könnte, steckt eine »lächerliche Unbescheidenheit« (Nietzsche, KSA 3, 627). Ihr wirkt die Unbeherrschtheit entgegen, durch die sich die Figur des puer robustus auszeichnet. Schließlich ist sie eben dies: eine Figur, die mal hier, mal dort, mal so, mal anders auftritt, nicht eine Argumentation, eine These, die klar zu formulieren und zu diskutieren wäre. Die Denker, die den puer robustus einsetzen, mögen glauben, er sei ihr willfähriges Werkzeug. Doch er spottet ihrer Selbstgewissheit, hat sein Eigenleben und avanciert zu einem Hauptdarsteller der Moderne. Auf die inneren Verwandlungen und äußeren Streitigkeiten, von denen er gebeutelt wird, würde ich nicht im Traum kommen (und erst recht nicht, während ich wach bin).
Gefragt ist jedoch nicht nur Misstrauen gegen die Theorie, sondern in genau dem gleichen Maße Zutrauen zu ihr. Im Glücksfall wird die Theorie von der Einsicht in ihre Grenzen, vom Chaos des Abenteuers, dem sie sich aussetzt, eher beflügelt als geschwächt. Mit Hilfe der Theorie gelangt man über die einzelne Situation hinaus. Man ist nicht mitgefangen und mitgehangen, sondern schaut auf sich und auf alle. So gesellt sich zur Abenteuergeschichte,6 die dieses Buch auch ist, eine Theorie des Störenfrieds. Sie will bestimmen, durch welchen Dreh sich seine Gestalt ändert und was von seinen Auftritten jeweils zu halten ist.
Um die Balance zwischen Abenteuergeschichte und Theorie zu wahren, werde ich die meisten systematischen Überlegungen erst im Laufe der Reise entwickeln, die ich antrete. Dann wird zum Beispiel zu fragen sein, warum der puer robustus so verdammt männlich ist oder was mit ihm passiert, wenn er seine weibliche oder einfach menschliche Seite entdeckt. Nicht nur seine Männlichkeit, sondern auch sein Individualismus ist auffällig – und vielleicht auch anfällig. An ihm klebt die Idee, soziale Kooperation anhand des Schemas von Vertragsschluss und Vertragsbruch abzuhandeln. Sie wird mich ebenso umtreiben wie die Frage, ob der puer robustus dazu verurteilt ist, Einzelgänger zu bleiben, oder ob er zu Gemeinschaften, zu Kollektiven Zugang findet. (Hier wird sich der Unterschied zwischen sympathetischer und synergetischer Vergesellschaftung als fruchtbar erweisen.) Bevor die Drehbühne in Gang kommt, auf der der puer robustus auftritt, bevor seine Spielzüge und Kampfformen im Detail erkundet werden, möchte ich immerhin einen Grundbegriff der Theorie des Störenfrieds einführen und eine kleine Typologie seiner verschiedenen Formen skizzieren. Der Grundbegriff heißt: Schwelle.
Es geht in diesem Buch, wie eingangs gesagt, um das Verhältnis zwischen Ordnung und Störung. Aus Gründen, die ganz unterschiedlicher Art sein können, rutscht der puer robustus an den Rand, schießt quer, grätscht dazwischen. Wie auch immer der Störenfried sich verhält, er befindet sich am Rand, an einer Grenze oder eben, wie es besser heißen sollte, an einer Schwelle. Diese Schwelle ist eines der unauffälligsten und zugleich wichtigsten baulichen Details im Gebäude der politischen Philosophie.
Das Wort Schwelle ziehe ich der Grenze vor, weil es zwei Besonderheiten aufweist. Zum Ersten gilt: Eine Schwelle ist typischerweise niedrig. Man kann sie überschreiten, über sie stolpern oder an ihr innehalten. Die Durchlässigkeit der Schwelle ist in weit höherem Maß als die der Grenze variabel und verhandelbar. Zum Zweiten kann mittels der Schwelle eine Aufteilung vorgenommen werden, mit der sich zwei Räume als Drinnen und Draußen definieren lassen. Eine solche Unterscheidung kennt zwar auch derjenige, der Grenzen zieht, aber hier hängt die Definition von Drinnen und Draußen allein am Standort des Betrachters: Das Ausland des Einen ist das Inland des Anderen – und umgekehrt. Dagegen gehört die prominenteste Version der Schwelle zu einem Eingang, mit dem die Zuordnung von Drinnen und Draußen ein für alle Mal gesetzt ist. Jemand, der vor der Tür steht, kann sich nicht weismachen, drinnen zu sein. Besser als die Grenze mit ihren variablen Zuordnungen passt die Schwelle zum politischen Problem von Ordnung und Störung: Sie bezieht sich auf einen Innenraum, der von einem Rand umrissen ist, an dem es zur Konfrontation zwischen den Mitgliedern der Ordnung und den Außenseitern kommt. Genau dabei wird die Durchlässigkeit der Schwelle zur Schlüsselfrage.
Eine Grenze trennt Bereiche oder Reiche, in denen hüben wie drüben Mitglieder zu finden sind. Der puer robustus, der sich an der Schwelle herumtreibt, steht nicht zwischen zwei Ordnungen, er bewegt sich vielmehr am Rand einer einzigen Welt, die durch die Reichweite ihrer Macht definiert ist. Dieser Rand ist kein anderer Ort, sondern eigentlich ein Nichtort. Der puer robustus gehört nicht irgendwo dazu, sondern ist der Unzugehörige schlechthin. Es fällt ihm schwer, sich an diesem Nichtort niederzulassen. Er kann sich nicht in dem Gefühl sonnen, für die Welt nichts übrig zu haben. Vielmehr bezieht er sich unweigerlich auf die Ordnung, befindet sich in einer Spannung zu ihr. Er führt ein »Leben auf der Schwelle« und bleibt »innerlich unabgeschlossen« (Bachtin).7
Da die Ordnung ohne einen Rand nicht sein kann, der ihren Geltungsbereich markiert, nimmt sie in Kauf, dass Menschen sich außerhalb dieses Bereiches, jenseits dieses Randes herumtreiben. Mit Hegel ist darauf hinzuweisen, »daß darin selbst, daß etwas als Schranke bestimmt ist, darüber bereits hinausgegangen ist« (WA 5, 145). Die Ordnung bringt also eigentlich den Störenfried hervor, den sie beobachtet und bekämpft. Sie will ausgrenzen und muss mit der Unruhe leben, von der sie umgeben ist wie von einem Feuerkreis. Dieses Schema von Drinnen und Draußen ist gebunden an ein zentralistisches Modell von Politik, das als Gegner nur Außenseiter kennt. Historisch gesehen heißt das: Der puer robustus kann nur ein Kind der frühen Neuzeit sein, also einer Zeit, in der das Kräftespiel zwischen verschiedenen Machtinstanzen (Königtum, Kirche, Adel etc.) durch das Machtmonopol des Staates abgelöst wird. Es ist kein Zufall, dass gerade Hobbes den puer robustus in die politische Philosophie eingeführt hat. Diese Figur bleibt jedoch so lange am Leben, wie solche Machtzentren den Ton angeben – ob es nun Nationalstaaten, imperiale Mächte, transnationale Institutionen oder andere global players sind –, also bis in die heutige Zeit. Damit ist auch klar, dass sich der puer robustus am Ende dieses Buches in einen Zeitgenossen verwandelt haben wird.
Wenn von »Schwelle« oder »Liminalität« die Rede ist, kommt unweigerlich die ethnologische Theorie des »Schwellenwesens« ins Spiel.8 Dabei ist der puer robustus nicht im Sinne der Ethnologie ein Wesen, dessen Existenz an eine Aus- oder Zwischenzeit gebunden ist, also etwa ein Jugendlicher, der kurz über die Stränge schlägt oder eine Woche lang in der Einöde auf das Erwachsensein vorbereitet wird. Das Ritual des Übergangs ist beim Störenfried keine Phase oder Episode; bei ihm wird der Übergang zur Lebensaufgabe. Er hält in dem Moment inne, in dem sein Leben in der Schwebe ist, und verdirbt damit zugleich der Ordnung die Geschlossenheit. Natürlich kann sie Härte demonstrieren, ihn für seine Verweigerung abstrafen oder mit aller Macht dazu zwingen, klein beizugeben. Doch der Störenfried hat nicht nur die Wahl zwischen Ausschluss und Eingliederung. Wenn er die Ordnung herausfordert und ihre Elastizität testet, kann sie auch ins Wackeln geraten. Es stellt sich, kurz gesagt, die Frage nach der direction of fit: Wer passt sich wem an? Macht die Ordnung mit dem Störenfried kurzen Prozess oder treibt er sie zur Veränderung, erwirkt er einen Umbruch?
Der puer robustus tritt als Schwellenwesen gegen den homo sacer an, gegen jene Figur also, die Giorgio Agamben der Vergessenheit entrissen hat. Beide stehen für die Ausgeschlossenen, und wie der puer robustus von Hobbes ein vir malus genannt wird, so wird der homo sacer im römischen Recht als homo malus bezeichnet.9 Doch in Agambens Analyse sind »Ausschließung«, »Absonderung«, »Verlassenheit« definitiv.10 Der homo sacer befindet sich in einem absoluten Draußen, er ist der ganz Andere, gegen den sich eine Ordnung definiert und den sie, jedenfalls in der Antike, straflos töten darf. Die Unterscheidung »zwischen dem Staat und dem Nicht-Staat«11 ist zementiert, die Schwelle, von der bei Agamben übrigens häufig die Rede ist,12 verwandelt sich in ein unüberwindliches Hindernis. Anders als Agamben und viele andere interessiere ich mich nicht nur für Grenzen, sondern auch für Grenzübergänge. Wenn man die Ausgrenzung absolut setzt, wird der Außenseiter – und mit ihm die Geschichte – lahmgelegt. Er kommt nicht als Akteur ins Spiel, sondern wird zum Opfer gemacht.13 An dieser Stelle darf man Foucault gegen Agamben setzen: »Man muss der Alternative des Draußen und Drinnen entkommen; man muss an den Grenzen sein.« – »Eine Kultur über ihre Grenzerfahrungen zu befragen heißt, sie an den Grenzen der Geschichte über eine Absplitterung, die wie die Geburt ihrer Geschichte ist, zu befragen.«14 Wenn die Grenzerfahrungen selbst eine Geschichte haben, dann heißt dies, dass die Grenzen permanent bestätigt, bestritten, verteidigt, verschoben oder durchbrochen werden. Und wenn all dies geschehen soll, dann muss es unter den Ausgeschlossenen und Eingeschlossenen nicht nur Leidtragende, sondern auch Handelnde geben. Der puer robustus ist ein solcher Handelnder. Ihm ist zuzutrauen, den Lauf der Welt zum Guten oder zum Bösen zu beeinflussen.
Mit der Kritik an Agamben verbinde ich einen allgemeinen Punkt: Mein Eindruck ist, dass die politische Philosophie an einer unguten Opposition zwischen Identität und Alterität krankt.
Auf der einen Seite ist der Außenseiter als Gegenstand der Theorie inzwischen so beliebt geworden, dass man paradoxerweise denken könnte, er sei einer von uns. Stuart Hall bemerkte schon im Jahre 1990, es würden viele »elegante Artikel über das ›Andere‹« geschrieben, ohne dass deren Autoren unbedingt »erfahren« hätten, »was ›Anderssein‹ für manche bedeutet«.15 Ohne die Rede von Alterität, Marginalität, Multitude etc. kommt die politische Theorie eines bestimmten Typus nicht aus. Sie tritt, grob gesagt, in einer fröhlichen und in einer melancholischen Variante auf, nämlich als Mobilisierung heterodoxer Energien oder als Verweis auf die prinzipiell unergründliche Andersheit des Anderen.
Auf der anderen Seite ist ein nicht minder prominenter Typus politischer Theorie fixiert auf Modelle kollektiver Identität und sammelt Material, aus dem der cement of society bestehen könnte. Die einschlägigen Stichworte heißen Leitkultur, Sozialkapital, Erinnerungsgemeinschaft, Solidarität, Gemeinwohl, Weltethik etc. Auch dieser Typus tritt in verschiedenen Varianten auf, nämlich mit dem konstruktivistischen Elan der Etablierung allgemein verbindlicher und verbindender Normen oder aber mit der restaurativen Geste der Sicherung von Traditionsbeständen.
Wenn – wie zu hoffen ist – die Richtigkeit dieser formalen Gegenüberstellung Vertretern beider Seiten einleuchtet, dann bleibt in einem nächsten Schritt nur zu klären, ob es ratsam ist, sich auf eine dieser Seiten zu schlagen. Im Licht der gerade skizzierten Theorie der Schwelle scheint mir dies unsinnig. – Denjenigen, die das Spiel der Alteritäten feiern und zugleich der Institutionalisierung des Zusammenlebens misstrauen, ist entgegenzuhalten, dass sie eigentlich nicht Differenz, sondern Indifferenz, einen Zustand der Gleichgültigkeit, propagieren. Der Streit um Abweichungen ist doch nur denkbar als Streit um Gemeinsamkeiten. – Diejenigen, die auf Identität setzen, kann man vielleicht am einfachsten mit einem Zitat aus Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahren in die Enge treiben:
Von einer Theatergesellschaft so gut wie von einem Reiche […] läßt sich gewöhnlich der Moment angeben, wenn sie auf der höchsten Stufe ihrer Vollkommenheit, ihrer Übereinstimmung, ihrer Zufriedenheit und Tätigkeit standen; oft aber verändert sich schnell das Personal, neue Glieder treten hinzu, die Personen passen nicht mehr zu den Umständen, die Umstände nicht mehr zu den Personen; es wird alles anders.16
Die Diskrepanz zwischen »Umständen« und »Personen« beschränkt sich nicht darauf, dass Letztere vielleicht uneins darüber wären, wie der politische Rahmen, in dem sie sich befinden, aussehen soll. Diese Diskrepanz führt vielmehr zu einer radikalen Verunsicherung von Institutionen. Sie befinden sich auf einem schwankenden Untergrund, weil das, was Goethe »Personal« nennt, permanent wechselt. Die Fremdheit kommt nicht nur aus der räumlichen Ferne, sondern entspringt zuallererst dem zeitlichen Lebens-Wandel. Ihm sind politische Ordnungen ausgesetzt, sobald sie sich in irgendeiner Form auf die Initiative ihrer Mitglieder beziehen und stützen – und dies gilt jedenfalls für alle modernen Gesellschaften seit Hobbes.
Heutzutage denkt man bei den Fremden sogleich an Migrationsströme in der globalisierten Welt; unweigerlich steigen sie am Horizont des Bildes auf, das in diesem Buch gezeichnet wird. Zu beschreiben ist aber zuallererst die innere Migration in einer Gesellschaft, also der Hochbetrieb, der Auftrieb an der Schwelle, an der politische Subjekte werden, was sie sind, an der Ordnungen herausgefordert sind, sich zu behaupten oder zu erneuern. Das heißt auch: Gerade weil moderne Gesellschaften von sich aus – un- oder bereitwillig – mit innerer Migration umgehen, sind sie für den Umgang mit äußerer Migration vorbereitet. Am Leitfaden des puer robustus werde ich mich am Ende bis zu den aktuellen Krisen der Ausgrenzung und Integration hangeln.
Wie ergeht es dem puer robustus, der an der Schwelle zur Ordnung steht? Er kann an ihr zerbrechen und zugrunde gehen. Er kann sich selbst aufgeben und langsam, aber sicher seriös werden. Doch neben seinem mehr oder minder fatalen Ende stehen ihm auch Szenarien der Selbstbehauptung offen. Sie fallen extrem unterschiedlich aus und lassen sich in einer kleinen Typologie des Störenfrieds zusammenfassen, von der ich mich in diesem Buch leiten lasse. Da gibt es zunächst den egozentrischen Störenfried, der – bildlich gesprochen – an der Schwelle auf den Boden stampft, sich gegen die staatliche Ordnung sträubt und seinen Eigenwillen auslebt. (Mit diesem Typus lässt Hobbes die Geschichte des puer robustus beginnen.) Neben ihn tritt der exzentrische Störenfried, der auf die Regeln pfeift, dabei aber nicht auf seinen Eigenwillen bauen kann, weil er noch auf der Suche nach sich selbst ist. Er nutzt den Rand, an dem er sich befindet, nicht als Aufenthaltsort, sondern als Sprungbrett ins Ungewisse. (Diesen Typus wird Diderot in die Geschichte des puer robustus einführen, und Tocqueville wird zwischen der Antipathie gegen den egozentrischen und der Sympathie für den exzentrischen Störenfried schwanken). Sodann gibt es noch den nomozentrischen Störenfried, der seinen Kampf gegen die Ordnung im Vorgriff auf Regeln führt, die dereinst an deren Stelle treten sollen. (Diesem Typus begegnet man bei Rousseau; Schiller wird ihn mit Karl Moor und Wilhelm Tell auf die Bühne bringen und Marx wird versuchen, ihn von der Bühne in die Wirklichkeit des Klassenkampfs hinüberzuziehen.)
Man kann das Vokabular noch anreichern, mit dem sich diese drei Typen von Störenfrieden charakterisieren lassen. An der Schwelle, auf der sie sich zum Status quo verhalten, geraten sie in eine Krise ihrer Zugehörigkeit, mit der sie unterschiedlich umgehen. Sie beharren auf sich (Obstinanz), halten Distanz und wenden sich ab (Aversion). Oder sie gehen über sich hinaus (Transgression), generieren Differenz und ecken an (Subversion). Oder sie nehmen das Neue vorweg (Antizipation), behaupten Diskrepanz und wandeln die Ordnung um (Konversion).
Mit der Trias aus egozentrischem, exzentrischem und nomozentrischem Störenfried lassen sich alle Figuren erfassen, die in diesem Buch auftreten – oder fast alle. In der Spätzeit des puer robustus wird man auf einen Typus stoßen, der sein Unwesen treibt, indem er so etwas wie eine gestörte Störung auslöst. Für seine Hetze und Härte braucht er etwas, was dem Selbstbild des Störenfrieds eigentlich zuwiderläuft: den Schutz der Masse, in der er verschwindet und in deren Namen er agiert. Er hat deshalb keinen besseren Namen verdient als den des massiven Störenfrieds.
Die Abfolge der Typen, die ich gerade geschildert habe, mag den Eindruck nahelegen, hier würde eine historische Entwicklung geschildert, in der einer nach dem anderen auftritt und abtritt. Das ist aber überhaupt nicht gemeint. Die Geschichte des puer robustus ist und bleibt eine Abenteuergeschichte, und das heißt, dass ihr keine logische Folge, keine geschichtsphilosophische Tendenz zugrunde liegt. Die verschiedenen Typen des Störenfrieds betreten die Bühne, verschwinden und tauchen immer wieder auf. Zwischen ihnen herrscht eine furchtbar-fruchtbare Konkurrenz. Der puer robustus liegt mit sich selbst im Streit, weil die Denker, die sich mit ihm befassen, ihn in die unterschiedlichsten Rollen hineintreiben. Sie legen ihn sich zurecht, um ihn dann anzugreifen oder zu verteidigen.
Da die Geschichte, die ich erzähle, zeitlich und sachlich mit der Durchsetzung der Demokratie in der westlichen Welt zusammenfällt, ist auch das Bild der Ordnung, das jene Denker dem Störenfried entgegenhalten, dem Wandel unterworfen. Zur Zu- und Abneigung gegenüber dem Störenfried tritt ein Kampf für oder gegen Demokratie, ohne dass bei diesem doppelten Pro und Kontra immer die gleichen Koalitionen und Fronten gebildet werden. Letzten Endes wird zu fragen sein, welche Agenda der Störenfried verfolgt, wenn die Demokratie sich bereit erklärt, ihn mit offenen Armen aufzunehmen, wenn sie sich selbst »wild« (Lefort), »rebellierend« (Abensour) oder »kreativ« (Dewey) nennt (s. u. S. 331, 389). So viel sei vorab gesagt: Er wird nicht verschwinden.
In diesem Buch werde ich die Stärken und Schwächen der Rollen, in die der puer robustus schlüpft, analysieren. Verständlich werden diese Rollenspiele nur vor dem Hintergrund der Bühnenbilder, auf denen der puer robustus sich bewegt, und im Widerspiel zu den Verteidigern der Ordnung, die sich mit ihm herumschlagen. Will man den Störenfried kennenlernen, muss man sich mit seinen Feinden sowie auch mit seinen Freunden vertraut machen; unter ihnen werden einige falsche Feinde und falsche Freunde zu finden sein. Welchem Störenfried Anerkennung und Ermutigung gebührt und wie man ihm auf die richtige Weise zugetan ist, wird sich zeigen. Es ist – um dies schon jetzt zu verraten – der exzentrische Störenfried, dem meine besondere Zuneigung gilt.
Auf der Drehbühne, die den puer robustus zum Auftritt einlädt, werden die prekären, riskanten Positionen des Außenseiters markiert, die Strategien der Ordnung, ihn auszugrenzen oder zu zähmen, sind zu erkunden, die Versuche, die Ordnung zu erschüttern und umzugestalten, werden durchgespielt. Der Vorhang hebt sich, das Spiel kann beginnen.
I.Der puer robustus als böser Mensch: Thomas Hobbes
1. Das Schwellenwesen im Spannungsfeld von Macht, Moral und Geschichte
Der puer robustus hat einen Vater, der ihn verstößt. Sein Name ist Thomas Hobbes. Diejenigen, die sich dieser Figur in der Folgezeit zuwenden, berufen sich auf ihn. Hätte Hobbes die lange Karriere des puer robustus als Zeuge verfolgen können, wäre sie von ihm argwöhnisch beäugt worden. Er wollte ihn als Fehlerbeispiel vorführen und aus der Geschichte verbannen. Gelungen ist ihm dies nicht. Was ist das für ein puer robustus, der in seiner politischen Philosophie das Licht der Welt erblickt?
Auf der ersten Station seines langen Weges nistet sich der puer robustus gleich im Zentrum der politischen Philosophie ein. Immerhin ist das »Vorwort« zu De cive, in dem er auftritt, nach Leo Strauss die »am meisten theoretische Fassung« von Hobbes' »Staatslehre« (GSI, 138). Hobbes sagt dort – wie in der Einleitung bereits zitiert –, »ut vir malus idem fere sit quod puer robustus, vel vir animo puerili« – »a wicked man« gleiche einem »childe growne strong and sturdy, or a man of a childish disposition« (C[d] 69; C[l] 81; C[e] 33).1 Drei Eigenschaften des puer robustus ergeben sich aus diesen wenigen Worten.
Da ist zum Ersten das auffälligste und zugleich sperrigste Wort in Hobbes' Diktum: robustus sei der Knabe, heißt es. Die Lexika bieten für robustus und robur die ganze Bandbreite von Stärke, Kraft, Macht (strength, vigour, force, power) an.2 Im metaphorischen Übergang von Natur zu Kultur wird die Härte des Eichenholzes auf die Stärke des Menschen übertragen. Robustus steht für etwas Körperliches, und diese Fundierung der Stärke in Natur wird für die Theorie des puer robustus bedeutsam werden. Die Semantik des robustus reicht zwar nicht bis zur Gewalttätigkeit, aber diese ist doch in Reichweite. Stärke, Kraft, Macht – all diese Umschreibungen zielen auf das, was ein Mensch (durchsetzen, gestalten) kann. Er wird als Handelnder ausgezeichnet, zur Debatte steht die »Macht eines Menschen« (L[d] 66; L[e] 62).3
Im Vergleich zum robustus ist die zweite Eigenschaft, die in Hobbes' minimalistischer Bestimmung vir malus – puer robustus auftritt, leichter greifbar: Der Kerl, um den es geht, ist malus, böse. Neben die Frage der Macht tritt damit die Frage der Moral. Offen bleibt, von welcher Warte aus das Urteil über ihn gesprochen wird. Vorausgesetzt wird eine Instanz, die zu diesem Urteil befugt oder ermächtigt ist. Sie tritt also selbst mit einem Machtanspruch auf, der sich der Kraft oder Macht des starken Kerls entgegenstellt.
Der dritte Punkt, der in Hobbes' Definition enthalten ist, zielt nicht auf eine feststehende Eigenschaft, die einer Person zukommt – dass sie etwa kräftig oder böse sei –, sondern auf die Eigenschaft, sich verändern oder heranwachsen zu können: Der Knabe wird zum Mann. Allgemein gesagt, wird am Generationengang als zeitlichem Prozess nichts Geringeres verhandelt als die Geschichte. Der puer robustus steht für eine Störung in dieser Geschichte. Er ist zwar erwachsen, behält aber einen kindlichen Geist. Seine Unreife steht im Kontrast zu dem Heranwachsen als Hineinwachsen in eine Rolle, als Bestätigung von Zugehörigkeit. Hobbes versucht, die Menschen über das Stadium der eigenmächtigen Kindlichkeit hinauszubringen. Sein guter Erwachsener schlüpft in die Rolle des Untertans, er gleicht damit freilich – um mein Ergebnis vorwegzunehmen – einem brav angepassten Kind, an dem weiterhin Spuren von Widersetzlichkeit zu erkennen sind.
Macht, Moral und Geschichte sind als die großen Themen gesetzt, die die politische Philosophie – nicht nur von Hobbes – umtreiben; begonnen sei mit dem dritten. Der puer robustus gehört in vorderer Linie zu einer großen Gruppe von Figuren, die in der politischen Theorie als Außenseiter verhandelt werden. Im Gegensatz zu fast all diesen Figuren lebt er von einer dynamischen Auffassung der Grenzen und der durch sie gesetzten Formen von Integration und Ausschluss. Die geschichtliche Entwicklung kommt unweigerlich ins Spiel, wenn es nicht um das Böse als statische Eigenschaft geht, sondern um das Werden des Bösen oder, wie man im Englischen sagen würde, themaking of evil. Indem Hobbes die Fragen nach Macht und Moral an die Generationen-(Junge-und-Mann- oder Kind-und-Mensch-)Frage koppelt, beschreibt er eine Welt in Bewegung. Aus dieser Bewegung greift er aber nur den einen Moment heraus, in dem der Mensch an die Schwelle gelangt, an der zwischen Gut und Böse zu wählen ist. Hobbes' Berücksichtigung der Geschichte erschöpft sich darin, diesen Moment, diese Entscheidungssituation zu dramatisieren. Die Frage von Anpassung oder Abweichung, Unterwerfung oder Aufruhr wird bei ihm in einem Ruck entschieden. Er klammert sich an die methodische Fiktion, »daß die Menschen – gleichsam wie Pilze – plötzlich aus der Erde hervorgewachsen und erwachsen wären« (C[d] 161; C[l] 160; C[e] 117). Er träumt den Traum des »alten Schäfers« aus Shakespeares The Winter's Tale, wonach die Menschen die Zeit zwischen »zehn und dreiundzwanzig«, in der sie nur »die Alten ärgern«, am besten verschlafen und dann als rechtschaffene Erwachsene erwachen sollten.4 Man sagt »mit Recht, Hobbes' Politik sei ›unhistorisch‹« (Strauss, GSIII, 121). Immerhin darf man ihm zugutehalten, dass er selbst das Unhistorische untergräbt, indem er mit dem puer robustus auf das geschichtliche, generationale Werden verweist. Dass »offenbar alle Menschen […] als Kinder geboren werden«, ist sogar Hobbes bekannt (C[d] 76; C[l] 92; C[e] 44).
Der puer robustus ist ein Mensch, der falsch entschieden hat, also auch auf die falsche Weise erwachsen geworden ist. Der Übergang »von Natur zur Gesellschaft«, die Verwandlung vom »wilde[n] Tier« in den »Menschen« (C[d] 75, 160; C[l] 92, 159; C[e] 44, 116) sind bei ihm gescheitert. Seine Störung lässt sich beschreiben als Verbleiben im »ewig gleichen Indianertum« (Aby Warburg).5 Zwar ist der puer robustus eingeladen, die Schwelle zu überschreiten, aber er fügt sich nicht, wie von Hobbes gefordert, dem Leviathan. Auch wenn seine Abweichung im unscheinbaren Rahmen des Generationenspiels, des Erwachsenwerdens verhandelt wird, steckt in ihr eine unheimliche, unbescheidene Drohung: die Fremdheit oder Feindseligkeit gegenüber der Ordnung.
Die Theologen des Mittelalters verschickten die Kinder, die ungetauft starben, in den limbus puerorum, einen Ort diesseits von Erlösung und Verdammnis.6 Noch zu Hobbes' Lebzeiten, in Calderóns Das große Welttheater von 1655, gelangt das Kind in diesen Limbus, nicht in Himmel oder Hölle.7 Hobbes' eigene Überlegungen halten sich von der Frage nach dem Seelenheil fern, er spricht auch nicht vom Limbus. Doch wenn man auf das dicht bevölkerte Vorfeld an der Schwelle der Ordnung hinausblickt, das Hobbes und seine Nachfolger sichten, dann hat man den Eindruck, es zeige sich eine Art Limbus, ein enorm ausgeweiteter Nichtort der Unentschiedenheit. Der moralischen und sozialen Bewährungsprobe kommt nun aber nicht – wie bei den Kindern – der Tod zuvor. Vielmehr wird sie von den Lebenden massenhaft verweigert.
Von einer Schwelle rede nicht nur ich, von ihr ist vielmehr – was üblicherweise übersehen wird – schon bei Hobbes selbst die Rede. Er verwendet den Begriff limen in einer Ergänzung8 zum ersten Kapitel seiner Schrift De cive, die wohl zeitgleich mit dem »Vorwort an die Leser« entstanden ist:
Da, wie wir sehen, die Gesellschaft unter Menschen schon wirklich besteht, da niemand außerhalb der Gesellschaft lebt und jeder Umgang und Unterhaltung sucht, so kann es als erstaunliche Torheit erscheinen, wenn ein Schriftsteller gleich an der Schwelle seiner Staatslehre den Lesern den anstoßerregenden Satz entgegenstellt, daß der Mensch keineswegs von Natur zur Gesellschaft geeignet sei. (C[d] 75 [Übers. geänd.]; C[l] 92; C[e] 44)
Ich habe die Übersetzung geändert, weil sie die Wendung »in ipso doctrinae civilis limine« zum »Anfang« der »Staatslehre« abschwächt. Damit werden zwei Pointen verpasst: Es handelt sich hier nicht um einen einfachen Anfang, einen Gründungsakt, mit dem man alles Vorausgehende abschütteln könnte, sondern eben um eine »Schwelle«, deren zwei Seiten – Draußen und Drinnen, Davor und Danach – zu bedenken sind. Und: Diese Schwelle ist ein Merkmal nicht nur der Lehre vom Staat, sondern auch des Staates selbst. Im »Vorwort an die Leser« von De cive bemerkt Hobbes, man müsse bei der »Ermittelung des Rechtes des Staates und der Pflichten der Bürger« so vorgehen, dass man sich den »Staat zwar nicht aufgelöst, aber doch gleichsam als aufgelöst« vorstellt (C[d] 67; C[l] 79; C[e] 32).9 In der Regel wird diese Stelle nur als Hinweis darauf gelesen, dass Hobbes sich auf den Naturzustand nicht als Realität, sondern im Rahmen eines Gedankenexperiments bezieht. Wenn sich der Staat nur »gleichsam« auflöst, geht es ihm nicht wirklich an den Kragen. Und doch spielt Hobbes mit dem Feuer, denn dem Staat wird hier – fiktiv oder faktisch – der Staatsfremde gegenübergestellt. Die Ordnung ist auf Unordnung bezogen, sie wird, mehr, als Hobbes dies am Ende lieb sein kann, in ihre eigenen Grenzen verwiesen. Niemand gehört automatisch dazu. Die Liminalität oder Randstellung des Menschen bekommt eine Schlüsselstellung in Hobbes' politischer Philosophie – und in diesem Buch.
Hobbes gibt die Existenz dieser Schwelle zu, er tut dies aber widerwillig und setzt alles daran, die Frontstellung zwischen Ordnung und Unordnung zu schärfen. Dass er in einem »Zeitalter« lebt, in dem sich »alle Menschenseelen in einer Art Gärung befinden« (Henry Power, 1664),10 behagt ihm gar nicht. Das Titelbild zur ersten Auflage von De cive macht deutlich, dass Hobbes lieber in Zuständen als in Übergängen denkt. Es zeigt zwei jeweils auf einem Podest stehende Figuren: auf der linken Seite eine mit Schwert und Waage ausgestattete, gepflegt gekleidete Dame, auf der rechten Seite eine bewaffnete Indianerin (oder ein Indianer?) im Bastrock. Links sieht man im Hintergrund friedliches Treiben, rechts eine kannibalische Jagd. Ergänzt wird dieses irdische Doppelbild im oberen Teil durch zwei Szenen des Jüngsten Gerichts. Links gelangen die Erlösten, von Engeln geleitet, in den Himmel, rechts scheucht der Teufel die Sünder in die Hölle. Die Interpreten dieses Bildes11 haben Großartiges zu dessen Entschlüsselung beigetragen, aber ein wichtiges Detail nicht erwähnt: eine Lücke. Sie zieht sich durch das ganze Titelbild, sie erscheint im unteren wie im oberen Teil. Die zwei Figuren unten schauen aneinander vorbei, die Gruppen oben kehren sich voneinander ab. Zwischen den Figuren und Figurengruppen spielt sich jeweils nichts ab. Man könnte dies verständlich finden, denn Himmel und Hölle sind weit voneinander entfernte Reiseziele. Und doch ist Hobbes mit dieser Lücke befasst und von ihr besessen. Sie steht für eine Schwelle und für eine offene Frage: Unter welchen Umständen gelangt die Indianerin auf die andere Seite? Wie erfolgt der Übergang vom Naturzustand zum gesellschaftlichen Zustand? Dazu ist mehr zu sagen als nichts.
Wenn man natürliches und zivilisiertes Leben nicht auseinandertreibt, sondern Schwellenkunde betreibt, dann stößt man am abgründigen Rand der politischen Ordnung nicht nur auf ferne Fremde wie die Wilden, sondern auch auf nahe Fremde, nämlich die eigenen Nächsten, die Kinder. Sie sind Außenseiter, die von innen kommen. Mit dem puer robustus bezieht sich Hobbes auf eine im Inneren der Gesellschaft fortlaufend generierte Fremdheit, die Ralph Waldo Emerson in jenem unübertrefflichen Satz herausgestellt hat, der als Motto dieses Buches dient: »The man is […] a misfit from the start.«12
Aus Hobbes' Sicht steht die Vergesellschaftung des Menschen für eine Entwicklung, an deren Beginn noch etwas im Argen liegt und an deren Ende die Ordnung hergestellt ist. Auf diese Eckpunkte bleibt man bezogen, auch wenn man sie nicht, wie Hobbes, anhand der Antithese zwischen Natur und Gesellschaft zu zwei Bollwerken ausbauen will. Der puer robustus steht nach Hobbes für den Fall, dass beim Übergang vom Naturzustand zum gesellschaftlichen Zustand etwas schiefgeht. Aber wodurch genau kommt es zum Störfall? Um sich davon ein genaues Bild zu machen, muss man die beiden anderen großen Themen heranziehen, die an den puer robustus gebunden sind: Macht und Moral.
Hobbes beschreibt den puer robustus als kräftig und beurteilt ihn als böse. Mit diesem Doppelschlag ergibt sich zunächst eine etwas ungewöhnliche Konstellation von Macht und Moral: ein Gegensatz zwischen der Eigenmächtigkeit, dem Machtmissbrauch des Einzelnen und der Moral des Ganzen. Diese Aufteilung schreit natürlich nach Umbesetzungen und Umdeutungen.
Zuallererst ist festzuhalten, dass Macht und Moral nicht in einem einfachen Gegensatz gegeneinander antreten. Es kommt vielmehr auch zur Koalition zwischen ihnen. Wenn die Moral des Ganzen über den puer robustus ihr Urteil fällt, so will sie sich ihrerseits mit Macht wappnen, um ihn in seine Schranken zu weisen. Gegen den einzelnen Machtmenschen baut sich die Macht des Ganzen auf. Umgekehrt hat der puer robustus vielleicht mehr im Repertoire als nur die Bosheit. Er kann der Moral, die das Ganze für sich reserviert, eine andere Moral entgegensetzen. Das große Vorbild hierfür ist Antigone, die ihrer braven Schwester Ismene – »Ich füge mich der Obrigkeit« – den großartigen, paradoxen Satz entgegenhält: »Fromm hab ich gefrevelt«.13
Wenn jemand die Macht herausfordert, dann hängt das Urteil darüber, ob er böse ist, nicht nur davon ab, wie er sich danebenbenimmt, sondern auch davon, wie es um die Spielregeln steht, an denen er vorbeilebt oder gegen die er verstößt. Nicht erst seit Émile Durkheim weiß man: »Indessen genügt es nicht, daß es Regeln gibt; denn manchmal sind die Regeln selbst die Ursache des Übels.«14 Der Störenfried kann aus dem Nichtmitspielen eine Tugend machen: eine Verweigerung von Kollaboration und Komplizenschaft. Und wenn er sich doch entschließt mitzuspielen, so heißt das keineswegs, dass er sein Störfeuer gleich löschen muss. Er kann klein beigeben, seine Teilnahme aber auch mit einer Bewährungsprobe für die Ordnung verbinden. Dann strengt der Außenseiter, der die Schwelle überschreitet, eine Nachverhandlung an, die zur Verwandlung der Ordnung führen soll. Das Junktim von Zugehörigkeit und Gehorsam ist kein Automatismus. Wer am Ende dazugehört, verschwindet vielleicht nicht unbemerkt in der Menge, sondern verändert deren Gesicht. Das letzte Wort über den Störenfried ist noch längst nicht gesprochen. Sigmund Freud beschreibt die Alternative:
Was sich in einer menschlichen Gemeinschaft als Freiheitsdrang rührt, kann Auflehnung gegen eine bestehende Ungerechtigkeit sein und so einer weiteren Entwicklung der Kultur günstig werden, mit der Kultur verträglich bleiben. Es kann aber auch dem Rest der ursprünglichen, von der Kultur ungebändigten Persönlichkeit entstammen und so Grundlage der Kulturfeindseligkeit werden. (1930a, GWXIV, 455)
Dass es zwischen Macht und Moral zu Umbesetzungen kommen kann, ist ein wichtiger Grund für die Anziehungskraft des puer robustus in der Zeit nach Hobbes. Der Kerl ist tatsächlich eine Kippfigur. Er zieht kontroverse Deutungen an, in denen die ganze Bandbreite von Macht und Moral im Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft zum Austrag kommt. Dies erlaubt er nicht nur, sondern er lädt geradezu dazu ein oder zwingt dazu. Bei Hobbes allerdings ist der puer robustus der Inbegriff des bad boy, ja sogar des vir malus. Wie eingangs gesagt: Am liebsten hätte er den puer robustus, den er selbst auf die Bühne der Geschichte gebracht hat, gleich wieder von ihr verscheucht. Um die Ambivalenzen und Ambitionen des Störenfrieds schert er sich nicht, er sieht die politische Ordnung nicht zur Selbstprüfung, sondern zur Selbstverteidigung herausgefordert. Für die Ordnung wächst sich der Streit mit dem puer robustus zum Kampf ums Überleben aus.
Ich möchte nun zunächst zeigen, wie sich Hobbes die Integration des Naturmenschen vorstellt, wie er ihn also davon abhalten will, »böse« zu werden, und in welche Probleme er dabei gerät (2.). Dass diese Probleme beträchtlich sind, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Hobbes sich von einer bunten Gesellschaft von Störenfrieden umgeben sieht, die die Ordnung bedrohen: Er trifft auf Narren, Epileptiker und Tollwütige, er entdeckt Unruheherde bei den Armen und bei den Reichen (3.). Ihnen allen stellt er den Leviathan als ideale staatliche Ordnung entgegen, die doch jener eingeborenen Rebellen nicht Herr wird (4.). Am Ende gehe ich der Frage nach, wie sich Hobbes' puer robustus zu einem Vorläufer verhält: dem puer robustus des Horaz (5.).
2. Eigeninteresse und Vernunft
Wenn sich am Rand der Gesellschaft ein ungeheures Außerhalb auftut, das von allen möglichen Naturwesen bevölkert ist, dann ist zunächst eine genaue Beschreibung der Übeltäter gefragt. Nicht alle, die sich dort draußen herumtreiben, sind böse. Hobbes muss den Personenkreis der Übeltäter eingrenzen, weil im Hintergrund eine unbequeme Frage lauert (vgl. Leo Strauss, GSIII, 26): ob der Mensch von Natur aus böse sei. Diese theologisch brisante Frage wird von ihm verneint, und damit eröffnet sich die Gelegenheit, den Weg des Naturwesens in die gute Gesellschaft hinein zu motivieren.
Hobbes beobachtet Kinder, »denen man nicht alles« gibt, »was sie begehren«, und schüttelt den Kopf darüber, dass sie »weinen und zürnen, ja […] selbst ihre Eltern [schlagen]«. Dieses Benehmen liege, so schreibt er, »in ihrer Natur; dennoch«, so beruhigt er sich, »sind sie schuldlos und nicht böse«. Sie hätten zur Moral gar keinen Zugang – und zwar deshalb nicht, weil sie zum »Gebrauch der Vernunft« noch nicht in der Lage seien (C[d] 69; C[l] 81; C[e] 33). Es liege in der Natur der Menschen, dass sie »alles, was ihnen gefällt, sogleich begehren«. Die Grundausstattung mit »Leidenschaften« sei für die Selbsterhaltung erforderlich und damit moralisch neutral (ebd.). Rousseau (s. u. S. 79) wird Hobbes darin folgen – und Nietzsche wird ihn in Menschliches, Allzumenschliches überbieten:
Das Unschuldige an den sogenannten bösen Handlungen. – Alle »bösen« Handlungen sind motivirt durch den Trieb der Erhaltung oder, noch genauer, durch die Absicht auf Lust und Vermeidung der Unlust des Individuums; als solchermaassen motivirt, aber nicht böse. […] Es kann erst dann der Boden für alle Moralität zurecht gemacht werden, wenn ein grösseres Individuum oder ein Collectiv-Individuum, zum Beispiel die Gesellschaft, der Staat, die Einzelnen unterwirft […]. Der Moralität geht der Zwang voraus. (KSA 2, 95f.)
Nietzsches scheinbar hobbesianisches Argument enthält allerdings ein anderes Gift als das Original. Die erste Dosis seines Giftes besteht darin, dass er nicht nur das »Kind« freispricht von der Bosheit, sondern auch »das souveraine Individuum«, das »für sich selbst« sagt, was »gut« ist (KSA 5, 293 [Zur Genealogie der Moral]). Die zweite Dosis ist enthalten in seiner Ableitung der Moral aus dem »Zwang«, mit der sie zur abhängigen Variable staatlicher Macht erklärt wird. Dies richtet sich gegen Hobbes' Annahme, auf dem Lehrplan des Lebens stehe der »Gebrauch der Vernunft«, mit dem das Individuum von sich aus zur Moral finde.
Wie kann Hobbes der von Nietzsche betriebenen Verschärfung des Konflikts zwischen »Individuum« und »Staat« entgehen? Er gesteht dem Menschen zu, Begierden zu haben, traut ihm aber zugleich moralisches Verhalten zu. Zur bösen Fehlentwicklung des mit Begierden ausgestatteten Menschen kommt es nach Hobbes nur dann, wenn zwei zusätzliche Bedingungen erfüllt sind. Der Mensch muss erstens über die Macht verfügen, seine Begierden auf Kosten und zum Schaden anderer durchzusetzen. Die moralische Bewertung eines Menschen bekommt damit einen konsequentialistischen Zug. Zweitens und vor allem muss ein Mensch es versäumt haben, die Gelegenheit zum Lernen zu nutzen, die ihm während des Heranwachsens offensteht und ihn über die zerstörerischen Konsequenzen seines Tuns aufklärt. Hobbes setzt darauf, dass »ein Lichtfunke der ratio [auf]blitzt« (Carl Schmitt).15 Streng genommen handelt es sich bei der Bosheit um eine Unterlassung, eine Abweichung von dem erwartbaren Maß an Vernunft. Wenn ein Erwachsener einen »Mangel an Vernunft« (C[d] 69; C[l] 81; C[e] 33) aufweist und damit für moralische Einsicht unzugänglich bleibt, wird er zu einem bösen Menschen. Dieser böse Mensch macht als Erwachsener nach Hobbes eigentlich nichts anderes als das noch-nicht-böse Kind, aber er tut es mit gewachsener Machtfülle und unter vorsätzlicher, wissentlicher Missachtung der Option, anders zu handeln. »Unkenntnis des natürlichen Gesetzes entschuldigt niemanden«, sagt Hobbes, da man »von jedermann« annehmen könne, dass er »seine Vernunft zu gebrauchen gelernt hat« (L[e] 202; L[d] 225). Entschuldigt sind allenfalls diejenigen, die diesen Lernprozess erst noch vor sich haben oder zu ihm gar nicht in der Lage sind:
Die fehlende Möglichkeit, das Gesetz zu kennen, entschuldigt völlig. Denn ein Gesetz, über das man sich nicht unterrichten kann, ist nicht verbindlich. Aber fehlendes Bemühen um Unterrichtung ist nicht als fehlende Möglichkeit anzusehen, und man darf von niemandem annehmen, der beansprucht, seine eigenen Angelegenheiten selbst zu verwalten, daß ihm die Möglichkeit zur Erkenntnis der natürlichen Gesetze fehlt, da sie von der Vernunft erkannt werden. Nur Kinder und Geisteskranke sind bei Verstößen gegen das natürliche Gesetz entschuldigt. (L[e] 208; L[d] 230)
Der puer robustus stellt sich quer zu einer Ordnung, in der nach Hobbes der Schulterschluss von Moral und Macht gelingt. Er bleibt dick- und hohlköpfig und meint, sich mit schierer Stärke durchsetzen zu können. Die eigene, einzelne Macht, die er beansprucht, fällt auf die Seite des Bösen. Für Hobbes ist dieser Kerl, dieser alt und stark gewordene, aber dumm gebliebene Kind-Mensch eine Gefahr auf dem Weg zu einem friedlichen Zustand der Gesellschaft. Wohlgemerkt: Es ist nicht die Robustheit, Kraft oder Macht, die Hobbes gegen diesen Menschen einnimmt, sondern die Tatsache, dass sie unbelehrt, ungeschlacht daherkommt. Das Böse ist Folge der Gedankenlosigkeit. Die Fehlentwicklung besteht nach Hobbes darin, dass das Kind, während es immer kräftiger wird, versäumt, sich seiner Vernunft zu bedienen. Das erste Zwischenergebnis lautet: Hobbes' Moraltheorie ist intellektualistisch. »Es ist die Summe der Hobbesschen Moraltheorie« – ich würde aber sagen: nur eine Teil-Summe –, »daß der ›sündigt‹ oder fehlt, der unvernünftig handelt« (Ferdinand Tönnies).16 Man fühlt sich an einen Wortwechsel aus Dostojewskijs Böse Geister erinnert: »Gibt es etwas Dümmeres als ein dummes gutes Schaf?« – »Ein dummes böses Schaf, ma bonne amie, ein dummes böses Schaf ist noch dümmer.«17 Wenn man diesen Dialog auf Hobbes bezieht, dann stößt man auf die Paarung von Dummheit und Bosheit sowie – umgekehrt – von Klugheit und Güte.
Wie ergeht es mir, wenn ich mich probeweise in die Situation des puer robustus hineinversetze? Dann stehe ich an der Schwelle zur Ordnung und höre das Urteil, ich sei böse. Eigentlich juckt mich das gar nicht, ich verstehe überhaupt nicht, was mit »böse« gemeint sein soll. Schließlich bin ich ein Naturmensch, der nach Hobbes die Eigenart hat, sich die Sprache nach Gutdünken zurechtzulegen. »Es gibt […] keine allgemeine Regel für Gut und Böse […]. Sie entstammt vielmehr dort, wo es keinen Staat gibt, der Person des Menschen« (L[d] 41; L[e] 39). Gut finde ich das, was gut für mich ist (vgl. L[d] 101; L[e] 93), auch wenn es schlecht für andere ist. Ich wundere mich nicht darüber, dass andere sich spiegelbildlich verhalten, also ihrerseits etwas für gut befinden, was mich schädigt. Wenn mir Bosheit vorgeworfen wird, dann geschieht dies von einem Raum aus, den ich nicht kenne und nicht anerkenne. Die politische Ordnung ist für mich terra incognita, weshalb mir die damit einhergehenden moralischen Ermahnungen und Anweisungen fremdbleiben. Was verstehe ich armer Teufel schon von Vernunft! Allgemeingültige Aussagen oder Vorschriften sind mir verschlossen.
Hobbes weiß all dies und hat für meine Borniertheit dankenswerterweise sogar Verständnis. Er ist aber zuversichtlich, dass ich mich zum Gebrauch der Vernunft bereitfinde. Er setzt an bei der »eigenen Vernunft«, die mir bei der Befriedigung meiner Bedürfnisse, zuvörderst bei der Sicherung der Selbsterhaltung hilft. Mit dieser dienenden oder instrumentellen18 Vernunft lege ich die »Vorschrift« oder »Regel« fest, wonach ich »am besten erhalten werden kann« (L[d] 99; L[e] 91). Das Zwischenergebnis, Hobbes vertrete eine intellektualistische Moraltheorie, muss man also einschränken. Das Eigeninteresse ist ihr vorgeschaltet und rückt die Vernunft ins zweite Glied. Ihr fällt die untergeordnete Aufgabe eines Werkzeugs zu: »Die Gedanken sind gleichsam die Kundschafter oder Spione [Scouts, and Spies] der Wünsche, die das Gelände erkunden und den Weg zu den gewünschten Dingen finden sollen« (L[d] 56; L[e] 53). Schon diese Art von Vernunft soll ausreichen, damit ich im Zuge einer individualistischen Abwägung – und ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit – zu dem Schluss komme, es sei eine gute Idee, mich in die politische Ordnung einzufügen.
Nach Hobbes' berühmtem Argument fällt mir die Wahl leicht zwischen einem Leben, das »einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz« ist, und einem Leben, in dem ich, frei von Furcht, mein Eigentum und meine Geschäfte pflege; nebenbei bleibt mir noch Zeit, mich den schönen Künsten zu widmen (vgl. L[d] 96; L[e] 89): »Die Leidenschaften, die die Menschen friedfertig machen, sind Todesfurcht, das Verlangen nach Dingen, die zu einem angenehmen Leben notwendig sind, und die Hoffnung, sie durch Fleiß erlangen zu können. Und die Vernunft legt die geeigneten Grundsätze des Friedens nahe« (L[d] 98; L[e] 90). Der Frieden ist für das Individuum die Voraussetzung, sein Eigeninteresse umzusetzen. Zur Sicherung dieses Friedens verlässt es sich auf die »allgemeine Gewalt« (common power), die souveräne Macht des Leviathan: »Die Menschen […] führen die Selbstbeschränkung, unter der sie […] in Staaten leben, letztlich allein mit dem Ziel und der Absicht ein, dadurch für ihre Selbsterhaltung zu sorgen und ein zufriedeneres Leben zu führen.« (L[d] 134, 131; L[e] 120, 117)
Damit ist klar, was der puer robustus falsch macht und warum Hobbes ihm den »Mangel an Vernunft« (s. o. S. 33) ankreidet. Er verfolgt das Ziel der Selbsterhaltung, schlägt aber einen Weg ein, der gar nicht zu diesem Ziel führt. Er schlägt Unterordnung und Staatstreue in den Wind, vertraut auf seine Stärke und versucht, sich auf eigene Faust und auf Kosten anderer durchzuschlagen. Mit dieser Obstinanz schädigt er sich am Ende selbst. Der Leviathan, zu dessen Friedenssicherung auch die »Wohltat«19 gehört, den Krieg der Worte zu schlichten und ein allgemeingültiges Vokabular festzulegen, verhängt über diesen puer robustus dann das Urteil, er sei böse.
Das heißt kurz gesagt: Wenn ich den puer robustus in mir überwinde und mich in eine Ordnung einfüge, die gut genannt wird, dann brauche ich dafür gar keinen moralischen Rückhalt. Ich werde moralisch, ohne von Moral auch nur die leiseste Ahnung zu haben. Das zweite Teilergebnis lautet daher: Hobbes' Moraltheorie ist amoralisch. Der Störenfried wird dazu gebracht, sein Störfeuer einzustellen, ohne dass man ihn irgendwie mit dem Ansinnen belästigt, sein Eigeninteresse zurückzustellen. Gerade dann, wenn er es auslebt, landet er in den Armen des Staates. Dieses paradoxe Bild einer amoralischen Moraltheorie wird von einer einflussreichen Richtung in der Hobbes-Forschung gestützt. Sie schaltet der Vernunft das Eigeninteresse vor und gelangt dabei doch zur Sicherung der politischen Ordnung. Demnach gilt: Ich halte mich nur an die Gesetze, weil sie mir nützen. Hobbes wird zum Herold von rational choice.20
Er meint genau zu wissen, wie die Naturmenschen funktionieren. Er sieht sie vom Eigeninteresse angetrieben – und bei dieser Eigenschaft hakt er ein und zieht sie um ihrer Selbsterhaltung willen in das friedliche, rechtliche Leben hinein. Notfalls durch »Zucht« (C[d] 69; C[l] 81; C[e] 34) kommt das Individuum zu der vernünftigen Einsicht, dass es in seinem besten Interesse ist, sich jetzt und auf Dauer an die Regeln zu halten, die im Gesellschaftsvertrag fixiert sind.
Indem Hobbes den Intellekt zum Diener eines amoralischen Eigeninteresses erklärt, scheint er immer weiter von den Ansprüchen der Moral abzukommen, die doch seinem Urteil über den »bösen« puer robustus zugrunde liegt. Doch man muss noch einen dritten und letzten Befund einbeziehen: Demnach bietet Hobbes nicht nur einen intellektualistischen und amoralischen, sondern auch einen genuin ethischen Zugang zur Moral. (Die Hauptrichtungen der Hobbes-Interpretation lassen sich diesen drei Zugängen zuordnen.)21
Weil Hobbes die Vernunft als Instrument versteht, mit der ein Ziel erreicht werden soll – das Ziel der Selbsterhaltung –, verzichtet er darauf, sie zu einer Erwägung über Ziele selbst heranzuziehen. Dabei ist das von ihm vorausgesetzte Ziel keineswegs selbstverständlich. Der scheinbar amoralische Zugang zur gesetzlichen Ordnung, der beim Eigeninteresse einsetzt, ist selbst Ergebnis einer ethischen Entscheidung. Die allgemeinen Regeln ergeben sich aus einer Wertsetzung, mit der das Überleben in Frieden über alles gestellt wird. Diese ethische Vorgabe wird kontrovers diskutiert. Samantha Frost macht sich für die Position stark, wonach der »Frieden« für Hobbes »der erste ethische Wert« sei. Roberto Esposito beklagt umgekehrt, dass bei Hobbes »das Leben […] seiner Erhaltung geopfert« werde.22 Wenn Hobbes das Überleben zum höchsten ethischen Wert erklärt, verkündet er jedenfalls keine Binsenweisheit. Platon zum Beispiel bestreitet sie in seinem Dialog Gorgias, Kant erklärt, »das Leben an und für sich selbst« sei »nicht das höchste Gut«,23 Schiller sagt: »Das Leben ist der Güter höchstes nicht« (SWII, 912), und der Schlusssatz des Films Slow West von John Maclean lautet: »There is more to life than survival.«
Hobbes kennt Ficinos Platon-Übersetzungen, ohne sich jedoch um die platonische Unterscheidung zwischen Leben und Überleben zu kümmern. Aber er trifft in seinem direkten Umfeld auf eine Art von Moral, die von seinem Minimalziel des Überlebens abweicht: auf die Adelsmoral, deren Ideale er nach Leo Strauss' Analyse (GSIII, 133) bekämpft. Der Hinweis darauf lohnt nicht etwa deshalb, weil adlige Ehre und Furchtlosigkeit im Vergleich zum individualistischen Eigeninteresse zu bevorzugen wären, sondern weil daran deutlich wird, dass es sich bei Hobbes' Ausgang vom Eigeninteresse nicht um eine Selbstverständlichkeit, einen amoralischen Automatismus handelt. Leo Strauss schreibt:
Nicht auf der Illusion einer amoralischen Moral, sondern auf einer neuen Moral, oder, um genauer zu reden, auf einer neuen Begründung der Moral beruht Hobbes' politische Wissenschaft. […] Er bestreitet schließlich allen Tugenden, die nicht zur Ermöglichung des Staates, d. h. des Friedens […] beitragen, […] den Tugend-Charakter. (GSIII, 28, 30, vgl. 41)
Hobbes' Minimalmoral der Selbsterhaltung ist also nicht alternativlos. Neben die bereits erwähnten Gegenentwürfe ließen sich noch weitere moralische Gesichtspunkte stellen, so etwa der moral sense, auf den die schottische Philosophie des 18. Jahrhunderts setzt. Hobbes' Bild vom Naturmenschen ist die Stilisierung eines Typus, der so simpel und eindimensional sein muss, damit passend zu diesem Typus ein Staat geschaffen werden kann, der ebenso simpel und eindimensional ist: ein Staat, der mit totaler Macht ausgestattet sein muss, weil das Ziel der Friedenssicherung alles andere aussticht.
Dass dieses übersichtliche Szenario brüchig ist, lässt sich anhand des puer robustus besonders gut zeigen. Egal welche der drei Hobbes'schen Moralversionen man gegen ihn aufbietet – sie alle verfehlen ihre Wirkung. Der Störenfried leidet nicht einfach unter einem »Mangel an Vernunft«, sondern kann sich durchaus auf eine rationale Strategie stützen. Seine Eigenmacht kann ihn dazu veranlassen, ohne den Schutz einer übermächtigen Ordnung seine Interessen zu verfolgen. Da er nicht aus dem Nichts kommt, sondern geworden ist, kann er sich von ethischen Haltungen leiten lassen, die quer zu Hobbes' Vorgaben liegen.
Der puer robustus