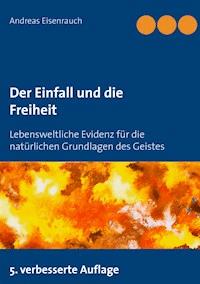
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn die Hirnforscher mit ihren Thesen Recht hätten, wie müsste dann unfreies Denken und Entscheiden aussehen, in welchen lebensweltlichen Phänomenen könnte die Unfreiheit sichtbar werden? Sollte es dann nicht so sein, dass alle Gedanken uns ungerufen und ohne vorige Erwägung bewusst werden müssten, dass wir sie als Einfälle erleiden sollten? Einfälle sind aber genau das, was wir im Leben an uns beobachten; es gibt sie, wir haben sie und wir haben deshalb auch diesen Begriff in unseren Sprachen. Es ergeben sich überraschende Konsequenzen, wenn man diese und noch mehr Tatsachen genauer analysiert. Wir erleben einzig einen unwillkürlich und unbewusst generierten Strom unserer Gedanken, dessen Urheber nur das Gehirn sein kann. Es wird hier dafür argumentiert, dass die Geist-Gehirn-Problematik aus einer unangemessenen Trennung beider Entitäten entsteht, die nicht einmal eine lebensweltliche Rechtfertigung hat, und somit auch keine philosophische haben kann. Entgegen aller Vorhersagen kann man dann zeigen, dass wir zentrale Eigenschaften wie Persönlichkeit, Urheberschaft und Verantwortung auch dann behalten, wenn man davon ausgeht, dass Denken und Entscheiden das Resultat unbewusster Gehirnaktivität sind. Die Bestimmung durch das Gehirn, welches der eigene Verwalter der eigenen Lebenserfahrung und Gründe eines Menschen ist, ist gerade keine Fremdbestimmung. Das Gehirn ist nichts Fremdes, es ist die von uns nicht abtrennbare Manifestation unserer Persönlichkeit. Stichworte: Philosophie Philosophie des Geistes Willensfreiheit Entscheidungsfreiheit Hirnforschung Gehirn Geist Bewusstsein Psychologie Einfall Mentale Verursachung Epiphänomen Urheberschaft Neuronenensembles Moral Menschenwürde
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Teil: Beobachtungen
„Willensfreiheit“ -Zumutung und Verteidigung.
Erste lebensweltliche Beispiele für „Unfreiheit“
Der unwillkürliche Strom der Gedanken
Die gewachsene Sprache
Ist der Agent geistig oder materiell?
Der Verwalter des Gedankenstroms
Teil: Folgerungen
Intuitionen und Illusionen
Mentale Verursachung und Handlungen
Das Epiphänomen
Die Urheberschaft bleibt uns erhalten
Eins und Eins sind doch nur Zwei
Gehirne und die Wissenschaften
Das Gleichgewicht der Moral
Schlussbemerkungen
Literatur:
Index
Nil tam difficile est, quin quaerendo investigari possiet.
(Nichts ist so schwierig, als dass es nicht durch Suchen erforscht werden könnte. Terenz, Heauton Timorumenos 675)
Vorrede
Sind wir frei in der Gestaltung unseres Willens oder nicht? Zur Beantwortung dieser Frage soll diese Abhandlung einen Beitrag leisten. Als Student der Biochemie in Frankfurt am Main hatte ich am Rande die Arbeiten des Hirnforschers Wolf Singer über die erfahrungsabhängige Strukturierung der Gehirne von Säugetieren während deren früher Entwicklung kennen gelernt. Ich war von den damit einhergehenden, schwerwiegenden Störungen, die zum Beispiel in der visuellen Wahrnehmung auftreten, wenn die frühen sinnlichen Gegebenheiten nicht denen einer normalen Lebenswelt entsprechen, sowohl fasziniert als auch schockiert. Das Gehirn junger Säugetiere durchlebt eine vorübergehende Phase extremer „Plastizität“, in deren Verlauf sich das Gehirn anhand der tatsächlich wahrnehmbaren Sinneseindrücke an die normalerweise im Leben auftretenden Vorkommnisse anpasst. Die Fülle oder der Mangel der frühen sinnlichen Wahrnehmungen bestimmt in dieser Zeit, was ein Lebewesen im ganzen Rest seines Lebens wahrnehmen kann! Wenn eine junge Katze in den ersten Monaten ihres Lebens keine horizontalen Strukturen erlebt, wird sie später nie welche wahrnehmen können (beispielsweise die Stufen einer Treppe). Vergleichbares gilt auch für die Menschen, wenngleich unsere Gehirne viel länger anpassungsfähig bleiben. Für mich waren diese Erkenntnisse die ersten wirklich eindringlichen Hinweise auf die grundlegende Bedeutung der Physis für die höheren, kognitiven Leistungen von Menschen.
Als ich am Anfang dieses Jahrtausends erfuhr, dass Singer aus seiner neurobiologischen Sichtweise heraus zu der Ansicht kam, dass uns „die Verschaltungen festlegen“ und dass wir „aufhören sollten, von Willensfreiheit zu sprechen“, war das für mich keine Überraschung. Es schien mir intuitiv die logische Konsequenz aus den früheren Erkenntnissen zur neuronalen Plastizität zu sein. Viel mehr hat mich überrascht, wie heftig die Hirnforscher und andere Menschen, welche die aus meiner Sicht leicht nachvollziehbaren Ansichten Singers teilen, aus anderen Fakultäten und aus der Öffentlichkeit angegriffen werden. Der häufig emotionale Tonfall der Erwiderungen deutet darauf hin, dass Singer und andere Hirnforscher wohl einen Punkt berührt haben, der als Angriff auf tief verwurzelte Selbstverständnisse aufgefasst wird. Es scheint vielen ein Alptraum zu sein, dass der Mensch im Wesentlichen als ein Teil der Natur anerkannt werden müsste und somit den Organisationsprinzipien der Natur unterliegen sollte. Alte Träume, mit deutlich religiösem Hintergrund, lassen viele Menschen (selbst die meisten vorgeblich säkular eingestellten Philosophen) darauf hoffen, irgendeiner dritten Kategorie zwischen Tier und Gott anzugehören: nur nicht Teil des Tierreichs sein, wenn wir schon keine Engel sein dürfen! Manch ein Denker scheint sich nach antiken Zeiten zu sehnen, als man noch nicht das Gehirn zum Denken brauchte, sondern der „Geist“ alles alleine besorgte. Einzelne aber schrecken zur Verteidigung dieses Traumes von der Freiheit vor keiner logischen oder sprachkritischen Spitzfindigkeit zurück; jegliche naturwissenschaftliche Wissenslücke wird herangezogen, um angeblich nachzuweisen, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Selbst die Mehrheit der Philosophen, die sich ernsthaft mit den naturalistischen Thesen befassen und die eine Beteiligung des Gehirns an Denkprozessen zugestehen, sucht immerfort noch nach Konzeptionen, die der bewussten, geistigen Person noch das letzte Wort beim Entscheiden vor der Ausbildung eines Willens sichern könnten.
Die Naturforscher müssen aber an ihren Thesen festhalten. Da ich überzeugt bin, dass die Vorstellungen der Hirnforscher stichhaltig sind, bin ich auch überzeugt, dass sie mit stetem Tropfen den Stein des öffentlichen Bewusstseins höhlen müssen, bis akzeptiert ist, was niemand hinweg argumentieren kann.
Seit meinen Studientagen hat mich also das Thema „Körper und Geist“ beschäftigt, auch noch, als ich die Welt der Laboratorien und Hörsäle längst verlassen hatte. Als die Debatten in der Öffentlichkeit begannen, hatte ich bereits für mich im „stillen Kämmerlein“ hierzu einige Ideen entwickelt. Mein Gedankengang war eigentlich recht einfach: Wenn die Hirnforscher Recht hätten, müsste doch von der Unfreiheit etwas in der Lebenswelt zu finden sein, entgegen den Versicherungen ihrer Kritiker, dass die Lebenswelt der wichtigste Garant der Freiheitsintuition sei.
Oder andersherum: Wie müsste unfreies Denken und Entscheiden aussehen, in welchen Phänomenen könnte Unfreiheit sichtbar werden? Sollte es dann nicht so sein, dass alle Gedanken uns ungerufen und ohne vorige Erwägung bewusst werden müssten, dass wir sie als Einfälle erleiden müssten?
Einfälle sind aber genau das, was wir im Leben an uns beobachten; es gibt sie, wir haben sie und wir haben deshalb auch diesen Begriff in unseren Sprachen. Einfälle „füllen“ unsere Vorstellungswelt mit Gedanken an, und wenn wir genau hinsehen, dann können wir feststellen, dass kein Gedanke jemals aktiv aufgerufen wird. Lebensweltliche Evidenz ist also keineswegs, wie vielfach behauptet, die „unhintergehbare“ (Janich) Gewähr für menschliche Willensfreiheit. Im Gegenteil, die genaue Beobachtung menschlichen Agierens zeigt in der Tat, dass alles, was gedacht wird, in Form von unkontrollierbaren Einfällen bewusst werden muss. Es gibt somit keine bewussten Abwägungen und Entscheidungen; die Vorgänge, die zu Entscheidungen führen, laufen allesamt unbewusst-automatisch ab und können nicht durch bewusste Aktivitäten gesteuert werden. Da alle möglichen Denkinhalte durch die Sinne erworben sind, in physischen Strukturen behalten werden und daher im Gehirn verwaltet werden müssen, ist es geradezu lebensweltliche Tatsache, dass es keinerlei mentale Verursachung von Willensentscheidungen und Handlungen geben kann, sondern es gibt umgekehrt allein die physische Verursachung aller mentalen Phänomene.
Durch den Rückgriff auf die Phänomene der Lebenswelt besteht hier keine Notwendigkeit, mit den Millisekunden der Libet-Experimente oder mit unübersichtlichen Beziehungen zwischen vielen Hirnarealen zu argumentieren, um den Beweis für die menschliche Unfreiheit zu führen. Auf solche Details konnte ich verzichten, was ganz nebenbei die Lesbarkeit dieses Buches auch für den Nichtfachmann erleichtern sollte. Auf neurophysiologische Einzelheiten wird hier nur in einem Umfang eingegangen, der die Prinzipien des Funktionierens der Gehirne erkennbar machen soll. Dabei kam es mir ganz besonders darauf an, die ungeheure Dynamik der Gehirnprozesse zu betonen, welche die Grundlage für die entsprechende Vielfalt und den Wandel in unserer Vorstellungswelt liefert.
Der Einfall spielt in den Diskussionen um die Willensfreiheit erstaunlicherweise bislang keine sichtbare Rolle. In einem Interview (Kölner Stadt-Anzeiger, 26.01.2011, "Reines Wegsperren ist inhuman") erwähnte Gerhard Roth vor nicht langer Zeit zwar den Satz: „denn ich habe keinen Einfluss auf meine Einfälle“. Und Gilbert Ryle (2002) deutete ebenfalls darauf hin, als er schrieb, dass „one thing that I cannot prepare myself for is the next thought that I am going to think.” Und dergleichen findet sich in Nebensätzen in einigen Internet-Foren, aber eine umfassende Würdigung der Aussagekraft dieses Phänomens und seine Einordnung in das Geflecht der Argumente zum Thema Willensfreiheit fand bisher noch nicht statt. Diese Lücke will ich mit diesem Buch nun schließen.
Im ersten Hauptteil „Beobachtungen“ möchte ich zunächst einen kurzen Abriss der Kontroverse liefern, die zwischen den Befürwortern und Herausforderern der Willensfreiheit ausgetragen wird. In den drei folgenden Kapiteln wird anhand alltäglicher Beispiele aufgezeigt, wie sehr „Einfälle“ und verwandte Phänomene am gängigen Bild einer freiheitlichen Lebenswelt kratzen, und dass die Behauptungen über lebensweltliche Freiheitsindikatoren keiner genauen Nachprüfung standhalten. Im fünften und sechsten Kapitel werden wir uns dem Gehirn zuwenden, das als der Ort identifiziert wird, an dem alles Denkbare behalten und verwaltet wird. Im zweiten Teil will ich die Schlussfolgerungen aus den Beobachtungen ziehen. In dessen erstem Kapitel wird insbesondere untersucht, wie die Phänomene unserer Lebenswelt, der viele Menschen intuitiv eine Freiheitsempfindung entnehmen, im Lichte unserer Nachprüfung neu interpretiert werden müssen. In den nachfolgenden Kapiteln werden die Konsequenzen der berichtigten lebensweltlichen Befunde auf etliche theoretische Konzepte zum Gehirn-Geist-Antagonismus erläutert. Im Lichte der Betrachtung der Einfälle werde ich also dafür plädieren, dass es keine mentale Verursachung gibt, und dass alle bewussten Zustände Epiphänomene der Gehirnaktivität sein müssen. Dieser Epiphänomenalismus erweist sich als die eigentliche Ursache unserer „Unfreiheit“. Es wird sich zeigen, dass die Determinierung unseres Entscheidens und Handelns durch physische Gesetzmäßigkeiten demgegenüber sogar bedeutungslos ist. Trotzdem werden wir sehen, dass alle menschlichen Fähigkeiten, die wir an uns selbst bewundern, und die gesellschaftlichen Institutionen, die sich darum entwickelt haben, unbeeinträchtigt bleiben. Auch wenn es das Gehirn ist, welches Gefühle, Gedanken und Entscheidungen mit sich führt, und nicht eine immaterielle Person, es ist unser Gehirn in dem unsere Erfahrungen behalten und verwaltet werden. Es sind dies die Erfahrungen, welche die Person prägten und ihre Entscheidungen begründen. Wenn Entscheidungen und Willensbildung aus unseren Gehirnen heraus Fremdbestimmung wäre, dann dürfte kein Mensch sein Gehirn mein Gehirn nennen. Wir machen das aber, und wir tun so mit gutem Grund. Auch damit drücken wir aus, dass uns Urheberschaft und Verantwortung für unsere Handlungen uneingeschränkt erhalten bleiben. Im vorletzten Kapitel, bevor wir abschließend resümieren, skizziere ich einen Vorschlag, wie Moral und Menschenwürde ohne Freiheit entstehen konnten und begründet werden können.
Es folgen aus meinen Gedanken letztlich zwei Resultate hinsichtlich der Freiheitsproblematik, die ich hoffentlich ausreichend scharf voneinander getrennt darlegen konnte: Freiheit vom Gehirn, die gibt es nicht, und die Freiheit nach eigenen Gründen zu handeln, ist durch das Gehirn ohne Einschränkung gewährleistet. Deshalb habe ich auch den Untertitel des Buches von „Lebensweltliche Indikatoren für die Unfreiheit menschlichen Denkens“ in „Lebensweltliche Evidenz für die naturalistischen Grundlagen des Geistes“ geändert. Denn es stellt sich ja heraus, dass die natürlichen Grundlagen des Denkens keineswegs die katastrophalen Konsequenzen der totalen Unfreiheit nach sich ziehen, welche uns die „Philosophen des Geistes“ seit langem mit Grabesstimmen einzureden versuchen.
In der hier vorgelegten fünften Auflage (die erste erschien Anfang 2012) wurden in verschiedenen Kapiteln weitere Präzisierungen meiner Argumente eingefügt, zusammen mit zahlreichen zusätzlichen Literaturzitaten. Insbesondere wurde das alte Kapitel I.5 „Der Verwalter der Erfahrung und der Entscheidungen“ ziemlich lang, so dass ich mich entschlossen habe, es aufzuteilen. Dass neue Kapitel I.5 enthält nun den Teil, mit der Erörterung, ob der Agent, der unsere Gedanken generiert, geistig sein kann, oder materiell sein muss. Das neue Kapitel I.6 befasst sich unter der nahezu alten Überschrift mit den Gegebenheiten und Fähigkeiten des Gehirns. Und leider fanden sich immer noch einige Tippfehler und „Copy-and-Paste“ –Unfälle, die natürlich wieder korrigiert wurden.
Am Ende dieses Bandes, so hoffe ich, werden weit verbreitete Missverständnisse bezüglich der tatsächlichen Abläufe unserer Willensbildung ausgeräumt sein. Ich bin durchaus optimistisch, dass meine Argumente einen Beitrag dazu leisten können, dass fortan auf einer besseren Basis über die Beiträge unserer physischen Grundlagen zu unseren geistigen Leistungen diskutiert werden kann als zuvor.
Bad Homburg v. d. H., im März 2018
I. Teil: Beobachtungen
1. „Willensfreiheit“ -Zumutung und Verteidigung
Damnant, quod non intellegunt.
(Sie verurteilen, was sie nicht verstehen. Quintilian, Institutio oratoria 10, 1, 26)
Ungefähr seit der Mitte der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts wird in deutschen Gelehrtenkreisen eine kontroverse Debatte über die (Nicht-)Existenz menschlicher Willensfreiheit geführt. Einige Hirnforscher, wie sie etwas pauschal gemeinhin genannt werden, interpretieren die experimentellen Ergebnisse der neurobiologischen Forschung der letzten Jahrzehnte dahingehend, dass alles, was ein Mensch denkt und handelt, durch physische Vorgänge im Gehirn vorbereitet und entschieden wird, bevor es diesem Menschen bewusst wird und er danach handeln oder sich dazu äußern kann1. Davon betroffen wären demnach auch die Vorgänge in jedem Menschen, die zur Ausbildung seines Willens führen.
Allerdings ist die übliche Redewendung eines freien oder unfreien Willens etwas unpräzise. Wie das gemeint ist, soll die folgende Überlegung klären.
Die menschliche Lebenswelt fordert von jedem Individuum, dass es unablässig Entscheidungen fällen muss. Einmal gefasste Entscheidungen führen in einen Zustand des „einen Willen Habens“, das heißt ein Mensch kann zu sich und zu anderen Menschen sagen: „Ich will X“ (und nicht Y oder Z, was auch möglich gewesen sein sollte). Betrachten wir also einen Menschen M1, der an einem beliebigen Tag für einen wichtigen Termin von seinem/ihrem2 Wohnort A in die benachbarte Stadt B reisen muss. Alle verfügbaren Gründe (die hier nicht detailliert ausgeführt werden müssen) am Vortag bedenkend, kommt M1 zu der Ansicht, dass es am vorteilhaftesten sei, in diesem Fall ein Taxi zu nehmen. Von dem Augenblick an, in dem sich M1 entschieden hat, läuft er mit dem Willen durch die Welt: „Morgen will ich mit dem Taxi von A nach B fahren.“
Ein Mensch kann seinen Willen hinsichtlich X wohl haben oder auch nicht. Für die Feststellung von Freiheit findet man hier keinen rechten Ansatzpunkt. Was dagegen frei oder unfrei sein könnte, sind die Vorgänge, die zur Entstehung eines Willens führen, wo vorher noch keiner war. Was allgemein unter der Überschrift „Willensfreiheit“ diskutiert wird, sollte eigentlich eher „Willensbildungsfreiheit“, oder noch besser „Entscheidungsfreiheit“ genannt werden.
Die Frage ist eben: Laufen solche Entscheidungsvorgänge, abhängig von bestimmten Anfangsgegebenheiten, streng regelmäßig auf ein durch die Regel determiniertes Ergebnis zu, oder ist der Vorgang „Ergebnis-offen“, insofern aus der Menge der möglichen Entscheidungen keine am Beginn des Entscheidungsvorgangs vorherbestimmt wäre. Zur Entscheidungsfreiheit auf der Grundlage der Ergebnis-Offenheit soll nach der Überzeugung vieler Menschen, welche die Ansichten der Hirnforscher nicht teilen, insbesondere die freie Wahlmöglichkeit der selbstbewussten Person beitragen, die letztendlich das bestimmt, was hernach entschieden sein soll. Mit der Person ist die Entität des Beispiels vom Anfang gemeint, die „Ich“ sagen kann. Die Person hat ein Bewusstsein, das zumindest zwei Aspekte kennt. Es gibt sicherlich das Bewusstsein von dem, was die Person aktuell wahrnimmt und bewegt („Jetzt gerade drückt mich beim Gehen der linke Schuh“). Darüber hinaus wird oft noch ein grundlegendes Bewusstsein von sich selbst unterschieden, das aus der Summe gemachter Lebenserfahrungen entsteht („Ich bin M1, das Kind von M5 und M6. Ich bin Bankangestellter, habe blaue Augen, bin sportlich, cholerisch, liebe rote Weine, wähle die Partei XYZ, ...“)3. Die Person blickt auf eine sie prägende Historie zurück, aus der ihr Selbstbewusstsein entsteht. Die prägende Historie beinhaltet auch die Erfahrungen, auf die ein Mensch zurückgreifen kann, wenn er vor den Entscheidungen steht, wie es in seinem Leben weitergehen soll. Damit sind nicht nur „große“ Entscheidungen gemeint, wie etwa die Wahl eines Berufs, sondern gerade auch die unzähligen kleinen Entscheidungen des Alltags, deren eine oben schon beschrieben wurde. Die Erfahrung liefert die Fakten und Gründe, die bedacht und überlegt werden sollten, bevor eine Entscheidung gefällt wird.
Alle Konzepte, welche für die Freiheit der Willensbildung argumentieren, beharren für die Steuerung der Aktivitäten eines Menschen auf dem Primat der Person als Urheberin ihres Willens. Sie kann hierzu autonom und kontrolliert Gründe abwägen4, sowie anschließend begründet entscheiden. Sie sehen das Gehirn in der einen oder anderen Weise als ein lediglich den Körper antreibendes, ausführendes Organ. Gelenkt werden die Entscheidungen und die darauf folgenden körperlichen Handlungen jedoch letztendlich von einer geistigen Entität, die nicht durch körperliche Gegebenheiten eingeschränkt sein soll.
Die Freiheits-Skeptiker hingegen sehen die bewusste Person und alle ihre Gedanken und Entscheidungen als Folge der Gehirnaktivität und somit in völliger Abhängigkeit von den organischen Prozessen. Im Gehirn, welches die Ursache allen lebensweltlich-facettenreichen Bewusstseins ist, herrschen die Kausalgesetze der Natur, denen sich somit auch die Willensbildung des Menschen unterzuordnen habe. So lautet -in aller Kürze- die deterministische Kernthese der Hirnforscher, mit der sie bestreiten, dass eine geistige Person die Freiheit haben könnte, ihre Entscheidungsprozesse autonom durchzuführen. Diese These wird gemeinhin als die hauptsächliche Herausforderung für die Existenz eines freien Willens gesehen und von vielen Philosophen entsprechend bekämpft. Wegen des Rückgriffs auf die mit naturwissenschaftlichen Methoden durch die Hirnforscher beobachtete Natur und aufgrund der damit einhergehenden Vermutung der wissenschaftlichen Erklärbarkeit geistiger Phänomene, wird deren Position als „Naturalismus“ bezeichnet (natürlich gibt es auch Philosophen, die naturalistische Positionen vertreten, die wenigsten davon bestreiten allerdings so konsequent die Entscheidungsfreiheit).
Die Antworten auf die gestellte Frage, ob die Willensbildung der Menschen persönlich-selbstbestimmt sei, oder nicht, hängen somit jeweils davon ab, ob der auf die Frage antwortende Mensch seiner subjektiven Selbsterfahrung als fühlende und denkende Person den ontologischen Primat einräumt oder ob er seine materielle Körperlichkeit als Grundlage für sein Menschenbild annimmt. Und in engem Zusammenhang damit steht eine andere Frage, nämlich die danach, ob denn das Bewusstsein, der Geist oder mentale Zustände eines Menschen die Macht zur aktiven Intervention im Körper dieses Menschen haben, danach also, ob eine mentale Verursachung von körperlichen Vorgängen aus geistigen Regungen heraus möglich ist. Denn wenn es nicht der Körper ist, der selbstorganisiert die Äußerungen eines Menschen generiert, dann muss der Geist die Möglichkeit und Fähigkeit haben, zu jeder Zeit, wann immer er will, in die körperlichen Prozesse einzugreifen.
Von den Verteidigern der derart bedrängten Entscheidungsfreiheit wird eine Vielzahl von Argumenten vorgebracht, welche die Haltlosigkeit der naturalistischen Thesen erhärten sollen. Die für die Thematik der lebensweltlichen Grundlagen der Willensbildung bedeutsamsten möchte ich hier kurz vorstellen, eine ausführlichere Diskussion derselben folgt im zweiten Teil dieser Schrift.
Schon auf einer grundsätzlichen Ebene wird die Anwendbarkeit physiologischer Messergebnisse auf die Erklärung der lebensweltlichen Phänomene geistiger und mentaler Zustände, wie Gefühle, Meinungen oder eben ein Wille, unter dem Vorwurf bestritten, das hiermit „Kategorienfehler“ begangen werden5. Wegen der kategorialen Verschiedenheit der biotischen Objekte, die allein Gegenstand der naturwissenschaftlichen Forschung sind, und der für die Wissenschaften unzugänglichen, mentalen Phänomene würden die Wissenschaften grundsätzlich nicht zu vollständigen Beschreibungen und Vorhersagen der geistigen Regungen der Menschen gelangen können. Ein mentaler Zustand, wie etwa ein „ich fühle“ oder „ich wünsche“ kann nur von dem, der fühlt und wünscht ermessen werden, nicht von einem außerhalb dieser Person agierenden Beobachter. Da Wissenschaften nie ein Gefühl oder einen Wunsch messen können, können sie auch keine Modelle oder Theorien entwickeln, wie diese Zustände entstehen.
Eine andere Art dieser Kategorienfehler wäre der „mereologische Fehlschluss“, der unterläuft, wenn Eigenschaften einer vollständigen Entität (der ganze Mensch) auf lediglich einen Teil derselben (beispielsweise das Gehirn) bezogen werden („Der Mensch denkt“ vs. „Das Gehirn denkt“)6. Das Fühlen und das Wünschen kann demnach nur dem ganzen Menschen zugeschrieben werden, niemals aber nur dem Gehirn, welches, als eine Ansammlung an sich „toter“ Materie, zur Erbringung mentaler Leistungen unfähig sein muss.
Hinsichtlich der Reichweite der Naturgesetze, welche die Hirnprozesse determinieren sollen, werden ebenfalls vielfach Zweifel geäußert, ob alle physischen Prozesse durch die Gesetze auch wirklich in aller Konsequenz beschrieben werden. Zahlreiche Publikationen bestreiten, dass Naturvorgänge so streng determiniert ablaufen, dass von einem gegebenen Punkt aus keine alternativen Prozessfortschritte möglich seien7. Ein sehr detailliert vorgetragener Einwand wäre der von Nida-Rümelin, der ebenfalls postuliert, dass die Vorgänge, die zu Entscheidungen führen, durch Naturgesetze nicht vollständig beschreibbar sind8. Es gäbe demnach schon auf der untersten Ebene der Wechselwirkungen zwischen Materie Singularitäten, die sich durch die physikalischen Gesetze nicht abbilden lassen; sozusagen definitorische Lücken im Kosmos der physikalisch beschreib- und berechenbaren Phänomene9. Und wenn schon in einfachsten physikalischen Szenarien, wie dem Abrollen einer Kugel, die auf einer anderen platziert wurde, keine alle Aspekte umfassende wissenschaftliche Beschreibung möglich ist, um wie viel unabbildbarer und unbestimmter wären dann die Vorgänge in hochkomplexen, lebenden Organismen.
„Intentionale Interventionen“ der bewusst handelnden Person greifen in Wirklichkeit an diesen naturwissenschaftlich nicht definierten Punkten an der Materie ein und steuern deren Teilchen in die intendierte Richtung. Dadurch, dass die „intentionalen Interventionen“ außerhalb der Reichweite naturwissenschaftlicher Methoden ansetzen, bleiben sie „epistemisch unauffällig“10. Ihre Existenz zeige sich aber lebensweltlich durch die Fähigkeit der Menschen, aus Absichten Handlungen folgen zu lassen. Die Entscheidungsfähigkeit der Person ist demzufolge ein vom physischen Geschehen unabhängiges Potential, die mentale Verursachung von Handlungen in der physischen Welt nach geistiger „Vorbereitung“ eine Tatsache.
Wie auch bei Nida-Rümelin, so sticht in den zahlreichen Entgegnungen und Widerlegungsversuchen das Argument hervor, dass es ebenfalls alltägliche, lebensweltliche Erfahrung sei, dass die Menschen sich als frei entscheidende und handelnde Akteure erleben und dass diese genuine Erfahrung nicht durch naturwissenschaftliche Argumente entkräftet werden kann. Schon in Zeiten, in denen es noch keine moderne Hirnforschung gab, wurde die Freiheitsintuition als Ur-Erfahrung in einem Gegensatz zu theoretisch-wissenschaftlichen Widerlegungsversuchen gesehen; bei Schiller11 heißt es zum Beispiel über die Freiheit: „Die Erfahrung beweist sie. Wie kann die Theorie sie verwerfen.“ Heidelberger12, um die Reihe der Beispiele aus jüngerer Zeit zu eröffnen, die sich direkt auf die „Zumutungen“ der Hirnforschung beziehen, identifiziert „Wahlfreiheit, genuine Urheberschaft und Reflexion auf sich selbst“ als „die zentralen Komponenten unserer Freiheitsintuitionen“. Für Nida-Rümelin13 gilt:
„Wir als normale menschliche Wesen, eingebettet in soziale Zusammenhänge, können gar nicht anders, als Verantwortlichkeit und Freiheit in dem Umfang vorauszusetzen, wie es für die von uns allen geteilten moralischen Empfindungen und Einstellungen [...] erforderlich ist. Unsere lebensweltlichen interpersonalen Beziehungen lassen keinen Spielraum für theoretische Überzeugungen, die diese Einstellungen als unbegründet erscheinen lassen würden.“
Pauen14 erkennt den Primat der Lebenswelt darin, „dass die Ergebnisse der Neurowissenschaften keinesfalls die zu erklärenden Fähigkeiten der Menschen abstreiten können, sie liefern hingegen zunehmend adäquatere Erklärungen für ihr zustande kommen“. Ähnlich auch Habermas15, er beharrt auf „der intuitiv unbestreitbaren Evidenz eines in allen unseren Handlungen performativ mitlaufenden Freiheitsbewusstseins“.
In diesem Zusammenhang wird vielfach auch die Kommunizierbarkeit von Sachverhalten in der jeweils gewachsenen Sprache der Menschen als Indikator für unmittelbar einsichtige und gültige Gegebenheiten der Lebenswirklichkeit aufgefasst. Nida-Rümelin16 ist sich sicher:
„Über lebensweltliche Tatsachen können wir uns verständigen, ohne uns darüber einig zu sein, welche (wissenschaftlichen) Theorien zutreffen.“
Noch ausführlicher äußert sich Janich17:
„Die Lebenswelt mit ihrer Alltagssprache und mit ihrer sozialen Praxis ist durch die Wissenschaft unhintergehbar. Die Alltagssprache hat methodischen Primat vor den Wissenschaftssprachen ebenso, wie es die charakteristischen menschlichen Qualitäten sind, die fachwissenschaftlichen Aspekten des Menschen methodisch vorausgehen.“
Etwas moderater drückt sich Bieri18 aus, wenn er feststellt: „Unsere sprachliche Sensibilität ist ein guter, wenn auch nicht unfehlbarer Führer, wenn es darum geht, über Ideen Klarheit zu gewinnen.“
All diesen Überzeugungen entsprechend, wurden die Schlussfolgerungen der Hirnforscher eingehend auf ihre Vereinbarkeit mit lebensweltlichen Selbstverständlichkeiten überprüft und daraufhin regelmäßig zurückgewiesen. Die Überprüfung, inwieweit die lebensweltlichen Voraussetzungen selbst wirklich stichhaltig erfasst und erkannt sind, wurde, wohl ihrer unterstellten Selbstverständlichkeit wegen, nicht für nötig erachtet19. Dabei wäre es gerade bei derart grundlegenden, teilweise transzendenten Argumenten besonders wichtig gewesen, sicherzustellen, dass das, was unterstellt wird, auch wirklich der Fall ist. Unsere Lebenswelt hält allerdings auch deutliche Zeichen dafür bereit, dass die bewusste Person nicht die entscheidende Instanz für die Generierung der menschlichen Äußerungen in Wort und Tat ist.
1 Für detailliertere Darstellungen der Gedankengänge der Hirnforscher, die auch jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen, siehe Prinz (1996), Roth (2009) und Singer (2004, 2006).
2Alle Sachverhalte, die hier geschildert werden, gelten selbstverständlich für Menschen beiderlei Geschlechts. Nur aus Bequemlichkeit bleibt der Autor bei der ihm vertrauten männlichen Schreibweise. Zudem wird meist ein neutraler „Mensch M“ zu Beispielen herangezogen, was der deutschen Grammatik zufolge maskuline Formen erzwingt.
3 Roth (2009, S. 132 f.) nennt diese beiden Formen des Bewusstseins Aktualbewusstsein und Hintergrundbewusstsein.
4 Siehe Bieri (2009, S. 54): „Überlegend können wir an unserem Willen arbeiten und darüber bestimmen, wie er sein soll.“ Oder auch Nida-Rümelin (2005, S. 36): „Die Freiheit, die wir voraussetzen müssen, ist also die der Deliberation, der Abwägung theoretischer und praktischer Gründe.“
5 Eine gute, kurze Diskussion dieser Themen findet sich in Tetens (1994), S. 127 ff.; hier auch weitere Literatur.
6 Bennett und Hacker (2003), S. 72 ff. Die Mereologie ist die Lehre vom Verhältnis eines Ganzen zu seinen Teilen.
7 Z. Bsp. Heisenberg (2003, S. 38f.) sieht den Zufall, „das Element der Bedingungslosigkeit“, als wichtigen Einflussfaktor im Weltgeschehen: „Er füllt überall die Lücken zwischen den naturgesetzlichen Zusammenhängen.“
8 Nida-Rümelin (2001, S. 39-52) Kapitel 2: Handlungsfreiheit
9 Allerdings erläutert Nida-Rümelin sein Konzept am Beispiel eines Gedankenmodells mit idealen Kugeln in einer Newtonschen Idealwelt. Er argumentiert in seinem Gedankenexperiment, es ließe sich auf Bedingungen extrapolieren, in denen sich physische Prozesse aus instabilen Gleichgewichtszuständen mit „Null“ –Kraft anstoßen lassen. Aber reale, hier ausgeklammerte Phänomene, wie Adhäsion, elastische Verformung oder thermische Bewegungen der Partikel in den Kugeln verhindern die Anwendbarkeit dieses Gedankenexperiments auf die „nichtidealen“ Bedingungen realer Materie. Wie schon der in Schulversuchen leicht darstellbare Unterschied zwischen den Beschreibungen des Verhaltens idealer Gase mit denen der realen Gase aufzeigt, ist die Annahme idealer Bedingungen lediglich zur anschaulichen Herleitung prinzipieller Abhängigkeiten geeignet. Auch wenn sich ein experimentelles Szenario soweit optimieren lässt, dass der Krafteinsatz, um das Abrollen der Kugel zu induzieren minimal wird, so wird der Grenzwert realiter doch nicht Null sein.
Ist die Anwendbarkeit dieses Gedankenexperiments auf die Bedingungen in der einfachen Welt realer Kugeln also schon fraglich, so ist die Übertragung der Schlussfolgerungen auf Szenarien in extrem inhomogenen Systemen, wie eben lebende Zellen, in denen pausenlos wechselnde Muster von Anziehungs- und Abstoßungskräften zwischen unzähligen Teilchen wirken, vollends zurückzuweisen.
Weiter ist an Nida-Rümelins Konzept zu bemängeln, dass er neben dem Gehirn noch ein Agens einführt, das "intentionale Interventionen" ausführen kann, ohne das er angibt, wie diese Instanz ihrerseits zu ihren Entscheidungen kommt. Hier wird (entgegen eigener Bekundungen) ein Dualismus verfochten, indem eine Materie-unabhängige Instanz beibehalten wird, die Absichten hat, und die zur Verwirklichung dieser Absichten auf den Körper einwirkt, bzw. den Körper hierfür als Werkzeug einsetzt.
10 Die Feststellung der „epistemischen Unauffälligkeit“ der mentalen Verursachung von Handlungen suggeriert allerdings, dass es mit verbesserten Messmethoden doch noch zur Darstellbarkeit der bislang noch undefinierten Vorgänge kommen könnte, dass sie doch noch auffällig werden könnten. Nida-Rümelin bleibt an dieser Stelle letztlich die endgültige Festlegung schuldig, ob die von ihm vermuteten Singularitäten wirklich unbestimmt sind, oder ob sie doch nur Wissenslücken der Menschen und ihrer unvollkommenen Methoden sind, die irgendwann gefüllt werden könnten. Daran hängt für Nida-Rümelins Vorstellungen ziemlich viel: Prozesse, die naturgesetzlich determiniert ablaufen, ohne dass wir es messen können, können trotzdem nicht die Grundlage von Freiheit sein.
11 Zitiert und kommentiert bei Safranski (2009), S. 28-34
12 Heidelberger (2005)
13 Nida-Rümelin (2005), S. 27
14 Pauen (2007), S. 11
15 Habermas (2005), S. 156
16 Nida-Rümelin (2001), S. 122
17 Janich (2009), S. 177
18 Bieri (2009, S. 30)
19 z. B. Nida-Rümelin (2005), S. 42: „..., nämlich nicht weniger als ein Konflikt zwischen zentralen lebensweltlichen Überzeugungen, die -wie wir gesehen haben- nicht ernsthaft zur Disposition stehen, und zentralen Annahmen eines wissenschaftlichen Weltbildes.“
2. Erste lebensweltliche Beispiele für „Unfreiheit“
Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen. (Man kann es nicht bemerken, -weil man es immer vor Augen hat.)
(Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 129)
An diesem Aspekt der lebensweltlichen Evidenz der Unfreiheit setzen die folgenden Abschnitte an. Es machte schon von vornherein die Hypothese Sinn, dass sich Hinweise auf die Unfreiheit des menschlichen Denkens im wirklichen Leben zeigen sollten, wenn die Hirnforscher mit ihren Postulaten Recht hätten. Bei genauer Beobachtung des menschlichen Agierens lassen sich auch in der Tat eindeutige Anzeichen der Unfreiheit ausmachen, die überraschenderweise weder in der Argumentation der Skeptiker menschlicher Entscheidungsfreiheit erscheinen und die erst recht nicht von den Philosophen wahrgenommen werden, die an der Vorstellung der rein geistigen Entscheidungsfreiheit festhalten. Zur Einführung betrachten wir zunächst drei aus dem Leben gegriffene Situationen.
Ein Mensch M1 erhält an einem normalen Vormittag einen Anruf von einem anderen Menschen M2 mit einer Einladung zu einer Besprechung für 16 Uhr. M1 überlegt, er findet keinen Grund, der gegen ein Treffen mit M2 um 16 Uhr spricht, und daraufhin sagt M1 dem M2 den Termin zu. Gegen 13 Uhr sitzt M1 mit weiteren Menschen beim Mittagessen in Gesprächen über beliebige Themen. Da fällt M1 plötzlich ein, dass M1 für den besagten Zeitpunkt schon seit Tagen bei seinem Partner P im Wort ist, endlich einmal nicht so lange im Büro zu bleiben, sondern sich mit P um 16 Uhr zu treffen, um ausgiebig zu 'shoppen' und anschließend gemütlich zu speisen.
M1 war in diesem Beispiel zweimal in kurzer Zeit nicht der Herr über den guten Grund gegen die Entscheidung, die Einladung anzunehmen, obwohl M1 diesen Grund zweifellos „hatte“. Hätte ein mit der Situation vertrauter Mitmensch den M1 auf sein Versprechen gegenüber P hingewiesen, dann hätte M1 sofort bestätigt, dass er um diesen Sachverhalt weiß. Aber als M1 diesen Grund benötigte, um die in dieser Situation richtige Entscheidung zu fällen, war er ihm nicht verfügbar. Der gute Grund war sogar faktisch inexistent, insofern M1 nicht mehr die leiseste Spur einer Erinnerung an ihn bewusst war, sonst hätte er ihn unweigerlich zur Entscheidungsfindung herangezogen. Jegliche mutmaßliche „intentionale Intervention“ im Gedächtnis (wo immer auch die von M1 gesammelten Informationen behalten werden), mit dem Ziel sich an alle Gründe für oder gegen die Annahme des Termins zu erinnern, war machtlos. M1 hat wider besseres Wissen eine falsche Entscheidung zu dem angebotenen Termin gefällt, weil er keine Möglichkeit hatte, über sein Wissen frei und bewusst zu verfügen, obwohl er zweifellos die Intention hatte, all sein relevantes Wissen bei der Entscheidungsbildung zu berücksichtigen. Beim Mittagessen aber, als M1 seine Aufmerksamkeit ganz anderen Inhalten zuwandte, also ohne je bewusst auf M2 oder P oder den Zeitpunkt „16 Uhr“ Bezug genommen zu haben und ohne dass eine erneute „intentionale Intervention“ zum Aufruf des Datums stattgefunden hätte, wurde M1 die früher getroffene Verabredung mit P dennoch bewusst.
Zu diesem Beispiel lässt sich noch eine gewissermaßen verschärfte Variante formulieren:
In einem Disput eines Gelehrten M3 mit Kollegen kommt es vor, dass M3 ein Zitat aus einer Publikation des abwesenden Gelehrten M4 vorbringt. Ein Gesprächsteilnehmer fragt nach der Literaturstelle, aus der M3 den Kollegen zitiert hat. In diesem Moment passiert es, dass M3 nicht mehr sagen kann, in welcher Publikation er die zitierte Stelle gelesen hat, obwohl er weiß, dass er die Information behalten hat und in früheren Situationen problemlos wiedergeben konnte.
Im Gegensatz zum ersten Beispiel, in dem M1 im entscheidenden Moment nichts von seiner Verabredung mit P wusste, verhält es sich hier sozusagen „anti-sokratisch“, insofern M3 keineswegs weiß, dass er nichts weiß, sondern ganz im Gegenteil, er weiß genau, dass er um die gesuchte Literaturstelle weiß, sie „liegt ihm auf der Zunge“. Er hat aber auf diese in ihm durchaus gespeicherte Information keine Zugriffsmöglichkeit, er muss warten, bis sie ihm „einfällt“!20
Solche Vorkommnisse erleben Menschen jeden Alters, sie sind keineswegs Anzeichen für beginnende Krankheiten oder aber für degenerative Alterungserscheinungen. Szenen wie
M2: „Weißt Du nicht, dass Du Dein Ziel schneller/billiger/umfassender erreicht hättest, wenn Du A statt B getan hättest?“
M1: „Du hast ja recht, das ist mir überhaupt nicht eingefallen!“
sind tagtäglich im Leben aller Menschen zu beobachten, nicht nur in spektakulären Szenarien, in denen es um Leben und Tod geht, wie in der Wissenswette im 1. Akt des „Siegfried“. Dort kann Wotan dem Mime, der gerade leichtfertig sein Leben verwettet hat, höhnisch vorhalten: „was Dir nützt, fiel Dir nicht ein!“21 Es ist auch nicht so, dass M3 sein Wissen um das Literaturzitat auf immer vergessen hätte, dass es ihm vollends „entfallen“ wäre. Auch hier können wir sicher davon ausgehen, dass der Moment kommt, in dem M3 diese Information wieder „einfällt“. Sie war irgendwo „in ihm“ verborgen -sogar vor seinem eigenen, bewussten Zugriff. Denn wenn er die uneingeschränkte Möglichkeit zum „Zugriff“ auf seine Gedächtnisinhalte hätte, dann hätte er den Gedanken sofort aufgerufen, und in der Diskussion wiedergegeben.
In unserer ersten Analyse der Lebenswelt fällt noch mindestens ein weiterer Typus von Vorfällen auf, den wir unbedingt beobachten müssen:
M1 will aus seiner Küche in einen anderen Raum gehen, um sich ein Blatt Papier zu holen, auf dem er seine Einkaufsliste niederschreiben will. Dort angekommen, hat er vergessen, warum er in diesen Raum gegangen ist22.
M1 wollte gewiss nicht von einem Augenblick zum nächsten vergessen was er tun musste, als er auf dem Weg zu dem erwünschten Blatt Papier war. Er musste erleiden, dass sich sein sicherlich aus guten Gründen entstandener Wille plötzlich in Wohlgefallen auflöste und er dastand und sich wunderte, warum er in den anderen Raum gegangen war. Seine guten Gründe, seine Entscheidung, sein Wille waren verschwunden. Der unvoreingenommene Beobachter der Lebenswelt stellt sich natürlich sofort die Frage: Wer oder was hat dem M1 seinen Willen genommen? Denn sicher ist, M1 war es nicht, er hat sich nicht in irgendeiner Weise anders entschieden, er wollte sich bis zuletzt, bis ihm sein Wille entfiel, sein Blatt Papier holen.
Diese Beobachtungen zeigen, dass wir Menschen darauf angewiesen sind, dass unserem Bewusstsein dessen Inhalte von einem vom Bewusstsein nicht beeinflussbaren Agenten zugeführt werden. Die benötigten Daten -Gründe, Fakten, Ideen, hilfreiche Gedanken- können nicht durch einen bewussten Aufruf verfügbar gemacht werden, wenn sie dem Menschen nicht beizeiten „von selbst“ einfallen! Dieser Agent hat zudem die Macht, den aktuellen Willen eines Menschen geradezu auszulöschen; sogar dann noch, während dieser Mensch schon daran ist, seinen Willen in die Tat umzusetzen.
Wohlgemerkt: Es ist der lebensweltliche Normalfall, dass uns zur rechten Zeit passende Gründe und Fakten für anstehende Entscheidungen, aber auch gute Ideen und schlagfertige Antworten einfallen und dann auch so lange bewusst bleiben, bis sie von dringenderen Vorstellungen verdrängt werden. Der oben erwähnte Agent assoziiert mit bemerkenswerter Effizienz aktuelle Sinneseindrücke mit behaltenen Gedächtnisinhalten, generiert daraus „Antworten“ auf die aktuellen Herausforderungen und macht sie bewusst. Wenn dieser Automatismus aber einmal nicht das Richtige tut, dann haben wir keine Macht, es zu erzwingen. Wir bemerken dann oft nicht einmal, dass nicht die richtigen Antworten generiert wurden, wie es M1 im ersten Beispiel widerfahren ist. Wenn wir denken, wissen wir nie, ob das, was wir denken, schon alles ist, was wir denken könnten!
Als erste Schlussfolgerung müssen wir mithin festhalten: Die von vielen Verfechtern der Entscheidungsfreiheit unterstellte aktive Rolle der bewussten Person lässt sich in der lebensweltlichen Wirklichkeit nicht nachvollziehen. Über Tatsachen und Gründe für Entscheidungen zu Handlungen kann nicht nach Belieben verfügt werden. Das Bewusstwerden von Erinnerungen und Vorstellungen ist kein Bewusstmachen, das wir auch unterlassen könnten (wenn eine Erinnerung an etwas einfällt, ist sie schon unwiderruflich da), sondern das Ergebnis widerfahrener Einfälle; ein aktives „von sich aus daran denken“ lässt sich bei genauem Hinsehen in unserer Lebenswelt nicht beobachten23. Ein jeder Mensch kann sich nur an das erinnern, was ihm zuvor eingefallen sein muss. Was nicht einfällt, das haben wir gesehen, ist unerreichbar verborgen, geradezu als würde es nicht existieren. Auch wenn man die Vorstellung hat, dass man sich an gemachte Erfahrungen bewusst erinnern will (wie an ein Literaturzitat), heißt es nicht, dass das auch gelingt, obwohl man weiß, dass man diese Erfahrungen besitzt24. Eine bewusste Person, die nur hoffen kann, dass ihr im Bedarfsfall wirklich alle ihr eigenen Gründe für oder gegen eine Entscheidung einfallen, die hingegen fürchten muss, dass sie einmal gefasste Entscheidungen wieder vergisst, und das alles im Zweifelsfall nicht durch aktive Interventionen beeinflussen kann, ist nicht frei.
20 M3 muss natürlich nicht unbedingt auf den „direkten“ Einfall des gesuchten Datums warten; vielleicht fällt M3 ein, dass er in seiner Aktentasche eine Publikation von M5 hat, der die benötigte Referenz ebenfalls zitiert. Aber auch auf diesen Einfall müsste M3 warten, bis er eintritt.
21 Wagner (1983b), S. 31
22 Bieri (2009, S. 33f.) erwähnt ein derartiges Vorkommnis, um aufzuzeigen, dass Handlungen ohne einen Willen sinnlos seien, auch für den Urheber dieser Handlung. Er erkennt offensichtlich nicht die Brisanz des Phänomens als solches, dass nämlich die Menschen unwillkürlich ihre eigene Entscheidung, ihren eigenen Willen verlieren können, für die Diskussion, ob die Willensbildung frei sein könnte.
23 Ein besonders vehement vorgetragener Standpunkt hierzu stammt von Kittel (2005), der Erinnern als Aktivität identifiziert:
„Willens-, Entscheidungs- und Wahlfreiheit beruht nämlich auf unserer Denkfähigkeit, unserer von Dichtern besungenen vielzitierten Gedankenfreiheit. Denken wiederum beruht auf unserem Erinnerungsvermögen, das in der Fähigkeit besteht, etwas zu wiederholen.
Erinnern ist eine Aktivität. 'Erinnerungen' sind deswegen bestimmte Einzelaktivitäten. (Diese führen wir mit dem Gehirn aus, nicht in ihm, wo sie von Hirnforschern meist gesucht werden...)“.
Und weiter:
„Damit sind wir fähig, in irgendwelchen Zusammenhängen einmal Erlebtes zu einem anderen Zeitpunkt und damit auch immer in anderen Umständen zu wiederholen, und zwar entweder auf andere (wenn auch vielleicht ähnliche oder 'gleiche', weil sich gleichende...) aktuelle Anregungen hin oder aber ohne solche und somit 'von selbst', und das immer wieder: einfach dadurch, dass wir von uns aus 'daran denken'.“ [Hervorhebungen im Original] Die Beobachtung, dass „etwas“ auf eine gleiche oder ähnliche Anregung hin in der Vorstellung 'wiederholt' wird, ist dabei ganz zutreffend; nur, diese Erinnerung fällt dann ein, ohne den richtigen Einfall zu haben lässt sich „von uns aus“ an überhaupt nichts denken.
24 Das „Wissen“ darum, dass man die benötigten Daten eigentlich kennt, ist somit der einzige Einfall, den der Agent in solchen Situationen bewusst werden lässt.
3.Der unwillkürliche Strom der Gedanken
Cuncta fluunt, omnisque vagans formatur imago. (Alles fließt, und wechselnd wird jedes Bild geformt. Ovid, Metamorphoses, 15, 178)
Die gerade beschriebenen Phänomene des Einfallens, Ausbleibens oder Verlöschens von Einfällen situativ relevanter Sachverhalte sind Symptome einer noch viel umfassenderen Passivität der bewussten Personen gegenüber den Vorstellungen, die ihnen bewusst werden. Um genauer zu betrachten, wie wir Menschen zu unseren Vorstellungen kommen, untersuchen wir den Fall, wie etwa die Vorstellung einer behaltenen Erinnerung an früher Erlebtes bewusst wird. Wie in der Fußnote 23 schon zitiert, gibt es die völlig richtige Beobachtung, dass gemerkte Daten, auf äußere Anregungen hin, in der Vorstellung des angeregten Menschen wiederholt werden. Aber unter welchen Umständen geschieht das? Beobachten wir beispielsweise wieder den Menschen M1, diesmal im Gespräch mit seinem Steuerberater.
Beide erörtern konzentriert die fiskalische Sachlage. An einem Punkt des Gesprächs will der Steuerberater einen Scherz machen, und behauptet, dass ein gewisser Sachverhalt schon seiner Großmutter bekannt war. Mit der Erwähnung der Großmutter des Steuerberaters, fällt M1 plötzlich selbst die Vorstellung einer seiner Großmütter ein.25
M1 war aber mit Steuerdingen intensiv befasst, er wollte keinen Augenblick an eine seiner Großmütter denken; er war nicht der Urheber dieser Vorstellung, sondern musste hinnehmen, dass ihm die Vorstellung einer Großmutter einfiel und er hatte keine Chance, das Aufkommen dieser Erinnerung in der Vorstellung zu verhindern. Er hatte darüber hinaus keine Macht, zu entscheiden, welche seiner beiden Großmütter ihm in seine Vorstellung einfällt (selbstverständlich vorausgesetzt, er hatte in seinem Leben auch beide kennen gelernt) und darüber, welche seiner Erinnerungen an die letztlich vorgestellte Großmutter tatsächlich wiederholt wurde26. Dazu darf man sich diese Erinnerungen nicht statisch denken. Genau besehen ist es sogar sehr oft so, dass eine ganze Serie von Vorstellungen in kürzester Zeit aufscheint. Es läuft geradezu ein ganzer „Film“ mit einer Auswahl der Erinnerungen an den angeregten Anlass im Bewusstsein des M1 ab. Auch in solchen alltäglichen Situationen zeigt sich erneut die passive Rolle der „handelnden“ Person des M1. Wieder finden wir das Wirken eines unbewussten Agenten: Der Steuerberater sagt etwas, und dem M1, fällt eine Vorstellung dazu ein, sie wird nicht aufgerufen. M1 hat nicht entschieden, dass ihm diese und keine anderen Vorstellungen seiner Großmutter einfallen sollen. Die Sequenz der Szenen des „Films“ entsteht ohne willentliche Steuerung. M1 wird es auch nicht entschieden haben, wenn ihm als Folge des ersten Einfalls weiter einfällt, den Steuerberater zu fragen, ob dessen Großmutter ebenfalls so gut kochen konnte. Und keiner von beiden wird es für sich entschieden haben, wenn dann M1 und sein Steuerberater, dem natürlich auch Vorstellungen seiner Großmutter bewusst sind, damit beginnen würden, Erinnerungen an die Rezepte der Großmütter auszutauschen. So entsteht unter Umständen ein neuer thematischer Fokus, oder es scheint eine nur Sekundenbruchteile andauernde Erinnerung auf, bevor wieder die anstehenden Steuerthemen in den Sinn kommen (weil natürlich der Anlass des Treffens durch die sinnlichphysische Gegenwart des Steuerberaters und der fiskalisch relevanten Dokumente die Aufmerksamkeit des M1 permanent auf die Gegebenheiten der realen Außenwelt lenken), die zuvor unwillkürlich aus dem Bewusstsein verdrängt worden waren. Dieser letzte Punkt verdient es, noch einmal hervorgehoben zu werden. Auch wenn die Ablenkung von den Steuerdingen durch die Vorstellungen der Großmütter nur kurze Zeit anhält, währenddessen ist die Steuerfrage vergessen, aus dem Bewusstsein verschwunden, so wie im Beispiel im vorangegangenen Kapitel M1 die Verabredung mit P in einer solchen Weise entfallen war, dass sie faktisch inexistent wurde.
Das Fortspinnen von Vorstellungen zeigt, dass dieser eigenartige Mechanismus einmal in den Fokus der Aufmerksamkeit eingetretene Gedanken unablässig unbewusst mit den zahllosen vorhandenen Erinnerungen eines Menschen abgleicht und gemerkte Assoziationen bewusst macht, die aus Erfahrung für die aktuelle Situation von Belang sein könnten. Aber oft genug fallen auch nebensächliche Assoziationen ein und führen in einen neuen thematischen Kontext. So könnte ein blaues Kleidungsstück, welches in der spontanen Vorstellung der Großmutter mit-erscheint, ebenso spontan in die Erinnerung an das Blau übergehen, welches Giovanni Bellini in seinen Gemälden oft für den Himmel verwendete. Und so wäre M1, vielleicht nur einen Moment lang, in Gedanken weitab von den Steuerdingen, wegen denen er sich mit seinem Berater verabredet hatte.
Da doch das Besingen der Freiheit durch Dichter auch als eine Evidenz für deren Wahrheit betrachtet wird27, so muss darauf hingewiesen werden, dass auch das unwillkürliche Karussell der Gedanken schon dichterische Würdigung erfahren hat. Das prominenteste Beispiel hierfür ist der letzte Abschnitt des „Ulysses“ von James Joyce, in dem ein einziger Gedankenstrom eines Menschen (der von Molly Bloom, der Ehefrau des Protagonisten Leopold Bloom) geschildert wird. Im folgenden Beispiel wurden die „Gedankentrenner |“ von mir eingefügt, um die Punkte zu markieren, an denen gedankliche „Themenwechsel“ eintreten:
„…und eine Flasche Spülicht die er uns als Rotwein andrehen wollte wo er keinen gefunden hatte der das Zeug säuft | o mein Gott | der geht sogar mit seiner Spucke noch sparsam um aus Angst er könnte sonst mal verdursten | oder ich müßte mal wieder paar Atemübungen machen | möchte wissen ob dieser Schlankmacher wohl was taugt | man kanns natürlich auch übertreiben Dünne sind gar nicht so sehr in Mode jetzt | aber Strumpfbänder derart wie ich habe das violette Paar zum Beispiel was ich heute getragen hab das war alles was er mir gekauft hat…“28
Dieser Gedankenstrom spiegelt sehr anschaulich die reale, unaufhaltsame, geradezu atemlos-ununterbrochene Abfolge menschlicher Vorstellungen wider. Auch die Unwillkürlichkeit dieser Abfolge der Vorstellungen wird hierdurch unmissverständlich demonstriert. Kein vorangehender Gedanke wägt über seinen Nachfolger ab oder ruft ihn auf, oder nimmt ihn irgendwie vorweg. Welche bewusste Aktivität hätte beispielsweise den zusammenhanglosen Übergang von der Betrachtung der „Angst vor dem Verdursten“ zu der Idee, wieder einmal Atemübungen zu machen, herbeigeführt und insbesondere die große Zahl der alternativ möglichen Fortführungen verworfen? Wie und wann wurde bewusst und aktiv festgelegt, dass gerade „o mein Gott“ gedacht wird, und nicht irgend ein anderer Stoßseufzer oder ein Kraftausdruck stattdessen? Oder dass gleich ein weiterer, an das vorige Thema anknüpfender Gedanke gedacht werden soll (wie es uns zumeist widerfährt, insbesondere wenn wir uns als auf ein Thema „konzentriert“ erleben29), oder dass ein ganz neuer Inhalt bewusst wird? Die Vorstellungen kommen und gehen jedoch tatsächlich so ohne „Punkt und Komma“, wie Joyce es dargestellt hat, ohne Innehalten und ganz und gar ohne Überlegen und ohne bewusste Entscheidung. Es kann hier natürlich nichts mehr überlegt und entschieden werden, denn dieser unwillkürliche Gedankenstrom ist genau das, was wir als Abwägung bezeichnen, wenn wir uns als abwägend erleben. Dieser Strom entfließt einer unbewussten Quelle, die uns unentwegt mit den Einfällen versorgt, aus denen die Sequenz der menschlichen Gedanken in Wirklichkeit besteht. Im Strom der Gedanken verdrängt jeder nachfolgende Gedanke seinen bewusst gewordenen Vorgänger, ohne dass der vergehende erste Gedanke irgendeinen Einfluss auf seinen Nachfolger hätte. Er erscheint uns daher bloß als ob er eine aktive Abwägung wäre, wenn wir die Abfolge unserer Gründe, Präferenzen und Entscheidungen erleben. Was jedoch in diesem Strom der bewussten Gedanken und Vorstellungen erscheinen wird, ist –in gewissem Sinne- bereits außerhalb des Bewusstseins abgewogen und entschieden worden. In dieser Quelle wirkt der Agent, dessen Wirksamkeit wir oben schon erkannt haben. Er legt fest, was einem Menschen, einer Person, bewusst wird und was wieder aus seinem Bewusstsein verschwindet.
Jeder Mensch kennt aber auch das umgekehrte Phänomen, dass nämlich Vorstellungen sich festsetzen, dass sie nicht mehr aus dem Sinn gehen. Sei es, dass Verliebte unentwegt eine Vorstellung des/der Liebsten präsent haben, selbst in Situationen, in denen sie diese eigentlich nicht gebrauchen können, wie beim Autofahren oder in Besprechungen im Büro, oder sei es, dass eine jüngst gehörte Melodie nicht mehr aus dem Sinn geht. Der Mensch, dem solches widerfährt, kann diese immer wiederkehrenden Vorstellungen nicht unterdrücken, er ist machtlos und unfrei diesen Phänomenen ausgesetzt, so lange, bis sie sich von selbst erledigen oder bis ein wirklich machtvoller äußerer Anlass die aktuelle Vorstellungswelt dominiert. In diesen Zusammenhang gehören offensichtlich auch Phänomene, wie Zwangsvorstellungen und Süchte (z. B. Spielsucht30) oder auch Unbeherrschtheit31. Auch hier kann der Mensch seine spontanen Reaktionen nicht kontrollieren, obwohl er die Vorstellung hat, dass seine Handlungen nicht zu seinem Vorteil sind und er sie eigentlich unterlassen muss.
Wenn wir uns also genau und unvoreingenommen beobachten, müssen wir feststellen, dass unsere lebensweltliche Vorstellungswelt aus einem unaufhörlichen, spontanen und unwillkürlichen Wechsel von Vorstellungen besteht, von denen die meisten offensichtlich von den uns aktuell durch die äußeren Sinne vermittelten Themen und Tätigkeiten angeregt werden32. Viele erscheinen darin aber auch scheinbar überraschend. Die Vorstellungswelt wird ausgefüllt von Einfällen, deren bewusste Urheber wir ausdrücklich nicht sind33. Der Agent gibt und nimmt die Vorstellungen nach eigenen Regeln, die wir nicht erkennen und nicht beeinflussen können und wir müssen das annehmen, was uns einfällt.
Auch im Falle von Entscheidungen, die ein Individuum fällen muss, ist es so, dass die damit verbundenen Vorstellungen der Entscheidungsgründe und der Entscheidung selbst spontane, unwillkürliche Einfälle sind. Am eindrücklichsten wird das in Situationen deutlich, in denen ohne viel Zeit zu Abwägungen sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. In der Alltagssprache werden diese dann gerne als „Bauchentscheidungen“ charakterisiert. Man macht, was gerade zu machen einfällt, ohne Abwägung und ohne bewusste Entscheidung. Aber auch die scheinbar „überlegt“ herbeigeführte Entscheidung, aus der sich ein wohlbegründeter Wille ergeben sollte, zeigt alle Elemente des unwillkürlich auftretenden Einfalls. Beobachten wir zur Erläuterung wieder M1, diesmal in einem Restaurant. M1 möchte sein Mahl mit einem Rotwein bereichern. Zu jedem Wein, von dem er in der Weinkarte liest, fallen ihm wieder etliche Vorstellungen aus seinen persönlichen Erinnerungen ein: Eigene Erfahrungen und Präferenzen, Empfehlungen anderer Menschen, Begleitumstände früherer Weingenüsse. Darunter sind sowohl die Wiederholungen sprachlich gefasster Tatsachen („M2 empfahl mir wärmstens den Zweigelt“), als auch die Vorstellungen von mit den Weinen assoziierten Geschmäcken, Gerüchen und anderer Erinnerungen, vielleicht eine bemerkenswerte Sonnenuntergangstimmung in den Abruzzen, während des Genusses eines Montepulciano.
Viele solcher Vorstellungen gehen M1 durch den Kopf, während er die Weinkarte studiert. Jede einzelne erscheint wie immer ohne bewusstes Zutun in der spontanen und unwillkürlichen Abfolge von Assoziationen zu der aktuellen Herausforderung „Auswahl eines Weines“. Würde M1 laut über seine jeweiligen Vorstellungen reden, so müsste ein stiller Beobachter zu dem Schluss kommen, dass M1 tatsächlich die Gründe für und gegen einzelne Weine aufzählt und abwägt. Denn auch „Vergleichs-Vorstellungen“ fallen ein, die im gedanklichen Selbstgespräch als Teil einer vollständigen Abwägung aufgefasst werden können („der Dornfelder ist süffiger als der Spätburgunder“; „die süffigeren Weine haben mir immer besser geschmeckt, als die trockenen“). Nur ist es eben auch bei diesen Gedanken der Fall, dass sie nicht bewusst herbeigerufen werden, sondern, dass auch die Vergleiche und Zwischenergebnisse Vorstellungen sind, die einfallen oder auch nicht einfallen. Fiel der Vergleich 'Dornfelder vs. Spätburgunder' in der hier geschilderten Szene wohl ein, so mag es sein, dass ein früher einmal festgestellter Unterschied zwischen Zweigelt und Portugieser diesmal überhaupt nicht bewusst wird, obwohl beide Rotweine auf der Weinkarte vorkommen. Die Vorstellungen, die im Zuge eines Entscheidungsprozesses bewusst werden, passieren reihum Revue (ganz so, wie es Ovid in den Metamorphosen gesehen hat: „Cuncta fluunt“), sehr oft mehrmals und zwangsläufig so lange, bis auch eine Entscheidung einfällt. Wenn wir nämlich M1 (und insbesondere uns selbst in vergleichbaren Situationen) genau beobachten, werden wir ohne weiteres feststellen, dass auch die finale Entscheidung letztlich in einem Augenblick plötzlich einfach „da“ ist, ein Einfall, der erst bewusst werden musste, wie alle anderen Vorstellungen auch34. Dessen Eintreten zu diesem Zeitpunktkonnte nicht beschleunigt, verzögert oder gar verhindert werden. Wir haben in diesem Augenblick nicht entschieden, dass die Abwägungsphase zu beenden sei, wir haben uns nicht vergewissern können, dass alle unsere Gründe berücksichtigt wurden, denn die Gründe, die uns bis dahin nicht eingefallen sind, waren bekanntlich für uns in dieser Zeit gleichsam nicht existent. Wir wussten nicht, welche Gründe noch relevant gewesen wären. Manchmal ist auch der Inhalt dieses Einfalls, die Entscheidung zum „Ich will X!“ für uns selbst überraschend, so dass wir rückblickend sagen müssen: „Ich weiß nicht, was da in mir vorging, als ich mich für X und nicht für Y oder Z entschieden habe.“
Und selbst dann, wenn einmal eine Entscheidung gefällt wurde, kommt es oft vor, dass die Vorstellungen zur bereits getätigten Entscheidung weiter aufscheinen, die gerade verworfenen Alternativen tauchen unwillkürlich wieder auf, der Zweifel, ob man richtig entschieden hat, wird bewusst. Das Karussell der Einfälle zu einer bereits entschiedenen Problematik dreht sich unter Umständen weiter, ohne dass man es steuern und ohne dass man es verhindern kann. Von einer Sekunde zur anderen kommt es vor, dass man einmal X will, das andere Mal Y, und zuletzt doch wieder X.
Die Erfahrungen, die jeder Mensch zur Bewältigung seiner lebensweltlichen Herausforderungen behalten hat, müssen natürlich identifiziert, abgewogen und priorisiert werden, damit sie in Gründe für oder gegen anstehende Entscheidungen münden können. Denn wir treffen unsere Entscheidungen aus Erfahrung; und unser Wille kann sich nur dann auf Gründe stützen, wenn diese zu der Zeit seiner Ausbildung schon Bestandteil unseres Erfahrungsschatzes waren. Wir erkennen den Ablauf der Such- und Auswahlvorgänge daran, dass uns vor jeder Entscheidung viele Fakten und Gründe bewusst werden (aber eben oft nicht alle). Durch die Unsicherheit darüber, ob bei einer gefassten Entscheidung alle grundsätzlich verfügbaren Gründe eingeflossen sind, haben alle unsere Entscheidungen eine Tendenz zur Irrationalität. Wobei zugrunde gelegt sein soll, dass eine Entscheidung rational gewesen wäre, wenn vom entscheidenden Individuum alle relevanten, behaltenen Informationen zur Entscheidungsbildung abgewogen worden wären. Eine rationale, autonome und freie Person müsste die Macht zur vollständigen Kontrolle über alle ihre Gründe besitzen (und über alle aus Erfahrung möglichen Entscheidungsoptionen; es kommt ja auch vor, dass nicht nur Gründe nicht einfallen, sondern häufig genug auch, dass einem M1 nicht alles einfällt, was überhaupt möglich wäre). Dies alles kann nicht sichergestellt werden. Eine rationale Abwägung aller Gründe zu Entscheidungsoptionen, in der systematisch jede Option mit jeder anderen nach Kriterien verglichen wird, findet im Leben daher selten statt. Und wenn, dann nur zufällig und im Nachhinein als solche identifizierbar. Wir suchen nicht in Gedächtnislokationen nach Entscheidungsoptionen und den Gründen für und wider die einzelnen Optionen und nach definierten Präferenzen und Wünschen, die den Gründen mehr oder weniger Gewicht verleihen können. Alle diese Parameter fallen uns ein, oder der Einfall bleibt aus. Uns fallen in den meisten alltäglichen Entscheidungssituationen lediglich fragmentarische, qualitative Zwischenresultate ein, wie „der Dornfelder ist süffiger als der Spätburgunder“. Ein tatsächliches Wiegen von Parametern, die einen „Gewichtswert“ hätten, ist lebensweltlich auch gar nicht erkennbar. Nehmen wir an, dass M1 drei Weine in der engeren Wahl hätte, wobei W1 der sein könnte, der M1 immer am besten schmeckte, W2 ist der preisgünstigste auf der Karte und W3 ist als Neuheit angepriesen, die unbedingt probiert werden sollte. Wie werden solche verschiedenen guten Gründe in der Praxis vergleichbar gemacht und abgewogen? Dazu müssten die schon schwer vorstellbaren Grade der Bewährtheit (W1), Preiswertigkeit (W2, das ist noch am einfachsten) und der „Neugierfaktor“ (W3) in eine Größe übersetzt werden, welche die unterschiedlichen Ausgangskriterien vergleichbar macht; gewissermaßen in „Standardmaße des Abwägens“. Solch eine Vergleichbarmachung findet im Bewusstsein des abwägenden M1 nicht statt35. M1 fallen die genannten Gründe für die in Frage stehenden Weine ein, er ist sich der Vorteile einer jeden Option bewusst. Aber er wägt die Optionen nicht aktiv und bewusst ab. Das Bewusstsein von den jeweiligen guten Gründen erlaubt ihm dann, nachdem ihm eingefallen ist, dass er W3 wählen will, zu wissen und zu verkünden, dass er diesmal dem Reiz des Neuen den Vorzug vor dem Bewährten und dem Billigen gegeben hat. Abgewogen wurde jedoch im unbewussten Hintergrund, nach Kriterien, die er selbst nicht nachvollziehen kann, deren lebensweltliche Anlässe M1 als behaltene Erfahrungen teilweise und vorübergehend einfallen, genauso, wie am Ende die resultierende Entscheidung.
Und daher muss M1, wenn er die Vorstellung hat, systematisch abwägen zu wollen, doch stets in der Sorge sein, ob ihm wirklich alles eingefallen ist. Er muss, genauer gesagt, die Vorstellung haben, dass er in Sorge darum ist. Eine solche Vorstellung kann M1 nur dann haben, wenn er ein „Bild“ von sich selbst behalten hat, in dem alle Beobachtungen und Erfahrungen mit sich selbst gespeichert sind. Dazu gehörte dann auch die Beobachtung, dass in der sinnlich erfahrbaren Lebenswelt oft genug falsch entschieden und gehandelt wurde, weil wichtige Erfahrungen nicht rechtzeitig eingefallen sind. Und wir beobachten tatsächlich auch an M1 in vielen Entscheidungssituationen, dass ihm einfällt, sich selbst zu fragen, ob ihm auch wirklich alles eingefallen ist, was in dieser Situation wichtig ist. Und M1 wartet dann oft eine Weile darauf, dass ihm eventuell doch noch etwas einfällt. M1 weiß nicht, ob ihm alles eingefallen ist, er weiß auch nicht mehr, ob ihm etwas, was er noch vor einigen Augenblicken gedacht hat, nicht schon wieder entfallen ist (sic!)36, und er kann davon nie aktiv Gewissheit erlangen. Auch wenn M1 alles aufschreibt, was ihm einfällt, so mag das verhindern, dass er etwas wieder vergisst, es gibt ihm aber immer noch keine Gewähr dafür, dass ihm wirklich alles eingefallen ist, worüber er verfügen könnte. Und es hat auch keinen Einfluss auf die Entscheidung, die letztlich einfällt.
Die im oberflächlichen Anschein verhaftete Alltagspsychologie postuliert dennoch den aktiven Zugriff auf die behaltenen Erfahrungen, die aktive Selektion und Abwägung derselben, ohne im Geringsten sagen zu können wie diese Operationen vor sich gehen. Die präzise beobachtende Alltagspsychologie erkennt dagegen, dass bewusst überhaupt nicht gesucht, zugegriffen und bewertet werden kann. Wenn wir oben noch geschrieben haben, dass die Lebenserfahrungen des M1 „sogar vor seinem eigenen bewussten Zugriff verborgen waren“, so müssen wir auch diese Formulierung korrigieren. Wir uns erinnernde Menschen selektieren offensichtlich nicht aus irgendwelchen Datenspeichern (weder aus geistigen, noch aus materiellen), wir wissen überhaupt nicht, wo wir suchen könnten, wohin unsere „intentionalen Interventionen“ greifen müssten, um unsere behaltenen Erfahrungen nutzen zu können. Auch bei Wittgenstein findet sich die unbeantwortete Frage, nach der Art und Weise, wie Erinnerungen wohl wiederholt werden mögen:
„Wie macht das Einer, wenn er sich das Gesicht des
Anderen in die Erinnerung ruft?





























