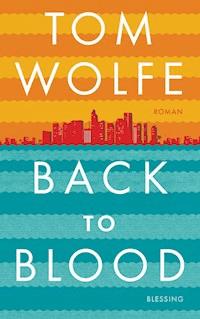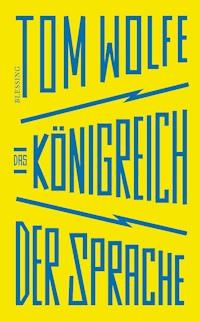8,99 €
8,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Amerika in den frühen Sechzigerjahren: LSD-Experimente, San Francisco, Blumenkinder. Und eine Busreise, wie es sie nie zuvor gegeben hat und nie mehr geben wird. 1968 beschrieb Tom Wolfe die Reise von Ken Kesey und seinen „Merry Pranksters“ in seinem legendären Klassiker. Ein Buch, welches längst als Neues Testament der Hipster-Mythologie gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
4,5 (16 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der Autor
1 SCHWARZGLÄNZENDE FBI-SCHUHE
2 DAS BLASENTOTEM
3 DER ELEKTRISCHE ANZUG
4 WIE FINDEN’SE DENN MEINEN BUDDHA?
5 DIESER REMMIDÄMMRIGE NEONSTAUB
6 DER BUS
7 NICHT GENEHMIGTES ACID
8 WIE MAN DIE MASSEN BEDUDELT
9 DER KRYPTA-TRIP
10 TRAUMKRIEGE
11 DIESES UNAUSGESPROCHENE DING
12 GEKASCHT
13 DIE HELL’S ANGELS
14 EIN WUNDER IN NUR SIEBEN TAGEN
15 EINE WOLKE
16 DIE TIEFGEFRORENE JUG BAND
17 DER EINE ODER ANDERE ABSCHIED
BEREITET EUCH AUF MEXIKO VOR!
MOUNTAIN GIRL GEHT ZURÜCK NACH POUGHKEEPSIE
SANDY GEHT NACH NEW YORK
18 COSMOS TASMANISCHE TEUFELEI
»BESTEHST DU DEN ACIDTEST?«
»BESTEHST DU DEN ACIDTEST?«
19 DAS TRIPS-FESTIVAL
20 DER STARKSTROMBRAUSEACIDTEST
21 DER FLÜCHTLING
22 ¡DIABLO!
23 DIE ROTE FLUT
24 KNAST AUF MEXIKANISCH
25 GEHEIMAGENT NUMERO UNO
26 DAS RÄUBER-UND-GENDARMEN-SPIEL
27 DIE REIFEPRÜFUNG
EPILOG
ANMERKUNG DES AUTORS
Copyright
Das Buch
Amerika in den späten Sechzigerjahren: LSD-Experimente, San Francisco, Blumenkinder. Und eine Busreise, wie es sie nie zuvor gegeben hat. 1968 beschrieb Tom Wolfe die legendäre Reise von Ken Kesey und seinen »Merry Pranksters« in Electric Kool-Aid Acid Test. Ein Buch, welches längst als »Neues Testament der Hip-Mythologie« gilt. Kesey, der Autor des Klassikers Einer flog über das Kuckucksnest, gründet Mitte der 60er-Jahre die Unerschrockenen Reisen GmbH, kauft für 1500 Dollar einen 1939er Schulbus, welcher in der Folgezeit als DER BUS zum Symbol des neuen, LSD-erweiterten Bewusstseins werden sollte. Zur gleichen Zeit macht sich Tom Wolfe einen Namen als der »heißeste Schreiber« der Herald Tribune. Neben Truman Capote und Norman Mailer gilt er als der bedeutendste Vertreter des New Journalism, der die Grenzen zwischen erzählender Prosa und Berichterstattung aufhebt. Aus einer geplanten Kurzgeschichte über Kesey wird ein umfassendes Dokument der Prankster-Historie. Er hört Bänder ab, sieht Filme, studiert Tagebücher und Briefe, und unterhält sich mit Dutzenden von Ohren- und Augenzeugen. Mit sich stakkatohaft überschlagender Sprache schickt Wolfe den Leser mitten hinein in die LSD-Trips der Pranksters: Der Leser ist unmittelbar dabei, auf Reise mit Timothy Leary, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, den Hell’s Angels, den Grateful Dead und natürlich Ken Kesey.
Der Autor
Tom Wolfe, 1931 in Richmond, Virginia, geboren, lebt in New York. In den Sechzigerjahren gehörte er mit Truman Capote, Norman Mailer und Gay Talese zu den Gründern des New Journalism, einer Synthese aus Journalismus und Literatur. Der vielfach preisgekrönte Schriftsteller war international längst als Sachbuchautor berühmt, ehe er 1987 mit Fegefeuer der Eitelkeiten seinen ersten Roman vorlegte, der auf Anhieb zum Weltbestseller wurde. Weitere Romane waren Ein ganzer Kerl und Ich bin Charlotte Simmons.
Lieferbare Titel (bei Heyne) Ich bin Charlotte Simmons
Die Originalausgabe THE ELECTRIC KOOL-AID ACID TEST erschien bei Farrar, Straus and Giroux, Inc., New York
1 SCHWARZGLÄNZENDE FBI-SCHUHE
Das ist gar nicht mal so dumm, Cool Breeze. Cool Breeze, ein junger Bursche mit drei oder vier Tagen Bart im Gesicht, hockt neben mir auf dem gemusterten Walzblech der offenen Ladefläche eines Pickup-Trucks. Und mit dem geht es hopsholpernd dahin. Wir tauchen ein, kommen wieder hoch und schaukeln auf der verrotteten Federung des Vehikels dahin wie auf einem schlingernden Boot. Nach hinten raus sehen wir San Francisco den Hügel hinunterhopsen, Spaliere endlos ineinander gestaffelter Fenstervorbauten, Elendsquartiere mit einem tollen Blick auf die Bucht: Alles hüpft und strömt den Hügel hinab. Die Leuchtschilder mit den Martinigläsern aus Neonröhren, die in San Francisco die Bars markieren, strömen hüpfend den Hügel hinunter, eines nach dem anderen, Tausende von purpurnen Martinigläsern, und unter diesen Martinigläsern wirbeln Hunderte, Tausende von Menschen auf dem Absatz herum, um diesen ausgefreakten, total außer Rand und Band geratenen Pickup-Truck zu begaffen, auf dem wir dahinpreschen; ihre weißen Lahmarschgesichter platzen ihnen wie Marshmellows aus dem Revers; und schon strömen auch sie hopsend den Hügel hinunter – aber weiß Gott, bei uns hier gibt’s aber auch wirklich was zu gaffen.
Und deshalb kommt es mir auch ziemlich komisch vor, als Cool Breeze allen Ernstes, das ganze Getöse übertönend, zu mir sagt: »Ich weiß nicht so recht – wenn Kesey rauskommt – soll ich nun mit zum Lagerhaus oder nicht?«
»Warum denn nicht?«
»Na, weil auch die Bullen da aufkreuzen werden, Mann, und so wie die drauf sind, also echt, ich bin auf Bewährung, verstehste, ich weiß echt nicht, ob ich das bringen soll.«
Na ja, so gesehen ist das gar nicht so dumm, Cool Breeze. Leg dich nicht unnötig mit dem Gesocks an. Besser du machst es wie jetzt gerade – und fällst erst gar nicht auf. Aber im Augenblick hat Cool Breeze solchen Schiss vor den Sheriffs, dass er einfach dahockt, vor den Augen tausender Bauklötzer staunender Bürgersleute, mit einer Art Sieben-Zwerge-Schwarzwälder-Gnomen-Hut-Mütze auf dem Kopf, über und über mit Federn gespickt und außerdem noch mit DayGlo bemalt. Uns gegenüber auf der Ladefläche kniet, ebenfalls weithin sichtbar, den Kopf weit zurückgeworfen und übers ganze Gesicht strahlend, ein Indianermädchen, ein Halbblut vom Stamme der Ottawa namens Lois Jennings, auf deren Stirn ein blitzendes rundes Silbermedaillon prangt, das abwechselnd in grellen Blitzen explodiert oder Regenbogenfarben verschießt – je nachdem, wie es gerade von der Sonne getroffen wird. Ja, und außerdem hat sie einen langläufigen 45er Colt-Revolver in der Hand, und kein Mensch da draußen auf der Straße weiß, dass das bloß ein Spielzeugrevolver ist, mit dem sie da drauflosballert – piuuuu-piuuuuu! -, immer auf die aus den Revers herausplatzenden Lahmarshmellowgesichter, wie Debra Paget in … in …
- Kesey kommt aus dem Knast!
Wir haben noch zwei weitere Sehenswürdigkeiten an Bord, wegen denen uns die da draußen so angaffen: das Schild mit »CUSTER STARB FÜR EURE SÜNDEN« auf der hinteren Stoßstange und unseren Fahrer, den Herzallerliebsten von Lois, Stewart Brand, einen hageren blonden Typen, der ebenfalls eine blitzende Silberscheibe auf der Stirn trägt und außerdem eine richtige Krawatte aus Indianerperlen um den Hals. Kein Hemd darunter, nur eine Krawatte aus Indianerperlen auf der nackten Haut und einen weißen Metzgerkittel, an dem eine Reihe Orden vom schwedischen König prangt.
Hier kommt ein besonders hübsches Exemplar, mit Diplomatenköfferchen und allen Schikanen, den geballten Groll eines so richtig erfüllten Tages auf dem Feierabendgesicht, und die … Schuhe – wie die glänzen! -, und was zum Teufel wollen denn diese schwachköpfigen Beatniks da – und Lois verpasst ihm eine in seinen guten alten lahmarschigen Marshmellow, und schon wischt auch er hopsend hinter uns den Hügel hinab.
Und unser Laster hebt und senkt sich wankend in einem Wetterleuchten rot-silberner DayGlo-Blitze, und ich bezweifle allen Ernstes, Cool Breeze, dass es heute in ganz San Francisco auch nur einen einzigen Bullen gibt, der dieses außer Rand und Band geratene Vehikel nicht vom Fleck weg als das identifizieren würde, was es ist – eine Guerillapatrouille des Bürgerschrecks LSD.
Die Bullen kennen die Szene mittlerweile in- und auswendig, wissen Bescheid über die Kostüme, die dope-strähnige Jesus-Mähne, die Indianerperlen, die indianischen Stirnbänder, die plumpen, bunten Eselsperlen, Tempelglöckchen, Amulette, Mandalas, Gottesaugen, fluoreszierenden Westen, Einhornhörner und die Duellhemden à la Errol Flynn; nur was die Schuhe anlangt, sind sie noch immer nicht auf den Trichter gekommen. In Sachen Schuhe kennen die Heads keine Gnade. Das Schlimmste, was man in ihren Augen anhaben kann, sind schwarzglänzende Schuhe mit Schnürsenkeln. Darüber erhebt sich eine ganze Hierarchie – obwohl praktisch jede Art von Halbschuh als unhip gilt – bis hinauf zu den Stiefeln, auf die alle Heads stehen: leichte, ausgefallene Stiefel, so bizarr wie nur möglich, oder, wenn sie nichts Besseres kriegen können, englische Stiefel, wie sie die Mods tragen, aber caliente sind natürlich handgearbeitete mexikanische Dandystiefel mit waffenscheinpflichtigen Spitzen und extra schmal. Und jetzt stellt euch mal die Szene vor, als es dem FBI endlich gelang, Kesey hoppzunehmen: schwarze! glänzende! FBI-Schuhe mit … Schnürsenkeln!
Wir haben noch ein Mädchen auf der Ladefläche, ein kleines dunkelhäutiges Ding mit vollem schwarzen Haar, das von allen Black Maria gerufen wird. Sie sieht wie eine Mexikanerin aus, aber sie spricht mich mit typisch sanftem kalifornischen Akzent an: »An welchem Tag bist du geboren?«
»Am zweiten März.«
»Ein Fisch«, sagt sie. Und dann: »Ich hätt’ dich nie für’n Fisch gehalten.«
»Warum nicht?«
»Du machst’n viel zu gesetzten Eindruck für’n Fisch.«
Ich versteh’ schon, was sie meint: In ihren Augen gehöre ich nicht unbedingt hierher – man sieht mir meine mangelnde Distanzlosigkeit an -, und ich fange selbst schon an zu merken, dass ich hier nicht dazugehöre. Drüben in New York, meine liebe Maria, ehrlich, da hält man mich für ganz cool, für einen Dandy sogar. Aber hier in der Welt der Heads von San Francisco scheint man wegen eines blauen Seidenblazers, einer überbreiten Krawatte voller Clowns und eines Paars … schwarzer … glänzender … Halbschuhe nicht gleich Beethovens Neunte anzustimmen. Lois mäht die Lahmarshmellows nieder, einen nach dem anderen; Cool Breeze verkriecht sich in die inneren Gefilde seines Gnomenfilzes; Black Maria, ihres Zeichens Skorpion, stöbert sich durch die Welt der Tierkreiszeichen; Stewart Brand fädelt den Wagen durch die gewundenen Straßen; Pailletten explodieren – und dabei passiert hier überhaupt nichts Besonderes, nur Alltagskram für die Welt der Heads von San Francisco; nichts weiter als eine Routinefahrt, um die Bürgersleute von San Francisco ein wenig in Rage zu bringen, nur so im Vorbeifahren, nichts weiter als Seelenfutter für die Leute aus der Szene, während man nebenbei noch irgendeinem Typen aus New York einen Lift zum LAGERHAUS spendiert, wo alle auf den Häuptling, den Boss, den Chief warten, auf Ken Kesey, der bald aus dem Gefängnis entlassen werden soll.
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich über Kesey noch nicht viel mehr, als dass er ein hoch angesehener 31-jähriger Romanschriftsteller war, der bis über beide Ohren in Drogentrabbel steckte. Er hatte 1962 Einer flog über das Kuckucksnest herausgebracht (aus dem er dann 1963 ein Theaterstück gemacht hatte) und dann 1964 Manchmal ein großes Verlangen. Er wurde in einem Atemzug mit Joseph Heller, Philip Roth, Bruce Jay Friedman und einigen anderen jungen Romanciers genannt, von denen man sicher war, sie würden eines Tages zu den ganz Großen zählen. Dann war er zweimal wegen Drogenbesitz – Marihuana – verhaftet worden, im April 1965 und im Januar 1966, war dann nach Mexiko abgehauen, um der gesalzenen Strafe zu entgehen, die ihn womöglich erwartete. Bei ihm als Wiederholungstäter hatte das gut und gerne nach fünf Jahren ausgesehen. Eines Tages bekam ich zufällig einige Briefe in die Hand, die Kesey seinem Freund Larry McMurtry aus Mexiko geschrieben hatte – von dem stammt der Roman Der Wildeste unter Tausend, die Vorlage für den Paul-Newman-Film Hud. Die Briefe barsten vor Ironie und waren total überdreht; sie lasen sich wie eine Mischung aus George Ade und William Burroughs, erzählten von Verstecken, Verkleidungen, Paranoia, der Flucht vor der Polizei, von Marihuana und der Suche nach dem Satori, der Erleuchtung, in den Rattengebieten von Mexiko. Es gab da eine Passage im Stil von George Ade, in der dritten Person geschrieben, als Parodie auf das, was die normale Borniwelt daheim in den Vereinigten Staaten jetzt von ihm denken musste:
»Um es kurz zu machen, dieser junge, gut aussehende, erfolgreiche und glücklich verheiratete Vater dreier lieber Kinder war ein von Ängsten getriebener Rauschgiftsüchtiger auf der Flucht, durch die er sich der gerechten Strafe zu entziehen suchte, die ihn wegen dreier schwerer Verbrechen und, Gott weiß, wie vieler anderer Delikte erwartete; eine Flucht, auf der er sich aus einer uralten Brandung auch gleich noch ein neues Satori zu formen gedachte – noch kürzer gesagt: der Mann war völlig übergeschnappt.
War er einst ein Athlet gewesen, dessen Ruf ihm gar einen Job als Linienrichter eingebracht hatte, ein Sportler, der sich mit der Elite der amerikanischen Ringer um den Titel balgen durfte, so wusste er jetzt nicht einmal mehr, ob er ein Dutzend Liegestütze zusammenbekam. Einst der Inhaber eines stattlichen Bankkontos, der die Taschen voll Geld gehabt hatte, konnte seine arme Frau jetzt zusehen, wie sie acht Dollar zusammenkratzen sollte, die sie ihm als Fluchtgeld nach Mexiko zu schicken hatte. Und dieser junge Mann, den man erst vor wenigen Jahren in das Who’s Who aufgenommen und als Gastredner so erlauchter Zusammenkünfte wie der Jahresversammlung des feinen Wellesley Clubs in Dah-la geschätzt hatte, diesen Mann hätte man jetzt noch nicht einmal mehr auf einer Versammlung des VDC (Vietnam Day Committee) hören wollen. Wie konnte ein so vielversprechender junger Mann in so kurzer Zeit so tief in Elend und Schande versinken? Nun, die Antwort darauf lässt sich in einem einzigen kurzen Wort finden, meine Freunde, in einer einzigen nur allzu bekannten Silbe: ›Dope!‹
Und selbst wenn einige dieser irregeleiteten Befürworter derartiger Chemikalien ins Feld führen wollen, dass dieser Mann bereits vor seinem literarischen Durchbruch dem Drogenkonsum verfallen gewesen sei, so sei hier eines vermerkt: Seine literarische Potenz hatte sich schon lange vor dem Eintritt des sogenannten psychedelischen Elements in sein Leben gezeigt, nur waren vor diesem Zeitpunkt nicht die geringsten Anzeichen für die Art von schwachsinnigem Gedankengut zu sehen gewesen, das wir seither bei ihm konstatieren.«
Dazu hatte er noch hinzugefügt:
»(oh, jajaaa, säuselt der Wind vor langer Zeit, vor langer Zeit – die Balken knarren und die Wände haben Augen … und es gibt eine Tür zu diesem Vogel in dem ju-hungfreulichen Himmel vor langer Zeit oh, jajaaa, kichert die Brandung vor langer Zeit, vor langer Zeit flüstert von tiefen Dingen, die man gemordet, als man das Böse bannte, und damit alle Türen zu den Vögeln verschloss vor langer Zeit.)«
Mir kam damals der Gedanke, nach Mexiko zu gehen, um ihn aufzustöbern und einen Artikel in der Art Junger-Romancier-auf-der-Flucht zu schreiben. Ich begann, mich umzuhören, wo er sich wohl in Mexiko aufhalten könnte. Zum Glück wusste in der New Yorker Szene damals jeder ganz genau, wo er steckte. Es war wohl das schicke Geheimnis jenes Sommers; man hatte es einfach zu wissen. Er ist in Puerto Vallarta. Er ist in Ajijic. Er ist in Oaxaca. Er ist in San Miguel de Allende. Er ist in Paraguay. Er hat gerade einen Dampfer von Mexiko nach Kanada genommen. Und jeder wusste es natürlich aus erster Hand.
Ich war immer noch dabei, mich umzuhören, als Kesey sich im Oktober wieder in die Vereinigten Staaten zurückschlich und auf der Küstenstraße südlich von San Francisco vom FBI gekascht wurde. Ein Beamter jagte die Straßenböschung hinab hinter ihm her, bekam ihn zu fassen, und man sperrte ihn ein. Also flog ich nach San Francisco. Ich ging ohne Umweg zum Bezirksgefängnis des San Mateo County in Redwood City, und die Szene im dortigen Warteraum ähnelte eher dem, was sich normalerweise am Bühneneingang auf der Rückseite des Music Box Theatre in New York abspielte. Es herrschte eine Atmosphäre freudiger Erwartung. Ich traf dort auch einen jungen Psychologen, Jim Fadiman, den Neffen von Clifton Fadiman, wie sich herausstellte; Jim und seine Frau Dorothy waren stillvergnügt dabei, drei I Ging-Münzen in den Buchrücken eines ewig dicken Schmökers über orientalische Mystik zu praktizieren; sie baten mich, Kesey doch irgendwie wissen zu lassen, dass die Münzen da drinnen waren. Mit von der Partie war außerdem noch eine mondgesichtige Brünette namens Marilyn, die mir erzählte, dass sie als Teenager Groupie gewesen und mit den Wild Flowers, einer Rock’n’ Roll-Band, befreundet gewesen war; jetzt ging sie aber so gut wie ausschließlich mit Bobby Petersen. Nein, Bobby Petersen sei kein Musiker. Nach dem zu urteilen, was sie so erzählte, war er eine Art Heiliger. Er saß unten in Santa Cruz in U-Haft und versuchte sich gegen eine Klage wegen Drogenbesitzes – Marihuana – mit dem Argument zu verteidigen, er rauche Marihuana aus religiösen Gründen, für ihn sei es ein Sakrament.
Ich kam nicht ganz dahinter, was sie unter diesen Umständen im Wartezimmer des Gefängnisses vom San Mateo County zu suchen hatte, außer eben, dass, wie ich schon sagte, das Ganze hier ohnehin ziemlich nach einem Bühneneingang aussah, wo man auf Kesey, den Star, wartete, der noch drinnen war.
Ich hatte Knatsch mit den Wärtern, weil sie mich nicht zu Kesey lassen wollten. Es brachte den Bullen ja schließlich nichts ein, wenn sie mich mit ihm reden ließen. Ein Reporter aus New York – das bedeutete doch bestenfalls noch mehr Reklame für diesen in den Himmel gehobenen Beatnik. Genau das war Kesey für sie: nichts als ein besserer Beatnik, den man wegen zweier Drogenklagen am Wickel hatte. Und warum sollte man sich aus dem einen Helden machen lassen? Ich muss dazu sagen, dass Kalifornien wirklich fesche Bullen hat. Alle scheinen sie hier jung zu sein und hochgewachsen, blond, mit babyblauen Augen, so als wären sie eben aus einer Zigarettenreklame gestiegen. Ihre Gefängnisse sehen nicht aus wie Gefängnisse, zumindest nicht das, was man von ihnen als Normalbürger zu sehen bekommt. Helle Holztäfelung ist alles, was sie einem zeigen, Leuchtstoffröhren, sandfarbene Metallverkleidungen, die an Aktenschränke erinnern; man kommt sich vor wie im Prüfungsraum für Beamtenanwärter in einem neuen Postverwaltungsgebäude. Die Bullen selbst, adrett und korrekt wie frische Eiswürfel, haben einen cremigen kalifornischen Akzent. Und korrekt wie sie sind, ließen sie mich schließlich auch während der Besuchszeit zu Kesey. Ich hatte zehn Minuten. Zum Abschied winkte ich Marilyn und den Fadimans, der ganzen ausgelassenen Szene vor der Treppe, noch einmal zu; dann brachte man mich in einem Aufzug hinauf in den zweiten Stock.
Der Aufzug öffnet sich, und wir stehen in einem kleinen Besuchszimmer. Es ist irgendwie ulkig. Ich sehe eine Reihe von vier oder fünf kleinen Kabinen, die mich an die schalldichten Kabäuschen erinnern, die man früher im Fernsehen bei Quizshows sah; jede Kabine war mit einer dicken Glasscheibe versehen, und hinter jedem Fenster sitzt ein Häftling im knastblauen Arbeitshemd. Sie hocken da wie auf Eis gelegte Schellfische. Vor jedem Fenster gibt es eine kleine Theke, auf der ein Telefon steht. Mit dessen Hilfe unterhält man sich hier. Ein paar Besucher sitzen bereits da, tief über diese Dinger gebeugt. Dann erspähe ich Kesey.
Er steht da, die Arme vor der Brust verschränkt und den Blick auf irgendeinen Punkt in der Ferne gerichtet, d. h. er starrt gegen die Wand. Er hat dicke Handgelenke und mächtige Unterarme, und die Art, wie er sie verschränkt hält, lässt sie gigantisch aussehen. Er sieht größer aus, als er in Wirklichkeit ist, vielleicht wegen seines Nackens. Er hat einen gewaltigen Nacken, und seine Sternocleidomastoideus-Muskeln wachsen ihm aus dem Gefängnishemd wie ein Paar Schiffstaue. Kiefer und Kinn sind massiv. Er sieht ein bisschen wie Paul Newman aus, nur dass er viel muskulöser ist, eine dickere Haut hat und ihm dicke blonde Locken um den Kopf wuchern. Obendrauf ist er dagegen schon fast völlig kahl, aber irgendwie passt das gut zu seinem mächtigen Nacken und der allgemeinen Preisringererscheinung. Schließlich lächelt er ein wenig. Es ist komisch, aber in seinem Gesicht ist nicht eine einzige Falte zu sehen. Nach all den Verfolgungsjagden und dem Theater mit der Polizei sieht der Mann aus, als hätte er gerade drei Wochen in einem Kurbad hinter sich; heiter und gelassen, ehrlich.
Dann nehme ich meinen Telefonhörer, und er nimmt den seinen, und das Ganze ist wie eine Szene aus Moderne Zeiten. Wir sind kaum einen halben Meter voneinander entfernt, aber uns trennt eine Glasscheibe von der Stärke eines Telefonbuchs. Wir könnten ebenso gut in verschiedenen Kontinenten sitzen und uns über ein Videotelefon unterhalten. Im Apparat knistert es fürchterlich, und der Ton ist miserabel, besonders wenn man bedenkt, dass der halbe Meter, den es hier zu überbrücken gilt, nun wirklich nicht die Welt ist. Selbstverständlich ging man davon aus, dass die Polizei alle Gespräche mithörte. Ich wollte ihn über seine Tage auf der Flucht in Mexiko befragen. Der Titel meiner Story lautete immer noch: Junger Romancier acht Monate auf der Flucht in Mexiko. Aber auf all das konnte er über diese bizarre Verbindung wohl kaum näher eingehen, und außerdem hatte ich ja nur zehn Minuten. Ich packe meinen Notizblock aus und fange an, ihm Fragen zu stellen – einfach querbeet. In der Zeitung hatte gestanden, er hätte gesagt, es wäre an der Zeit, dass die psychedelische Bewegung »über LSD hinauswachse«, sich »jenseits des Acid« begebe. Das sollte er gesagt haben, also fragte ich ihn danach. Dann fing ich an, wie ein Verrückter in Kurzschrift in mein Notizbuch zu kritzeln. Ich konnte sehen, wie sich einen halben Meter von mir entfernt seine Lippen bewegten. Seine Stimme knackte über die beknackte Leitung, als käme sie aus Brisbane. Das Ganze war völlig verrückt. Es war, als machten wir zusammen Gesichtsgymnastik.
»Meiner Ansicht nach«, sagte er, »ist es an der Zeit, die Reifeprüfung abzulegen, das, was bisher passiert ist, abzuschließen, darüber hinauszugehen, zu was Neuem vorzudringen. Die psychedelische Welle begann vor sechs oder acht Monaten, als ich nach Mexiko ging. Sie ist in der Zwischenzeit zwar enorm gewachsen, aber sie hat sich nicht weiterentwickelt, sie tritt auf der Stelle. Das was ich gesehen habe, als ich zurückgekommen bin, ist das Gleiche wie das, was ich gesehen habe, als ich wegging. Es ist alles nur größer, das ist alles -« Er spricht leise und mit dem beinahe astreinen Akzent des Menschen vom Land. Und über die zwei Fuß lange Leitung kracht und raspelt es, als reibe sich einer Parmesan über unser Gespräch; und er redet und redet:
»… es ist nichts Kreatives passiert«, sagt er, »und ich glaube, mein Beitrag wird darin bestehen, den nächsten Schritt vorzubereiten. Ich glaube nicht, dass wir eine Bewegung weg von den Drogen kriegen, solange es nicht auch etwas gibt, auf das wir uns zubewegen können …«
- und all das in einem einfachen ländlichen Akzent und über irgendetwas, von dem ich – ich will mal ehrlich sein – verdammt noch mal kein einziges Wort kapiere. Dazwischen immer wieder irgendwelches Kryptozeugs, obskure Aphorismen. Ich sage ihm, dass ich gehört hätte, er wolle nicht mehr schreiben. Warum?
»Ich bin lieber Blitzableiter als Seismograph«, sagte er.
Er sprach über etwas, das er »Acidtest« nannte, und über Ausdrucksformen, in denen es keine Trennung mehr zwischen ihm und seinem Publikum geben würde. Alles würde zu einer einzigen großen Erfahrung verschmelzen, bei der alle Sinne weit offen sein müssten: Worte, Musik, Licht, Klänge, Berührungen – Blitze.
»Meinen Sie so etwas in der Art, wie es Andy Warhol in New York macht?«, fragte ich ihn.
… Pause … »Ich will euch ja nicht zu nahe treten«, meint Kesey schließlich, »aber New York ist mindestens zwei Jahre hintendran.«
Das sagt er mit unendlicher Geduld, mit einer Art Höflichkeit, wie man sie tatsächlich zuweilen auf dem Land findet, so als ob … ich will ja nicht unhöflich sein zu euch Jungs aus der Stadt, aber hier bei uns herüben sind einige Sächelchen abgelaufen, auf die würdet ihr in euren kühnsten Träumen nicht kommen, nicht in’ner Million Jahre, Alter, das sage ich dir …
Meine zehn Minuten waren abgelaufen, und schon stand ich wieder vor der Tür. Ich hatte nichts erreicht außer meiner ersten Berührung mit einem merkwürdigen Phänomen, jenem seltsamen hinterwäldlerischen Charisma, der Kesey-Präsenz. Ich hatte nichts anderes zu tun, als die Zeit totzuschlagen und zu hoffen, dass Kesey irgendwie gegen Kaution auf freien Fuß kommen würde, damit ich mich weiter mit ihm unterhalten konnte, um weitere Einzelheiten für Flüchtig in Mexiko zu erfahren. Dies schien zu diesem Zeitpunkt jedoch verdammt viel verlangt, denn immerhin hatte Kesey zwei Marihuanaklagen am Hals und sich außerdem schon einmal über die Grenze hinweg aus dem Staub gemacht.
Also mietete ich mir einen Wagen und fing an, in San Francisco herumzugondeln. Komischerweise sind meine stärksten Erinnerungen an San Francisco diejenigen, wie ich in meinem gemieteten Wahnsinnsschlitten die Hügel der Stadt hinauf- oder hinunterröhre, auf die Schienen der Kabelbahn gleite und wieder herunter; wie ich zum North Beach hinunterschippere, dem legendenumwobenen North Beach, der altehrwürdigen Heimat der Westküstenboheme: Haufenweise hatten hier große Namen wie Big-Daddy-was-weiß-ich abgehangen; der ernsthafte Bohemien deckte sich nach wie vor bei Cost Plus Imports mit Handgewerkeltem aus aller Welt ein, und die langhaarige kleine Ostküstenprotestantin oder die knackige kleine Jüdin trieb es feste mit jungen und hippen Briketts. Aber jetzt lag der North Beach bereits in den letzten Zügen. Es war letztlich nur noch eine Anhäufung von Stripschuppen. Im berühmten Hauptquartier der Beat Generation, dem City Lights Bookstore, hockte Shig Murao, der japanische Wichtigtuer vor Ort, mit finsterer Miene herum, und der Bart, der ihm aus dem Gesicht stand, sah aus wie Stechginster und Farn auf der Planzeichnung eines Architekten. Mit gebeugten Schultern hing er neben der Ladenkasse über einer Gesamtausgabe von Kahlil Gibran, während eine zu einem Kongress in die Stadt gekommene Ladung spesenritternder Kassenzahnärzte zwischen zwei Stripeinlagen auf der Suche nach den legendären Beatniks in seinem Laden die Schmöker befingerten. Das Topless war jetzt die Attraktion: Oben-ohne am North Beach mit Stripperinnen, die sich ihre Brüste mit Silikoninjektionen aufpumpten.
Die Action, das heißt die hippen Cliquen, die hier ursprünglich den Ton angegeben hatten, diese Action war jetzt samt und sonders nach Haight-Ashbury umgesiedelt. In kürzester Zeit würden sich auch dort die Leithammel etablieren, die zu jeder erfolgreichen Boheme gehören, und kolonnenweise würden Autos voll gaffender Touristen Stoßstange an Stoßstange das Viertel durchkreuzen, und natürlich würden die Busse von der Stadtrundfahrt nicht fehlen: »Und hier befinden wir uns … dem Zuhause der Hippies … dort drüben sehen Sie übrigens gerade einen«, und dann würden auch die Schwulen und die schwarzen Nutten, die Buchhandlungen und Boutiquen hier ihren Einzug halten. Haight-Ashbury und die LSD-Schlucker, die Acid Heads, waren der letzte Schrei.
Aber nicht nur der North Beach lag im Sterben. Das ganze hippe Leben alten Stils – Jazz, Kaffeehäuser, Bürgerrechte (›Lad-ein-Brikett-zum-Dinner-ein‹), Vietnam, das alles war mit einem Mal moribund, wie ich feststellen musste; sogar bei den Studenten von der Universität in Berkeley, die auf der anderen Seite der Bucht San Francisco gegenüberliegt, und die das Herz der »Studentenrebellion« gewesen war, und so weiter. Es war schon so weit gekommen, dass es in der hippen Szene noch nicht einmal mehr Schwarze gab; nicht einmal mehr als Galionsfiguren oder Alibis. Es war unglaublich: Schwarze, Briketts, die eigentliche Seele all dessen, was Hip-sein bedeutete, des Jazz, der ganzen hippen Sprache: »man« und »like« und »dig« und »baby« und »scarf« und »split« und »later« und »so fine«, die Seele der Bürgerrechtsbewegung und dessen, was es bedeutete, als braves erzamerikanisches Töchterlein mit dem Abschluss einer piekfeinen Mädchenschule wie dem Reed College in der Tasche am North Beach oder unten in der Mason Street einzuziehen und es mit Schwarzen zu treiben; all das ausgefeilte Händeschütteln, Betatschen und Schulterklopfen, der gute alte Brauch, eimerweise seine Seele über den Briketts auszukippen – alles aus, vorbei, einfach unglaublich.
So begann ich also, den Trends hinter all dem Auf und Ab, den Zuckungen der Bohemeszene San Franciscos auf die Schliche zu kommen. In der Zwischenzeit – es grenzte fast an ein Wunder – waren Keseys drei junge Anwälte – Pat Hallinan, Brian Rohan und Paul Robertson – so weit, Kesey gegen Kaution freizubekommen. Sie versicherten den Richtern des San Mateo County sowie denen in San Francisco, dass Herr Kesey ein dem Wohle der Öffentlichkeit äußerst dienliches Projekt im Auge hätte. Er sei mit der ausdrücklichen Absicht aus seinem Exil zurückgekehrt, in der Winterland Arena von San Francisco ein gigantisches Treffen aller Heads und Hippies einzuberufen, um DEM JUGENDLICHEN zu sagen, er solle die Finger vom LSD lassen, weil das ganz, ganz gefährlich sei und ihm davon womöglich das bisschen Grips im Hirn schmolz. Es sollte eine richtige Zeremonie werden, bei der sich alle feierlich vom LSD lossagen sollten: eine Art Reifeprüfung. Sie sollten sich ihr Leben »jenseits vom Acid« einrichten. Das war wohl genau das, wovon Kesey auch mir gegenüber gesprochen hatte, nehme ich an. Zur gleichen Zeit gaben sechs von Keseys engsten Freunden aus der Gegend von Palo Alto ihre Häuser als Sicherheit für eine Gesamtsumme von 35 000 Dollar Kaution, die am Bezirksgericht von San Mateo hinterlegt werden sollte. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Richter ausrechneten, dass sie Kesey damit so oder so am Wickel hatten. Wenn er sich jetzt, während er auf Kaution draußen war, aus dem Staub machte, dann wäre das ein derart mieses Verhalten gegenüber seinen Freunden – es würde sie immerhin ihr Zuhause kosten -, dass Kesey als Drogenapostel oder was auch immer ein für alle Mal unten durch wäre. Und wenn er nicht stiften ging, dann hatte er sich schließlich verpflichtet, mit DEM JUGENDLICHEN zu sprechen – und das wäre noch besser. Wie auch immer, was zählte war, dass Kesey auf dem Weg in die Freiheit war.
Dieses Szenario war in Haight-Ashbury selbst jedoch nicht allzu populär. Ich fand schnell heraus, dass die Szene der Heads in San Francisco schon zu einer derart umfangreichen Bewegung geworden war, dass Keseys Rückkehr und sein Plan, sich vom Acid loszusagen, unter den Heads die erste große politische Krise ausgelöst hatte. Alle Augen waren jetzt auf Ken Kesey und seine Truppe gerichtet, die unter dem Namen The Merry Pranksters – Die lustigen Schelme – firmierte. Tausende von jungen Leuten zogen nach San Francisco, um ein Leben zu führen, das auf LSD und dem ganzen psychedelischen »Ding« basierte. »Ding« war das wichtigste abstrakte Wort in Haight-Ashbury. Es konnte einfach alles bedeuten: Ismen, Lebensstile, Gewohnheiten, Neigungen, Sachen, für die man sich engagierte oder einfach Fortpflanzungsorgane. »Ding« und »Freak«! »Freak« bezog sich auf Stile und Obsessionen, so wie in »Stewart Brand ist ein Indianerfreak« oder »die Welt der Tierkreiszeichen – das ist ihr freak«; oder es bezog sich einfach auf einen Head in voller Montur. Das Wort hatte dabei keinerlei negative Konnotationen. Wie auch immer, die Heads hatten einige Wochen zuvor im Golden Gate Park, am Fuße des Hügels, auf dem Haight-Ashbury liegt, ihr erstes großes »Be-in« abgehalten. Dahinter steckte der ironische Gedanke, eine Gedenkfeier anlässlich des Tages abzuhalten, an dem man LSD in Kalifornien zur illegalen Substanz erklärt hatte. Hier hatten sich alle »Stämme« versammelt, alle Gruppen der Stadt. Alle Freaks kamen und machten ihr »Ding«. Ein Head namens Michael Bowen hatte die Kiste organisiert, und Tausende von Heads kamen zusammen, alle in ihren Kostümen, mit klingelnden Glöckchen, singend, ekstatisch tanzend, und dröhnten sich auf die eine oder andere Weise zu; sie zeigten den Bullen ihre satirischen Lieblingsgesten, reichten ihnen Blumen, begruben die Mistkerle unter saftigen Blütenblättern, die vor Liebe nur so troffen. Oh Mann, Tom, das Ding war einfach absolut irre, der absolute Kurzschluss: Tausende von drogenverliebten Heads waren gekommen und brachten den Bullen das Staunen bei; und jeder fühlte sich wie auf einer Fiesta der Liebe und der Euphorie. Sogar Kesey, der damals noch auf der Flucht gewesen war, hatte sich hergewagt und eine Zeit lang unter die Menge gemischt, und dann waren plötzlich alle eins, Kesey eingeschlossen – und jetzt kommt er aus heiterem Himmel daher, in den Klauen des FBI und anderer Superbullen, er, Kesey, der Name in unserem Leben, und gibt die Parole aus, es sei an der Zeit, die Reifeprüfung abzulegen und sich vom LSD loszusagen. Was soll denn das? Will er sich auf einmal feige abseilen, oder was ist da los? Die Stoppt-Kesey-Bewegung bekam auf einmal sogar Anhänger innerhalb der hippen Szene.
Wir schippern in unserem abgefahrenen Laster am LAGERHAUS vor und – nun, zunächst einmal fange ich an zu kapieren, dass Leute wie Lois und Stewart und Black Maria durchaus den gesetzteren, kopflastigeren Teil der Merry Pranksters darstellen. Das LAGERHAUS steht in der Harriet Street zwischen Folsom und Howard. Wie fast das gesamte übrige San Francisco ist auch die Harriet Street eine Ansammlung von weiß gestrichenen Holzgebäuden mit Erkerfenstern. Aber sie liegt mitten im Vergnügungsviertel von San Francisco, und trotz all der Farbe sieht es hier aus, als wären vierzig Säufer in den Schatten gekrochen, krepiert, schwarz geworden, aufgedunsen und explodiert – und als hätten sie dabei einen solchen Schwall von Korkenzieherbakterien in die Gegend geschleudert, dass die in jedes einzelne Brett dieser Straße gefahren waren, in jede einzelne Latte, jeden Spalt, jeden Splitter und jede einzelne fleckige Farbflocke. Das LAGERHAUS selbst entpuppt sich als eine Garage im Erdgeschoss eines verlassenen Hotels. Zuletzt kommerziell genutzt hatte die Räumlichkeiten eine Großbäckerei. Wir fahren an die Garage heran und sehen direkt davor einen Lieferwagen stehen, der in blauer, gelber, oranger und roter DayGlo-Leuchtfarbe bemalt ist; auf der Kühlerhaube prangt in riesigen Lettern ein BAM. Aus dem schwarzen Loch, das in die Garage führt, tönt einer der säbelbeinigen Urzeitgesänge Bob Dylans, unverkennbar mit seiner obszön lechzenden Mundharmonika und der vernuschelten Stimme – ein Ernest Tubb mit Katarrh …
Wir betreten einen riesigen chaotischen Raum, in dessen Halbdunkel sich auf den ersten Blick gut zehn bis fünfzehn amerikanische Flaggen umherzubewegen scheinen. Das Ganze entpuppt sich als eine Gruppe von Männern und Frauen, die meisten von ihnen zwischen zwanzig und dreißig, in weißen Overalls von der Art, wie sie das Bodenpersonal auf Flugplätzen trägt, nur dass man auf diese hier Teile der amerikanischen Flagge genäht hatte, zumeist Sterne auf blauem Hintergrund, aber bei einigen laufen auch rote Streifen die Beine hinab. An den Wänden stehen eine Menge Bühnengerüste, über die man Decken geworfen hat, als wären es Vorhänge, und dazwischen stapeln sich, gegen die Wände gelehnt, ganze Reihen entwurzelten Theatergestühls und große Kuben voller Metallabfälle, und an der Decke sieht man die Stahlträger; von ihnen hängen Seile herab.
Eine der als Vorhänge dienenden Decken bewegt sich zur Seite, und eine kleine Gestalt springt von einer gut drei Meter höher gelegenen Plattform. Die Gestalt leuchtet. Es ist ein junger Typ, ungefähr einsfünfzig groß, mit einer Art Fliegerhaube aus dem Ersten Weltkrieg auf dem Kopf … seine Klamotten sind über und über mit leuchtenden grünen und orangefarbenen Schnörkeln bemalt; er glüht richtiggehend, sogar seine Stiefel. Es sieht wirklich so aus, als hüpfe er auf einem Paar fluoreszierender Riesenkaugummikugeln zu uns herüber. Bei uns angekommen, bleibt er stehen. Er hat ein schmales, fein geschnittenes Asketengesicht, einen mächtigen Schnurrbart und riesige Augen. Die Augen verengen sich zu Schlitzen, und sein Gesicht fällt in ein verschmitztes Grinsen.
»Ich hab da oben grad’n achtjährigen Jungen gehabt«, sagt er.
Worauf er in ein schniefendes Gickeln verfällt und mit Riesenschritten, wie ein Glühwürmchen leuchtend, zu einer der Ecken hinüberspringt, mitten in den Schutt hinein. Alle lachen. Das Ganze ist wohl irgendein Witz für Eingeweihte. Zumindest bin ich der Einzige, dessen Blick die Gerüste nach den Überresten eines kleinen Jungen absucht.
»Das ist der Einsiedler.« Drei Tage später sehe ich, dass er sich hinten in der Ecke eine Höhle gebaut hat.
In der Mitte der Garage steht ein riesiges leuchtendes Ungetüm: Ich erkenne einen Schulbus, der in allen nur denkbaren Pastelltönen leuchtet, die ihn in Tausenden von großen und kleinen Mustern überziehen: Orange, Grün, Purpurn, Lila, Chlorblau, das Ganze sieht aus wie eine Kreuzung aus Fernand Léger und Dr. Strange; die Farben branden tosend gegeneinander an und bringen sich gegenseitig zum Vibrieren – als hätte irgendein Witzbold Hieronymus Bosch einen 1939er International Harvester-Schulbus und 50 Eimer DayGlo hingestellt: Hier, mach was draus! Auf dem Boden vor dem Bus arbeiten zwei oder drei der Sternenbannerleute an einem gut fünf Meter langen Transparent, auf dem ich ACIDTEST-REIFEPRÜFUNG lese. Unter dem katarrhverdächtigen Ächzen von Dylans Bocksgesängen herrscht ein heilloses Durcheinander. Irgendwo greinen ein paar Säuglinge; ich kann sie zwar nicht sehen, aber sie sind irgendwo in dem riesigen Raum und heulen. Etwas abseits steht ein Typ um die vierzig mit gewaltigen Muskeln, die jeder sofort zu sehen kriegt, da er kein Hemd anhat – nur Khakihosen und rote Lederstiefel, ein Kerl mit einem Wahnsinnskörper, der sich in einer Art kinetischer Trance zu befinden scheint: Er lässt nämlich einen kleinen Vorschlaghammer hoch in die Luft sausen, den er immer wieder am Stiel zu fassen kriegt, wenn er geschossen kommt; dabei stößt er pausenlos mit den Armen und Beinen um sich, rollt mit den Schultern und nickt mit dem Kopf, und das alles in einem ganz eigenen zuckenden Rhythmus – als laufe irgendwo im Raum Joe Cubas »Bang Bang«, wo doch plötzlich nicht einmal mehr Bob Dylan zu hören ist, und aus einem Lautsprecher, den ich nirgendwo entdecken kann, eine geisterhafte Spektralstimme vom Tonband tönt:
»Die Nirgendwo-Mine … wir fördern Stanniolpapier für Kaugummi …« – im Hintergrund irgendeine bizarre elektronische Musik mit orientalischen Intervallen, der Musik Juan Carillos nicht unähnlich – »… wir entreißen es dem Bauch der Erde … wir, die Kumpel der Nirgendwo-Mine … heute, jeden Tag …«
Einer der Flaggenleute kommt herüber.
»Hey, Mountain Girl! Das is’ ja irre!«
Mountain Girl ist ein hochgewachsenes Mädchen, kräftig gebaut und hübsch, mit dunkelbraunem Haar, das ihr über die Schultern herabfällt, das heißt, dunkelbraun ist nur das obere Drittel, die unteren beiden Drittel sehen aus wie ein in Cadmiumgelb getauchter Farbpinsel, weil sie sich die Haare blond gefärbt hat, als sie das letzte Mal in Mexiko war. Sie dreht sich auf dem Absatz um und zeigt uns den Kreis aus Sternen auf dem Rücken ihres Overalls.
»Die ham wir in einem Uniformladen gekauft«, erzählt sie uns. »Sind die nicht klasse? Da war so ein alter Zausel im Laden und der jammert: ›Aber ihr wollt die Fahnen doch hoffentlich nicht zerschneiden und euch Kostüme draus machen, oder?‹, und ich sag zu ihm: ›Neeiiin, wir besorgen uns noch Pauken und Trompeten, und dann veranstalten wir’ne Parade. Aber schaut euch mal das hier an! Deswegen ham wir die überhaupt erst gekauft.«
Sie deutet auf einen Ansteckknopf, den sie an ihrem Overall befestigt hat. Alle lehnen sich vor, um zu sehen, was es damit auf sich hat. Am unteren Rand des Knopfes ist in Jugendstil-Lettern ein Spruch eingraviert: ›Nicht klein zu kriegen.‹ Der Werbeslogan der Fahnen.
Nicht klein zu kriegen! … einfach Wahnsinn, dieser Spruch. Unzählige Male waren sie schon eingebuchtet worden, die Pranksters: von den Bullen des San Mateo County, den Bullen in San Francisco, den Bullen von der Mexicale Federale, von den FBI-Bullen, von Bullen, Bullen, Bullen und noch mal Bullen … nicht klein zu kriegen … der blanke Wahnsinn.
Und immer noch sind die Babys am Greinen. Mountain Girl wendet sich an Lois Jennings.
»Was machen denn die Indianer, damit ihre Bälger zu schreien aufhören?«
»Sie halten ihnen die Nase zu.«
»Echt?«
»Mit der Zeit kapieren sie’s dann.«
»Das probier ich mal … klingt schon irgendwie logisch …« Worauf Mountain Girl zu ihrem Baby, einem vier Monate alten Mädchen namens Sunshine, hinübergeht, es aus seiner tragbaren Krippe nimmt und sich mit ihm in einen der Theatersitze setzt. Aber anstatt das Mädchen der Indianerbehandlung auszusetzen, knöpft sie sich ihren ›Nicht-klein-zu-kriegen‹-Overall auf und beginnt es zu stillen.
»Die Nirgendwo-Mine … kein Gefühl, kein Geschrei, kein Geheule …« Brä-äng, twi-ing »… und ging zurück in die Nirgendwo-Mine …«
Wieder lässt der Hammerjongleur seinen Hammer in die Luft sausen...
»Wer ist denn eigentlich der da?«
»Das ist Cassady.«
Das kommt mir fast wie ein Wunder vor. Ich weiß schließlich verdammt gut, wer Cassady ist. Cassady, Neil Cassady, der Held »Dean Moriarty« aus Jack Kerouacs Unterwegs, der junge Schlurf aus Denver, der den ganzen Roman hindurch in irgendwelchen Autos kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten rast, immer hinter dem Leben her oder auf der Flucht vor ihm, wer will das schon sagen. Und jetzt steht er hier – wie er leibt und lebt – hat inzwischen gut seine vierzig Jährchen auf dem Buckel -, steht in dieser Garage, wirft mit einem Hammer um sich, verrenkt sich das Gestell im Rhythmus der Joe-Cuba-Combo in seinem Kopf und … quasselt dabei in einer Tour vor sich hin. Cassady ist ein gnadenloser Redner. Aber so eng sollte man das vielleicht gar nicht sehen. Cassady ist der König des Monologs, und es ist ihm Jacke wie Hose, ob er dabei Publikum hat oder nicht. Er steigt in seinen Monolog wie in eines der zahllosen Autos, die er in seinem Leben gefahren hat, und schon ist er auf und davon, auch allein, wenn es sein muss, obwohl ihm durchaus jedermann an Bord willkommen ist. Er antwortet einem sogar gerne auf all die Fragen, die einem so in den Sinn kommen, wenn auch nicht unbedingt in der Reihenfolge, in der man ihm diese stellt, und zwar, weil wir hier noch nicht anhalten können, verstehste, bis zur nächsten Raststätte sind es nämlich noch mindestens vierzig Meilen, verstehste, und spult dabei seine Erinnerungen ab, unzählige Metaphern, literarische, orientalische und hippe Anspielungen quellen aus ihm heraus und statt Punkt und Komma immer wieder die jeden Sinnes beraubte und ziemlich unwahrscheinliche Formel »verstehste« -
2 DAS BLASENTOTEM
So ging das die ganzen zwei oder drei Tage, die ich mit den Merry Pranksters in der Garage auf Kesey wartete. Die Pranksters schienen sich durch meine Anwesenheit nicht weiter stören zu lassen. Eine Blondine, die zu den Sternenbannerleuten gehörte – sie sah aus wie Doris Day, wurde jedoch Doris Delay genannt -, deutete an, ich sollte doch etwas mehr … na ja, Farbe in mein Erscheinungsbild bringen. Das tat weh, Doris Delay, aber ich weiß ja, es war lediglich als freundliche Anregung gedacht. Nein wirklich, sie wollte mir damit sicher nicht zu nahetreten. Ich für mein Teil behielt meine Krawatte an, um zu zeigen, dass ich auch meinen Stolz hatte. Aber keiner scherte sich drum. Also lungerte ich einfach weiter dort rum, während Cassady seinem Hammer Saltos beibrachte und Spektralmusik vom Band lief; Babys plärrten, Nippel wurden freigelegt; der Bus leuchtete, menschliche Sternenbanner wuselten herum und Freaks liefen ein, drehten eine Runde und schlurften wieder zurück ins Sonnenlicht der alten Harriet Street. Und mir blieben nur ein paar Stunden, um zu schlafen oder mir eine Toilette suchen zu gehen.
Die Toilette; tja. Kein Klempner hatte sich je in das alte Lagerhaus verirrt, und es gab noch nicht mal kaltes Wasser. Man konnte entweder rausgehen, auf das leere Nachbargrundstück, und hinter einem Bretterzaun inmitten der bereits in großen luftig-duftigen Schwaden über den Dreck dahindunstenden Menschenpisse Stellung beziehen; oder man kletterte eine Leiter hinauf und verschwand durch eine Luke, die in das krätzige alte Hotel führte, wo längst verlassene, ehemals von Pennern bevölkerte Korridore von Räumen gesäumt wurden, deren schwammige Holzbestandteile vom bloßen Hinsehen zu bröseln begannen – und zu krabbeln vor Ungeziefer und larvig verpupptem Getier. Selbst den Pranksters war das zu ranzig. Die meisten von ihnen gingen zur Shell-Tankstelle an der Kreuzung. Also marschierte ich los zur Shell-Tankstelle, Ecke Sixth und Howard. Ich fragte nach den Toiletten, und der Typ dort verpasst mir DEN BLICK – diesen mörderischen Blick mit dem eingebauten Ja ja, tanken tunse nich bei mir, aber auf mein Kloster wollnse – und dann deutet er durchs Fenster auf die Blechdose im Büro. Der Schlüssel zum Klo ist an eine große leere Shell-Öldose gekettet. Ich greife sie mir und trete vom Büro aus auf den betonierten Vorplatz hinaus, auf dem sich die Kreditkartenelite betanken lässt und, sich die Beine vertretend, mit Pinzettenfingern die Unterhosen aus den Wachsrunzeln ihrer alternder Skrota zupft. An denen schleppe ich meine Shell-Öldose vorbei, die ich auf beiden Händen trage wie ein Blasentotem, um die Ecke, zu den Toiletten, und – na, schön, was soll’s. Aber dann kommt es mir mit einem Schlag, dass das für die Pranksters Dauerzustand ist. Die leben so! Männer, Frauen, Buben, Mädchen, die meisten von ihnen mit gutbürgerlicher Mittelschichtkinderstube, Männer und Frauen und Buben und Mädchen und Kinder und Säuglinge, so leben sie seit Monaten, einige von ihnen seit Jahren, quer durch Amerika und wieder zurück, im Bus, bis hinunter in die Rattengebiete Mexikos und wieder herauf, immer wie die Zigeuner entlang der Rasthausrandbezirke zu segeln, sich ständig heimlich aufs Klo zu schleichen, immer in Verteidigungsstellung gegen die mörderischen Blicke. Und es stellt sich heraus, dass sie sogar Filme und Bänder haben von ihren Duellen mit Rasthauspächtern im Herzen Amerikas, die verzweifelt versuchen, ihre in Beton gegossenen Toiletten mitsamt den ewig leeren Handtuchspendern vor diesen DayGlo-Irren zu schützen...
Ich bin wieder im LAGERHAUS. Der Trubel lässt nicht eine Sekunde nach. Langsam, aber sicher beschleicht mich bei der ganzen Geschichte ein komisches Gefühl. Das liegt jedoch nicht nur an den Kostümen, den Tonbändern, dem Bus und alldem. Ich habe auf dem College Wochenenden mit Bürstenschnittjungs aus der Verbindung überlebt, bei denen es sowohl optisch als auch akustisch irrer zuging, absolut ausgerastete Feten. Das … komische Gefühl überkommt mich, wenn die Sternenbannerleute zu mir kommen und Sachen sagen wie – na ja, da steht zum Beispiel Cassady und lässt seinen Hammer sausen, den Kopf tief in den Geheimnissen des Universums, denen bei seiner Grübelei himmelangst werden müsste, und peng, der Hammer, er hat ihn verfehlt, und das Ding knallt auf den Betonboden der Garage, und einer der Sternenbannerleute sagt zu mir: »Weißt du, der Chief sagt, wenn Cassady danebengreift, dann ist das nie und nimmer Zufall -«
Schon mal die Bezeichnung »Chief« – »Häuptling«. Die Pranksters haben zwei Termini, wenn von Kesey die Rede ist. Wenn es sich lediglich um eine banal-weltliche Angelegenheit handelt, dann ist er für sie einfach »Kesey«, wie etwa in »Kesey hat einer’n Zahn ausgeschlagen«. Aber wenn sie von Kesey als dem Führer oder Lehrer der ganzen Gruppe sprechen, dann wird er der »Chief«. Am Anfang kam mir das ziemlich aufgesetzt vor. Aber dann, als die Schwaden des allgegenwärtigen Mysto-Dunstes auch in meinen Kopf einzusickern begannen, wurde es, na ja, eben … Mysto. Dieser Dunst, ich kann ihn tatsächlich hören in meinem Kopf; ein gewaltiges sssssssssssssss – wie nach einer Überdosis Chinin. Ich habe keine Ahnung, ob es außer mir noch jemandem so geht oder nicht. Aber wenn um mich herum etwas im Gange ist, das mich zur Genüge beunruhigt, mir Ehrfurcht oder Befremden einflößt oder auch nur bizarr genug ist, etwas, bei dem ich spüre, dass ich damit nicht fertig werde, dann kommt es mir so vor, als ginge alles in mir auf Alarmstufe Rot, und die Dunstschleier beginnen mich zu umhüllen …
»- wenn Cassady danebengreift, dann ist das nie und nimmer Zufall. Er will uns damit was sagen. Irgendwas geht dann vor sich im Raum, irgendwas ist drauf und dran, zum Problem zu werden, üble Schwingungen liegen in der Luft, die er damit zu vertreiben versucht.«
Und sie glauben das auch. Jedes noch so kleine Detail im Leben eines jeden von ihnen steckt voller … Bedeutung. Und jeder ist ständig auf der Hut und achtet auf diese Bedeutungen. Und dann die Schwingungen. Es gibt so unendlich viele Schwingungen. Irgendwann später war ich mal oben in Haight-Ashbury mit einem jungen Burschen, keinem Prankster, aber auch aus einer Kommune, und der Typ versucht einen alten Sekretär aufzukriegen, eines dieser alten Dinger, die man aufklappt und man hat eine Schreibunterlage, und er klemmt sich einen Finger in das Scharnier. Aber anstatt einfach »Verdammte Scheiße!« oder was auch immer zu sagen, gerät ihm das Ganze gleich zu einer Metapher fürs Leben und überhaupt, und er meint:
»Das ist typisch! Seht ihr’s nicht? Sogar das arme Schwein, das dieses Ding hier gebaut hat, spielte mit, wie man’s von ihm verlangt hat. Seht ihr, dass das Ding so gebaut ist, dass es nach außen aufgeht? Immer geht alles nach außen und dann hinein, es muss einfach nach außen gehen und dann hinein in dein Leben, immer wieder derselbe beschissene alte Schub - du versteht, ja? – und die denken noch nicht mal drüber nach – du versteht, ja? – und genauso machen die alles, was sie bauen, und du stehst hier und die stehen da drüben, und die hören nicht auf, auf dich loszugehn. Schaut euch mal den Küchentisch da drüben an!« Durch eine offene Tür sieht man in einem anderen Raum einen alten Küchentisch mit einer Emailplatte. »Der ist einfach besser gebaut, einwandfrei besser als der ganze Zierscheiß hier, mein ich; ich steh auf diesen Küchentisch, echt, weil das Ding einfach da ist – verstehste? – er steht da, um zu empfangen, und darum geht es, er ist passiv, ich meine, was ich sagen will, was zum Teufel ist schon überhaupt’n Tisch. Freud hat gesagt, ein Tisch ist ein Symbol für eine Frau mit gespreizten Schenkeln, beim Bumsen, Traumsprache – du verstehst? -, und jetzt sag mir einer, für was das hier ein Symbol sein soll?« Er deutet auf den alten Sekretär. »Er ist ein Symbol für ein lautes Scheiß-auf-dich, ich scheiß auf dich, oder stimmt’s vielleicht nicht?« Und so weiter, bis mich das Gefühl beschleicht, ich müsste ihm eine Hand auf die Schulter legen und ihm sagen, warum trittst du dem Ding nicht einfach gegen die Kniescheibe und lässt es dabei bewenden.
Aber wie auch immer, dieses Gerede geht ständig so. Jeder klaubt die kleinsten Anlässe auf, als wären sie Metaphern für das Leben an sich. Das Leben eines jeden Einzelnen wird von Minute zu Minute sagenhafter als das sagenhafteste Buch. Das ist doch Humbug, verdammt noch mal … aber mysto … und nach einiger Zeit infiziert man sich damit wie mit irgendwas Juckendem, einem Hautausschlag oder der Krätze.
Und dann das ganze Theater mit diesen Spielchen. Die normale Borniwelt draußen, so scheint es, besteht aus Millionen von Leuten, die alle in irgendwelche Spielchen verwickelt, ja, in ihnen gefangen sind, Spielchen, von deren Existenz sie noch nicht einmal eine Ahnung haben. Ein Typ, den sie Hassler nennen, kommt aus der grellen Sonnenwand draußen auf der Harriet Street herein, und zoooom, er wartet nicht mal auf die Metaphern. Noch nie in meinem Leben bin ich mit einem mir völlig Fremden so schnell in eine Diskussion über abstrakte Sachverhalte geraten. Vom Fleck weg kommen wir auf die Spiele. Hassler ist ein junger Typ, sieht gut aus, breites Gesicht, langes Haar, Prinz-Eisenherz-Pony genau wie im Comicstrip, und er trägt einen Rollkragenpulli voller Metallsterne, so Dinger, wie sie Generäle auf den Schultern tragen, und er sagt zu mir, »Unsere ganze Kultur ist derart von Spielen durchdrungen, dass … brabbelbrabbel … Ego-Spiele … immer alles beurteilen total verkorkst und Gehirnwäsche und wir sagen uns … wehrt euch dagegen« – hier streckt er seine Hände aus und fährt mit den Fingerspitzen gegeneinander, als übe er sich in Karate...
Aber meine Gedanken sind am Wandern. Ich tue mich schwer mit dem Zuhören, weil mich eine kleine Plastikschachtel mit einer Zahnbürste und einer Tube Zahnpasta fasziniert, die Hassler unter einen Daumen geklemmt hält. Das Ding fährt vor meinen Augen hin und her, während Hasslers Hände sich wehren … Was für eine spaßige Ansammlung von Schmuddelbohemiens. Dieser Typ mit den Generalssternen auf dem Pulli hält mir eine Art Vesperpredigt über die Sünden der Menschheit und – eine Zahnbürste! – aber warum nicht! – er putzt sich nach jeder Mahlzeit die Zähne – macht er tatsächlich. Er putzt sich die Zähne nach jeder Mahlzeit, obwohl sie hier in dieser Garage wie die Zigeuner leben, und obwohl es kein heißes Wasser gibt, keine Toilette, keine Betten außer einigen alten Matratzen, in denen Dreck, Staub, Schimmel eine Einheit mit den knapp darüber stehenden Wölkchen bilden, gut gemischt mit der Füllung, und die Pranksters strecken sich auf den Gerüsten lang, im Bus, auf der Ladefläche eines Lieferwagens, und in ihren Nasenlöchern beginnt es zu modern -
»- aber weißt du was? Die Leute fangen an, das Gewebe der Spiele zu durchschauen, nicht nur die Heads und so, sondern alle möglichen Leute. Nimm mal Kalifornien. Es gibt da seit jeher diese Pyramide -«
Hier umreißt Hassler mit seinen Händen eine Pyramide, und ich schaue fasziniert zu, wie der blitzblank polierte Plastikzahnbürstenbehälter die eine Schräge der Plastikpyramide hochfährt -
»- sie transzendieren diesen ganzen Scheiß«, sagt Hassler, nur dass seine Stimme dabei ernst ist und klar und sanft wie die eines High-School-Schülers bei seiner Abschlussrede, als sagte er nichts weiter als Mögen die Senioren des nächsten Jahres unseres Mottos gedenken - »transzendieren den ganzen Scheiß -«
ENDE DER LESEPROBE
Die Zitate in diesem Buch stammen aus folgenden Werken: Hermann Hesse, Morgenlandfahrt© Suhrkamp Verlag 1968 Joachim Wach, Religionssoziologie© Mohr Verlag 1951
Verlagsgruppe Random House
Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 03/2009
Copyright © der Originalausgabe 1968 by Tom Wolfe
Copyright © dieser Ausgabe 2009 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-02480-2V002
www.heyne.de
www.randomhouse.de