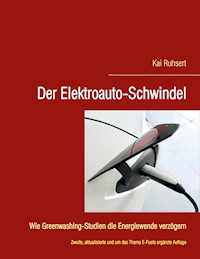
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zentrale Thesen: * Investitionen in die Elektromobilität sind für den Klimaschutz vollständig verlorenes Geld * Die Öffentlichkeit wird getäuscht * Wissenschaftler applaudieren der politisch erzwungenen Durchsetzung des E-Autos wider besseren Wissens und getrieben von Eigennutz Ein Leser schrieb mir zur ersten Auflage: "Ich habe das Buch in einem Zug gelesen. Chapeau! Das ist mit großer Akribie und Umsicht sowie beeindruckendem Sachverstand geschrieben. Immer dann, wenn ich gedacht habe, jetzt müsste das Buch aber auf das und das eingehen, folgte prompt eine passende Passage. Alles drin, und kein Gramm Fett zu viel. Las sich bei allem Faktenreichtum durchweg spannend und vor allem zum Schluss dann auch noch recht amüsant (armer Prof. Wietschel)."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danken möchte ich
meiner Frau Eva, deren Einwände sehr zur besseren Verständlichkeit beitrugen
meinem Bruder Sven für die kritische Durchsicht
Freunden für ihre Anmerkungen und
den von mir befragten Wissenschaftlern für Antworten, die auf die eine oder andere Weise immer aufschlussreich waren
Der Kommentar von Dieter Teufel auf dem Buchumschlag bezieht sich auf die erste Auflage des Buches, das noch nicht das Kapitel „Ausblick in die Zukunft“ enthält. Alle weiteren Änderungen sind marginaler Natur.
Hinweise zum Gebrauch des Buches:
Fußnoten werden mit hochgestellten Ziffern durchgezählt (z.B
9
)
Quellen sind mit abwärts gerichteten Pfeilen und hochgestellten Ziffern markiert (z.B.
↓
10
). Die Nummern geben die Position im Quellenverzeichnis auf den letzten Seiten des Buches an.
Inhalt
Zusammenfassung
Glossar
Intro
E-Auto-Studien: Der Mehrheits-Konsens
4.1 Gegenstimmen
4.2 Plausible CO
2
-Bilanzen
4.2.1 Schnellkurs zur Herkunft des Ladestroms
4.2.2 Zur Klimabilanz von Selbstversorgern
4.3 Ergebnisse des Marginalstromansatzes
Politisch unerwünschte Fakten
5.1 Auswirkungen politischer Leitlinien auf Studien
5.2 Der Strommix wird nach dem gewünschten Ergebnis ausgewählt
5.3 Grünstrom wird bilanztechnisch für Elektroautos reserviert
5.4 Es wird eine Kompensation der CO
2
-Emissionen behauptet
Folgen der wissenschaftlichen Fehlberatung
6.1 Autohersteller werden zum Bau von Spritschluckern motiviert
6.2 Subventionen für höhere Treibhausgasemissionen
6.3 Die Energiewende wird um Jahre verzögert
6.3.1 Fehlallokation staatlicher Ressourcen
6.3.2 Ladeinfrastruktur
6.3.3 Oberleitungs-Lkw
Besonderheiten batterieelektrischer Fahrzeuge
7.1 Unterschiede zu anderen Antriebsarten
7.2 Elektromobilität und Energiewende
7.2.1 Elektroautos als Verbraucher von Überschussstrom
7.2.2 Lastmanagement
7.2.3 Höhere Netzverluste
7.2.4 Akkus als Langzeit-Stromspeicher?
7.3 Sinnvolle Anwendungsnischen für Elektroautos
Blick über die Landesgrenzen
Fazit zur Rolle des E-Autos in der Energiewende
Ausblick in die Zukunft
10.1 Rahmenbedingungen
10.2 Der Bedarf an Strom wird schneller als das Angebot steigen
10.2.1 Einige postulierte Effizienzverbesserungen sind fraglich
10.2.2 Einige Elektrifizierungen verringern die Effizienz
10.2.3 Neue Anwendungen werden mehr Strom verbrauchen
10.3 Ohne importierte Synfuels keine Energiewende
10.4 Zur Wirtschaftlichkeit von Synfuels
10.5 Alternative Brennstoffzelle?
10.6 Das Gesamtsystem ist zu optimieren
10.7 Elektroantrieb? Gewiss, aber doch bitte nicht so
10.8 Das batterieelektrische Auto ist das Resultat von Fehlberatung
Unstimmigkeiten in Studien und Stellungnahmen
11.1 Forschungsinstitute, Ministerien und Behörden
11.1.1 Die Kopplungs-Phantasien des IFEU
11.1.2 Wuppertal Institut: „Weit auseinanderliegende Ergebnisse“
11.1.3 DIW: Klimavorteile dank „Netto“-CO
2
-Reduktion?!
11.1.4 Professor Wietschels kuriose Suche nach dem Grenznachfrager
11.1.5 Der klimaschädliche Kampf des SRU gegen Erdgas
11.1.6 Das Öko-Institut und die „Systemperspektive“
11.1.7 Das problematische Verhältnis des UBA zum Marginalstrom
11.1.8 Europäische Institutionen: Gutachten zu Diensten der Politik
11.2 Automobilhersteller: Hauptsache Kohle?
Lässt sich die voreilige Einführung von Elektroautos noch bremsen?
Stichwortverzeichnis
Quellen
1. Zusammenfassung
Die Klimabilanz batteriebetriebener Elektroautos wird von Studien gleichen wissenschaftlichen Anspruchs gegensätzlich bewertet
Günstige Bewertungen ergeben sich nur mit Luftbuchungen, d.h. indem Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) bilanztechnisch doppelt verbraucht werden darf: Einmal von den bisherigen Stromverbrauchern und ein weiteres Mal von Elektroautos. Eine Sichtung ergab 18 Studien ohne und 62 mit Doppelverbuchung von EE. In neun weiteren Publikationen wird grüner Strom dem öffentlichen Netz rechnerisch entzogen und exklusiv den Elektroautos zugeordnet.
80 Prozent der Studien dienen somit dem Greenwashing der Elektromobilität.
Die in den Studien angewandten Bilanzierungstricks folgen den Empfehlungen politischer Gremien zur Markteinführung des Elektroautos, die teilweise Gesetzeskraft erlangten
Alle Studien fordern den verstärkten Ausbau von EE; die Greenwashing-Studien verschweigen jedoch, dass Elektroautos als zusätzliche Stromverbraucher die Ökostromquote senken
In der jetzigen Phase der Energiewende erhöhen Elektroautos den CO
2
-Ausstoß des Individualverkehrs. Beinahe sofort verfügbare, sparsamere Autos mit Verbrennungsmotoren oder serielle Hybridfahrzeuge würden hingegen eine rasche Verringerung ermöglichen.
Die Elektromobilität ist frühestens dann klimaneutral, wenn der Differenzstrom für zusätzliche Verbraucher aus erneuerbaren Energien produziert wird - was nicht vor Mitte dieses Jahrhunderts der Fall sein wird
Die Förderung der Elektroautos behindert und bremst die Energiewende, weil diese Mittel bei der Finanzierung sinnvoller Maßnahmen fehlen und der Zusatzstrombedarf die Abschaltung der fossilen Kraftwerke verzögert
Da Elektroautos nichts dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen zu senken, kann die staatliche Förderung nicht mit Umweltvorteilen begründet werden
Batteriebetriebene Elektroautos werden in keiner Phase der Energiewende eine bessere Klimabilanz als Autos mit Verbrennungsmotoren haben:
Abbildung 1: CO2-Emissionen in den verschiedenen Phasen der Energiewende [g CO2/km]
Anmerkungen: 1
Die oberen drei Balken stellen den heutigen Zustand dar: Elektroautos verursachen wegen des fossilen Strommix sehr hohe Treibhausgasemissionen.
Der vierte Balken zeigt an, wie stark die Treibhausgasemissionen der Elektroautos sinken, wenn Kohle- durch Erdgaskraftwerke ersetzt werden. Verbrauchsoptimierte Autos mit Verbrennungsmotoren (wie der dunkelgrün eingefärbte Toyota Prius mit Erdgasbetrieb; ein Experimentalfahrzeug, das in kürzester Zeit serienreif sein könnte) erreichen dieses Niveau schon heute.
Die Farbe rosa markiert eine Kuriosität: 2030 tritt ein EU-Flottengrenzwert in Kraft, der mit gar keiner Antriebsart eingehalten werden kann (59,4 g/km).
Das batteriebetriebene Elektroauto wird auch nach der Entfossilisierung der gesamten Energieversorgung keinen Klimavorteil haben, weil die Verbrennungsmotoren dann mit emissionsfreiem synthetischem Kraftstoff betrieben werden.
1 Die Fahrzeugverbräuche wurden spritmonitor.de entnommen; das Elektroauto ist ein Hyuandai Ioniq; zum Toyota Prius siehe Kap. „Subventionen für höhere Treibhausgasemissionen“; zu den Treibhausgasemissionen siehe Kapitel „Plausible CO2-Bilanzen“
2. Glossar
2 Damit hat sich ein physikalisch falscher Begriff durchgesetzt. Energie kann nur umgewandelt, aber nicht „erneuert“ werden. Gemeint sind de facto unerschöpfliche Energiequellen.
3. Intro
Am 18. Mai 2016 hatte die Bundesregierung Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität mit einem Investitionsvolumen von knapp unter einer Milliarde Euro beschlossen. ↓1 Drei Jahre später riefen Automobilunternehmen nach immer mehr staatlichen Subventionen für Elektroautos:
„Auf der IAA stellt Volkswagen-Chef Diess den ersten rein elektrischen VW vor – und fordert viel mehr Staatsgeld für Elektroautos.“↓2
Auch der europäische Herstellerverband ACEA fordert die EU-Staaten zu einer „dramatischen Erhöhung von Investitionen in die Ladeinfrastruktur“ auf. In allen EU-Staaten müsse es ausreichend Anreize wie Kaufprämien geben. ↓3
Die Förderung wurde kräftig ausgebaut: ↓4
„Bis zum Jahr 2023 will die Bundesregierung Elektromobilität mit 9,3 Milliarden Euro fördern.“
2022 bezifferten Ökonomen der Deutschen Bank die Kosten für den Staat über die gesamte Nutzungsdauer auf bis zu 22.000 Euro je Mittelklasse-Fahrzeug. ↓5 Prof. Dr. Peter Hoberg von der Hochschule Worms schaute noch genauer hin und entdeckte zusätzliche versteckte Subventionen in Höhe von über 18.000 € je Fahrzeug. 6
Der Einsatz von Steuergeldern sollte einen nachweisbaren Nutzen für die Allgemeinheit haben. Von Elektroautos wird behauptet, sie trügen zur Verringerung der CO2-Emissionen3 bei. Stimmt das?
3 Der Begriff CO2-Emissionen meint in diesem Buch immer das Treibhauspotential CO2e
4. E-Auto-Studien: Der Mehrheits-Konsens
Die meisten Wissenschaftler bescheinigen BEV Klimavorteile. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) stellte z.B. im März 2019 fest: ↓7
„Die Ergebnisse zeigen für alle drei Fahrzeugklassen und alle unterstellten Szenarien eine sehr deutlich positive THG-Gesamtbilanz von Elektrofahrzeugen.“
Das IFEU-Institut kam im April 2019 zu ähnlichen Schlussfolgerungen: ↓8
„In allen untersuchten Fällen hat das Elektroauto über den gesamten Lebensweg einen Klimavorteil gegenüber dem Verbrenner.“
Da wundert es nicht, dass das Bundesumweltministerium mit diesem Argument zum Kauf ermuntert: ↓9
„Die Analyse der Klimabilanz … zeigt, dass die Treibhausgasemissionen eines rein batterieelektrischen Fahrzeugs (kurz: Elektroauto) selbst unter Berücksichtigung des deutschen Strommix geringer ausfallen als bei vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, und das schon für ein heute gekauftes Fahrzeug.“
Es beruft sich auf eine Behörde:
„Bei der Beantwortung dieser Fragen und der Erstellung der Analyse hat das Umweltbundesamt fachlich unterstützt.“
Auch der ADAC verkündete schließlich in millionenfacher Auflage: ↓10
„In der Kompaktklasse hat das Elektroauto auch bei Nutzung des deutschen Strommix mit 150 g CO2/km die beste CO-Bilanz ...“
4.1 Gegenstimmen
Andere Untersuchungen konnten keinen Nutzen für das Klima feststellen. Zitat aus einer Studie des Heidelberger Umwelt- und Progonose-Instituts vom Oktober 2019:
„Elektroautos sind entgegen einer weitverbreiteten Meinung nicht klimaneutral, sie verursachen als einzelnes Fahrzeug ungefähr gleich hohe CO2-Emissionen wie normale Benzin- oder Diesel-PKW.“ ↓11
Das DIW kam 2015 zu einem noch ungünstigeren Befund: ↓12
„Im BAU-Szenario des Jahres 2030 wird die durch Elektrofahrzeuge bedingte CO2-Reduktion im Straßenverkehr durch Mehremissionen im Stromsektor überkompensiert.“4
Diese widersprüchlichen Ergebnisse sind keine deutsche Besonderheit. Die Analyse von 44 internationalen Papieren ergab 2018, dass sich für praktisch jede Behauptung über E-Autos eine Studie als Beleg finden lässt.↓13 Die angegebenen Werte der Treibhausgasemissionen von BEV reichen von 20 bis über 290 g CO2/km:
Abbildung 2: Bandbreite der in Studien ermittelten Treibhausgasemissionen von BEV
Wie kann es sein, dass Wissenschaftler zu derart gegensätzlichen Bewertungen kommen?
4.2 Plausible CO2-Bilanzen
Anhand einer eigenen, vergleichenden Klimabilanz soll aufgezeigt werden, wie stark die Ergebnisse der Studien von Annahmen abhängen. Dazu genügen wenige Ausgangsdaten:
Für Autos mit Benzin- oder Dieselmotor sind realistische Verbrauchswerte zu ermitteln sowie die Treibhausgasemissionen je Liter verbrannten Kraftstoffs.
Für Elektroautos ist es ein wenig komplizierter: Hier kommt es darauf an, welche Kraftwerke den zusätzlichen Strom zur Aufladung der Akkus produzieren.
Als Vergleichsfahrzeuge wählen wir zwei Volkswagen-Modelle der Baujahre ab 2020 von etwa gleicher Größe und Fahrleistung: Den ID.3 mit 150 PS und den Golf mit Benzin- und Dieselmotor mit 100 bis 120 PS.5
CO2-Bilanzen lassen sich in wenigen Schritten erstellen:
Als Ausgangspunkt kann der Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch dienen. Die praxisfernen Normwerte aus den Autoprospekten ignorieren wir und konsultieren stattdessen die Website
www.spritmonitor.de
. Dort tragen Autobesitzer ihre tatsächlichen Alltagsverbräuche ein. Im März 2022 waren dies 19,9 kWh/100km für den ID.3, 5,83 l/100 km für den Golf Benziner und 4,92 Liter für den Golf Diesel.
Viele gebräuchliche Angaben zu den spezifischen CO
2
-Emissionen von Benzin- und Dieselkraftstoff enthalten nur das bei der Verbrennung entstehende Kohlendioxid und sind daher zu niedrig:
6
„Vorkettenemissionen sind nicht Teil der offiziellen Emissionsberichterstattung unter der UNFCCC und werden auch nicht in den Klimaschutzzielen der Bundesregierung berücksichtigt. Aus klimapolitischer Sicht macht es aber durchaus Sinn den Einfluss der Vorketten auf die Gesamtemissionen zu betrachten.“↓14
Wir möchten die so genannten Bereitstellungsaufwände für Förderung, Verarbeitung und Transport der Ölprodukte berücksichtigen.↓15 2022 gab das Bayerische Landesamt für Umweltschutz für Benzin 2880 g/l und für Dieselkraftstoff 3160 g/l an.↓16
Beim Elektroauto kommen Verluste auf dem Weg des Stroms vom Kraftwerk bis zum Akku hinzu: Rund 10 % im Stromnetz
↓
17
sowie ca. 16,5 % Ladeverluste.
↓
18
Somit muss etwa 28 % mehr Strom erzeugt werden, als der Antrieb verbraucht.
BEV fahren zwar lokal emissionsfrei, in einem Teil der Kraftwerke entsteht aber doch CO
2
. Aussagekräftige Klimabilanzen müssen daher die Emissionen der Ladestromproduktion korrekt berücksichtigen.
↓
19
Dazu ist eine Frage zu klären, von der sich zeigen wird, dass sie für das Gesamtergebnis von entscheidender Bedeutung ist:
Tanken E-Autos Durchschnitts- oder Differenzstrom?
In vielen wissenschaftlichen Studien basieren die Treibhausgasemissionen der Ladestromproduktion auf dem durchschnittlichen Kraftwerks-Strommix. Dafür scheint auf den ersten Blick zu sprechen, dass alle Verbraucher die elektrische Energie aus einem gemeinsamen Netz beziehen. Warum sollten dann für Elektroautos besondere Regeln gelten?
Bei genauerem Hinsehen jedoch ist diese Frage nicht so eindeutig zu beantworten. Der Durchschnittsmix unterscheidet nämlich nicht zwischen Grund- und Residuallast: ↓20
„Die schwankende Residuallast muss in der Hauptsache durch regelbare Kraftwerke gedeckt werden, insbesondere durch diverse Arten von Wärmekraftwerken…“
Das bedeutet konkret: Steigt der Ladestrombedarf, dann werden nur fossile Kraftwerke hochgeregelt. Statt des Durchschnitts-Strommix ist daher ein fossiler Strommix anzuwenden. Der Bund der Energieverbraucher hat dies im Januar 2018 mit deutlichen Worten zusammengefasst:
„Doch warum darf man bei den Emissionsberechnungen nicht den bundesdeutschen Strom-Mix zugrunde legen? Die Erklärung ist einfach, aber nicht zu widerlegen: Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen und AKW produzieren immer, wenn sie können und betriebsbereit sind, da ihre variablen Kosten sehr gering oder nahezu null sind. Wegen eines zusätzlichen E-Fahrzeugs werden sie nicht mehr Strom produzieren (können). Also muss der zusätzliche Strom aus einem Kraftwerk kommen, das bislang nicht ausgelastet ist. Denkbar wäre auch, dass weniger Strom exportiert wird – doch dann würde im Ausland ein fossiles Kraftwerk hochgefahren, denn dort gilt das gleiche betriebswirtschaftliche Prinzip für die Stromerzeugung. … Diese Situation wird auch dann noch vorherrschen, falls in zehn oder zwanzig Jahren über 50 Prozent der Stromerzeugung durch regenerative Energiequellen stattfindet. Wer also mit den niedrigen Emissionswerten des Kraftwerks-Mix rechnet, lügt sich eins in die Tasche – mancher bewusst, mancher aus Unkenntnis.“↓21
Auch das Umweltbundesamt stellte 2016 fest, dass für die Klimabilanz des BEV nicht der Durchschnittsstrommix, sondern ein „Ladestrommix“ anzuwenden ist, basierend auf dem „Kraftwerkspark, der zur Betankung von Elektrofahrzeugen unter sonst gleichen Bedingungen tatsächlich in Anspruch genommen wird.“↓22
Diese Vorgehensweise entspricht den anerkannten Regeln wissenschaftlichen Arbeitens zur Erstellung von Lebenszyklusanalysen, wie sie z.B. im „General Guide for Life Cycle Assessement“ der Europäischen Kommission beschrieben sind: ↓237
„Bei einigen Technologien macht es einen großen Unterschied aus, ob ein marginaler oder ein durchschnittlicher Ansatz zur Anwendung kommt. Im Falle der Stromerzeugung kann die Grenztechnologie Kohle- oder Windkraft sein, während die Durchschnittstechnologie sich typischerweise von Fall zu Fall stark unterscheidet. Bei Produkten oder Systemen, die viel Elektrizität verbrauchen, wird schon die Wahl des Elektrizitäts-Mix oft das Gesamtergebnis bestimmen. Die falsche Wahl des Modellierungsprinzips führt dann zu irreführenden Ergebnissen.“
Zu dieser Frage konsultieren wir zusätzlich das „Manual Daten-und Qualitätsstandards für Ökobilanzen zu Pkw-Antrieben“ (2019 verfasst vom Öko-Institut und dem Verband der Chemischen Industrie). Darin heißt es: ↓24
„Als Marginalstrom8 wird derjenige Strom bezeichnet, der aufgrund einer zusätzlich nachgefragten Strommenge (z. B. aufgrund der Einführung neuer, strombasierter Technologien) zusätzlich bereitgestellt wird. Da er in Deutschland heute in der Regel durch eine höhere Auslastung konventioneller Kraftwerke erzeugt wird, ist er meistens fossiler Natur. Welche Erzeugungstechnologien ihn bereitstellen, wird nach dem Merit-Order-Prinzip über die Grenzgestehungskosten definiert.“
Dies anzuerkennen setzt natürlich voraus, E-Autos als zusätzliche Verbraucher einzustufen. Daran kann jedoch kein Zweifel bestehen, sofern tatsächlich untersucht werden soll, ob die Umstellung des Individualverkehrs auf Elektromobilität Klimavorteile hat. Dann sind genau zwei Zustände zu vergleichen, nämlich die Volkswirtschaft als Ganzes mit und ohne Elektroautos; entscheidend ist, auf welche Weise der Gesamtverbund der Kraftwerke auf die Zuschaltung dieser weiteren Gruppe von Stromverbrauchern reagiert. Da aus der Perspektive der Stromversorger mit zunehmender Verbreitung von Elektroautos eine „neue, strombasierte Technologie“ hinzukommt,9 ist für BEV ein Marginalstrommix zu ermitteln, dessen Zusammensetzung der Merit Order10 folgt.↓25 Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft e. V. erklärte 2019, warum sich dies auf die Klimabilanz zusätzlicher Stromverbraucher ungünstig auswirkt:
„Werden die rein betriebsbedingten Emissionen betrachtet, so zeigt sich, dass – mit Ausnahme der Kernenergie – emissionsintensive Brennstoffe aufgrund ihrer niedrigen Grenzkosten bevorzugt zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Selbst hocheffiziente Gas- und Dampfturbinenkraftwerke (GuD) kommen nach dem Merit-Order-Prinzip erst nach emissionsintensiveren Steinkohlekraftwerken zum Einsatz.“↓26
Die folgende Prinzipdarstellung veranschaulicht diese Zusammenhänge: 11
Abbildung 3: Merit Order↓27
Anmerkungen dazu:
Obwohl Wind-, Sonnen- und Biomassenkraftwerke stets mit maximal möglicher Leistung laufen,
12
konnten sie z.B. 2021 kaum die Hälfte des Strombedarfs decken.
↓
28
Ihre Leistung schwankt stark, weshalb Strom aus EE als „fluktuierend“ bezeichnet wird. Das Diagramm zeigt, wie bei steigendem Bedarf zunächst nukleare und dann verschiedene fossile Kraftwerke die zur Stromversorgung notwendige Residuallast liefern.
Die senkrechten, schwarzen Linien markieren, wie viel nichtregenerativer Strom zu einem bestimmten, willkürlich gewählten Zeitpunkt produziert wird.
Der Abstand zwischen den beiden senkrechten Linien veranschaulicht, was passieren würde, wenn man eine fiktive Menge Elektroautos vom Stromnetz trennte oder hinzuschaltete: Nur die Produktion fossilen Stroms würde um den Ladestrom verringert oder erhöht werden.
13
Weiterer Zubau an Stromerzeugung aus EE verschiebt die Ladestromlast
innerhalb des fossilen Bereichs
nach links.
Ökostrom muss lt. EEG immer vorrangig abgenommen werden und hat daher bereits Abnehmer. Zusätzlichen Strom können nur die fossilen Kraftwerke erzeugen.
Daraus folgt, dass Elektroautos die Produktion fossilen Stroms in Höhe des gesamten Ladestroms erzwingen.
Die im Laufe der Jahre ansteigende Ökostromquote kann daran auf absehbare Zeit nichts ändern. Denn der höhere EE-Anteil wird die Klimabilanz des Elektroautos so lange nicht verbessern, wie der zum Ausgleich des Ladestroms erforderliche zusätzliche Strom aus fossilen Kraftwerken stammt.





























