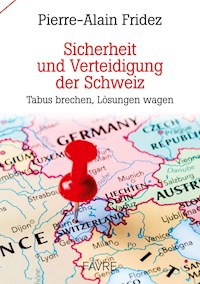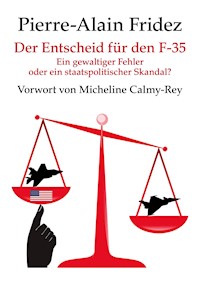
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 27. September 2020 hat die Schweizer Stimmbevölkerung mit 8000 Stimmen Unterschied die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge hauchdünn angenommen. Es geht heute nicht darum, dieses Ergebnis in Frage zu stellen, denn die Regeln der Demokratie sind klar. Das Problem liegt voanders: im unverständlichen Entscheid der Schweizer Regierung, dem Parlament nach einem völlig undurchsichtigen Verfahren den amerikanischen Kampfjet F-35A von Lockheed Martin vorzuschlagen. Der F-35A ist ein Tarnkappen-Kampfflugzeug, das für Angriffe tief im feindlichen Gebiet und nicht für die Luftpolizei und -verteidigung konzipiert ist, die für den Schutz des Schweizer Luftraums im Vordergrund steht. Der F-35A weist zudem viele Probleme auf: das teuerste Flugzeug, besonders im Unterhalt, technische Mängel und vor allem ein Jet, der sich noch in Entwicklung befindet und dessen Triebwerk ausgetauscht werden muss... Der überraschende Entscheid der Schweizer Regierung verdient eine gründliche Untersuchung. Sie wird aber durch eine bleierne Wand der Geheimhaltung erschwert, die dieses Geschäft umhüllt. Wer aber ohne jede Transparenz arbeiten und die Wahrheit verschweigen will, wird dennoch eines Tages mit deren Enthüllung konfrontiert sein. Und das Ergebnis ist klar: Dieses Flugzeug ist definitiv für die Schweiz nicht geeignet. Und selbst die Eidgenössische Finanzkontrolle äusserte ernste Bedenken bezüglich der gewaltigen finanziellen Risiken, die mit diesem Projekt verbunden sind. Und eines ist sicher: Sollte die Schweiz den F-35A am Ende trotz allem beschaffen, wird dies kein gemütlicher Spaziergang werden. Vielmehr deutet vieles auf eine Wiederholung des Mirage-Skandals der 1960er Jahre hin...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT VON MICHELINE CALMY-REY
EINLEITUNG
TEIL 1 EIN MANGELHAFTES FLUGZEUG FÜR FALSCHE AUFGABEN
1 EIN JET FÜR ANGRIFF ODER FÜR VERTEIDIGUNG?
1.1 Die Versprechungen des Bundesrates bei der Abstimmung 2020
1.2 Der F-35A im Vergleich zur europäischen Konkurrenz
1.3 Stealth – wirklich nützlich für die Schweiz?
1.4 Kann der F-35 autonom eingesetzt werden?
2 DESASTRÖSE ERFAHRUNGEN IN DEN USA
2.1 Die Entwicklung des F-35 – eine endlose Geschichte des Scheiterns
2.2 Die Kritik nimmt zu
3 KONZEPTIONELLE MÄNGEL DER BESCHAFFUNG
3.1 Ein Kampfflugzeug ohne angemessene Bewaffnung
3.2 Ein Kampfflugzeug fast ohne Ausbildung und Training?
3.3 F-35A-Daten ohne Integration in die elektronische Infrastruktur der Armee?
3.4 Die Abhängigkeit von den USA bei der Wartung
4 FEHLENDE STRATEGISCHE KOHÄRENZ
4.1 Der Einsatz der F-35A in anderen Ländern ist nicht mit dem geplanten Einsatz in der Schweiz vergleichbar
4.2 Die Schweiz verfügt seit 30 Jahren über keine Verteidigungsstrategie
4.3 Welche militärische Rolle spielt die Schweiz in Europa?
TEIL 2 UNANNEHMBARE FINANZIELLE RISIKEN
5 DIE BERECHNUNGEN DES BUNDESRATES
5.1 Plötzlich kosteten die F-35A eine Milliarde mehr
5.2 Die Aussagen in der Armeebotschaft 2022
5.3 Wenig einleuchtende Berechnungen des Bundesrates
6 ES GIBT KEINE «PREISGARANTIE»
6.1 Angebote der US-Regierung sind nie «verbindlich»
6.2 Andere F-35-Länder kämpfen mit steigenden Kosten
6.3 Ein lächerlicher Risikozuschlag
7 DIE RISIKEN DER BESCHAFFUNG IN DEN USA
7.1 Nie erreichter Status der vollen Produktionsreife (FRP)
7.2 Der F-35A ist nach wie vor nur zu 50 Prozent verfügbar
7.3 Das Triebwerk wird ersetzt und ALIS funktioniert nicht
8 DIE WAHREN BESCHAFFUNGSKOSTEN IN DER SCHWEIZ
8.1 Der Stückpreis steigt – zukünftige Kosten sind ungewiss
8.2 Wo bleiben die Kosten der AMRAAM?
8.3 Die Kosten der baulichen Infrastruktur
8.4 Die Kosten der Integration in die elektronische Infrastruktur der Armee
8.5 Die Kosten einer angemessenen Bewaffnung
9 DIE WAHREN BETRIEBSKOSTEN IN DER SCHWEIZ
9.1 Die Erklärungen des Bundesrates…
9.2 Nur 35 Millionen CHF für Treibstoff?
9.3 Nur 35 Millionen CHF für Gehälter?
9.4 Nur 230 Millionen CHF für die Wartung?
10 VERGLEICHE MIT DEN BETRIEBSKOSTEN IN ANDEREN LÄNDERN
10.1 Methode
10.2 US Luftwaffe
10.3 Norwegen
10.4 Dänemark
10.5 Niederlande
10.6 Die Betriebskosten liegen im Vergleich nahe beieinander
10.7 Unabsehbare Lebenswegkosten
11 UNERTRÄGLICHER LÄRM
11.1 Ein paar Hinweise zur akustischen Physik
11.2 Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu hören ... oder doch?
11.3 Alle Länder beschweren sich über den unerträglichen Lärm der F-35
11.4 Und in der Schweiz?
11.5 Messungen in den USA weichen stark von unseren ab
11.6 Die Lösung des VBS gegen den Lärm: weniger Flüge
11.7 Ein minimalistischer Kurzbericht
12 SEHR TEURE UPDATES
12.1 Bundesrat ignoriert die Kosten für Updates
12.2 Erfahrungen mit dem F/A-18 in der Schweiz
13 ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZIELLEN RISIKEN
TEIL 3 WIE KAM ES ZU DIESEM UNVERSTÄNDLICHEN ENTSCHEID?
14 DAS KOMPLOTT
14.1 Ein geduldig vorbereitetes Beschaffungsverfahren
14.2 Vier «wenig aussagekräftige» militärische Anforderungen rezykliert
14.3 Zwanzig «geheime» Bewertungskriterien
14.4 Bewertung anhand von 79 streng geheimen Kriterien
14.5 Erstaunliche Missionen
14.6 AHP – eine undurchsichtige Bewertungsmethode
14.7 AHP – ungeeignet, nicht dokumentiert und rechtlich «heikel»
14.8 Eine schlechte Ausrede
14.9 Unsere Annahme, «wie die Evaluation gemacht wurde»
15 EINE REGIERUNG, DIE NICHT REGIERT
15.1 Wie also diesen unverständlichen Entscheid erklären?
15.2 Bundesrat «vor vollendete Tatsachen gestellt»
15.3 Ein Verfahren ohne jede geostrategische Überlegung
15.4 Illusorische Annahme sinkender Flugstunden
15.5 Alles in allem ein glasklares Vergabeverfahren ... oder doch nicht?
15.6 Eine externe (Alibi)-Überprüfung
15.7 Ankündigung, alle Daten der Evaluation zu vernichten
16 SPEZIALISTEN, DIE ALLE MACHT MONOPOLISIEREN
16.1 Ein extrem einflussreiches Team von Technokraten in armasuisse und Luftwaffe
16.2 Mächtig trotz einer langen Liste von Pannen und Pleiten
16.2.1 Der Gripen – ein «Papierflieger»
16.2.2 Das FIS-Heer Debakel
16.2.3 Die Duro-Pleite
16.2.4 Mörser 16 – schwere Verfahrensmängel
16.2.5 Hermes-Drohnen – massive Verzögerungen
16.2.6 F-5 Tiger oder die Verschwendung von Steuergeldern
16.2.7 Die Saga der Boden-Luft-Verteidigung
16.2.8 Ein leistungsschwaches Bundesamt
17 WARUM HAT ARMASUISSE SO VIEL MACHT?
17.1 Vergabe von Milliarden ohne Wettbewerb und Rechtsschutz – ein Machtfaktor
17.2 Transparency International, die OECD und der Europarat kritisieren die Schweiz
17.3 Die ersten Anzeichen eines Umdenkens kommen für Air2030 zu spät
TEIL 4 GEOPOLITISCHE ASPEKTE EINES ABWEGIGEN ENTSCHEIDS
18 DIE GEOPOLITISCHEN FOLGEN
18.1 Der Entscheid, die Schweiz für mindestens 30 Jahre an die USA anzudocken
18.2 Ein Bündnis mit der NATO?
18.3 Über eine europäische Alternative nachdenken
19 DIE FOLGEN FÜR UNSERE SICHERHEIT
19.1 Der Krieg in der Ukraine bestätigt unsere Analyse
19.2 Unbegründete Sicherheitsversprechen mit dem F-35A
19.3 Wegen Ukrainekrieg mehr Sicherheit für die Schweiz?
19.4 Sicherheitslage der Schweiz in der Mitte von Europa
20 POLITISCHE KONSEQUENZEN
20.1 Die Arbeit der Aufsichtsorgane EFK und GPK
20.2 Die Rückweisung an den Bundesrat ebnet den Weg für bessere Alternativen
20.3 Ein wenig Geschichte, um den Kontext in Erinnerung zu rufen und die aktuellen Herausforderungen besser zu verstehen
20.3.1 Der Schatten des Mirage-Skandals
20.3.2 Tiger-Teilersatz endet mit einem Totalabsturz
20.3.3 Fehlende «Beschaffungsreife» wird als Risiko bewertet
20.3.4 Das Projekt Air2030
20.3.5 Referendum und Abstimmung vom 27. September 2020
20.4 Die Stop-F-35-Initiative als unser Notnagel
20.5 Schlussfolgerungen
ANHANG
Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz vom 28. Juni 2021
ABKÜRZUNGEN
QUELLEN UND LITERATUR
Vorwort von Micheline Calmy-Rey
Über Kampfflugzeuge
Pierre-Alain Fridez beschenkt uns mit einem gut recherchierten Buch über etwas, das ein Staatsskandal oder zumindest eine Demonstration von Inkompetenz sein könnte. Der Bundesrat will ein amerikanisches Kampfflugzeug, den F-35, kaufen. Finanzielle Risiken: Angesichts der Erfahrungen der Länder, die dieses Flugzeugs bereits beschafft haben, erreichen die Budgetüberschreitungen Höchstwerte. Vor allem aber ist das Flugzeug für die Aufgaben, die es laut Bundesrat erfüllen soll, nämlich die Luftpolizei und die Luftverteidigung, nicht geeignet. Seine grösste Stärke, die Tarnkappen-Eigenschaft, ist dafür nutzlos.
Die Schweiz ist im Bereich der Verteidigung wie in anderen Politikfeldern pragmatisch. Sie verfügt über eine Milizarmee und über Kampfflugzeuge. Das Ziel ist es, reagieren zu können, wenn wir angegriffen werden. Der Grad der Sicherheit hängt von der Einschätzung der Bedrohung ab. Da es als sehr unwahrscheinlich gilt, dass eine thermonukleare Bombe auf die Schweiz abgeworfen wird, hält die Schweiz es nicht für sinnvoll, ballistische Interkontinentalraketen zu besitzen. Unsere Verteidigung ist also nicht absolut, sondern relativ, basierend auf einer Analyse der Risiken, die uns bedrohen.
In Anbetracht der geostrategischen Veränderungen konzipiert die Schweiz ihre Sicherheit in einem umfassenden Ansatz, der neben der Armee Diplomatie, Information und Wirtschaft umfasst. Auf technischer Ebene wird die Verteidigungsinfrastruktur nach internationalen Standards aufgebaut, die darauf abzielen, verschiedene Systeme zu beherrschen, zu integrieren und zu etwas Besonderem zu machen, um die Abhängigkeit von aussen so weit wie möglich zu vermeiden. Soweit die schöne Theorie.
Zwar liegt die Verteidigung der Schweiz in unseren eigenen Händen, doch wird sie durch unsere militärische, technologische und industrielle Abhängigkeit von den Grossmächten beeinflusst. So müsste die Schweiz, wenn wir uns für ein amerikanisches Flugzeugmodell entscheiden würden, akzeptieren, dass die Nutzung der damit verbundenen Technologien Kontrollen unterworfen ist, die sicherstellen, dass die Nutzung der Flugzeuge nicht gegen amerikanische Interessen verstösst, und dies ohne Mitspracherecht bei den technologischen Schlüsselbereichen. Keine grosse Sache, werden einige sagen, achtet unsere Armee doch darauf, dass sie so ausgerüstet ist, dass sie mit den Armeen unserer Nachbarn oder der Länder, mit denen wir die gleichen Werte und Interessen vertreten, zusammenarbeiten kann. Die Schweiz sorgt daher für die Interoperabilität ihrer Armee und beteiligt sich auch an der Partnerschaft für den Frieden im Rahmen der NATO.
Die Schweiz steht mit dem Dilemma der Abhängigkeit nicht allein da. Belgien hat amerikanische Kampfflugzeuge erworben. Mit der Wahl des F-35 (wie Italien oder die Niederlande) entschied es sich für einen amerikanischen statt für einen deutsch-französischen Verteidigungsschirm. Darüber hinaus ist das US-amerikanische Luftabwehrsystem Patriot in den Niederlanden, Schweden, Deutschland und Finnland im Einsatz. Im September 2019 genehmigte Washington den Verkauf von zweiunddreissig F-35-Flugzeugen an Polen. Die Loyalität all dieser Länder ist also eine doppelte: sowohl europäisch als auch transatlantisch. Auch Deutschland kauft F-35. Allerdings sind all diese Länder NATOMitglieder, und für Deutschland ist der F-35 nur in Kombination mit Eurofighter und nur für nukleare Einsätze gemäss NATO-Vorgaben vorgesehen. Die Wahl neuer Kampfflugzeuge ist immer strategisch: Ist die Schweiz auf dem Weg, ein blinder Passagier der NATO zu werden?
Infolge der Ukraine-Krise 2014 haben sich die Beziehungen zwischen der NATO und Russland verschlechtert. Die praktische Zusammenarbeit untereinander wurde ausgesetzt. Die NATO positioniert sich heute verstärkt als eine rein westliche, von den USA dominierte Militärallianz. Diese veränderte Dynamik macht die Zusammenarbeit zwischen der neutralen Schweiz und der NATO umso heikler.
Ich bin überzeugt, dass der Luftraum von grosser Bedeutung ist. Es ist nicht möglich, Bodentruppen ohne Kontrolle der dritten Dimension einzusetzen. Der Entscheid, unsere Kampfflugzeuge und unser Luftverteidigungssystem zu erneuern, hätte jedoch im Hinblick auf die Grundsätze unserer Aussenpolitik und damit auch auf die Neutralität bewertet werden müssen. Wenn man bedenkt, dass diese Mittel im Betrieb von ausländischer Spitzentechnologie abhängig sind, ist diese Frage strategisch von grosser Bedeutung.
Der Entscheid des Bundesrates beruhte jedoch auf einer einfachen Kosten/Nutzen-Abwägung der verschiedenen Angebote, ohne unsere aussenpolitischen Interessen zu berücksichtigen. Hätte er dies getan, wären die europäischen Angebote zweifellos attraktiver und unsere Nachbarn weniger verärgert gewesen.
Der Krieg in der Ukraine rückt das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Unsere Verteidigungsministerin will diesen Umstand nutzen, um den Kauf des neuen Kampfflugzeugs rasch abzuschliessen. Sie kündigt die Unterzeichnung des Vertrags an, bevor die Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle und der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates zu diesem Thema vorliegen, was zumindest von einem Willen zeugt, die Dinge auf die Spitze zu treiben. Dies umso mehr, als die Unterzeichnung noch vor Ablauf der Angebotsfrist am 31. März 2023 und ohne das Ergebnis der Volksabstimmung über die Initiative «Stop F-35» abzuwarten, erfolgen könnte. Staatspolitischer Skandal, krasse Inkompetenz, Verweigerung der Demokratie: Es ist das Verdienst von Pierre-Alain Fridez, diese Herausforderungen aufzuzeigen.
Am 24. Juni 2022 Micheline Calmy-Rey
Einleitung
In der Schweiz ein Buch über die Anschaffung neuer Kampfflugzeuge zu schreiben, hat vor dem Hintergrund der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine und der Emotionen und Ängste, die das Wiederaufflammen des Krieges am Rande von Europa hervorgerufen hat, eine besondere Bedeutung. Und die Tatsache, dass ich ein linker Politiker bin, macht dies nicht einfacher. Es geht inzwischen ja nicht mehr darum, ob unser Land eine Flotte von Kampfflugzeugen braucht. Über den Grundsatz brauchen wir uns nicht mehr zu streiten. Die Stimmbevölkerung hat diese Frage am 27. September 2020 geklärt, wenn auch nur mit einem knappen Vorsprung von einigen tausend Stimmen (1 605 839 Ja – 50,1 Prozent gegenüber 1 597 324 Nein – 49,9 Prozent, d. h. eine Differenz von 8 515 Stimmen).1 Die Mehrheit billigte das Air2030-Projekt des Bundesrates. Es gibt keinen Grund, dies in Frage zu stellen. Wir sind Demokraten. Dura lex, sed lex.
Damit erhielt der Bundesrat den Auftrag, dem Parlament ein Projekt zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vorzuschlagen. Die Wahl des Flugzeugtyps liegt beim Bundesrat, ein Vorrecht, das ihm das Parlament ausdrücklich übertragen hat. Dieses Vorrecht ist das Ergebnis eines subtilen politischen Kalküls der rechten Parlamentsmehrheit. Sie wollte unbedingt vermeiden, dass sich das Debakel wiederholt, das für sie das Scheitern der Gripen-Beschaffung im Jahr 2014 darstellt. Die Debatte sollte sich auf keinen Fall auf die Frage beziehen, welches Flugzeug auszuwählen sei. Vielmehr sollten sich die Stimmenden allein zum Grundsatz äussern, ohne dass sich der Bundesrat mit möglichen Mängeln eines bestimmten Flugzeugs herumschlagen muss. Das war ein Novum. Die Rechte wollte den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern bewusst die Möglichkeit nehmen, über die Wahl eines Flugzeugs zu diskutieren. Das Argument lautete, dies sei allein Sache der Fachleute.
Am 30. Juni 2021 gab der Bundesrat nach einem undurchsichtigen Verfahren seinen Wunsch bekannt, 36 Flugzeuge des Typs F-35A vom USHersteller Lockheed Martin zu beschaffen.2 Ein Luft-Boden-Angriffs-Flugzeug, das als der bei weitem teuerste und mit zahlreichen Mängeln behaftete Jet verschrien war.3 Aber wie durch Zauberhand erwies sich dieses Flugzeug nach der vom Bundesamt für Rüstung (armasuisse) durchgeführten Evaluation nicht nur als «das Beste», sondern auch als «das kostengünstigste» in Anschaffung und Unterhalt – ein Wunder. In den Medien und unter Experten herrschte allgemeines Unverständnis,4 ganz zu schweigen davon, dass der Bundesrat die geopolitischen Aspekte aus der Debatte ausklammerte,5 obwohl er nur wenige Wochen zuvor die Verhandlungen mit der Europäischen Union über das Rahmenabkommen abrupt abgebrochen und unser Land auf der europäischen Bühne damit zutiefst isoliert hatte. Die offenbar sehr schroffe Zurückweisung der europäischen Konkurrenz (Eurofighter und Rafale) trug auch nicht dazu bei, die Situation zu verbessern.
Dieses Buch versucht, die Umstände und Verfahren zu entwirren, die zu diesem schwer erklärbaren Ergebnis führten, und auf die Ungereimtheiten und Risiken dieser Beschaffung hinzuweisen.
In allen parlamentarischen Debatten und während der Kampagne zur Volksabstimmung über die Vorlage Air2030 vom 27. September 2020 war stets die Rede von der Beschaffung eines Mehrzweck-Kampfflugzeugs, das die Aufgaben erfüllen soll, die ihm anvertraut werden sollen: Luftpolizei und Schutz unseres Luftraums. Der F-35 ist jedoch in erster Linie ein Flugzeug für den Luft-Boden-Angriff, ein Tarnkappenbomber, der ideal ist, um den Krieg in die Tiefe des feindlichen Territoriums zu tragen, möglichst als Teil eines integrierten militärischen Verbundes wie der NATO – und nach Ansicht vieler Experten sicher nicht die erste Wahl für die Aufgabe der Luftpolizei und der Luftverteidigung.6
Ich lade Sie ein, dieses Buch wie einen Krimi zu lesen, ein Schwarzbuch, das schonungslos die Undurchsichtigkeit eines Verfahrens untersucht, das viele Fragen aufwirft und das zu einem völlig unverständlichen Entscheid des Bundesrats geführt hat, der für unser Land schwerwiegende Folgen haben kann, namentlich in finanzieller Hinsicht. Ich hoffe, dass ich beim Leser und bei der Leserin Neugier und begründete Zweifel wecken kann über ein Geschäft, das zumindest ein grosser Fehler ist, aber auch zu einem weiteren Skandal in der langen Saga der stets hoch umstrittenen Beschaffungen von Kampfflugzeugen durch die Schweiz werden könnte.
Doch im Moment beschäftigen uns vor allem die Ukraine und das Martyrium des ukrainischen Volkes, das dem Grössenwahn des Kremlherrn zum Opfer gefallen ist. Und die Frage, wie man die Anschaffung der F-35A in Frage stellen kann, wenn doch in Europa wieder Krieg ist? Das Parlament fordert, die Militärausgaben der Schweiz bis 2030 auf 1 Prozent des BIP zu erhöhen und massiv aufzurüsten.7 Neben Flugzeugen sollen auch Panzer und Minenwerfer angeschafft werden... Damit bietet dieses Buch auch Gelegenheit, die Sicherheitslage der Schweiz im Herzen von Europa zu betrachten und die Massnahmen zu erörtern, die wir ergreifen müssen, um unsere Sicherheit wirklich zu verbessern.
Als der Bundesrat seine Wahl bekannt gab, bemühte ich mich, eine Fülle von Informationen über dieses Flugzeug, seine wiederkehrenden Probleme, seine Eigenschaften, seine Fähigkeiten, sein Potenzial und vor allem die finanziellen Aspekte dieser Anschaffung zu sammeln. Aus diesen Informationen geht hervor, dass es ein ernsthaftes Problem gab. Warum also dieser verrückte Entscheid? Ich wollte es verstehen. Ich wollte verstehen, wie das Verfahren durchgeführt wurde, von wem, unter welcher Kontrolle. Lange Nachforschungen, die durch das völlige Fehlen von Transparenz seitens der Bundesbehörden erschwert wurden. Aber am Ende haben die mir zur Kenntnis gebrachten Informationen (von denen einige im Zusammenhang mit meiner Funktion als Parlamentarier stehen und über die ich nicht sprechen darf, da das Amtsgeheimnis verpflichtet) mir ermöglicht, besser zu verstehen, was geschehen sein muss, Fehlfunktionen im Verfahren aufzudecken und in mir mehr als ernsthafte Zweifel an der gesamten offiziellen Rhetorik des Bundesrates und des VBS (Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport) aufkommen zu lassen.
Noch einmal: Dieses Buch will kein Plädoyer gegen den Kauf neuer Kampfflugzeuge sein. Der demokratische Entscheid der Stimmbürger und Stimmbürgerinnen muss respektiert werden. Dieses Buch zielt auf den F-35A ab, ein teures Flugzeug, das unseren Bedürfnissen nicht gerecht wird, sowie auf bestimmte Praktiken, die uns höchst nachdenklich stimmen.
Als ich dieses Buch schrieb, fühlte mich wie ein Aufklärer, der versucht, Licht ins Dunkel zu bringen...
Ich möchte Micheline Calmy-Rey meinen tiefsten Dank dafür aussprechen, dass sie sich bereit erklärt hat, das Vorwort zu diesem Buch zu schreiben; Roger Nordmann, Mattea Meyer und Cédric Wermuth für ihre stets sachdienlichen Bemerkungen und ihre unerschütterliche Unterstützung dieses Projekts; und meinem Freund Jean-Christophe Schwaab für seine klugen Ratschläge. Mein besonderer Dank gilt jedoch Peter Hug, Historiker und ehemaliger politischer Sekretär der sozialdemokratischen Fraktion der Bundesversammlung, für seine geschätzte und wesentliche Unterstützung bei der Erarbeitung dieses Buches.
Pierre-Alain Fridez
1 BUNDESRAT: Beschluss vom 13. November 2020 über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 27. September 2020. Bundesblatt 2020, S. 8776.
2 BUNDESRAT: Air2030: Bundesrat beschliesst Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35A. Medienmitteilung, 30.06.2021.
3 McFATE, Sean: The F-35 tells everything that’s broken in the Pentagon. The Hill, 11.03.2021; COPP, Tara: ‘It Failed Miserably’. After Wargaming Loss, Joint Chiefs Are Overhauling How the US Military Will Fight, 26.07.2021; TINGLEY, Brett: Joint Chiefs Seek A New Warfighting Paradigm After Devastating Losses In Classified Wargames. The Drive, 27.07.2021; GOTTLIEBSEN, Robert: 'Useless': a US general's verdict on the Joint Strike Fighter. The Australian, 02.08.2021; Former US Secretary of Defense calls the F-35 a piece of shit. News read online, 23.01.2021; KENNEDY, Sean: The F-35 may be unsalvageable. The Hill, 26.03.2021 ; VON LIEVEN, Christoph: Die F-35. Viel Geld für wenig Sicherheit. Hamburg, Greenpeace, 2022.
4 RENZ, Fabian: Dieser Fehlentscheid wird uns noch lange wehtun. Tages-Anzeiger, 03.07.2021; SCHMID, Adrian: So geht das nicht, Frau Bundesrätin. SonntagsZeitung, 04.07.2021; BAILAT, Lise: Rien ne garantit que le F-35 coûtera 2 milliards de moins. 24heures, 03.07.2021.
5 CAVELTY, Gieri: Kampfjet-Kauf. Eine unpolitische Landesregierung. SonntagsBlick, 04.07.2021 ; PETIGNAT, Yves: F-35: la démission du politique. Le temps, 03.07.2021.
6 BRIDEL, Georges: F-35-Kauf wäre unverständlich. Infosperber, 27.06.2021; TUSA, Francis: Switzerland Air2030 Justification: What Doesn’t Add Up, And Where. Defence Analysis, 02.08.2021.
7Schrittweise Erhöhung der Armeeausgaben, sodass sie spätestens bis 2030 mindestens 1% des BIP betragen. Gleichlautende Motionen der Sicherheitspolitischen Kommissionen des Nationalrates (22.3367) und des Ständerates (22.3374), eingereicht am 21. bzw. 31. März 2022. Der Bundesrat beantragt am 13. April 2022 deren Annahme. Angenommen im Nationalrat am 9. Mai 2022 und im Ständerat am 2. Juni 2022.
Teil 1 Ein mangelhaftes Flugzeug für falsche Aufgaben
1 Ein Jet für Angriff oder für Verteidigung?
1.1 Die Versprechungen des Bundesrates bei der Abstimmung 2020
Der Bundesrat argumentierte vor der Abstimmung vom 27. September 2020 über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge fast ausschliesslich mit dem Schutz des Schweizer Luftraums. Sein Hauptargument lautete: Wir brauchen im Alltag eine permanente Luftpolizei und im Bedarfsfall zusätzlich eine Luftverteidigung. Die Mehrheit stimmte zu. Dieser Entscheid muss respektiert werden.
Klar und deutlich wird dies namentlich im Abstimmungsbüchlein,8 das die Bundeskanzlei mit Blick auf das Referendum allen Stimmberechtigten zugestellt hat. Darin beschrieb der Bundesrat unter der Überschrift «Aufgaben der Kampfflugzeuge» die Ziele der Beschaffung und die wesentlichen Einsätze, welche die neuen Jets erfüllen sollten, wie folgt:
• «Luftpolizeidienst: Die Armee setzt Kampfflugzeuge tagtäglich für den Luftpolizeidienst ein. Sie sorgt dafür, dass sich alle an die Luftverkehrsregeln halten, und hilft Flugzeugen, die in Not geraten sind. Sie interveniert, wenn ein Flugzeug den Schweizer Luftraum ohne Erlaubnis benutzt. Kampfflugzeuge können ein solches Flugzeug beispielsweise zur Landung auffordern und zu einem Flugplatz begleiten. Zudem schützen Kampfflugzeuge Grossveranstaltungen wie das Jahrestreffen des World Economic Forum (WEF) in Davos und internationale Konferenzen – etwa am UNO-Sitz in Genf.»
• «Terrorbedrohung und internationale Spannungen: Bei einer anhaltenden Terrorbedrohung hat die Armee die Aufgabe, den Luftraum über längere Zeit intensiver zu kontrollieren. Kampfflugzeuge können beispielsweise dann intervenieren, wenn Terroranschläge mit entführten Linienflugzeugen oder mit Kleinflugzeugen drohen. Wenn es im Umfeld der Schweiz zu Spannungen zwischen Staaten kommt, müssen Kampfflugzeuge den Luftraum kontrollieren und dafür sorgen, dass keine unbefugten ausländischen Militärflugzeuge über die Schweiz fliegen.»
• «Bewaffnete Konflikte: Wenn die Schweiz angegriffen wird, setzt die Armee Kampfflugzeuge ein, um ihren Luftraum zu verteidigen... Mit Kampfflugzeugen werden zudem Aufklärungsflüge und Einsätze gegen feindliche Ziele am Boden geflogen.»
Im Abstimmungsbüchlein betonte der Bundesrat also vor allem, wie wichtig es sei, über die Mittel zu verfügen, um Luftpolizei- und Luftverteidigungsmissionen zum Schutz unseres Luftraums durchzuführen. Von Angriffen auf ausländisches Territorium war zu keinem Zeitpunkt die Rede.
Die Frage ist zentral, was ein neues Kampfflugzeug leisten soll. Denn die Antwort bestimmt in hohem Masse, wie die Kriterien und Modelle ausgestaltet werden, die der Evaluation zugrunde liegen. Es ist vorgängig zu entscheiden, welche Kategorie von Kampfflugzeug für das in der Schweiz vorgesehene Einsatzspektrum am besten zugeschnitten ist. Wir können – Bomber und Spezialflugzeuge ausgenommen – drei Kategorien von Kampfflugzeugen unterscheiden:
• Reine Jagdflugzeuge: Sie eignen sich allein für Luft-Luft-Missionen, d.h. für die Luftpolizei und die Luftverteidigung. Beispiele sind die F-14, F-15C und F-22.
• Mehrzweckkampfflugzeuge: Sie können sowohl für Luft-Luft- als auch für Luft-Boden-Missionen eingesetzt werden. Die beiden europäischen Kampfflugzeuge, die armasuisse evaluiert hat, gehören zu dieser Kategorie. Länder, die über den Rafale oder den Eurofighter verfügen, setzen diese Flugzeuge in der Regel sowohl für Luftpolizei und Luftverteidigung als auch für Luft-Boden-Missionen ein. Es gibt auch leichte Mehrzweckkampfflugzeuge, wie die M-346FA von Leonardo oder die in Südkorea hergestellte FA-50, mit demselben Einsatzprofil.
• Mehrzweckkampfflugzeuge, die für Luft-Boden-Angriffe optimiert sind: Ein typischer Vertreter dieser Kategorie ist der Tornado – oder heute der F-35. Seine Tarnkappen-Eigenschaft befähigt ihn zu überraschenden Luft-Boden-Angriffen. Dieser Tarnkappen-Eigenschaft wird alles andere untergeordnet. Er kann deshalb nur wenige Waffen mitnehmen, denn diese müssen im Flugzeugrumpf verborgen werden. Zudem erfordert die Tarnkappen-Eigenschaft eine Aussenform mit ebenen Flächen und vielen Kanten. Der F-35A hat deshalb nur verminderte Flugleistungen. Er steigt langsamer und beschleunigt schlechter als die andern evaluierten Flugzeuge. Er ist unhandlich und kaum in der Lage, Manöver mit einem anhaltend hohen Lastfaktor durchzuführen. Ausserdem muss er klassischerweise immer von einem reinen Jagdflugzeug wie dem F-22 oder dem F-15 begleitet werden, um gegnerische Jäger abzuwehren.
Um ausschliesslich Luft-Luft-Missionen durchzuführen, wäre ein reines Jagdflugzeug wohl grundsätzlich effizienter als die vier von armasuisse evaluierten Kampfflugzeuge: der Eurofighter Typhoon, der Rafale, der F/A-18 Super Hornet und der F-35A.
Vergleichen wir diese vier, so sind die europäischen Jets bei der Luftpolizei und der Luftverteidigung besser als der F-35A, ein Flugzeug, das für die Offensive und den überraschenden Luft-Boden-Angriff auf feindliches Gebiet optimiert ist.
Eine wesentliche Frage bleibt bestehen: Gibt es für unser Land Szenarien, die die Anschaffung eines Mehrzweck-Kampfflugzeugs mit ausgeprägter Luft-Boden-Fähigkeit rechtfertigen? Da der Bundesrat den Kauf von Luft-Boden-Waffen in ernst zu nehmender Menge für den F-35A auf den Sankt-Nimmerleinstag verschieben will,9 bestätigt unsere Regierung nur, was wir schon immer gesagt haben: Es gibt für die Schweiz heute, morgen und sogar übermorgen kein Szenario, das solche zusätzlichen Fähigkeiten rechtfertigen würde. Somit bildet die Wahl des Flugzeugtyps und die geplante Anzahl ein Problem. Der Krieg in der Ukraine stellt das schlimmste Szenario dar, das man sich am Rande von Europa vorstellen kann. Aber alle können es Tag für Tag beobachten: Unsere privilegierte geografische Lage und die militärischen Bündnisse unserer Nachbarn bieten einen wirksamen Schutz. Russische Panzer und Flugzeuge werden nicht bis zu uns vorstossen. Und ein Konflikt im Zentrum von Europa bleibt unvorstellbar. Darüber sind sich alle einig, sogar der Bundesrat.
Aber wir sind Demokraten – das Ergebnis der Volksabstimmung vom 27. September 2020 ist eindeutig: Wir werden neue Kampfflugzeuge beschaffen. Die Frage, welches Mehrzweckkampfflugzeug für die Schweiz am wenigsten ungeeignet wäre, muss aber weiterdiskutiert werden. Der F-35A wird es bestimmt nicht sein.
1.2 Der F-35A im Vergleich zur europäischen Konkurrenz
Nachdem im Abstimmungskampf der Schutz des eigenen Luftraums im Zentrum stand, erwarteten alle Beobachter, dass der Bundesrat ein Kampfflugzeug wählen würde, das für diese Aufgabe besonders geeignet ist.
Der Entscheid des Bundesrates vom 30. Juni 2021 entsprach jedoch in keiner Weise seinen Versprechungen, die er vorgängig stets gemacht hatte. Die Wahl des F-35A schlug deshalb wie eine Bombe ein und löste unter Fachleuten auf der ganzen Welt grösstes Erstaunen aus. Viele hielten die bundesrätliche Behauptung, der F-35A sei von den vier von armasuisse evaluierten Kampfflugzeugen «am besten» geeignet, «die Schweizer Bevölkerung auch in Zukunft vor Bedrohungen aus der Luft zu schützen», für höchst unwahrscheinlich. Ebenso wie die Behauptung, der F-35A habe in der Evaluation mit 336 Punkten «den höchsten Gesamtnutzen» bei der Bewertung erzielt, dies mit einem beträchtlichen Abstand von 95 Punkten und mehr zu den anderen Kandidaten.10
Georges Bridel, ein anerkannter Schweizer Experte in diesen Fragen, schrieb im Juni 2021, kurz vor dem Bundesratsentscheid: «Die F-35 mit anderem Profil, als wir es benötigen. Das Defizit des F-35 in der Luftpolizei: Eine rasche Intervention (Fachjargon «QRA») erfüllt der F-35 weit weniger gut als die europäischen Konkurrenten Eurofighter und Rafale. Der Zeitbedarf des F-35 zur Interzeption eines Luftfahrzeuges auf 11’000 Meter mit Steigen auf 11 Kilometer (typische Flughöhe der Verkehrsflugzeuge) und anschliessender Verfolgung (Überschall) ist gegenüber einem leistungsfähigen Standard-Jagdflugzeug um mindestens 50 Prozent höher. Das dauert über 1 Minute länger im Vergleich zur Konkurrenz. Im Luftkrieg sind das Ewigkeiten. Nur schon aufgrund dieses Kriteriums könnte der F-35 nicht beschafft werden: Die Konkurrenz fliegt ihm buchstäblich davon. Die Stealth-Fähigkeit des F-35 spielt in der defensiven Luftverteidigung nur eine untergeordnete Rolle.»11 Der F-35 ist ein Flugzeug, das für eine offensive Rolle auf feindlichem Territorium und die Zerstörung strategischer Ziele am Boden massgeschneidert ist. Es ist aber weniger leistungsfähig und daher wenig wirksam für den Schutz des eigenen Luftraums, insbesondere in einem kleinräumigen Territorium wie dem unseren.
Ebenso äussert sich Joseph Henrotin, Experte beim französischen Magazin Défense & Sécurité Internationale auf Swissinfo.ch vom 20. April 2021, gegenüber Alexis Rapin: «Bei den für die Schweizer Luftwaffe typischen Luftpolizeieinsätzen, also auf kurzen Distanzen, ist das Flugzeug für sein Gewicht untermotorisiert und relativ schwerfällig manövrierbar.»12
Diese Beurteilung wird in einem Artikel, der am 15. Juli 2021 in der Zeitschrift L'Illustré erschien, von zwei Schweizer Militärspezialisten, (die aus anderen Gründen dennoch für den F-35 eintreten), weitgehend geteilt: Auf die Frage, ob man «in einem winzigen Land mit gebirgigem Gelände wie der Schweiz nicht eher ein hyperagiles Flugzeug wie der Rafale dem F-35 bevorzugen sollte, dessen Stealth-Zwänge die Manövrierfähigkeit und die aerodynamischen Qualitäten beeinträchtigen», antwortet der Chefredakteur der Revue Militaire Suisse, Alexandre Vautravers: «Der Rafale ist in der Tat äusserst dynamisch, solange sie nicht mit schweren Bomben oder externem Treibstoff beladen ist. Im Unterschied zum französischen Flugzeug ist der F-35 nicht darauf ausgerichtet, ein möglichst wendiger Abfangjäger zu sein. Seine Stärken sind seine lange Flugdauer und seine Tarnkappenfunktion; seine Radarsignatur entspricht einer Fläche von nur wenigen Quadratmillimetern. Er ist in der Lage zu sehen und zu schlagen, ohne gesehen zu werden...». Und der Genfer Luftfahrtjournalist Pascal Kümmerling bezeichnet im selben Artikel die Flugleistungen des F-35 als «geringer als die des Rafale».13
All diese Fachleute bestätigen, dass der F-35A ein Flugzeug ist, das für Überraschungsangriffe in der Tiefe des feindlichen Gebiets optimiert ist. Jene Experten, die tatsächlich unabhängig und nicht dem Gesetz des Schweigens unterworfen sind, sind sich einig, dass der F-35A für Luftpolizei- und Luftverteidigungsmissionen, die im Vordergrund der Bedürfnisse der Schweiz stehen, nicht besonders geeignet ist. Denn der F-35A braucht länger, um abzuheben, steigt langsamer, beschleunigt schlechter, ist schwerfällig und kaum in der Lage, Manöver mit einem hohen Lastfaktor durchzuführen. Und ist zudem unzureichend bewaffnet.
Der F-35A wurde für den Luft-Boden-Einsatz optimiert. Setzen ihn die USA im Krieg ein, so wird er von Jagdflugzeugen wie dem F-15 oder F-22 begleitet, damit diese im Kampfgebiet für die Luftüberlegenheit sorgen und den F-35A entsprechend schützen. Die F-15 und F-22 «säubern» den Luftraum und ermöglichen es dem F-35A, seine Angriffsmission im feindlichen Gebiet mit erhöhter Sicherheit durchzuführen. Die Luftstreitkräfte von Grossmächten wie den USA verfügen über sich ergänzende Kategorien von Kampfflugzeugen, die je für unterschiedliche Aufgaben besonders geeignet sind. Für Luft-Luft-Aufgaben setzt die US-Luftwaffe andere, besser geeignete Plattformen ein, während für punktgenaue Überraschungsangriffe auf entfernte Bodenziele kein anderes Kampfflugzeug so geeignet ist wie der F-35A.
Die europäischen Kampfflugzeuge der Generation «viereinhalb», wie der Rafale oder der Eurofighter, sind in der Regel die einzigen modernen Plattformen der betreffenden Länder und müssen daher alle operativen Aufgaben mit allen Arten von Bewaffnungen abdecken. Ihre Einschränkungen in Bezug auf die Kampfübersicht und die Entdeckbarkeit – da nicht allein für den Einsatz gegen Bodenziele optimiert – spielen für die Bedürfnisse der Schweiz keine Rolle. Bei der Evaluation eines Kampfflugzeugs für die Schweiz sind andere Kriterien zur effizienten Durchführung ihrer Missionen massgebend.
Für die Schweiz, keine Frage, sind es die Flugleistungen, die für die Luftpolizei und die Luftverteidigung von entscheidender Bedeutung sind. In der kleinen Schweiz geht es darum, ein zu identifizierendes Flugobjekt rasch zu erreichen, bevor es das Land verlassen kann. In den folgenden Beispielen wird der F-35A mit einem Jagdflugzeug verglichen, das in den 1970er Jahren entwickelt und seither modernisiert wurde. Man sieht, dass selbst dieses alte Jagdflugzeug – hier wird der F-35A mit dem F-16 Block 52 (ein Flugzeug der vierten Generation) verglichen – bei Luftpolizeiund Luftverteidigungsmissionen besser abschneidet als der F-35A. Wichtig zu wissen: Die europäischen Mehrzweckkampfflugzeuge – der Rafale und der Eurofighter – sind noch leistungsfähiger als der F-16 Block 52.
Lassen Sie uns zwei Beispiele für typische Luftpolizeimissionen analysieren:
1) Luftpolizeimission QRA (Quick Reaction Alert) von Payerne zu einem Abfangpunkt in 11 km Höhe über Genf.
Beide Flugzeuge sind mit vier Luft-Luft-Lenkwaffen und einer Bordkanone bewaffnet und benötigen keinen externen Treibstoff. Nach dem Start lautet die Aufgabe: schnellstmöglicher Steigflug auf 11 km Höhe, Beschleunigung auf Mach 1,6 (F-35A) resp. Mach 1,8 (vierte Generation) und Annäherung an das Ziel.
Das Ergebnis: Zwischen dem «Lösen der Bremsen» und dem Erreichen des Zielpunkts vergehen 327 Sekunden beim F-35A und 274 Sekunden beim Flugzeug der vierten Generation. Der F-35A benötigt also 20 Prozent oder fast eine Minute mehr Zeit. Wenn das Flugzeug der vierten Generation das Ziel erreicht hat, ist der F-35A noch 17 km davon entfernt.
2) Luftpolizeiliche Mission von Payerne zu einem Abfangpunkt in 11 km Höhe über St. Gallen mit Begleitflug nach Genf (Flugdistanz 710 km).
Beide Flugzeuge sind wiederum mit vier Luft-Luft-Lenkwaffen und einer Bordkanone ausgestattet und benötigen keinen externen Treibstoff. Die Aufgabe lautet: Nach dem Start schneller Steigflug auf 11 km Höhe, Beschleunigung auf Mach 1,6 (F-35A) oder Mach 1,8 (vierte Generation) und Anflug auf das Ziel. Dann 360 km Begleitflug mit Mach 0,8 nach Genf, anschliessend Rückflug nach Payerne mit Wartezeit von 20 Minuten vor der Landung.
Das Ergebnis: Vom «Lösen der Bremsen» bis zum Erreichen des Zielpunktes über St. Gallen vergehen 645 Sekunden für den F-35A und 550 Sekunden für das Flugzeug der vierten Generation. Der F-35A benötigt 17 Prozent mehr Zeit, also fast eine Minute. Wenn das Flugzeug der vierten Generation das Ziel erreicht, ist der F-35A noch 30 km vom Zielpunkt entfernt.14
Der Rückstand ist nicht allein auf die geringere Steigleistung zurückzuführen, sondern vor allem auf die Beschleunigung auf Überschall-Geschwindigkeit (von Mach 0,8 auf 1,2), bei welcher der F-35A durch seine kantige, für Stealth optimierte Form benachteiligt ist.15
1.3 Stealth – wirklich nützlich für die Schweiz?
Die Befürworter des F-35A räumen ein, dass dessen Flugleistungen nicht sehr gut sind und deutlich unter den Leistungen der bewerteten europäischen Kampfflugzeuge liegen. Als wichtigstes Gegenargument führen sie an, dass dieser Nachteil durch die Tarnkappeneigenschaft des F-35A ausgeglichen werde.16
Dennoch bringt Stealth, wie Tarnkappeneigenschaften im Fachjargon genannt werden, bei den für die Schweiz wichtigen Einsatzformen keinen Vorteil. Bei der Luftpolizei und der Luftverteidigung spielt diese Eigenschaft keine Rolle, was wir weiter unten zeigen werden.
Doch zuerst wollen wir erklären, was Stealth eigentlich genau ist? Das Ziel von Stealth ist es, das Risiko der Entdeckbarkeit eines Flugzeugs zu verringern. Stealth-Flugzeuge absorbieren daher einfallende Radarwellen teilweise. Was trotzdem reflektiert wird, wird durch eine geeignete Form der Flugzeugzelle in wenige, bestimmte Nebenrichtungen abgelenkt, um die Entdeckungswahrscheinlichkeit aus der Hauptrichtung zu verringern.
Diese Massnahmen sind auf Wellenlängen im Zentimeterbereich zugeschnitten. Für Radargeräte, die sich im Wellenbereich von Dezimetern oder Metern befinden, sind Tarnkappenflugzeuge in den üblichen Entfernungen erkennbar. Solche Entwicklungen sind im Gange.17 Ein weiterer Ansatz zum Entdecken von Stealth-Flugzeugen sind Passivradaranlagen. Diese messen die zufälligen Reflexionen am Stealth-Flugzeug von unzähligen, permanenten Sendern verschiedenster Wellenlänge wie Radio, TV, Handy-Antennen etc. an mehreren Standorten und verwenden die Zeitverzögerung gleicher Signale abhängig von den Empfangsstandorten dazu, die Koordinaten der Reflexion zu ermitteln.18
Die besondere, kantige Form von Tarnkappenflugzeugen ist ein aerodynamischer Nachteil, vor allem im Überschallbereich. Daher haben Tarnkappenflugzeuge niedrigere Höchstgeschwindigkeiten und Beschleunigungswerte als andere Kampfflugzeuge, obwohl sie stärker motorisiert sind, um den (aufgrund ihrer Form) zusätzlichen Widerstand im gesamten Geschwindigkeitsbereich auszugleichen.
Das ideale Einsatzprofil des F-35, das alle seine besonderen Eigenschaften nutzt, besteht in der Fähigkeit, möglichst unerkannt tief in das feindliche Territorium einzudringen. Das Flugzeug nutzt seine Stealth-Fähigkeit, um heimlich, geschützt durch seine Tarnung, auf ein bestimmtes Ziel zuzufliegen. Es kann im internen Schacht nur wenige Bomben mitführen, normalerweise zwei, denn zusätzliche Bomben müssten unter den Flügeln angehängt werden, was die Tarnkappeneigenschaft zunichtemachen würde.
Hinzu kommt, dass diese besondere Eigenschaft relativ ist. Die Tarnkappeneigenschaft ist beim F-35 – im Gegensatz zum Stealth-Bomber B-2 – nur von vorne und der Seite des Flugzeugs vorhanden, nicht aber von oben und unten und nicht von hinten. Der F-35 ist also nur frontal von vorne schlechter entdeckbar als die Mitbewerber in der Evaluation.
Kampfflugzeuge ohne Stealth-Eigenschaften benutzen eine andere Möglichkeit, beim Anflug auf verteidigte Ziele so spät wie möglich vom Radar erfasst zu werden: den sogenannten «stillen Modus». Dazu schaltet das angreifende Flugzeug das Bordradar und die Störsender aus, während es die notwendigen Informationen über Ort und Art des Ziels über eine Datenverbindung von anderen, weiter entfernten Kampfflugzeugen, Satelliten oder unbemannten Drohnen erhält.
Mit seinem riesigen Triebwerk, das einen heissen Abgasstrahl erzeugt, weist der F-35A eine deutliche Wärmesignatur auf und ist daher mit Infrarotsensoren, die Kampfflugzeuge heute standardmässig mitführen, leicht zu erkennen. Namentlich im Luftkampf, der viele Manöver in alle Richtungen und ein aktivierter Nachbrenner mit einschliesst, ist die Tarnkappenwirkung des F-35A stark reduziert.
Um die radarwellenabsorbierenden Eigenschaften über die ganze Oberfläche mitsamt allen Fügungen, Zugangstüren und Sensorfenstern intakt zu halten, sind schon nach wenigen Flugstunden umfangreiche Wartungsarbeiten erforderlich. Diese besonders sorgfältig und aufwändig auszuführenden Wartungsarbeiten sind ein wichtiger Grund für die sehr hohen Betriebskosten, die dem Flugzeug zugeschrieben werden.
Die Bedeutung der Radar-Stealth-Eigenschaften von bemannten Kampfflugzeugen wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht nur wegen des Aufkommens von Passivradar-Systemen kontinuierlich abnehmen, sondern auch, weil für den Angriff auf stark verteidigte Ziele inzwischen unbemannte Plattformen in Entwicklung sind. Jeder militärtechnische Fortschritt wird u.a. genutzt, Soldaten von Aufgaben mit hohem Risiko fernzuhalten. So sind Kampfdrohnen als Teil des deutsch-französischen Luftkampfsystems der Zukunft (Future Combat Air System, FCAS) vorgesehen. Von bemannten Kampfflugzeugen aus werden unbemannte Plattformen, die ihrerseits Stealth-Eigenschaften aufweisen, aus grosser Distanz zum Bodenzielangriff oder zur Aufklärung in die gefährlichen, flabverteidigten Zonen gesteuert.
Die angebliche «Unsichtbarkeit» des F-35 und die Bedeutung dieser Tarnkappen-Eigenschaft sind also sehr relativ. Vor allem bei einer Luftpolizei- und Luftverteidigungsmission über unserem Hoheitsgebiet bietet diese keinerlei Vorteil. Um beispielsweise ein unbekanntes Flugzeug abzufangen, muss unser Kampfjet von der Flugleitung am Boden zum Ziel geführt werden können. Das geht nur, wenn die Radargeräte am Boden den F-35A erkennen können.
Wie der Bundesrat bestätigt, ist in Friedenszeiten Stealth im Luftraum, der von der zivilen Luftfahrt genutzt wird, gar nicht erlaubt.19 Durch das Anbringen einer Lüneburger Linse – eines absichtlich starken Radarreflektors – am Flugzeug muss die Stealth-Eigenschaft aufgehoben werden.20
Das neue Kampfflugzeug muss den Luftraum der Schweiz schützen. Die Fähigkeit, fern im Ausland Angriffe zu fliegen, ist für unser Land nutzlos. Die Frage, ob unser zukünftiges Kampfflugzeug Stealth-Eigenschaften hat oder nicht, ist deshalb eine Scheindebatte.
Hinzu kommt: Um die Schweiz zu erreichen, müsste ein potenzieller Angreifer wie Russland zuerst den Luftraum von NATO-Mitgliedern durchqueren und den Streitkräften der atlantischen Allianz seine Luftüberlegenheit aufzwingen. Dieser Tag ist nicht absehbar.
Man kann klar sagen, dass die «aussergewöhnlichen» Eigenschaften des F-35A (Stealth, Sensortechnik und Datenintegrationsfähigkeit), die in der Evaluierungsgruppe der armasuisse Bewunderung und Begeisterung hervorgerufen haben, für ein neutrales Land wie die Schweiz überbewertet wurden. Fassen wir die wesentlichen Elemente zusammen:
• Stealth ist in Friedenszeiten verboten und auch im Krieg von weit überschätzter Wirksamkeit, da das Flugzeug zum grössten Teil immer noch entdeckbar ist. Ausserdem ist die Tarnkappeneigenschaft sehr teuer im Unterhalt, da sich schon nach wenigen Minuten Überschallflug Blasen auf der Tarnkappenoberfläche bilden, was eine langwierige Wartung nach sich zieht. Die Tarnkappeneigenschaft erfordert spezielle Beschichtungen, die sehr empfindlich sind, vor allem gegenüber Hitze. Hohe Geschwindigkeit führt zu einer erheblichen Überhitzung der Flugzeugoberflächen.
• Diese konkreten Probleme erklären die Einsatztaktik des F-35A: Führt er einen Angriff in Richtung des feindlichen Territoriums durch, wird er von einer Flotte von Jagdflugzeugen begleitet, die den Luftraum frei halten, dann plötzlich abdrehen und den F-35A langsam in niedriger Höhe in Richtung seiner Ziele vorrücken lassen. Kurz vor dem Angriff beschleunigt der F-35A unvermittelt, feuert und dreht sofort ab, um so schnell wie möglich in die eigenen Linien zurückzukehren.
• Die andere «aussergewöhnliche» Eigenschaft des F-35A betrifft seine Sensoren und die Fähigkeit, Daten zu integrieren. Diese Eigenschaften sind jedoch nur im Rahmen eines grossen Netzwerks (wie der NATO) und mit enormen Investitionen voll nutzbar. Wir werden diese zweite Fähigkeit im nächsten Kapitel entmystifizieren.
8Erläuterungen des Bundesrates. Volksabstimmung vom 27. September 2020. Broschüre.
9 Siehe unten Kapitel 3.1.
10 BUNDESRAT: Air2030. Der Bundesrat beschliesst Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35A. Mitteilung vom 30.06.2021.
11 BRIDEL, Georges: F-35-Kauf wäre unverständlich. Infosperber, 27.06.2021.
12 HENROTIN, Joseph, und zitiert in: RAPIN, Alexis: F-35: Grosse Fragezeichen hinter dem «Ferrari der Lüfte». Swissinfo.ch, 20.04.2021.
13 VAUTRAVERS, Alexandre; KÜMMERLING, Pascal: Victoire du F-35A. «Le choix de cet appareil est parfaitement logique». L'Illustré, 15.07.2021.
14 EUROCONTROL: Aircraft Performance Database, 2022; ROYAL AIR FORCE: Specifications of our Aircraft, 2022; DASSAULT AVIATION: Specifications and Performance Data, 2021; US AIR FORCE: F-35A Lightning II, 2021; AIR POWER AUSTRALIA: Joint Strike Fighter, 2021; eigene Berechnungen.
15 JOINT STRIKE FIGHTER OFFICE: Dokumentation, 2006.
16 «Die Kompromisse bei der Leistung der Flugzeuge sind verständlicherweise bedauerlich, aber der Schlüssel zum Überleben ist es, nicht als Erster gesehen zu werden », sagt: DIGIOVANI, Robert: Why do stealth aircraft generally lose in maneuverability? Aviation Stack Exchange, 25.10.2018.
17The Development of Stealth and Counterstealth. Aviation Week, 11.09.2015.
18 DUJARDIN, Olivier: Radars passifs, pour quelles applications? Centre Français de Recherche sur le Renseignement. Note No 11, Mai 2019; JOHNSEN, Terje; OLSEN, Karl Erik: Bi- and Multistatic Radar. Kjeller, Norwegian Defence Research Establishment (FFI) 2006; SEIDLER, Christoph: Passives Radar. Deutsche Techniker sollen US-Kampfjet enttarnt haben. Spiegel Wissenschaft, 30.09.2019.
19 BUNDESRAT: Antwort vom 13.12.2021 an SEILER GRAF, Priska: Ist Stealth für den Luftpolizeidienst in Friedenszeiten erlaubt? Fragestunde, Frage 21.8195 vom 08.12.2021.
20 CENCIOTTI, David: Image Of Israeli F-35 Flying Off Beirut (With Radar Reflectors). The Aviationist, 24.05.2018.
1.4 Kann der F-35 autonom eingesetzt werden?
Ich habe es gerade erwähnt: Die Befürworter der F-35A geben zu, dass die Flugleistungen des F-35A nicht besonders gut sind. Aber neben der Stealth-Fähigkeit bringen die Befürworter des F-35A das zweite Gegenargument vor: Dieser Nachteil werde durch die Überlegenheit seiner Informatiksysteme ausgeglichen.21
In der Tat ist der F-35 ein fliegender Supercomputer, ein Verbund komplexer Systeme, der darauf ausgelegt ist, eine Fülle von Informationen zu empfangen, weiterzugeben und in einem riesigen Netzwerk zu kämpfen, das mit vielen Kampf- und Aufklärungs-Flugzeugen sowie mit zahlreichen weiteren Waffensystemen und Unterstützungsmitteln am Boden und zur See verbunden ist.
Als «Datenstaubsauger» und «vernetzter Krieger» macht der Einsatz des F-35A ausserhalb eines Militärbündnisses wenig Sinn, denn er kann seine Fähigkeiten nur in diesem Rahmen wirklich zur Geltung bringen. Eigenständig betrieben, sind seine Fähigkeiten nur beschränkt nutzbar.
Konkret machen die Sensoren und die Fähigkeiten zur Datenintegration nur im Rahmen der NATO Sinn. So haben die europäischen NATO-Mitgliedsländer den F-35 mit dem Ziel angeschafft, ihre Beteiligung am nationenübergreifenden Bündnis zu stärken.
Dafür gibt es einen einfachen technischen Grund. Die enorme Datenmenge, die der F-35 sammelt und verarbeitet, wird innerhalb einer F-35-Flotte allein durch das System des Multifunction Advanced Data Link (MADL) geteilt.22 MADL verbindet freilich ausschliesslich die F-35 untereinander, kann aber nicht für die Luft-Boden-Kommunikation genutzt werden. Die F-35 können mit MADL also keine Daten an die Systeme zur Luftraumüberwachung und zum Management von Bodenoperationen übermitteln, sondern allein mit Data Link 16, das sehr viel weniger leistungsfähig ist. Ausserdem kann MADL nicht für die Kommunikation mit anderen Kampfflugzeugen in Europa verwendet werden, sondern nur zwischen den F-35. Und die anderen F-35 in Europa werden ausschliesslich innerhalb der NATO eingesetzt. Dieselbe Pfadabhängigkeit besteht bei den Sensoren, die für die Lagedarstellung verantwortlich sind. Die Situation Awareness, also der schnelle und vollständige Überblick über die Kampfsituation, ist für den Erfolg entscheidend, insbesondere bei Luft-Boden-Angriffen auf stark verteidigte Bodenziele.23 Dieser Überblick ist im autonomen Betrieb durch die Schweiz unmöglich zu erhalten.
Bei Luft-Luft-Missionen ist die Analyse der empfangenen Signale der bordeigenen Sensoren auch wichtig. Innerhalb von Sekunden muss entschieden werden, ob es sich beim entdeckten Objekt um einen Freund handelt oder einen Feind, den es zu bekämpfen gilt. Um dies zu tun, nutzt der F-35 die sogenannten Mission-Data im Bordcomputer. Diese Informationen sind streng geheim. Die USA verwalten sie für alle F-35-Nutzerstaaten zentral auf der Eglin Luftwaffenbasis in Florida. Je nach Einsatzgebiet lädt der F-35 die Daten in eine Bedrohungsbibliothek (Threat-Library). Im Einsatz werden die empfangenen Radarsignale mit den abgespeicherten Mustern aus der Threat-Library verglichen und bei einer Übereinstimmung das Ziel als Symbol mit Typ und Fähigkeiten des Systems dargestellt.24 Das Ziel kann ein anderes Flugzeug oder ein Flugabwehrsystem sein. Die zentrale Frage ist stets, ob feindlich oder freundlich.
Geht es um Zielidentifikation, wird die Schweiz immer von andern Staaten abhängig sein. Die Schweiz verfügt nicht über die weltweiten Aufklärungskapazitäten, sich diese Informationen selbst zu beschaffen. So nutzt der Rafale natürlich auch eine Bedrohungsbibliothek, die unter französischer Verwaltung steht.25 Die Schweiz muss sich also die politische Frage stellen, von wem sie lieber abhängig sein möchte: von den USA, von Frankreich oder von einem anderen europäischen Staat?
So oder so ist klar, dass die Situation Awareness, bei der bedrohliche Objekte (am Boden oder in der Luft) im Cockpit mit Typ und Standort dargestellt werden, nur bei hundertprozentigem Zugang zu den besten und aktuellsten Mission-Data funktioniert und nicht als Grundfähigkeit des Systems angesehen werden darf. Die Daten der Bedrohungsbibliothek beruhen fast vollständig auf geheimen Informationen (etwa von Spionagesatelliten)26, die nicht gekauft werden können, sondern nur an andere Staaten weitergegeben werden, wenn ein Vertrauensverhältnis besteht und es zudem im Interesse des weitergebenden Staates liegt, diese Informationen zu teilen. Europäische NATO-Staaten haben in der Regel keinen Zugang zu den sensitivsten Bedrohungsdaten der USA und können jene Daten, die sie erhalten, nicht einfach weitergeben. In dieser Hinsicht wird die Schweiz völlig auf sich allein gestellt und vom Lieferstaat abhängig sein. Es sei daran erinnert, dass unser Land, das keine strategische Bedeutung hat, nicht immer gute Erfahrungen mit den USA gemacht hat, wie zum Beispiel die Tatsache zeigt, dass die USA die Lieferung von Ersatzteilen für die F/A-18 Hornet mehrmals unterbrochen haben.
Einfacher formuliert: Wenn die Schweiz den F-35A erwirbt, tritt sie faktisch der NATO bei. Wenn sie nicht Mitglied der NATO ist, hat sie keinen Zugang zu den Informationen, die den F-35A zu dem machen, was er ist: ein fliegender Riesencomputer. Die optimale Nutzung der Sensoren und der Fähigkeiten zur Integration der empfangenen Daten ist nur im Rahmen eines breiten Bündnisses wie der NATO sinnvoll. Und diese Fähigkeiten können nur genutzt werden, falls die Schweiz in die Kommandostruktur der NATO eingebunden ist und die hochkomplexen Prozesse über Jahre hinweg im Verbund intensiv trainiert hat.
Es ist daher verständlich, dass sich mehrere europäische Mitgliedsstaaten der Atlantischen Allianz wie Belgien, Dänemark, Deutschland, Grossbritannien, Italien, die Niederlande und Norwegen für dieses Flugzeug entschieden haben. Damit können sie vernetzt operieren, allerdings um den Preis enormer Investitionen, die eine allseitige Vernetzung erfordert. So gesehen ist deren Entscheid mit Blick auf die NATO-Doktrin der «Vorneverteidigung», d.h. der ständigen Androhung von Überraschungsangriffen, durchaus logisch. Für die Luftpolizei und die Luftverteidigung setzen viele europäische Länder ja andere Flugzeuge ein, die dafür besser geeignet und vor allem im Betrieb kostengünstiger sind.
Noch ein Wort zu Finnland, das sich Ende 2021 auch für den F-35A entschieden hat. Nach der russischen Drohung, die Ukraine anzugreifen, war dies für Finnland der entscheidende Schritt auf dem Weg zum angestrebten NATO-Beitritt. Finnland wurde schon vorher von den USA auf einem Niveau unterstützt, das mit dem eines NATO-Mitglieds vergleichbar war. Finnland und Schweden nahmen seit Jahren regelmässig an grossen Militärübungen der NATO teil. Nun haben beide Länder offiziell ihren Antrag auf Mitgliedschaft in der Allianz gestellt.
Für die Schweiz zeichnet sich eine andere Lösung ab, die sehr einfach und wohl die wahrscheinlichste ist: Unsere Luftwaffe verzichtet darauf, das volle Potenzial der F-35 inklusive der Interoperabilität mit der NATO zu nutzen. Und die Öffentlichkeit wird dies höchstwahrscheinlich nicht erfahren... Wir werden später auf diese Frage zurückkommen.
Es bleibt hinzuzufügen, dass der Unterschied zwischen dem F-35A und den europäischen Kampfflugzeugen im Bereich Sensorintegration und Kampfübersicht gar nicht gross ist, wie eine vergleichende Bewertung der Avionik des F-35A und jener der Rafale (stellvertretend für die europäischen Kandidaten) zeigt. Viele dieser Systeme sind in beiden Flugzeugtypen eingebaut und haben ein vergleichbares Niveau, nur punktuell mit leichtem Vorteil für den F-35A.
So ist die Integration aller Sensordaten in ein einziges Lagebild beiden Typen gemeinsam. Beim F-35A werden alle Ziele und Bedrohungen (aus der Luft und am Boden) auf dem Helmbildschirm angezeigt, ebenso beim Rafale ab dem Standard F4. Unterschiede sind nur in wenigen Situationen feststellbar.
Beim Entscheid F-35A oder ein Kampfflugzeug der europäischen Konkurrenz handelt es sich also viel weniger um eine technische als um eine politische Frage: Will sich die Schweiz von der NATO und den USA abhängig machen oder die bewährte Zusammenarbeit zum Schutz unseres Luftraums mit den europäischen Nachbarstaaten fortsetzen?
21 BERSET, Beni, Chef-Testpilot bei armasuisse, befragt von: WIDMER, Reto: Kampfjet- Beschaffung F-35: So ist die Digitalisierung bei den Kampfjets angekommen. SRF 22.08.2021.
22 SIMINSKI, Jacek: F-35: Capabilities, Missions, Kinematics, Role In Ukrainian Crisis And Beyond. Interview with Billie Flynn. The Aviationist, 07.04.2022; «Fifth-generation fighters are typically limited to communicating with each other and to command and control centers via legacy tactical data connections, not in their native, but incompatible digital 'languages' [as the] Multifunctional Advanced Data Link [MADL] for F-35», nach: US AIR FORCE: F-22, F-35 first secure bidirectional data sharing. Secretary of the Air Force Public Affairs (AFNS), 14.12.2020.
23 JENSEN, David: F-35 Integrated Sensor Suite: Lethal Combination. Aviation Today, 01.10.2005.
24 OSBORN, Kris: The F-35 Uses a «Threat Library» To Destroy Its Enemies. National Interest, Oct 2018.
25 THALES: Thales on Bord the Dassault Aviation Rafale. www.thalesgroup.com, abgerufen am 12.06.2022.
26Intelligence Support to the Adaptive Acquisition Framework (ISTAAF) Guidebook. US Department of Defence, Acquisition Intelligence Division, 15.09.2021.
Kapitel 3
2 Desaströse Erfahrungen in den USA
2.1 Die Entwicklung des F-35 – eine endlose Geschichte des Scheiterns
Hinter dem F-35 steht ein Jahrzehnte altes, äusserst ehrgeiziges Entwicklungsprogramm für ein Kampfflugzeug, das Tarnkappenmerkmale mit einem leistungsfähigen Sensorsystem kombiniert, um Angriffe tief in feindlichem Gebiet und vernetzte Operationen durchführen zu können.
Der Beginn des Programms geht auf das Jahr 1997 zurück, als das Pentagon Boeing und Lockheed einlud, im Wettbewerb für das Joint Strike Fighter-Programm Demonstrationsflugzeuge vorzuschlagen. 2001 erhielt Lockheed den Zuschlag. Der Programmname ist aufschlussreich: Joint steht für den Verbund von Luftwaffe, Flotte und Marine, Strike für den Angriff tief im feindlichen Territorium und Fighter für Kampfflugzeug. Das Ziel war also ein Flugzeug, das allen Teilstreitkräften für den Angriff zur Verfügung steht. Der F-35 ist ein Flugzeug, das für den Angriff in der Tiefe konzipiert ist, nicht für die Verteidigung. Dieser Punkt ist von zentraler Bedeutung und fasst das ganze Missverständnis zusammen, das dem Entscheid der Schweiz zugrunde liegt.
Ein erster Prototyp des F-35 verliess im Februar 2006 die Produktionshalle in Fort Worth, Texas. Der F-35A, der konventionell startet und landet, war für die US-Luftwaffe bestimmt, der F-35B für Kurzstart und Senkrechtlandung für das Marine Corps und der F-35C für die sehr kurzen Pisten auf den Flugzeugträgern der Navy.
Der erste F-35A wurde 2016 in Dienst gestellt.27 Die Strategie, das Flugzeug bereits während der Entwicklungsphase zu beschaffen und zu exportieren, bevor die abschliessenden Tests erfolgt waren, führte und führt bis heute zu zahlreichen kostspieligen Änderungen an bereits ausgelieferten Jets, die zur Nachrüstung und Reparatur in die Fabriken zurückgerufen werden mussten.28 Seit Jahren werden in den USA Stimmen laut, die diese verhängnisvolle Strategie kritisieren, die sich nicht bewährt hat.29 2009 versprach Lockheed, sich bis spätestens 2014 den abschliessenden Tests zu unterziehen; sie sind bis heute ausstehend...
Seit Beginn zog dieses Programm wegen seiner exorbitanten Kosten, verspäteten Lieferungen und technischen Mängeln30 die Kritik des Rechnungshofs und breiter politischer Kreise der USA auf sich, die bis heute nicht verstummt sind. Die Aufsichtsorgane der USA veröffentlichen regelmässig vernichtende Berichte über dieses Flugzeug, das eine Katastrophe nach der anderen verursacht,31 zuletzt, weil das immer noch pannenanfällige Triebwerk ausgetauscht werden muss.32
Der F-35 ist ein einsitziger und einmotoriger Tarnkappenjet der fünften Generation, der für den Angriff auf stark verteidigte Bodenziele entwickelt wurde. Die Streitkräfte, die über den F-35 verfügen, setzen ihn fast ausschliesslich für diese Fähigkeit ein. Der Einsatz im Luft-Luft-Kampf erfolgt nur mangels besserer Möglichkeiten, etwa wenn die US Navy auf einem Flugzeugträger zusätzlich zum F-35C über keine Jagdflugzeuge verfügt, die im Normalfall für den Schutz des Luftraums besorgt sind.
Das Industrieprogramm sah vor, für drei Teilstreitkräfte parallel ein einziges Kampfflugzeug zu entwickeln – dies in der Hoffnung, so Kosten sparen zu können – den F-35A (Air Force), -B (Marines) und -C (Navy) mit möglichst vielen Gemeinsamkeiten. Die drei Flugzeuge stellten sich aber als weit unterschiedlicher als erwartet heraus, was eine der Ursachen für die vielen technischen Probleme des Programms ist. Diesen Umstand leugnet armasuisse, indem sie in der Armeebotschaft 2022 die äusserst niedrige Risikoprämie von 1,5 Prozent bei der Beschaffung des F-35A damit rechtfertigt, der Hersteller fertige «die Schweizer Kampfflugzeuge nach denselben Standards und Verfahren, nach denen über 3000 Flugzeuge hergestellt werden». Nein, es sind viel weniger – die Bestellungen und Produktionszahlen liegen weit unter den ursprünglichen Planungen, sind seit 2021 stark rückläufig und werden nie die illusionäre Anzahl von 3000 erreichen – und zudem unterscheiden sich die drei Flugzeugtypen immer mehr. Anstatt wie ursprünglich angedacht, 70–90 Prozent gemeinsame Merkmale zu haben, ähneln sich die drei Typen F-35A, F-35B und F-35C nur noch zu 20–25 Prozent.33 Der US-Kongress beschloss deshalb Ende 2021, das Büro für das gemeinsame Programm zu schliessen.
Probleme gab und gibt es bis heute in grosser Zahl, ein Dauerthema in diesem Programm, was zu einer gewaltigen Kostenexplosion und erheblichen Verzögerungen geführt hat. War im Jahr 2007 geplant, die volle Produktionsreife bis 2013 zu erreichen,34 musste 2012 dieses Ziel um sechs Jahre auf 2019 verschoben werden35 und ist dennoch bis heute nicht erreicht. Nach wie vor befindet sich der F-35 in der Entwicklungsphase. Die volle Produktionsreife wird nicht vor 2024 erreicht – elf Jahre später als ursprünglich geplant.36 Rechnete man 2010 noch mit Lebenszykluskosten (Life-cycle-costs) von 764 Milliarden US-Dollar,37 so geht man inzwischen von mehr als dem Doppelten aus, nämlich 1700 Milliarden US-Dollar.38
Die Entwicklung des F-35 wurde in Etappen geplant, wobei die Funktionstüchtigkeit der Avionik und der Informatik nacheinander getestet werden sollten. In jeder Phase wurden Hunderte von Fehlern festgestellt, was den Prozess langsam, komplex und kostspielig machte. Derzeit befindet man sich in der Etappe Block 3F, aber die volle Einsatzfähigkeit muss auf den Block 4 warten. Das 2018 hätte bis 2023 abgeschlossen sein und gut 10 Milliarden US-Dollar kosten sollen. Aber im April 2022 berichtete der US-Rechnungshof, Block 4 werde frühestens 2029 fertig und bis dahin deutlich über 15 Milliarden US-Dollar verschlingen.39
Die US-Regierung versprach der Schweiz, deren Jets ab 2027 ausgeliefert werden sollen, trotzdem den Stand Block 4. Bis dahin müssen aber noch viele Probleme gelöst und riesige Investitionen getätigt werden. So soll unter anderem das Triebwerk ausgetauscht werden. Auch die Software für die gesamte Wartungs- und Einsatzlogistik, ALIS genannt, steht auf dem Prüfstand. Die Entwicklung von ALIS kostete bisher 16,7 Milliarden Dollar, es funktioniert aber nach wie vor nicht...40
Die Liste der bis heute ungelösten 870 Mängel ist beeindruckend. Hier nur eine kleine Auswahl:
Fliegt der F-35 länger als ein paar Sekunden Überschallgeschwindigkeit, so nehmen Triebwerk und Material ernsthaften Schaden.
Der Schleudersitz erfüllt die Sicherheitserwartungen nicht.
Das Fahrwerk bereitet gröbere Probleme.
Der Waffenschacht pflegt sich zu überhitzen.
Im System der Sauerstoffversorgung gibt es Mängel.
Die Waffensysteme zum Angriff auf Bodenziele treffen wenig genau.
Wird einer der zahlreichen F-35-Tanks von einem Projektil getroffen, ergeben sich schwerwiegende Feuer- und Sicherheitsprobleme. Diese enden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einer Katastrophe.
Der Blitzschutz ist so schlecht, dass schwere technische Schäden auftreten, falls F-35 Gewittern zu nahe kommen. Die US-Behörden erliessen deshalb die Vorschrift, dass F-35 mindestens 40 km von Gewittern entfernt fliegen müssen, um sie vor Blitzen zu schützen. Auch am Boden müssen F-35 durch Blitzableiter geschützt werden, falls ein Gewitter weniger als 18 km von der Basis entfernt ausbricht.
41
Der Helm des Piloten gilt zwar als technologisches Schmuckstück, das ihm alle benötigten Informationen liefert. Der Helm gilt aber als wenig zuverlässig, obschon der Pilot für seine eigene Sicherheit und die erfolgreiche Erfüllung seiner Missionen darauf angewiesen ist.
Die Mängel des F-35, der sich nach wie vor in Entwicklung befindet und noch lange nicht fertiggestellt ist, sind nicht vernachlässigbar, denn sie haben konkrete Folgen für alle Länder, die den Jet gekauft haben. Neben dem Unfallrisiko und den hohen Kosten für Reparaturen und Nachrüstungen leben diese Länder ständig mit dem Risiko, dass ihre Flotte ganz oder teilweise stillgelegt werden muss. Einige Beispiele:
• 2016 legten die amerikanischen und norwegischen Luftstreitkräfte einen Teil ihrer F-35-Flotte still, weil sich die Isolierung der Kühlleitungen für die Avionik in den Treibstofftanks ablöste und bröckelte. Das Problem wurde anlässlich grösserer Wartungsarbeiten im Depot entdeckt. Nach einer allgemeinen Überprüfung betraf es 57 Flugzeuge, von denen sich 42 noch in der Produktionsphase befanden.42