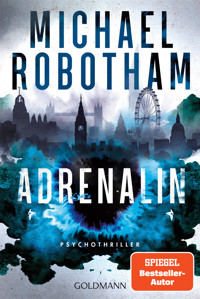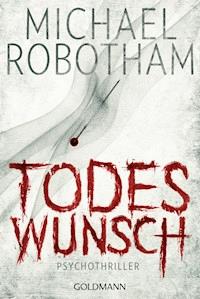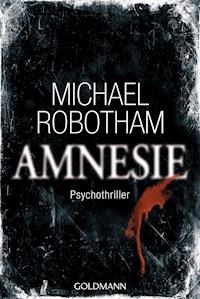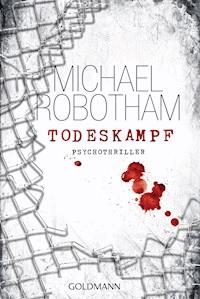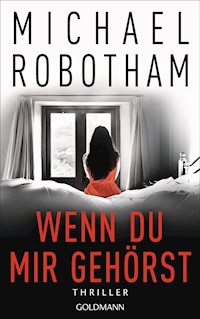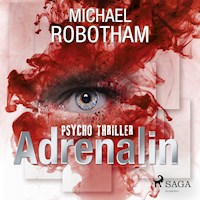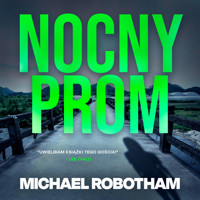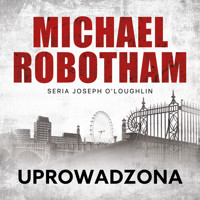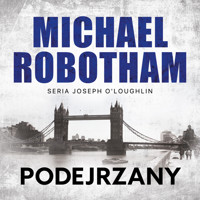14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Phil McCarthy
- Sprache: Deutsch
»Ohne jeden Zweifel: Michael Robotham ist definitiv einer der besten Thrillerautoren der Welt.« literaturmarkt
Deiner Familie entkommst du nicht ...
Die junge Polizistin Phil McCarthy hat es nicht leicht – als Tochter eines Kriminellen muss sie sich doppelt beweisen. Doch sie liebt ihren Beruf und setzt alles daran, Karriere zu machen. Eines Nachts, während einer routinemäßigen Streife, begegnet sie einem kleinen Mädchen, das allein durch die Straßen irrt. Phil bringt das Kind nach Hause, wo sich ihr ein schrecklicher Anblick bietet: Die Mutter des Mädchens sitzt tot in der Küche, gefesselt an einen Stuhl. Fast zeitgleich wird ganz in der Nähe ein brutaler Überfall auf den Ehemann der Toten verübt. Zwei grausame Verbrechen, die in Verbindung zu stehen scheinen, und ausgerechnet Phils Vater steht bald im Fokus der Ermittlungen ...
»Von Anfang bis Ende Spannung pur!« Kirkus Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Als Tochter eines Londoner Gangsterbosses wandelt die Polizistin Phil McCarthy auf einem schmalen Grat zwischen ihrem Beruf und ihrer Familie. Doch Phil liebt ihren Job, und sie setzt alles daran, voranzukommen. Als sie eines Nachts mit einem Kollegen auf Streife geht, treffen sie auf ein kleines Mädchen, das mutterseelenallein herumirrt. Phil bringt das Kind nach Hause und findet dort die Mutter tot auf. Zeitgleich wird wenig entfernt ihr Mann überfallen und mit einer Sprengladung am Körper zurückgelassen. Die beiden brutalen Verbrechen scheinen miteinander verbunden zu sein, und es gibt Hinweise, dass Phils Vater der Drahtzieher ist. Unversehens gerät die Polizistin zwischen die Fronten, und sie trifft eine Entscheidung, mit der sie nicht nur ihre Karriere, sondern auch ihr Leben aufs Spiel setzt …
Weitere Informationen zu Michael Robotham finden Sie am Ende des Buches.
Michael Robotham
Die weiße Krähe
Psychothriller
Aus dem Englischen von Kristian Lutze
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »The White Crow« bei Sphere, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung September 2025
Copyright © der Originalausgabe 2025 by Bookwrite Pty.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © Zoltan Toth/Trevillion Images; FinePic®, München
KN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30542-0V002
www.goldmann-verlag.de
Für Lesley Poole
Er war ein Mörder, eine Kreatur, die Beute machte und sich von Lebendigem nährte und ohne Hilfe, allein, nur kraft ihrer eigenen Stärke und ihres Könnens, in einer feindlichen Umgebung triumphierte, in der nur die Starken überleben.
Jack London, Der Ruf der Wildnis
1
In der schwarzen Nacht der Seele ist es immer drei Uhr morgens. Diesen Satz hat F. Scott Fitzgerald fast sechzig Jahre vor meiner Geburt geschrieben, aber er ist heute immer noch ziemlich wahr. Um diese Zeit schläft London nicht. Es ruht bloß die Augen aus, summt ungeduldig und wartet darauf, dass die Sonne aufgeht. Es ist wie ein alterndes zahnloses Ungeheuer, das sich durch Jahre kaut, die zu schlucken es sich müht.
Ich sitze am Steuer eines Streifenwagens und fahre über die Prince Charles Road nach Hampstead in North London. Das Licht der Scheinwerfer gleitet über den nassen Asphalt und spiegelt sich in den glänzenden Oberflächen geparkter Autos. Von den Kühlerhauben perlen Regentropfen. Neben mir hat PC Rowan Cooper ein Handy ans Ohr geklemmt und nimmt Essensbestellungen entgegen.
Wir sind unterwegs, um Frühstück zu besorgen, in einer jüdischen Bäckerei in East Finchley, die die besten Salt Beef Bagels jenseits der Brick Lane macht. Unsere Kollegen in der Polizeistation Kentish Town haben Hunger oder Langeweile oder beides, obwohl Langeweile ein Wort ist, das niemand in den Mund nimmt. Eine ruhige Nacht ist eine gute Nacht. Und gute Nächte sind selten.
»Was willst du?«, fragt Coop.
»Räucherlachs und Frischkäse.«
»Du bist so ein Mädchen.«
»Ich bin Pescetarierin.«
»Ist das so was wie eine Anglikanerin?«
»Nein, aber ich komme auch so direkt in den Himmel.«
Coop ist einer der wenigen Personen, die mich Philomena und nicht Phil nennen. Meine Mutter ist eine andere. An meinem ersten Tag in Kentish Town hat sie den Sergeant meiner Station angerufen und ihm erklärt, dass ich mit PC Philomena McCarthy anzusprechen sei. Der Sergeant hielt es für eine Verarsche, und ich wurde wochenlang damit aufgezogen.
Coop ist gerade erst mit der Polizeischule fertig, hat jedoch das Selbstvertrauen eines sehr viel erfahreneren Kollegen. Vielleicht ist das ein Männerding. Als ich nach meinem Abschluss in Henderson ganz neu in dem Job war, habe ich verzweifelt versucht, mich anzupassen, anstatt aufzufallen, was typisch weiblich ist. Das war vor vier Jahren, und inzwischen fühle ich mich wohler in meiner Uniform, achte jedoch immer noch darauf, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Mit einer Familie wie meiner ist es das Beste, sich bedeckt zu halten.
Dies ist meine letzte Schicht nach sechs Arbeitstagen hintereinander, die mit zwei Frühschichten begonnen haben, gefolgt von zwei Nachmittagsschichten und jetzt zwei Nachtschichten, bevor ich vier Tage frei habe. Morgen, das heißt heute, habe ich eine Familienfeier – eine Taufe in einer Kirche in Greenwich –, wo ich Patentante des ersten Babys meiner Cousine Rosie werden soll.
Danach entführt Henry mich zu einem romantischen Wochenende nach Paris, was eigentlich ein Geheimnis sein soll. Aber ich habe, auf der Suche nach Geld für die Putzfrau, in seiner Jackentasche die Quittung für zwei Eurostar-Tickets gefunden. Weitere Hinweise habe ich dann in seinem Facebook-Feed entdeckt – Airbnb-Wohnungen im Quartier Latin. Vor Siri hat man keine Geheimnisse.
Das wird unser erster Trip ins Ausland seit unserer Hochzeitsreise – zehn extrem feuchte Tage auf den Malediven, wo ein Tropensturm namens Bethany alle Niederschlagsmengenrekorde brach. Wir haben die gesamte Zeit im Bett verbracht, zehn Tage Sex und Netflix-Binge-Watching, nur unterbrochen davon, die Balkontür mit Handtüchern abzudichten und im Restaurant Tropfen von oben auszuweichen.
Vermutlich steht Sex auch an diesem Wochenende ganz oben auf der Agenda, weil wir beide in letzter Zeit so beschäftigt waren und Henry mir die Idee schmackhaft machen will, eine Familie zu gründen. Die Verführung wird bestimmt nett – Champagner, Kaviar und Blick auf die Seine –, aber ich werde meine Meinung nicht ändern. Noch nicht.
Wir sind erst seit einem Jahr verheiratet, und ich bin ganz zufrieden damit, fürs Erste noch weiter zu üben. Es ist schließlich nicht so, als würde mir meine biologische Uhr schon laut in den Ohren ticken. Ich bin neunundzwanzig, Henry ist einunddreißig, und wir haben eine Hypothek, deren Tilgung zwei Gehälter braucht. Ganz zu schweigen von dem Unterhalt an seine Ex-Frau, die Henry behandelt wie ihren persönlichen Geldautomaten.
Was Babys betrifft, lautet meine Antwort »noch nicht«, aber ich habe einen groben Zeitplan im Sinn. Mit vierunddreißig das erste, ein weiteres mit sechsunddreißig. Ein Mädchen. Ein Junge. Wenn ich sie bloß bei Uber Eats bestellen könnte, mit Knoblauchbrot als Beilage.
Im Augenblick genieße ich meine berufliche Laufbahn. Ich wurde vor acht Monaten von Southwark nach Camden versetzt, und bisher hat niemand in der Wache Kentish Town meine familiären Verbindungen erwähnt – obwohl ein paar von ihnen sie bestimmt kennen. Manche Kinder müssen elterlichen Erwartungen entsprechen. Ich muss ihnen entkommen.
Mein Vater ist Edward McCarthy, meine Onkel sind die McCarthy-Brüder, die die Boulevardpresse als »schillernde lokale Größen« oder »ehemalige Häftlinge«, jedoch nie als »Gangster« bezeichnet, weil mein Vater die Nummer seines Anwalts auf Kurzwahl gespeichert hat.
Ich habe nie verstanden, warum Menschen von »organisiertem Verbrechen« sprechen. Nie ist von »organisierter Krankenpflege«, »organisiertem Unterrichten« oder »organisierter Buchhaltung« die Rede. Warum bekommen Verbrecher diese zusätzliche Klassifizierung? Vielleicht weil die meisten Verbrechen chaotisch, impulsiv und dumm sind, weshalb die Täter in der Regel auch gefasst werden. Nicht jedoch Edward McCarthy. Anschuldigungen und Unterstellungen perlen an ihm ab, als wäre er John Gotti, der Teflon-Don. Nichts bleibt je haften.
»Mit einer Extraportion Senf«, übermittelt Coop die letzte Bestellung. »Wir sind in einer Viertelstunde da.«
Zufrieden steckt er sein Telefon weg und trommelt auf das Armaturenbrett. Für Coop ist Essen wie ein Wettkampfsport, was sich allmählich auch um seine Hüften abzeichnet, obwohl er mir ständig erzählt, er würde für den London Marathon trainieren.
Um diese Uhrzeit sind die meisten Straßen verlassen bis auf Mülllaster, Straßenkehrmaschinen und hin und wieder ein schwarzes Taxi, das heutzutage auch jede andere Farbe haben kann. Es hat aufgehört zu regnen, und die Lichter der Laternen sind von einem nebligen gelben Schimmer umhüllt, der sich in den Pfützen auf der Straße spiegelt.
Wir sind auf dem Haverstock Hill, nicht weit von der U-Bahn-Station Belsize Park, als ein Fahrradfahrer aus einer Nebenstraße geschossen kommt und eine rote Ampel überfährt. Ich sehe etwas Gelbes aufblitzen und trete auf die Bremse. Räder blockieren. Reifen quietschen. Der Fahrradfahrer weicht aus und dreht sich im letzten Moment mit einem angstvollen Blick um. Der Wagen stupst gegen sein Hinterrad. Das Rad gerät ins Schlingern, doch der Fahrradfahrer wahrt das Gleichgewicht, steigt aus dem Sattel, tritt mit in knappen Radlerhosen wackelndem Arsch in die Pedale und schießt weiter den Haverstock Hill hinunter.
»Verdammt!«, sagt Coop und stützt sich mit den Händen am Armaturenbrett ab. Sein Notizblock und sein Handy sind in den Fußraum gefallen.
»Ein Irrer«, sage ich und sauge Luft zwischen den Zähnen ein.
»Willst du ihn verfolgen?«
Wir erwägen die Frage still und denken beide das Gleiche. Falls wir den Radfahrer einholen, verbringen wir die restliche Nacht damit, Berichte zu schreiben, Aussagen vorzubereiten und das Formular für eine Anzeige auszufüllen. Nach zwölf Stunden Arbeit und einem halben Tag beim Gericht dürfen wir dann zusehen, wie er sich vor den Richtern aufführt wie ein Chorknabe, die ihm einen Klaps auf die Finger geben und ihn ermahnen werden, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein.
»Ich glaube, wir haben ihm einen ordentlichen Schrecken eingejagt.«
»Er hat sich in die Hosen geschissen«, sagt Coop.
Der Streifenwagen steht im Leerlauf mitten auf der Kreuzung. Bevor ich losfahre, werfe ich einen Blick in den Rückspiegel.
»Hast du das gesehen?«, frage ich und drehe mich um.
»Was?«
»Auf der Straße. Hinter uns. Ein Kind.«
»Du hast ein Kind gesehen?«
»Ja.«
Er folgt meinem Blick. Die Straße ist leer.
»Bist du sicher?«
»Ja.«
Ich parke den Wagen an der Ecke und gehe zurück zu der Kreuzung. Coop holt mich joggend ein.
»Wenn du sagst Kind, wie alt?«
»Noch klein. Ein Junge, glaube ich.«
»Wo war er?«
»Er stand an der Straßenecke.«
Wir haben die Stelle erreicht. Die meisten Häuser liegen ein Stück von der Straße zurück, die kleinen Vorgärten sind von Zäunen, Backsteinmauern oder sauber gestutzten Hecken umgeben. Wir blicken den Haverstock Hill hinauf und hinunter.
»Vielleicht war es ein Hund«, sagt Coop.
»Nein.«
Unsere Schulterfunkgeräte knacken gleichzeitig.
»An alle Fahrzeuge. Alle Fahrzeuge. Notfalleinsatz. Andauernder schwerer Zwischenfall. Hatton Garden. Fahren Sie zum Holborn Circus und riegeln Sie den Bereich ab.«
Coop antwortet über Funk. »Hier Kilo Quebec Drei Null. Zwölf Minuten entfernt. Ende.«
»Fahr du«, sage ich.
»Wir sollten zusammenbleiben.«
»Ich lasse kein Kind allein hier draußen.«
Ich spreche in mein Funkgerät. »Hier Kilo Quebec Drei Null. PC McCarthy. Ich habe ein verirrtes Kind im Pyjama gesehen. Ich nehme die Suche zu Fuß auf.«
»Was ist Ihre Position?«
»Haverstock Hill auf Höhe England’s Lane.«
»Haben Sie eine Beschreibung?«
»Ein kleiner Junge in einem Schlafanzug.«
»Ungefähres Alter?«
»Schwer zu sagen. Ich habe ihn nur ganz kurz gesehen.«
»Brauchen Sie Unterstützung?«
»Wenn, gebe ich Bescheid.«
»Verstanden. Ende.«
Ich hole eine Taschenlampe und eine Wärmedecke aus dem Streifenwagen und sehe Coop nach, als er wegfährt. Über Funk höre ich die Unterhaltung der Kollegen zu dem Einsatz in Hatton Garden. Offenbar ein Raubüberfall. Das war’s dann wohl mit der ruhigen Nacht.
Ich gehe langsam den Bürgersteig der England’s Lane entlang, leuchte unter Autos und spähe über Hecken. Die Wurzeln der Bäume haben die Steine angehoben, sodass das Pflaster stellenweise uneben ist. Die Straße ist auf beiden Seiten von Blöcken aus rotem Backstein gesäumt, unterbrochen von dem einen oder anderen freistehenden Einzel- oder Doppelhaus. Wahrscheinlich stehen die meisten unter Denkmalschutz. Teuer. Abgedunkelt. Im Tiefschlaf.
Eins der Tore steht halb offen. Ich betrete den Vorgarten und höre ein Rascheln zwischen feuchten Blättern im Dickicht. Es könnte eine Katze oder ein Fuchs sein. London ist voller Füchse, die sich perfekt an das städtische Leben angepasst haben. Sie plündern Mülltonnen und ziehen ihre Brut in den Parks und Heideflächen auf.
Ich schwenke die Taschenlampe hin und her, gehe in die Hocke und blicke unter die Hecke. Der Strahl der Taschenlampe erfasst einen blassen weißen Fuß. Ein Schienbein, einen Knöchel, fünf schlammige Zehen, eine Schlafanzughose.
»Hallo«, sage ich.
Der Fuß verschwindet.
Ich setze mich auf den Rasen und spüre, wie die Feuchtigkeit durch meine Hose dringt. Der Garten riecht nach Kompost und Grasschnitt.
»Ich heiße Phil. Hast du auch einen Namen?«
Schweigen.
»Lass mich raten. Vielleicht heißt du Peter wie Peter Rabbit oder Stuart wie Stuart Little. Bist du ein Kaninchen oder eine Maus?«
Eine dünne Stimme antwortet: »Nein.«
»Du klingst wie eine Maus. Mäuse jagen mir jedes Mal einen Schrecken ein. Ich habe immer Angst, dass sie in meinem Hosenbein nach oben laufen. Das würdest du doch nicht machen, oder?«
»Nein.«
»Ich glaube, ich brauche einen Beweis, dass du keine Maus bist. Vielleicht könntest du mir deine Finger zeigen. Mäuse haben keine Finger.«
Nach einer kurzen Pause raschelt es im Laub. Eine kleine Hand wird unter den Büschen ausgestreckt.
»Hmm«, sage ich. »Vielleicht haben Mäuse doch Finger. Aber sie haben bestimmt keine Zehen. Hast du Zehen?«
Nach einer weiteren Pause tauchen unter der Hecke zwei Beine in einer Schlafanzughose auf.
»Dann bist du wohl keine Maus. Aber was könntest du sonst sein?«
»Ich bin ein kleines Mädchen.«
»Nein. Das ist unmöglich. Kleine Mädchen wohnen nicht in Hecken. Kleine Mädchen sollten warm eingekuschelt in ihren Bettchen liegen.« Ich rutsche ein Stück näher. »Ich muss noch mal von vorn anfangen und deinen Namen raten. Du klingst wie eine Jasmine oder eine Ariel oder eine Elsa. Auf jeden Fall eine Prinzessin.«
»Ich will keine Prinzessin sein.«
»Verstehe. Dann heißt du vielleicht Ninty Minty oder Cutie Patootie?«
»Ich bin Daisy«, sagt die Stimme.
»Das ist ein hübscher Name. Wie das englische Wort für Gänseblümchen. Ich mag Gänseblümchen. Was machst du so spät noch draußen?«
»Ich konnte Mummy nicht wecken.«
»Oh, verstehe.«
»Und ich darf nicht mit Fremden reden.«
»Das ist ein sehr guter Rat, aber ich bin keine Fremde. Ich bin eine Polizistin. Und ich möchte dich nach Hause bringen.«
Ich warte wieder, doch in der Hecke rührt sich nichts.
»Ich sag dir, was ich machen werde, Daisy. Ich leg mich hin und schlafe ein bisschen. Das würde ich zwar lieber irgendwo machen, wo es warm und trocken ist, aber ich kann dich nicht hier draußen allein lassen.«
Ich entfalte die Rettungsdecke mit der Silberfolie, breite sie auf dem Rasen aus, und rolle meinen Körper darauf zusammen.
Nach einer Weile raschelt es im Laub. Ich öffne die Augen einen Spalt und sehe ein junges Gesicht auftauchen. Daisy krabbelt aus der Hecke, kniet sich neben mich und rüttelt sanft an meiner Schulter. Sie hat einen Pagenschnitt, ihre Wange ist mit Schlamm verschmiert.
»Ich muss mal Pipi«, sagt sie.
»Okay, dann bringe ich dich nach Hause.«
Daisy schüttelt den Kopf. Sie presst die Schenkel zusammen.
»Du könntest einfach hier machen«, schlage ich vor.
»Im Garten?«
»Als ich so alt war wie du, habe ich immer im Garten Pipi gemacht.«
Daisy sieht mich skeptisch an.
»Du musst vorsichtig sein, damit nichts auf deine Füße spritzt«, sage ich. »Zieh deine Schlafanzughose runter und geh in die Hocke. Ich halte dich an den Armen fest, damit du nicht umfällst.«
Daisy befolgt meine Anweisungen. Sie streckt ihren kleinen Hintern in Richtung Hecke.
»Es kommt nichts«, sagt sie.
»Denk an fließendes Wasser.«
»Warum?«
»Das hilft.«
Ich fange an ein Kinderlied zu singen, das ich von früher kenne. »Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Und wenn’s genug geregnet hat, dann wächst auch wieder Gras.«
Kurz darauf höre ich das Plätschern von Urin.
»Womit soll ich mich abwischen?«, fragt Daisy.
»Mit einem Papiertaschentuch«, sage ich und hole eins aus meiner Tasche.
Nachdem sie die Schlafanzughose wieder hochgezogen hat, wickle ich sie in die Foliendecke.
»Du hast gesagt, du konntest deine Mummy nicht wecken. Lag sie im Bett?«
»Nein.«
»Wo war sie denn?«
»In der Küche.«
Meine Hoffnung sinkt. »Wo wohnst du?«
Sie weist in die Dunkelheit.
»Kannst du es mir zeigen?«
Daisy fasst meine Hand und führt mich leicht humpelnd zum Bürgersteig. Ihre Hand ist eiskalt.
»Wie alt bist du?«, frage ich.
»Fast sechs.«
»Und wie heißt du mit Nachnamen?«
»Kemp-Lowe.«
»Sind das zwei Namen oder einer?«
»Es ist mein Name.«
Wir biegen in die Antrim Road und gehen vorbei an Mietshäusern aus rotem Backstein und viktorianischen Reihenhäusern, die zum größten Teil in Wohnungen umgewandelt worden sind.
Vor einem großen Einzelhaus bleibt Daisy stehen. Das Eisentor steht offen, und ein gepflasterter Weg führt zu einer von Glyzinen umrankten Tür.
»Ist das dein Haus?«
Sie nickt.
»Wie bist du rausgekommen?«
Daisy zeigt auf die Haustür, als sollte das klar sein.
»Gehört eins von diesen Autos deiner Mummy oder deinem Daddy?«
Sie blickt die Straße auf und ab und zeigt auf einen silbernen Mercedes der Luxusklasse. Ihre Familie hat offensichtlich Geld. Ich drücke auf den Rufknopf meines Funkgeräts. »Kilo Quebec Drei Null an Zentrale.«
»Hier Zentrale, ich höre.«
»Ich habe das Kind gefunden. Ein Mädchen, fünf Jahre alt. Sie heißt Daisy Kemp-Lowe. Sie sagt, sie konnte ihre Mutter nicht wecken. Ich stehe jetzt vor dem Haus. Können Sie eine Kennzeichenabfrage für mich durchführen?«
»Zentrale, verstanden.«
»Ein silberner Mercedes. Hotel Victor Sechs Drei Golf Mike Charlie.«
Wir setzen uns auf die Treppe vor dem Haus und warten. Ich wickle die Wärmedecke enger um Daisy. Dabei fällt mir das Blut am Ärmel ihres Schlafanzugs auf.
Mein Funkgerät krächzt. »Zentrale an Kilo Quebec Drei Null. Das Fahrzeug ist zugelassen auf einen Russell Kemp-Lowe. Antrim Road fünfundsiebzig.«
»Verstanden.«
Ich sehe Daisy an. »Dann wollen wir dich mal wieder ins Bett bringen.«
2
Drei Meilen Luftlinie entfernt betritt Detective Chief Inspector Brendan Keegan ein Juweliergeschäft in Hatton Garden. Er zermalmt Scherben unter seinen Sohlen und filmt mit seinem Handy.
»Hi, wie geht es Ihnen?«, fragt er einen Mann, der auf einem Drehstuhl sitzt.
Der Mann kann nicht antworten, weil sein Mund mit Paketband zugeklebt ist. Seine Handgelenke und Knöchel sind mit Klebeband an den Stuhl gefesselt. Er ist Anfang vierzig und auf eine verwahrloste Art leicht übergewichtig, als würden seine sportlichen Aktivitäten sich darauf beschränken, hin und wieder dem Bus hinterherzurennen und nach der Fernbedienung des Fernsehers zu greifen.
Sein Pony klebt an seiner feuchten Stirn, Schweißtropfen sind sein Gesicht hinunter bis zu den Rändern des Paketbands geflossen. Ein Fahrradschloss ist um die Hüfte des Mannes geschlungen und durch die Ärmel einer dicken schwarzen Weste gefädelt, die von drei Plastikklammern in der Mitte der Brust zusammengehalten wird. Von der Weste führen Drähte zu einem zigarrenförmigen Glasfläschchen, das auf dem rechten Oberschenkel des Mannes liegt. Darin befindet sich flüssiges Metall. Ein Neigungsschalter. Wenn der Mann sich bewegt, fließt das Quecksilber in der Röhre nach unten und schließt den Stromkreis.
»Ich bin DCI Keegan. Sie können mich Brendan nennen.«
Der Mann auf dem Stuhl bewegt sich nicht. Wenn die Augen das Fenster zur Seele eines Menschen sind, braucht dieses ein Glasreinigungsmittel und einen Abzieher, denn seine Augen sind von Qual getrübt und jedes Verstandes beraubt. Er kann sich nicht bewegen. Er darf sich nicht bewegen.
Keegan filmt weiter die zertrümmerten Vitrinen und offenen Schubladen. Ein einzelner Anhänger in Form einer Träne ist in der Eile runtergefallen und liegt zwischen Scherben und zersplitterten Holzstücken auf dem Boden. Der Mann sitzt an einem Schreibtisch in einem Büro auf der Rückseite des Verkaufsraums. Hinter ihm steht ein großer, im Boden festgenieteter, eiserner Tresor, offen und leer. Eine Alarmanlage schrillt ununterbrochen in die Stille, und flackerndes gelbes Licht fällt auf den nassen Bürgersteig und die vor dem Laden parkenden Fahrzeuge.
Zwei Constables haben als Erste auf den Alarm reagiert, die offene Tür, den ausgeraubten Laden und den Mann auf dem Stuhl vorgefunden und Verstärkung gerufen. Dabei erwähnten sie das Wort »Bombe«, was alle in erhöhte Aufmerksamkeit versetzte, inklusive Keegan, den diensthabenden leitenden Detective in der Polizeistation Kentish Town. Inzwischen haben sich draußen zehn Polizisten versammelt, und weitere treffen ein, evakuieren benachbarte Gebäude und leiten den Verkehr um. In der Zentrale wird man veranlassen, dass kurzfristig Gas und Strom abgestellt und die Signale von Mobiltelefonen blockiert werden, damit nichts eine Explosion auslösen kann.
Das Juweliergeschäft nimmt das gesamte Erdgeschoss eines vierstöckigen Gebäudes im Regency-Stil ein, in den darüberliegenden Etagen sind Wohnungen. In den Nachbarhäusern und auf der anderen Straßenseite gibt es weitere Schmuckläden. Holborn ist das Zentrum des britischen Diamantenhandels mit mehr als dreihundert Juwelieren auf einer Fläche von fünfhundert Quadratmetern.
Keegan hält Ausschau nach Stolperdrähten oder druckempfindlichen Platten auf dem Boden, die die Detonation der Weste auslösen könnten. Er spürt, wie das Blut von seinem Herzen durch die Arterien und immer kleinere Gefäße fließt, bis es direkt unter seiner Haut pulsiert. Er bewegt sich behutsam vorwärts und untersucht die Weste. Sie ist dick und schwarz mit Taschen mit Klettverschluss. Er filmt weiter mit seinem Handy, während er den Stuhl langsam dreht und live kommentiert.
»Sieht aus wie eine Taucherweste mit zahlreichen Taschen. Plastikklammern vorne und an den Seiten. Ein Draht, der mit einem kleinen Glasröhrchen verbunden ist, das auf seinem rechten Oberschenkel liegt.«
Er beschreibt auch den Verkaufsraum und das Büro dahinter. »Ein Eingang zur Straße. Vitrinen an den Wänden und in Höhe des Tresens. In dem Büro stehen ein Schreibtisch, ein Stuhl, Aktenschränke und ein Tresor. Offen. Leer.«
In diesem Moment bricht der Alarm jäh ab. Die Stille kommt so plötzlich, dass es sich anfühlt, als wäre etwas aus großer Höhe gefallen und alle würden auf den Aufprall warten.
Keegan hebt die Hände, die in Handschuhen stecken. »Sie müssen ganz stillhalten. Verstanden?«
Der Juwelier bedeutet ihm mit einem Blick, dass er verstanden hat.
»Wenn dieser Schalter sich bewegt, sehen wir uns wieder … und zwar im ganzen Raum.«
Sein Versuch einer humoristischen Auflockerung geht komplett an dem Juwelier vorbei.
»Normalerweise würde ich das in einem schnellen Ruck machen, aber ich werde es langsam abziehen.«
Mit einem Fingernagel beginnt er, eine Ecke des Klebebands vor dem Mund des Juweliers abzuknibbeln, fasst das Ende mit Daumen und Zeigefinger und zieht das Band langsam ab. Der Mann stöhnt und saugt Luft ein. Der Neigungsschalter auf seinem Knie bewegt sich. Keegan streckt die Hand aus, bereit einzugreifen. Beide starren auf das Glasröhrchen.
»Meine Frau«, krächzt der Mann. »Sie haben sie als Geisel genommen. Helfen Sie ihr.«
Er stößt die Worte schluchzend hervor, und der Stuhl schwankt.
»Nicht bewegen!«, fleht Keegan. »Bitte. Entspannen Sie sich. Und jetzt sagen Sie mir Ihren Namen.«
»Russell Kemp-Lowe.«
»Ist das Ihr Geschäft?«
»Ja.«
»Wo wohnen Sie, Russell?«
»In Belsize Park. Antrim Road. Nummer fünfundsiebzig.«
»Haben Sie Ihre Frau dort zum letzten Mal gesehen?«
»Ja«, sagt er gepresst. »Und meine kleine Tochter.«
»Wie heißt Ihre Frau?«
»Caitlin.«
»Und Ihre Tochter?«
»Daisy.«
»Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?«
Er wirkt verloren, außerstande, die Zeit abzuschätzen. »Sie waren in dem Haus. Die Männer hatten Pistolen. Sie haben mich gezwungen, hierherzufahren.«
Eine Frauenstimme dringt durch den Funkverkehr. »Hier ist EXPO1, EXPO1. Hören Sie mich?«
»Das ist das Entschärfungskommando«, sagt Keegan, um den Juwelier zu beruhigen. Er meldet sich über Funk, die Frau stellt sich als Sergeant Christine Blainey vor und fragt ihn nach der Sprengvorrichtung. Keegan beschreibt sie und hebt behutsam die Klappe einer der Westentaschen an. Darin steckt ein kleiner Block aus einem Material, bei dem es sich um Plastiksprengstoff handeln könnte. Er berichtet ihr von dem Neigungsschalter und dem Fahrradschloss, das durch die Ärmel der Weste und um die Lehne des Stuhls gefädelt ist. Es ist aus mit Plastik ummanteltem, geflochtenem Stahl und hat ein Zahlenschloss mit vier Nummern.
Keegan betrachtet die Zahlen und merkt sich die eingestellte Ziffernfolge: 4, 8, 7, 2. Dann versucht er ein paar andere Kombinationen – die naheliegenden wie viermal die Null, viermal die Neun und 1, 2, 3, 4.
»Besteht die Möglichkeit, dass es noch weitere Vorrichtungen gibt?«, fragt Blainey.
»Ich habe keine gesehen.«
»Druckempfindliche Platten, Stolperdrähte?«
»Nichts, was mir ins Augen gefallen wäre.«
Eine Rotzblase platzt in der Nase des Juweliers, und sein rechtes Knie beginnt, unkontrolliert auf und ab zu wippen. Der Neigungsschalter bewegt sich. Keegan streckt die Hand aus und drückt ihn an Russells Bein.
»Tut mir leid. Ich kann nichts dafür«, sagt der Juwelier mit erstickter Stimme. »Ich spüre meine Beine nicht mehr.«
»Sie machen das super«, sagt Keegan. »Wackeln Sie mit den Zehen, um den Blutfluss in Gang zu bringen. Vorsichtig. Ja, genau so.«
Über Funk wird regelmäßig die neueste Lage durchgegeben. Die umliegenden Gebäude werden evakuiert, ein bewaffnetes Einsatzkommando ist zu der Adresse in Belsize Park geschickt worden.
Um den Juwelier abzulenken, fragt Keegan ihn nach seiner Tochter.
»Sie ist fast sechs. Sie hat im Dezember Geburtstag. An Heiligabend. Sie findet es cool, Weihnachten Geburtstag zu haben. Eines Tages wird sie die Nachteile erkennen.«
»Was wünscht sie sich?«
»Sie überlegt es sich ständig anders. Ich habe versprochen, mit ihr in den Shake Shack am Leicester Square zu gehen. Sie liebt die geriffelten Pommes und die Milchshakes.«
Keegan hat einen kleinen Sohn, der gerade erst drei geworden ist, und eine Frau, die ihn vor einem halben Jahr verlassen hat. Sie will die Scheidung. Er möchte es noch einmal versuchen. Er weiß, dass die Ehe zerbrochen ist, aber manche Sachen funktionieren auch noch, wenn sie unvollständig oder inkompatibel sind. Seine Zwangsstörung ist ein Problem – sein obsessiver Reinlichkeitsfimmel und andere Zwänge. Früher fand seine Frau seine »Marotten« amüsant, jetzt ist sie nur noch genervt.
Christine Blainey meldet sich erneut über Funk. Sie ist mit ihrem Team vor dem Laden. »Ab hier übernehmen wir.«
Keegan geht zur Tür, aber Russell ruft: »Sie lassen mich doch nicht allein?«
Sein Stuhl bewegt sich. Sein Knie. Der Neigungsschalter. Keegan fängt ihn auf und beobachtet, wie das Quecksilber in der Glasröhre in Richtung des Auslösers und wieder zurück fließt. Beide Männer atmen weiter.
»Tut mir leid«, sagt Russell.
»Schon okay.«
»Lassen Sie mich nicht allein.«
»Ich bleibe genau hier.«
Keegan informiert Blainey. Kurz darauf erscheint eine schwarz gekleidete Gestalt im Türrahmen. Mit ihrer Kleidung und der Panzerweste wirkt sie stämmig, dazu trägt sie zwei große, an ihre Unterarme geschnallte Metallplatten.
»Bin ich auch zu der Party eingeladen?«, fragt sie, die Stimme durch den Helm mit Gesichtsvisier gedämpft.
Sie bewegt sich wie eine Trickfilmpuppe, als sie das Büro betritt, bleibt stehen und lässt den Blick schweifen. »Okay, was haben wir hier?«, fragt sie mit einem gleichzeitig rauen und sanften West-Country-Akzent. »Sie heißen Keegan, richtig? Und Sie müssen Russell sein.«
»Ich kann meine Beine nicht spüren«, stöhnt der Juwelier und blinzelt sie hilflos an.
»Sie haben sie noch. Und so soll es auch bleiben.«
Vorsicht arrangiert Blainey Schutzschilder um den sitzenden Juwelier und zieht eine kleine Stiftlampe aus der Tasche. Sie hockt sich neben Russell, begutachtet den Neigungsschalter, öffnet vorsichtig die Taschen der Sprengstoffweste und blickt hinein. Mit behandschuhten Fingerspitzen streicht sie über die Drähte, folgt ihnen von dem Schalter zu den Taschen und zurück.
»Okay, wir machen Folgendes. Ich werde das Fahrradschloss aufschneiden und Ihre Hände und Füße losbinden, aber Sie müssen absolut stillhalten. Verstanden?«
Russell nickt.
Blainey wendet sich an Keegan. »Ich möchte, dass Sie sich hinter die Schilde begeben. Sie bieten keinen großen Schutz, aber vielleicht verhindern sie, dass Ihre Eier oben aus Ihrem Kopf rauskommen.«
»Kluge Ansage«, sagt Keegan, der immer noch den Neigungsschalter an den Oberschenkel des Juweliers drückt. »Aber vielleicht sollte ich einfach hierbleiben.«
»Ihre Entscheidung, aber dann will ich, dass Sie sich vorstellen, das Glasröhrchen, das Sie in der Hand halten, ist das teuerste Glas Malt-Whisky auf der ganzen Welt und bis zum Rand voll.«
»Ich könnte einen Drink vertragen«, sagt Keegan.
»Ich lade Sie ein, wenn das hier vorbei ist.«
»Single Malt.«
»Nicht bei meinem Gehalt.«
Sie nimmt einen Bolzenschneider aus der Tasche, die um ihre Hüfte hängt.
»Und jetzt halten Sie das Röhrchen ganz vorsichtig hoch. So ist gut.«
Blainey hebt das Fahrradschloss an und öffnet den Bolzenschneider. Sie klemmt den Stahldraht zwischen die Messer, drückt die Hebel zusammen und schneidet ihn mühelos durch. Dann zieht sie das Kabel langsam aus den Ärmeln der Weste und wickelt es vom Stuhl.
»Okay, Russell, jetzt sind Sie dran. Heben Sie vorsichtig die Arme. Langsamer. Noch langsamer.«
Russell befolgt ihre Anweisungen und entblößt Schweißflecken unter den Achselhöhlen. Behutsam löst Blainey eine Plastikklammer nach der anderen, von oben nach unten. Die Weste teilt sich, und Blainey zieht sie vorsichtig von Russells Schultern und über seinen Kopf. Keegan hat immer noch den Schalter in der Hand. Die Drähte spannen sich. Er hält die Hände höher, aber nach wie vor ruhig.
Blainey legt die Weste auf den Tisch und fragt den Juwelier, ob er aufstehen kann. Russell versucht es, doch seine Gliedmaßen reagieren nicht. Sein Hirn sendet die Botschaft erneut, und er erhebt sich schwankend. Als er sich aufrichten will, verliert er die Balance, stolpert und fällt auf Keegan zu.
Blainey stößt instinktiv den Unterarm gegen Russels Brust, um seine Richtung zu ändern. Der Juwelier stolpert rückwärts über den Stuhl, weg von dem Neigungsschalter. Mit einem widerlichen dumpfen Aufprall schlägt er mit dem Kopf gegen die Ecke des Safes und ist schon bewusstlos, bevor er auf dem Boden zusammensackt.
Die beiden Polizisten atmen langsam aus.
»Fast hätte ich meinen Drink verschüttet«, sagt Keegan.
»Und ich hätte mir fast in die Hose gemacht«, sagt Blainey und sieht nach dem Juwelier, der eine heftig blutende Platzwunde am Kopf hat, jedoch gleichmäßig atmet.
»Was passiert jetzt?«, fragt Keegan.
»Das ist der Punkt, wo ich entscheide, ob ich den roten oder den blauen Draht durchschneiden soll.«
»Sie wissen es nicht?«
»Meistens nehme ich den blauen.«
»Sind Sie Tory-Wählerin?«
»Chelsea-Fan.«
Sie hat eine kleine Zange mit Gummigriffen in der Hand. Sie zieht die schweren Handschuhe aus. Ihre Fingernägel sind rot lackiert. Die Backen der Zange packen den Draht, und Keegan schließt die Augen.
Als er sie wieder aufmacht, hat Blainey ihren Helm abgenommen, und dunkles Haar fällt auf ihre Schultern. Sie hat ein rundes Gesicht, Sommersprossen auf der Nase und ein leicht schiefes Lächeln.
Sie reicht ihm einen Beweisbeutel. »Sie haben die Ehre«, sagt sie und zeigt auf den Neigungsschalter.
Sie hebt die Weste an, öffnet die Taschen und summt vor sich hin, als sie einen Ziegel aus Knete herauszieht.
»Plastiksprengstoff?«, fragt Keegan.
»So soll es jedenfalls aussehen.«
»Eine Attrappe?«
»Eine gute.«
»Mein Gott. Mir ist eben mein ganzes Leben vor den Augen vorbeigezogen.«
»Ich hoffe, es war erfüllt.«
»Die zweite Hälfte sollte besser werden.«
Keegan drückt auf den Knopf des Schulterfunkgeräts und erklärt seinem Team vor der Tür, dass sie wegtreten können. Er blickt auf den bewusstlosen Russell. »Ich brauche hier drinnen einen Notarzt.«
Blainey packt ihre Ausrüstung zusammen.
»Was wissen wir über seine Frau?«, fragt sie.
»Nach wie vor keine Nachricht.«
3
»Warte hier«, sage ich zu Daisy und lasse sie auf der untersten Stufe zurück.
Ich drücke auf die Klingel und warte. Niemand macht auf.
Daisy hat gesagt, ihre Mutter sei in der Küche. Sie könnte bewusstlos sein oder verletzt. Das würde auch das Blut am Pyjama des Mädchens erklären.
Ich trete ein paar Schritte von der Haustür zurück und betrachte die Erkerfenster. Sie sind doppelt verglast und mit Aufklebern einer Security-Firma versehen, die darüber informieren, dass das Grundstück von Sicherheitskameras überwacht wird. Die Holzjalousien innen sind so geneigt, dass man nicht hineinsehen kann.
Kann ich einen Einbruch rechtfertigen? Gewaltsames Eindringen ist erlaubt, wenn eine unmittelbare Bedrohung von Leib und Leben vorliegt und eine Verzögerung die Unversehrtheit der Bewohner oder anderer Personen gefährden könnte.
Ich kehre zu Daisy zurück. »Bewahren deine Mummy und dein Daddy vielleicht irgendwo einen Schlüssel auf, falls sie sich mal ausschließen?«, frage ich. »Unter einem Blumentopf? Oder in Daddys Auto?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Okay. Warte noch mal kurz.«
Ich steige die Stufen wieder hoch.
»Kilo Quebec Drei Null. Beamtin zu Fuß in der Antrim Road. Im Haus reagiert niemand. Bitte um Erlaubnis zum Betreten.«
»Erteilt. Brauchen Sie einen Schlüsseldienst?«
»Irgendwann bestimmt.«
Ich ziehe den Klauenhammeraufsatz aus der Brusttasche meiner Weste, schraube ihn auf den ausgefahrenen Schlagstock, treibe ihn wie einen Keil in den Spalt zwischen Tür und Rahmen und bewege ihn langsam hin und her, um die Lücke weiter aufzustemmen. Dann mache ich einen Schritt zurück und ziele mit einem Tritt auf eine Stelle direkt unterhalb des Schlosses. Das Geräusch hallt in der Dunkelheit wider, in der Nachbarschaft fängt ein Hund an zu bellen.
Seit ich neun bin, lerne und praktiziere ich Karate. Ich weiß, wie ich meine Energie in einen Tritt lenken kann, mit dem ich zur Not einen angreifenden Crack-Süchtigen niederstrecken oder eine Tür aufbrechen kann. Aber diese ist störrisch. Ich versuche es erneut. Holz splittert, die Tür schwingt nach innen auf und schlägt gegen die Wand.
»Polizei! Ist jemand zu Hause?«
Die Eingangshalle hat eine hohe Decke und einen Fliesenboden im Schachbrettmuster. Eine breite Treppe führt in die oberen Stockwerke. Das gesamte Dekor strahlt Eleganz und Reichtum aus wie aus einer Zeitschrift für Innenarchitektur. Meiner Stiefmutter würde es gefallen. Sie kennt den Unterschied zwischen Glas und Kristall, Porzellan und feinem Knochenporzellan, handgeknüpft und handgewebt; deshalb nennen meine Onkel sie auch »die Herzogin«.
Daisys Schuhe stehen nebeneinander auf einem Regal unter einer Reihe von Kleiderhaken. Ein pinkfarbener Schulranzen hängt neben einem roten Wollmantel mit Fleece-Kragen in Kindergröße. Warum hat sie nicht daran gedacht, sich etwas Warmes überzuziehen, als sie das Haus verlassen hat? Sie war in Eile. Sie hatte Angst.
Ich blicke in den Salon, der für Kinder offensichtlich tabu ist. Kein Spielzeug weit und breit. Auf dem Kaminsims stehen Familienfotos, die Daisys Leben dokumentieren. Ihre Geburt, die ersten Schritte, Daisy mit einem Dreirad auf einem Bürgersteig. Das nächste Zimmer ist ein Spielzimmer mit einer Kiste voller Spielsachen, einer Staffelei und Bildern, die an eine Pinnwand geheftet sind.
Mein Funkgerät krächzt. Eine drängende Stimme meldet sich. »Zentrale an Kilo Quebec Drei Null, die Beamtin zu Fuß.«
»Hier Kilo Quebec Drei Null, ich höre.«
»Wo sind Sie?«
»In dem Haus.«
»Sofort raus! Ein bewaffnetes Einsatzkommando ist zu der Adresse unterwegs.«
»Warum? Was ist passiert?«
»Wir haben eine Meldung über einen Überfall auf ein Privathaus. Verlassen Sie das Grundstück. Warten Sie auf die Kollegen. Haben Sie verstanden?«
»Kilo Quebec Drei Null. Verstanden. Ende.«
Vor mir liegt die Küche. Wenn ich den Arm ausstrecke, kann ich die Tür fast berühren. Ich blicke mich um. Daisy sitzt immer noch auf der Treppe vor dem Haus. Ich kann von oben ihren Kopf sehen, der aus der Notfalldecke herausragt.
Ich ziehe ein Paar Plastikhandschuhe aus der Tasche, streife sie über und spreize die Finger. Mit dem Fuß stoße ich die Küchentür auf. Das Licht aus dem Flur schwappt über den gefliesten Boden und fällt diagonal auf die Beine einer Frau, die auf einem Stuhl sitzt und in meine Richtung guckt.
Sie trägt ein Nachthemd. Ihre Beine sind bis zu den Oberschenkeln nackt und gespreizt. Ihr Gesicht liegt im Dunkeln.
Ich betrete die Küche und taste nach dem Lichtschalter. Das Licht geht blinkend an. Meine Augen gewöhnen sich an die Helligkeit. Die Frau starrt mich mit stumpfem Blick an. Ihr Mund ist mit Packband zugeklebt. Ihre Füße sind zusammengebunden, ihre Hände hinter dem Rücken gefesselt, ebenfalls mit Packband.
Ich reiße das Band von ihrem Mund ab, presse meine Wange an ihre Brust, lausche auf einen Herzschlag und taste an ihrem Hals nach dem Puls. Ihr Körper ist kalt. Ihre Lippen sind blau. Auf dem Boden neben ihr liegt ein Stofftier. Ein zerknautscht aussehendes Nilpferd mit Wackelaugen und abstehenden Ohren. Es muss Daisy gehören. Sie war hier. Sie hat versucht, ihre Mutter zu wecken.
»Kilo Quebec Drei Null. Die Beamtin zu Fuß in der Antrim Road. Alarmieren Sie die Mordkommission. Tote Frau. In der Küche. Im Erdgeschoss. Auf der Rückseite des Hauses an der genannten Adresse.«
»Sie sollten auf das bewaffnete Einsatzkommando warten.«
»Ich hatte einen hinreichenden Grund. Das kleine Mädchen konnte ihre Mutter nicht wecken.«
»Treten Sie den Rückzug an. Warten Sie auf Verstärkung.«
»Verstanden. Ende.«
Ich lasse den Knopf des Funkgeräts los und betrachte erneut Daisys Mutter. Ich weiß nicht einmal ihren Namen. Ich wünschte, ich könnte ihre Augen schließen und ihr im Tod ein wenig Würde geben, doch ich habe auch so schon riskiert, einen Tatort zu kontaminieren.
»Sie haben ein wunderschönes Haus«, flüstere ich. »Und eine wunderschöne Tochter. Wir werden herausfinden, wer das war, und sie werden dafür bezahlen.«
4
»Sie sind also die berühmte ›Beamtin zu Fuß‹«, sagt Brendan Keegan und reicht mir einen Einwegbecher mit Kaffee.
Ich richte mich ein wenig gerader auf und stelle mich vor. »PC Philomena McCarthy.«
»Stehen Sie bequem«, sagt er, aber nicht spöttisch.
Ich mustere den Detective aus dem Augenwinkel. Er ist Anfang vierzig, mittelgroß mit dunklem Haar, einem breiten Mund und einer leicht schiefen unteren Zahnreihe. Seine braunen Augen sind neugierig und eigenartig melancholisch und erinnern mich an Patch, einen Hund, den ich früher hatte und der dann irgendwann weg war, um »auf einem Bauernhof zu leben«, wie mein Vater mir erklärte.
Für die Leitung einer Mordermittlung ist Keegan jung, doch er wirkt selbstbewusst, vielleicht sogar ein wenig arrogant, was allerdings auch Fassade sein könnte, um seine Unsicherheit zu kaschieren. Seine Kleidung ist Business Casual, Sakko und schwarze Jeans, ziemlich fortschrittlich im Vergleich zu den zerknitterten, an Ellbogen und Hosenboden glänzenden Anzügen, wie sie die meisten seiner Kollegen tragen.
Keegan weist auf eine niedrige Steinmauer. Wir sitzen nebeneinander, nippen an unserem lauwarmen Kaffee und sehen zu, wie Leute von der Spurensicherung in weißen Overalls das Haus betreten und verlassen.
Im Osten wird es langsam heller, die Skyline zeichnet sich vor dem blassen Himmel ab, und die Wolken bekommen Kontur. Daisy schläft auf der Rückbank eines Streifenwagens in der Nähe, zusammengerollt unter einer Decke, ihr Nilpferd unter den Arm geklemmt. Das Stofftier ist das Einzige, was ich aus dem Haus mitgenommen habe.
»Sie sind eingebrochen«, sagt Keegan, ohne vorwurfsvoll zu klingen.
»Ich hatte die Vermutung, dass Bewohner verletzt sein könnten.«
»Was hat Sie dazu bewogen?«
»Daisy hat gesagt, dass sie ihre Mutter nicht wecken konnte.«
»Haben Sie Spuren von gewaltsamen Eindringen festgestellt?«
»Nein.«
»Wie ist das Mädchen aus dem Haus gekommen?«
»Sie ist groß genug, um die Haustür aufzusperren.«
DCI Keegan nickt, als wäre er mit meinen Antworten zufrieden.
»Wie heißt sie?«, frage ich und meine das Opfer.
»Caitlin Kemp-Lowe. Ihrer Familie gehört das Juweliergeschäft in Hatton Garden.«
»Dann war es also ein Raubüberfall.«
»Eine Geiselnahme in ihrem Haus. Sie haben ihren Mann gezwungen, zu dem Laden zu fahren und den Safe zu öffnen.«
Ich betrachte das Haus, das jetzt von den ersten Sonnenstrahlen erfasst wird. Keegan scheint meine Gedanken zu lesen. »Es gibt Sicherheitsvorkehrungen. Bewegungsmelder an den Fenstern. Panikknöpfe. Überwachungskameras.«
»Die Alarmanlage war aus«, sage ich.
»Das System wurde deaktiviert, und die Kameras wurden mit Farbe besprüht. In dem Juweliergeschäft war es das Gleiche.«
Er kippt die Reste seines Kaffees in den Vorgarten. »Sind Sie nach oben gegangen?«
»Man hat mir befohlen, das Haus zu verlassen.«
»Das war nicht meine Frage.«
»Ich wollte mich vergewissern, dass nicht noch jemand im Haus war.«
»Haben Sie irgendwas angefasst?«
»Ich hatte Handschuhe an.«
»Woran erinnern Sie sich?«
Warum fragt er mich das? Er könnte selbst ins Haus gehen und sich die Räume ansehen.
Ich schildere, wie ich die Treppe bis zum ersten Absatz hinaufgestiegen bin und das Elternschlafzimmer betreten habe. Die Bettdecke war auf einer Seite aufgeschlagen. Auf der Kommode lagen zerknüllte Make-up-Tücher neben Tiegeln mit Nachtcreme und Gesichtsreiniger. Im Deckel einer aufgeklappten Schmuckkassette lag ein einzelner Ohrring, ein Lotus-Cluster-Ohrstecker.
»Was?«
»Die Edelsteine hatten die Form einer Lotusblume.«
»Nur ein Ohrring?«
»Ja.«
»Sie haben ein Auge fürs Detail.«
Wieder bin ich nicht sicher, ob in seiner Bemerkung nicht leiser Spott mitschwingt. Eine Mitarbeiterin der Spurensicherung kommt aus dem Haus, schlägt die Kapuze ihres Overalls zurück, nimmt die Schutzbrille ab und macht Keegan ein Zeichen.
»In der Küche sind wir noch beschäftigt, aber der Rest des Hauses gehört Ihnen.«
Er wendet sich wieder mir zu. »Kommen Sie.«
»Wohin?«
»Sie werden mich durch das Haus führen.«
»Warum?«
»Weil Sie schon mal dort waren.«
Er zieht ein Paar Plastikhandschuhe aus der Tasche und hält sie mir hin, doch ich habe meine eigenen. Wir steigen die Stufen zur Haustür hinauf und durchqueren die Halle auf Brettern, die wie Trittsteine angeordnet sind. Die Küchentür vor uns steht offen. Kurz sehe ich Caitlin Kemp-Lowes Leiche. Sie liegt jetzt auf einer Plastikplane auf dem Boden. Das Blitzlicht einer Kamera fällt auf ihr Gesicht. Dann wird die Plane über ihren Körper geklappt.
»Hier entlang«, sagt Keegan und führt mich die Treppe hinauf.
Das Schlafzimmer ist so, wie ich es in Erinnerung habe. Auf einer Seite des Bettes ist die Decke zurückgeschlagen. Die Lesebrille einer Frau liegt auf einem Roman von Ann Patchett.
»Sie waren zusammen aus«, sage ich. »Schick aus.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Sie hat sich abgeschminkt und ihren Schmuck abgenommen. Außerdem hat sie ihr Cocktailkleid aufgehängt, aber nicht in den Kleiderschrank. Sie wollte es reinigen lassen.«
»Sie sind gut in so was«, sagt Keegan.
»Sie hat geduscht und ein Nachthemd angezogen, aber ich glaube, sie hatte sich noch nicht hingelegt. Auf dem Kissen ist kein Abdruck.«
»Was ist mit Ihrem Mann?«
»Vielleicht ist er später zu Bett gegangen oder hat in einem anderen Zimmer geschlafen.«
Keegan steht in dem begehbaren Kleiderschrank und inspiziert die Kleider, links ihre, rechts seine. Er scheint die Ordnung zu bewundern. Frische Hemden hängen neben Anzügen und legeren Jacken. Jeans und Pullover haben eine eigene Schublade.
»Wozu braucht jemand sieben Kaschmirpullis?«, fragt er.
»Für jeden Tag der Woche einen.«
Er schiebt die Hemden zur Seite und enthüllt einen quadratischen Wandsafe. Ein Kombinationsschloss und ein Griff.
»Eine verpasste Gelegenheit, oder sie wussten nichts von diesem Tresor«, sage ich.
»Über alles andere waren sie im Bilde – die Sicherheitskameras, die Alarmanlage.«
Wir verlassen das Elternschlafzimmer und werfen einen Blick in die anderen Zimmer im ersten Stock. In einem finden sich Spuren, dass es benutzt wurde – ein Männerpyjama unter einem Kopfkissen. Schlaftabletten, die Fernbedienung eines Fernsehers. Keegan schaltet ihn ein. Auf dem Bildschirm flackert ein Sportsender auf.
»Vielleicht schnarcht er«, sage ich.
»Haben Sie Erfahrung damit?«
»Phasenweise.«
Das letzte Zimmer liegt am weitesten auf der Rückseite des Hauses. An der Tür hängt ein Bild von einem Einhorn und ein selbst gemaltes Schild, auf dem steht: Daisys Zimmer.
»Es war von außen abgeschlossen«, sage ich und zeige auf den Schlüssel.
»Was die Frage aufwirft – wie ist sie rausgekommen?«
Das Zimmer des kleinen Mädchens ist in Pastellfarben gestrichen und beherbergt ein Schaukelpferd, ein Puppenhaus und Unmengen an Stofftieren, die auf dem großen Einzelbett verteilt sind. Daisys Pantoffeln stehen auf dem Teppich, auf der Bettdecke liegt ein Bademantel.
»Wieso haben sie die Kinderzimmertür abgeschlossen?«, fragt Keegan.
»Sie wollten, dass sie hier drinnen bleibt.«
Ich ziehe die Vorhänge auf und untersuche das Schiebefenster, dass sich nur ein paar Zentimeter öffnen lässt. Der Garten liegt sieben Meter tiefer.
»Vielleicht hat Daisy die Tür abgeschlossen, als sie das Zimmer verlassen hat.«
»Wieso sollte sie das tun?«
Ich lasse den Blick weiter durch das Zimmer streifen. Es ist wie eins dieser Rätsel um einen verschlossenen Raum, die Hercule Poirot und Miss Marple ständig lösen müssen.
»Irgendwas hat Daisy geweckt«, denke ich laut. »Vielleicht hatte sie einen Albtraum, oder sie musste mal. Wenn die Tür abgeschlossen war, hätte sie gerufen.«
»Ihre Mutter konnte nicht antworten.«
Ich stelle mir vor, wie Daisy versucht, die Tür zu öffnen.
»Was macht sie dann?«, fragt Keegan.
Mir fällt ein hoher Wandschrank neben dem zugemauerten Kamin auf. Die Tür ist aufgeklinkt. Dahinter vermute ich weitere Spielsachen, doch in dem Schrank befindet sich ein Schacht, der ins Erdgeschoss führt.
»Ein Speiseaufzug«, sage ich. »Die Küche muss direkt unter uns sein.«
»Dann war das hier früher ein Esszimmer«, sagt Keegan und blickt an mir vorbei. »Ist sie kräftig genug?«
»Ihr Gewicht hat geholfen«, sage ich. »Wenn man an den Seilen zieht, wird ein Gegengewicht aktiviert.«
»Woher wissen Sie das?«
»Mein Vater hat so einen.«
»Sie stammen aus einem reichen Elternhaus.«
»Nicht, als ich ein Kind war.«
Keegan zieht an dem Seil, löst das Gegenwicht aus, und eine kleine Holzkiste taucht auf.
»Okay, mal angenommen, Sie haben recht – und Daisy lässt sich bis zur Küche herab. Was sieht sie dort?«
»Sie hat gesagt, sie konnte ihre Mutter nicht wecken.«
»Das legt nahe, dass Caitlin Kemp-Lowe bereits tot war.«
Wir gehen zurück ins Erdgeschoss und bleiben auf der Treppe stehen, als Caitlins Leiche in einem zugezogenen Leichensack herausgetragen wird.
»Wo ist der Ehemann?«, frage ich.
»Im Krankenhaus.«
»Weiß er von seiner Frau?«
»Noch nicht.«
Wir stehen wieder auf der Treppe vor dem Haus. Daisy schläft immer noch in einem Polizeiwagen und sabbert auf den Kopf des Nilpferds.
»Wie ist sie?«, fragt Keegan.
»Intelligent und mutig.« Ich spüre, wie sich mein Hals zuschnürt.
»Sie könnte unsere einzige Zeugin sein.«
»Was geschieht jetzt mit ihr?«
»Das Jugendamt schickt jemanden vorbei. Wenn Sie bis dahin bei ihr bleiben könnten?«
»Ich fahre heute nach Paris«, sage ich. »Mit meinem Mann«, füge ich hinzu, als bedürfe das einer Erklärung. Warum erzähle ich Keegan, dass ich verheiratet bin? Welchen Unterschied macht das?
»Sie werden diese Reise verschieben müssen«, sagt er.
»Das wird Henry gar nicht gefallen.«
»Was macht Henry beruflich?«
»Er ist Feuerwehrmann.«
»Er wird es verstehen.«
Keegan wird von dem Leiter des Spurensicherungsteams gerufen. Ich sitze neben Daisy, ihr Kopf liegt auf meinem Schoß. Sie murmelt etwas, schläft jedoch weiter. Um uns herum ist die Straße zum Leben erwacht. Nachbarn versammeln sich an den Straßensperren, tratschen und spekulieren, was passiert sein könnte.
Detectives gehen bereits von Tür zu Tür, sammeln Material von Videotürklingeln und Kameras ein und nehmen Aussagen darüber auf, was die Leute in den Stunden nach Mitternacht gesehen oder gehört haben. Alarmanlagen. Schreie. Streitigkeiten. Unbekannte Fahrzeuge oder Gesichter. Lieferungen.
Ich rufe Henry an. Er schläft noch halb. »Hallo, Wombat«, sagt er – mein derzeitiger Kosename. »Wie spät ist es?«
»Fast acht.«
»Bist du auf dem Nachhauseweg?«
»Nein. Ich werde noch festgehalten. Es hat einen Mord gegeben. Ich habe die Leiche gefunden.«
»Scheiße! Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Mir geht es gut, aber wir können heute nicht wegfahren. Sie wollen, dass ich hierbleibe.«
»Aber es ist schon alles geplant.«
»Wir können es verschieben.«
»Wir kriegen unser Geld nie zurück, nicht, wenn ich so spät storniere.«
»Wir können ein anderes Mal nach Paris fahren.«
»Woher wusstest du, dass wir nach Paris fahren wollten?«
»Gut geraten.«
»Hat dein Vater es dir erzählt?«
»Nein. Und was bitte hat er damit zu tun?«
»Er hat mir die Namen von ein paar Restaurants genannt.«
»Ich weiß nicht, ob mir die Vorstellung gefällt, dass mein Vater hilft, unsere romantischen Wochenenden zu planen.«
»Er hat nicht alles geplant«, sagt Henry und klingt enttäuscht.
»Ich mache es wieder gut«, sage ich. »Ich ziehe mein Französisches-Zimmermädchen-Kostüm an.«
»Du hast kein Französisches-Zimmermädchen-Kostüm.«
»Vielleicht ist das meine Überraschung.«
Keegan räuspert sich, und ich lege hastig auf und spüre, dass meine Wangen glühen. Erröten ist der Fluch meines Lebens seit der Pubertät, als mein Gesicht jedes Mal aufleuchtete wie eine Ampel, wenn ein gutaussehender Junge mit mir sprach. Ich habe Henry gerade abgewürgt. Ich muss mich später entschuldigen. Noch mehr schlechtes Gewissen.
Keegan ist mit einer matronenhaften Frau zurückgekommen, deren schwarzes Haar so streng nach hinten gebunden ist, dass ihre Augenbrauen aussehen wie Notenschlüssel.
»Das ist Mrs Manifold vom Jugendamt. Sie ist gekommen, um Daisy abzuholen.«
Ich rüttle sanft an Daisys Schulter. Sie will nicht aufwachen. Ich hebe ihr Kinn an. »Hey! Du kleine Schlafmütze. Zeit zu gehen.«
Sie blinzelt und reibt sich die Augen.
»Diese nette Frau wird dich irgendwohin bringen und in ein richtiges Bett stecken.«
»Ich will nicht woanders hin«, sagt Daisy. »Ich will zu Mummy.«
»Deine Mummy ist nicht da.«
»Wohin ist sie gegangen?«
Mein Herz setzt für einen Schlag aus. In der Polizeiausbildung hatten wir auch einen Kurs in Trauerberatung. Kindern sollte man es so schnell wie möglich sagen. Je länger man es hinausschiebt, desto größer wird das Risiko, dass sie ein Gespräch mithören oder es auf eine andere unangemessene Art erfahren. Gleichzeitig sollte Daisy die Nachricht von jemandem erfahren, den sie liebt und dem sie vertraut – ihrem Vater oder ihren Großeltern.
»Ist sie tot?«, verlangt Daisy mit großen Augen die Wahrheit zu wissen. »Fleabag ist gestorben. Wir haben sie im Garten neben dem Goldfischteich begraben, weil sie immer versucht hat, die Goldfische zu fangen. Mummy hat gesagt, sie ist in den Himmel gegangen.«
»Deine Mummy ist auch im Himmel«, sage ich.
»Mit Fleabag?«
»Ja.«
Daisys Unterlippe zittert. »Ich will zu Daddy.«
»Er ist im Krankenhaus, aber du wirst ihn ganz bald sehen. Jetzt musst du aber erst mal mit dieser netten Frau gehen, nur bis dein Daddy dich abholen kommt.«
»Warum kann ich nicht bei dir bleiben?«
»Ich bin Polizistin und habe sehr viel zu tun.«
»Du passt auf Leute auf?«
»Ja, aber Mrs Manifold wird eine nette Familie für dich finden.«
Daisy sieht die Frau an, offensichtlich nicht überzeugt.
Mrs Manifold wird langsam ungeduldig und beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie beugt sich in den Wagen. »Hallo, junge Dame, du bist aber ein hübsches Ding.«
»Verpiss dich!«, sagt Daisy.
Beim Anblick von Mrs Manifolds schockiertem Gesicht muss ich kichern.
»Das war nicht besonders höflich«, versuche ich, es zu überspielen. »Du solltest dich entschuldigen.«
»Ich will bei dir bleiben.« Daisy schlingt die Arme um meinen Hals und packt mich so fest, dass es wehtut. Mit ihr im Arm steige ich aus dem Polizeiwagen und versuche, sie an die Sozialarbeiterin zu übergeben, doch Daisy klammert sich noch enger an mich. Drei Personen versuchen, sie von mir wegzuziehen. Daisy kreischt, die Umstehenden gaffen.
»Vielleicht sollten wir das irgendwo anders machen«, sage ich.
Mrs Manifold hat einen Arm um Daisys Hüfte gelegt und schafft es, ihre Beine von meinem Körper zu lösen. Daisy schreit und strampelt. Tränen strömen über ihre Wangen.
Mit einem plötzlichen Ruck wird sie ganz von mir gerissen, und Mrs Manifold stößt ein triumphierendes Geräusch aus. Im selben Moment beißt Daisy der Frau zwischen Daumen und Zeigefinger in die Hand.
»Nehmen Sie sie weg! Nehmen Sie sie weg!«, schreit Mrs Manifold und hebt die Hand, um zuzuschlagen, bremst sich jedoch im letzten Moment. Stattdessen stößt sie das Mädchen von sich. Daisy fällt nach hinten, prallt gegen den Streifenwagen und sackt im Rinnstein zusammen. Sie blinzelt entsetzt, springt dann wieder in meine Arme, drückt ihr Gesicht an meine Brust und schlingt die Beine um meine Hüften.
»Das kleine Miststück«, murmelt Mrs Manifold.
»Sie haben sie gestoßen«, sage ich ungläubig.
»Sie hat mich gebissen.«
»Das ist mir egal. Ich könnte Sie wegen Körperverletzung festnehmen.«
»Ach, jetzt seien Sie nicht so melodramatisch.« Sie wendet sich DCI Keegan zu. »Sie haben gesehen, was passiert ist.«
»Das habe ich, und die Constable hat recht. Ich schlage vor, dass Sie sich bei Daisy entschuldigen und Ihre Einstellung überdenken.«
Mrs Manifold starrt das Kind an und murmelt leise etwas. Es könnte eine Entschuldigung sein oder eine Morddrohung.
Ich ziehe Keegan zur Seite. »Sie können ihr Daisy nicht überlassen.«
»Was soll ich denn sonst machen?«
»Ich könnte sie mit nach Hause nehmen.«
»Sie sind an den Ermittlungen beteiligt.«
»Ich habe sie gefunden, mehr nicht. Sie vertraut mir.«
Daisy hat ihr Gesicht immer noch an meinem Hals vergraben, hat jedoch aufgehört zu weinen.
»Kommst du mit mir nach Hause?«, frage ich.
Sie nickt schniefend.
»Okay, nehmen Sie sie erst mal mit«, sagt Keegan. »Aber wir müssen sie trotzdem irgendwo unterbringen.«
5
Edward McCarthy steht am Rand einer schlammigen Grube voll Wasser, darin ein halb versunkener Bagger, der aussieht wie ein versteinerter Dinosaurier, der bei archäologischen Grabungen freigelegt wurde.
McCarthy trägt eine Öljacke mit Fellkragen und einen Filzhut, der zu klein für seinen Kopf wirkt. Seine kürzlich erworbenen Gummistiefel sind mit Schlamm beschmiert.
»Wie kriegen wir den da raus?«, fragt er.
»Mit einem Kran«, sagt sein Bruder Clifton, der in dasselbe Loch blickt.
»Kann man ihn reparieren?«
»Lässt sich noch nicht sagen.«
Clifton ist einen Kopf größer und hat eine Narbe, die sich vom Mund über die linke Wange kräuselt, sein »Glasgow-Lächeln«, wie er sie nennt. Er trägt einen braunen Trenchcoat und hat einen schwarzen Haarschopf, der hochsteht, egal wie sehr er ihn mit Gel in Schach zu halten versucht.
McCarthy wendet sich ab und platscht durch Pfützen zu dem Metallzaun, den der Bagger auf seinem Weg niedergewalzt hat. Die Spur der Zerstörung zieht sich weiter über die Baustelle. Eine eiserne Schalung wurde herausgerissen, Masten wurden gefällt. Eine umgekippte Chemietoilette verströmt den Geruch von Scheiße.
»Was haben wir noch verloren?«, fragt er.
»Eine Pfahlramme, einen Kompaktlader und eine Grabenfräse.«
»Wie viel?«
»Wenn man sie nicht reparieren kann … zweihunderttausend.«
»Versicherung?«
»Deckt Vandalismus nicht ab.«
»Das ist kein Vandalismus – das ist Sabotage.« McCarthy tritt eine leere Coladose aus dem Weg, die scheppernd gegen den umgefallenen Zaun prallt.
Eine Wand des Baustellenbüros in der Nähe ist weggerissen worden, die Inneneinrichtung ist entblößt wie ein ausgenommener Wal. Durchweichte Papiere und zertrümmerte Computer sind auf dem Boden verstreut.
»Wo waren die Sicherheitsleute?«
»Gegenüber dem alten Hüttenwerk wurde ein Auto angezündet«, sagt Clifton. »Ein Ablenkungsmanöver. Während die Wachleute nachgesehen haben, ist das hier passiert.«
»Wir haben doch bestimmt Überwachungskameras?«
»Drei Männer in Schwarz, mit Skimasken und Handschuhen.«
Wenn es nicht das eine ist, ist es etwas anderes, denkt McCarthy. Regen. Lieferkettenprobleme. Kostenüberschreitungen. Umweltauflagen. Denkmalschutzbestimmungen. Und jetzt Vandalismus. Nicht der erste Angriff. Drei im vergangenen Monat. Jeder gravierender als der vorherige. Eine Eskalation.
Bis jetzt hat der unbekannte Saboteur noch keine Forderungen gestellt. Offensichtlich eine Subspezies, irgendjemand weiter unten in der Nahrungskette, der versucht, McCarthy von seinem Platz zu verdrängen. Neid ist etwas Schreckliches – ein Krebs an der Seele.
An Tagen wie diesem wünscht McCarthy sich, er hätte etwas Einfacheres mit seinem Leben angefangen, wäre Briefträger, Buchhalter oder Lokführer geworden. Sein Großvater hat vierzig Jahre den Nachtzug von Euston nach Edinburgh gefahren. Vielleicht kein leichtes Leben, aber weniger kompliziert. Ein Gleis. Ein Fahrplan. Ein Anfang und ein Ende.
Stattdessen ist McCarthy Immobilienentwickler geworden, ein Euphemismus für seine diversen Aktivitäten, bevor er sich ganz auf das Hope-Island-Projekt konzentriert hat – ein Areal mit Wohn- und Bürotürmen, einen Steinwurf vom London City Airport entfernt. Eigentlich hätte dieses Spiel um alles oder nichts eine Lizenz zum Gelddrucken sein sollen, stattdessen ist es zu einem wiederkehrenden Albtraum geworden, erst der Brexit, dann Covid, explodierende Kreditzinsen und Ärger ohne Ende. Er muss mit mehreren Bällen jonglieren – Angestellte, Gewerkschaften, Gläubiger, Lieferanten –, und all das, während gleichzeitig jemand versucht, ihm mit einer Kettensäge die Arme abzutrennen. Die Eine-Million-Dollar-Frage lautet: Wer?
Bis jetzt ist noch jeder, der dumm genug war, die McCarthy-Familie herauszufordern, schnell eines Besseren belehrt worden. Ein Besuch von Daragh, Bruder Nummer zwei, hat das Problem in der Regel gelöst. Ein ernstes Wörtchen, und die Subspezies hatten sich angemessen die Hosen vollgeschissen oder waren für die nächsten zehn Jahre untergetaucht und hatten gehofft, dass Daragh sie nie wieder aufsuchen würde.
Außerdem hatte McCarthy es weitgehend vermieden, Rivalitäten zu schaffen. Er hat seinen Erfolg nicht zur Schau gestellt, nicht mit seinem Reichtum geprotzt und den Gesetzeshütern seine Triumphe nicht unter die Nase gerieben. Ja, er besaß ein nettes Häuschen und ein paar Luxuskarossen – aber im Herzen war er immer noch ein Straßenhändler, der lieber Fish and Chips aß als Foie gras.
Als er mit Constance eine Vertreterin des niederen Adels heiratete, tat er das nicht, um Statuskomplexe zu kompensieren oder sein gesellschaftliches Ansehen aufzupolieren. Sein Stil ist es immer gewesen, das Rampenlicht zu meiden und eher die besten Anwälte dafür zu bezahlen, dass die Leute keine unbequemen Fragen zu seinen Geschäftsinteressen stellen.
Für diese Interessen hat er Freundschaften mit Politikern, Ratsherren und leitenden Polizeibeamten kultiviert. Natürlich sind Rädchen geschmiert worden, doch im Gegensatz zu den alten Zeiten erweist man Gefälligkeiten nicht mehr mit dicken braunen Papiertüten voller Bargeld. Großzügigkeit kann man auch mit einer Platinmitgliedschaft bei den Fußballclubs von Chelsea oder Arsenal, Tickets für das Royal Opera House oder Tipps für eine Einlaufwette direkt aus dem Maul des Pferdes beweisen. Das Gleiche hat McCarthy auch für die Herausgeber mehrerer überregionaler Zeitungen getan, doch die wechseln häufiger als er bei seinem Auto das Öl und sind für gewöhnlich schmierige kleine Wichser.
Dass seine jüngste Tochter Mitglied der Metropolitan Police geworden ist, ist ebenfalls problematisch für ihn, doch McCarthy hat versucht, Philomenas Wahl zu respektieren, ohne seine eigenen Ziele zu gefährden. Und auch wenn er den Beruf hasst, für den sie sich entschieden hat, ist er stolz auf sie, liebt sie und hofft, dass sie ihren Irrweg irgendwann einsehen wird.
Clifton scheint auf Anweisungen zu warten.
»Dieser Scheiß muss aufhören«, bricht McCarthy das Schweigen. »Verdoppelt die Wachen. Rund um die Uhr. Knallharte Jungs.«
»Und wenn sie jemanden erwischen?«
McCarthy weist auf die mit Wasser gefüllte Grube. »Begrabt sie.«
Ein Range Rover rollt durch den umgefallenen Zaun, platscht spritzend durch Pfützen und kommt neben McCarthys Range Rover zum Stehen. Daragh steigt aus und stakst vorsichtig durch den Schlamm, um seine Oxford Brogues nicht zu verdrecken. Er sieht aus wie Bob Hoskins auf Steroiden, mit einem kurzen eckigen Körper, schütterem Haar, und hat den großspurig trampelnden Gang eines Sumo-Ringers.
»Habt ihr schon gehört?«, fragt er.
»Wir gucken es uns gerade an«, sagt Clifton.
»Nein, nicht das«, sagt Daragh, ohne den versenkten Bagger zu beachten. »Heute Nacht ist Kemp-Lowe ausgeraubt worden. Komplett leergeräumt. Ein Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.«
McCarthy interessiert sich schlagartig nicht mehr für die Verwüstungen auf der Baustelle. »Was ist passiert?«
»Ich kenn noch nicht alle Einzelheiten. Aber in Hatton Garden wimmelt es von Bullen. Ich hab den Polizeifunk abgehört und etwas über eine Bombe aufgeschnappt. Das Dings musste gerufen werden.«
Clifton: »Das Sprengstoffkommando?«
»Ja, sag ich doch.«
»Was wurde geraubt?«, fragt McCarthy mit scharfem Unterton.
»Das weiß man noch nicht, aber in Belsize Park ist jemand gewaltsam in ein Haus eingedrungen. Eine Frau ist tot.«
»Dort wohnt Russell«, sagt Clifton.
»Seine Frau?«, spekuliert McCarthy. »Sie müssen sie als Geisel genommen haben.« Er wendet sich Clifton zu. »Wann ist Russell aus Antwerpen zurückgekommen?«
»Am Donnerstag. Ich habe das Geld am Dienstag überwiesen.«
»Wie viel haben wir ihm gegeben?«
»Elf Millionen.«
Sie sehen sich ernst an. Worte sind unnötig.
»Fahr ins Krankenhaus«, sagt McCarthy zu Daragh. »Finde heraus, was du kannst.«
»Ich hab die Taufe und Dingens.«
»Sag Finbar, er ist dran.«
6
Ich sollte Henry anrufen, doch ich will nicht, dass Daisy das Gespräch mithört. Seit dem Zwischenfall mit Mrs Manifold hat sie meine Hand nicht mehr losgelassen. Wir sitzen auf der Rückbank eines Streifenwagens, der uns mitgenommen hat. Daisy trägt Jeans und ihren roten Wollmantel. Ich habe ein paar Sachen aus ihrem Zimmer in eine Reisetasche gepackt. Ihr blutverschmierter Schlafanzug wurde ins Labor geschickt, und man hat Proben von Daisys Speichel und ihren Fingernägeln für eine DNA-Analyse genommen.
In dem Reihenhaus in Clapham folgt Daisy mir durch die Haustür und zieht sofort die Schuhe aus, als wäre sie schon hundertmal hier gewesen. Ich stelle sie in ein Regal, das Henry gebaut hat. Wenn er nicht gerade Brände bekämpft, ist mein Mann nebenbei auch als Handwerker aktiv.
»Du hättest Schreiner werden sollen«, habe ich einmal zu ihm gesagt.
»Wie Josef«, fügte er hinzu.
»Dann wäre ich Maria.«
»Und schwanger.«
»Aber trotzdem noch Jungfrau.«
»Okay, hier beenden wir die Analogie vielleicht lieber.«
Die Tagespost liegt noch ungeöffnet auf der Fußmatte. Stromrechnungen, Kontoauszüge und Werbeprospekte für lokale Restaurants und Geschäfte.
Henry späht über das Geländer. »Hallo, Fremde. Ich dachte, du wärst an einem Tatort.«
Daisy tritt hinter mir hervor. Sie blinzelt Henry mit ihren unfassbar langen Wimpern an.
»Das ist Daisy«, sage ich. »Sie besucht uns für einen Tag.«
Henry sieht mich verwirrt an und überprüft dann rasch, dass er mehr anhat als nur seine Boxershorts.
»Er sieht vielleicht ein bisschen furchteinflößend aus, aber er ist ein großer Teddybär«, erkläre ich Daisy.
»Ist er dein Freund?«
»Nein, ich habe ihn geheiratet.«
Sie hält ihr Stofftier hoch. »Das ist Hippo.«
»Ist Hippo ein Junge oder ein Mädchen?«, fragt er.
»Ein Junge natürlich.«
»Also, Hippo sieht aus, als hätte er Hunger. Was möchte er essen? Porridge? Rührei? Baked Beans?«
»Daddy sagt, von Bohnen muss man furzen.«
»Das ist sehr wahr«, sagt Henry. »Außer man heißt Philomena. Die furzt nie.«
»Sehr witzig«, sage ich.
Die beiden lachen, weil sie den gleichen kindischen Humor haben.
»Okay, was möchtest du denn essen?«, fragt er.
Daisy runzelt konzentriert die Stirn und verkündet dann: »Nudeln mit staubigem Käse.«
»Was ist staubiger Käse?«, frage ich.
»Ich glaube, sie meint Parmesan«, sagt Henry.
Eine perfekte Beschreibung.