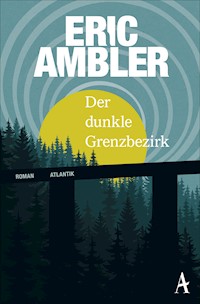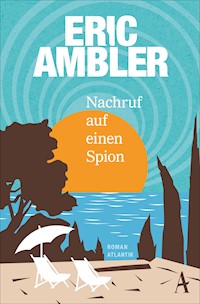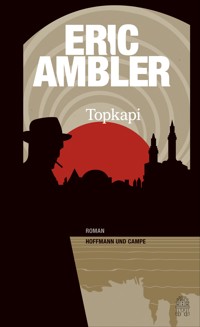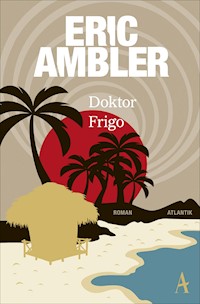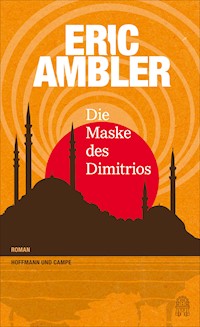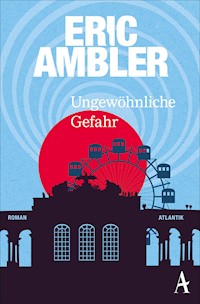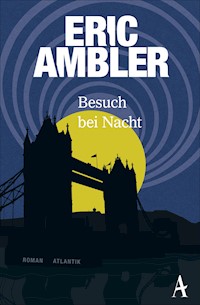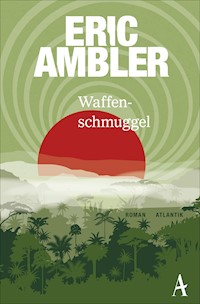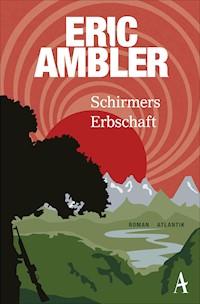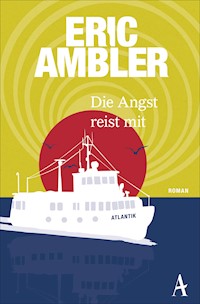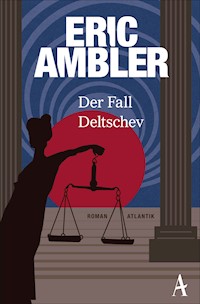
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem Balkanstaat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Oppositionspolitiker Deltschev angeklagt: Ihm werden Verrat und terroristische Verschwörung vorgeworfen. Im Auftrag einer amerikanischen Zeitung berichtet der feinsinnige britische Theaterschriftsteller Forster über den Schauprozess und gerät dabei in ein Dickicht von dunklen Machenschaften, hinterhältigen Machtkämpfen und einem gefährlichen Komplott. Bald geht es nicht nur für Deltschev um Leben und Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Eric Ambler
Der Fall Deltschev
Roman
Aus dem Englischen von Mary Brand und Walter Hertenstein
Atlantik
Vieles an euren Guten macht mir Ekel,
und wahrlich nicht ihr Böses.
Wollte ich doch, sie hätten einen Wahnsinn,
an dem sie zu Grunde giengen,
gleich diesem bleichen Verbrecher!
Nietzsche, Also sprach Zarathustra
1
In Ländern, in denen anders zu denken als die Machthaber gleichbedeutend ist mit Hochverrat, wird der politische Führer, der dieses Verrates überführt ist, nicht unbedingt sein Ansehen beim Volk verlieren. Und wenn das Volk ihn verehrt und geliebt hat, verleiht vielleicht gerade seine Hinrichtung seinem Leben eine Würde, die es vordem nicht besaß. In solchen Fällen sieht sich die tyrannische Regierung, die ihn verurteilte, nicht nur mit der Erinnerung an einen fehlbaren Menschen, sondern mit einem Mythos konfrontiert, mächtiger als der wirkliche Mensch es je hätte sein können – und unverletzbar. Daher ist ein solcher Prozess keine Formalität, sondern eine Vorbereitungsphase und Vorsichtsmaßnahme. Zuerst muss der Mensch entehrt und zerstört werden, und dann kann man ihn gefahrlos als Verbrecher behandeln. Manchmal zwingt man ihn, die Verbrechen, deren er beschuldigt ist, kläglich einzugestehen; wenn er aber nicht Mitglied der Partei war, die ihn jetzt zu vernichten sucht, so finden solche Geständnisse nicht immer Glauben beim Volk; und wenn er gar Führer einer noch nicht aufgelösten Oppositionspartei ist, tut die Regierung gut daran, den Schein eines korrekten Prozesses zu wahren, Zeugen beizubringen, Beweise zu beschaffen und ihm zu gestatten, sich zu verteidigen.
So war es mit Nikolai Petkow in Bulgarien, mit Julius Maniu und Jon Mihalatsche in Rumänien und mit vielen anderen Liberalen in Osteuropa. Petkow wurde gehenkt. Maniu und Mihalatsche wurden zu lebenslänglicher Einzelhaft verurteilt. Als der Prozess gegen Jordan Deltschev anfing, gab es bereits ein Schema für derartige Verfahren.
Die Anklage gegen ihn lautete auf ›Verrat und Vorbereitung einer terroristischen Verschwörung zur Ermordung des Staatsoberhauptes‹. Der Prozess begann am 11. Juni vor dem Volksgericht. In der Anklageschrift wurde er als ›Vorsitzender der agrarsozialistischen Partei und früheres Mitglied der Provisorischen Regierung der Nationalen Einheit‹ bezeichnet. In Wirklichkeit war er Premier- und Außenminister dieser Regierung gewesen und war immer noch Führer der letzten nennenswerten Opposition gegen die Regierung der Volkspartei.
Ein amerikanischer Zeitungsverleger, dem ich in London mehrmals begegnet war, hatte mich aufgefordert, dem Prozess beizuwohnen und eine Artikelserie darüber zu schreiben. Ich war von diesem Angebot überrascht, denn ich hatte niemals etwas in dieser Art geschrieben und dachte zuerst an eine Namensverwechslung. Es war aber kein Irrtum gewesen, und ich hatte den Auftrag angenommen.
Ich glaube, die meisten Schriftsteller, die noch nie für Zeitungen gearbeitet haben, gefallen sich dann und wann in dem Gedanken, sie wären glänzende Reporter, wenn sich nur die Gelegenheit böte. Manche haben damit auch recht. Bei mir lag es anders. Mit einer Feierlichkeit, die mir nachträglich rührend erscheint, suchte ich mir einen alten Times-Artikel über Deltschev heraus, kaufte einige einschlägige Bücher und speiste mit einem Volkswirtschaftler, der einmal vor dem Königlichen Institut für Internationale Angelegenheiten einen Vortrag gehalten hatte. Ich fühlte mich verpflichtet, über das Land, das ich besuchen wollte, sein Volk und seine Probleme etwas zu erfahren.
Sonderbarerweise erfuhr ich tatsächlich etwas. Bei diesem Mittagessen hörte ich zum ersten Mal von der ›Bruderschaft des Offizierskorps‹. Mein Bekannter tat sie als Witz ab.
Ursprünglich war diese Bruderschaft anscheinend eine Wohlfahrtseinrichtung gewesen für die Familien der Armeeoffiziere, die nach dem Putsch in Mazedonien 1925 erschossen worden waren; der Bund sollte die Familien schützen und sie finanziell unterstützen. Die Gründer waren Kameraden der Opfer und hatten mit ihrer Sache sympathisiert; aber sie waren keine reichen Leute, und bald kamen einige von ihnen zu der Überzeugung, der ehrenhafteste Schutz und die beste Hilfe für die Hinterbliebenen sei, jene zu ermorden, die deren Ernährer zum Tode verurteilt hatten.
Anfang der dreißiger Jahre war die Bruderschaft zu einer Geheimgesellschaft reaktionärer Extremisten geworden und hatte mindestens achtundzwanzig politische Morde verübt. Sie befasste sich nun nicht mehr mit einfachen Racheakten, sondern wollte die potenziellen Urheber künftiger Ungerechtigkeiten, die später zu rächen wären, vorsorglich umbringen. Und da nach dem Dogma der Bruderschaft jeder Politiker oder höhere Beamte mit Neigung zu liberalen Ideen als potenzieller Urheber künftiger Ungerechtigkeiten galt, wurde die Bruderschaft zu einem Problem für alle Parteien.
Alle Versuche der verschiedenen Vorkriegsregierungen, die Mörder vor Gericht zu bringen und die Organisation zu zerschlagen, waren halbherzig und hatten nur zum Teil Erfolg. Es war freilich leicht, die Bruderschaft zu missbilligen, aber es gehörte Mut dazu, etwas gegen sie zu unternehmen. Die Bruderschaft überlebte und behielt auch viel von ihrem traditionell militärischen Charakter bei, obwohl sie von ihrem Prinzip, nur Offiziere als Mitglieder aufzunehmen, abgegangen war, und sich bald Psychopathen aus allen möglichen Bevölkerungsschichten ihr anschlossen. ›Revolver und Dolch‹, das Symbol anderer terroristischer Organisationen des Balkans, wurde von der Bruderschaft in ›Gewehr und Bajonett‹ umgeändert, und während der Besetzung hatte sie aus Snobismus lieber mit der Wehrmacht zusammengearbeitet als mit der Gestapo.
Jedoch auch dieser Beweis von Unterscheidungsvermögen hatte die Provisorische Regierung, die nach der Befreiung eingesetzt wurde, nicht vom Versuch – dem ersten ernsthaften – abgehalten, die Bruderschaft ein für alle Mal auszurotten. Sie bediente sich dabei aller Vollmachten, die ihr die Notstandsgesetze gaben. Schon auf der Mitgliedschaft bei dieser Organisation stand der Tod, und monatelang fanden Verhaftungen, Schnellverfahren und Hinrichtungen statt. Die Säuberungsaktion war so erfolgreich gewesen, dass niemand daran zweifelte, dass die Bruderschaft von einem ihrer Mitglieder verraten worden war. Aber daran dachte man bald nicht mehr. Als während der Wahlen keiner der üblichen Bruderschaftsmorde vorkam, nahm man erleichtert an, dass die Organisation nun endlich tot und begraben sei. Und jetzt wurde diese Leiche ausgegraben und – o Wunder! – für lebendig erklärt. Denn unter anderem warf man Deltschev vor, dass er, der es sich als Führer der Provisorischen Regierung zur Aufgabe gemacht hatte, die Bruderschaft auszurotten, in Wirklichkeit eines ihrer Mitglieder und das Haupt einer Verschwörergruppe gewesen sei, die den Regierungschef der Volkspartei ermorden wollte.
Ich verließ London Ende Mai und kam einen Tag vor Beginn des Prozesses in der Landeshauptstadt an.
2
In einem großen Teil Südosteuropas sind die schwersten Regengüsse Anfang Juni schon vorüber, und der Schlamm in den Straßen trocknet, wird hart und zu Staub zerrieben. Die bunten Mauern der Dörfer glühen in der starken Sonne, und die Schatten sind schwarz und scharf. Nur auf den höheren Balkan-Berggipfeln liegt noch Schnee. Das Getreide steht hoch und üppig, und in den Flusstälern östlich der jugoslawischen Grenze sieht man vom Zug aus die Felder mit Rosen und weißem Mohn in voller Blüte. In den Städten aber ist die Luft feucht, und die Insekten, die in der Sonne über den Abfällen schwirren oder aus den dunklen Tiefen der Hotelbetten kriechen, sind voller Lebenslust. Der Mensch jedoch verspürt um diese Zeit eine seltsame Niedergeschlagenheit; seltsam, weil trotz der Trägheit des Körpers der Geist unruhig wacht, als fürchte er ein drohendes Unheil.
Auf dem Zentralbahnhof empfing mich der Vertreter meines Auftraggebers. Sein Name war Georghi Paschik.
Ich sah ihn auf dem Bahnsteig stehen, als mein Zug einlief; ein kleiner, brünetter, schwächlicher Mann mit randloser Brille, einem knapp sitzenden Leinenanzug und einer ganzen Reihe von Füllfederhaltern in der äußeren Brusttasche. Unter dem Arm trug er eine dünne schwarze Aktentasche mit einem silbernen Medaillon am Ende des Reißverschlusses. Er stand an einem Pfeiler und blickte sich um, herrisch-unsicher, wie ein reicher Reisender, der keinen Gepäckträger sieht und weiß, dass er sein Gepäck nicht selbst tragen kann. Ich glaube, es waren die Füller, an denen ich ihn erkannte. Er trug sie wie eine militärische Auszeichnung.
Heute weiß ich viel über Paschik. Ich weiß zum Beispiel, dass die schwarze Aktentasche, die er mit so viel Würde trug, selten etwas anderes enthielt als ein vertrocknetes Sandwich und einen Revolver; dass er den Anzug bekommen hatte, als er in einem Vertriebenenlager arbeitete; dass einer dieser Füllfederhalter aus Passaic, New Jersey, stammte, und dass diese Tatsachen direkt mit seinem Tod zusammenhingen. Ich weiß jetzt ungefähr, wie sein Geist arbeitete, und ich kenne die seltsamen Phantasien, von denen er besessen war.
Aber damals war er für mich nur ein Name, den ich gelegentlich bei einer Unterhaltung gehört hatte – ›unser Vertreter da unten, Paschik, wird Ihnen die nötigen Papiere besorgen‹ –, eine wartende Gestalt auf einem Bahnsteig. Ich war nicht darauf vorbereitet, einem von Gott Gezeichneten zu begegnen.
Er schüttelte mir die Hand und lächelte freundlich.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Foster. Haben Sie schon gefrühstückt?«
»Noch nicht. Nett von Ihnen, mich abzuholen!«
Er machte eine abwehrende Geste. »Ich habe meinen Wagen draußen. Wir werden Ihr Gepäck tragen müssen, Mr. Foster. Um diese Zeit sind keine Gepäckträger da.«
Er sprach recht gut Englisch, mit einem ausländisch-amerikanischen Akzent. Er war mir nicht besonders sympathisch. Er hatte ein rundliches, blasses Gesicht mit Doppelkinn und zwei Tage alten Bartstoppeln, und die braunen feuchten Dackelaugen schielten leicht durch die randlosen Brillengläser. Er wirkte sachlich und sehr höflich.
»Gute Reise gehabt, Mr. Foster?«, fragte er, als wir zu seinem Wagen gingen.
»Danke, leidlich.«
»Keine Schwierigkeiten an der Grenze?«
»Nur die üblichen.«
»Das freut mich.«
Er trug mein Gepäck zu einem schäbigen Opel, der hinten keine Polster hatte. Er nahm mir die Schreibmaschine ab, um sie mit dem Koffer zu verstauen, hielt aber plötzlich inne und betrachtete sie nachdenklich.
»Wissen Sie, Mr. Foster«, sagte er, »manchmal machen die Behörden jenen Besuchern, bei denen sie nicht viel Sympathien für unsere Regierung vermuten, große Schwierigkeiten.«
»So?«
»Leider ja.« Er stellte die Schreibmaschine in den Wagen, ließ aber den Handgriff noch nicht los und wandte sich mir zu. Einen Augenblick schien er etwas sehr Wichtiges sagen zu wollen. Es lag ihm schon auf der Zunge. Dann besann er sich anders. Er zuckte die Achseln. »Es ist jetzt hierzulande alles etwas schwierig, Mr. Foster«, sagte er. »Jedenfalls freut es mich, dass man Ihnen keine Ungelegenheiten machte.«
Sein Büro war in einem Haus direkt neben dem Boulevard Marschall Sokolowski. Es nannte sich ›Paneuropäischer Pressedienst‹ und vertrat die Interessen mehrerer amerikanischer und einiger englischer Zeitungen, deren Besitzer es nach dem Krieg für überflüssig gehalten hatten, wieder eigene Redaktionen in der Hauptstadt zu eröffnen. Paschik war tüchtig und machte einen recht guten Eindruck. Ich musste als Ausländer bei der Polizei und als Pressekorrespondent beim Innen- und beim Propagandaministerium gemeldet werden. Außerdem brauchte ich einen Spezialausweis für den Prozess. Wir waren erst gegen Abend mit allem fertig.
Obwohl wir bei den verschiedenen Amtsstellen ziemlich lange warten mussten und sich auch die üblichen Gelegenheiten zur Unterhaltung boten, wurden wir den ganzen Tag nicht warm miteinander. Er blieb meistens höflich, aber zurückhaltend, vermied jedes Gespräch über Deltschev oder den Prozess, aus dem manchmal recht fadenscheinigen Grund, dass man uns zuhören könnte, und stellte mich den Beamten mit gemessener Höflichkeit vor, die deutlich ausdrückte, dass er für mein künftiges Verhalten keine Verantwortung übernehme. Er machte den Eindruck eines Filialleiters, der den Sonderbearbeiter aus der Hauptstelle zwar auf jede erdenkliche Art unterstützt, sich im stillen aber berechtigte Zweifel erlaubt, ob die Ergebnisse den Aufwand auch rechtfertigen. Das verstand ich recht gut; ich hätte diese Zweifel sogar geteilt. Mit der Zeit realisierte ich aber, dass seine Haltung nur zum Teil Berufsneid war, hinter dem sich ganz andere Sorgen um mich verbargen. Ungereimtheiten in seinem Verhalten ließen das durchblicken: Auf plötzliche Ausbrüche von Herzlichkeit folgten betretene Pausen, in denen ich feststellte, dass mich seine braunen kurzsichtigen Augen verstohlen musterten, als wolle er mein Bankkonto abschätzen; oder dass er, wie vorhin auf dem Bahnhof, etwas verschwieg, das er schon auf der Zunge hatte. Wahrscheinlich waren, während ich unterwegs war, schlechte Nachrichten für mich eingetroffen, oder er hatte eine Bitte an mich, die ich vermutlich ablehnen würde. Der Gedanke machte mich nervös. Und leider hatte ich Paschik gegenüber bereits ein schlechtes Gewissen. Ich konnte ihn nicht leiden – seines Geruches wegen.
Ich hatte diesen sauren, muffigen Geruch gleich bemerkt, als wir am Bahnhof in seinen Wagen gestiegen waren, und zuerst wusste ich nicht, ob der Wagen oder der Besitzer stank. Ich habe sicher keine heikle Nase, und die Ausdünstung der Großstädter stört mich nicht. Ich habe oft Leute mit »Körpergeruch« getroffen, die mir aber deshalb nicht zuwider waren. Paschik aber war mir zuwider. Vielleicht lag es daran, dass er in Auftreten und Erscheinung – mit Leinenanzug, amerikanischer Brille, Aktentasche, betonter Gefälligkeit – ganz und gar nicht zu diesem schlechten Geruch passte. Ich erinnere mich noch jetzt: Als ich festgestellt hatte, dass er so roch und nicht der Wagen, achtete ich bei allen Leuten, mit denen wir in Berührung kamen, besonders darauf, ob das, was meine Nase beleidigte, nicht vielleicht nur der Geruch dieser Stadt und nicht der eines bestimmten Bürgers sei. Aber nein – es war Paschik. Ich konnte ihn nicht riechen. Das war unvernünftig und erwies sich bei allem, was später passierte, als Nachteil für mich.
Die Sonne war noch nicht untergegangen, aber ein Kirchturm und die Kuppel einer Moschee streckten ihre Schatten wie Daumen und Zeigefinger über den St. Mihailsplatz, als wir, zum letzten Mal an diesem Tag, aus dem Propagandaministerium traten und zu Paschiks Wagen zurückgingen. Ich hatte meinen Sonderausweis für den Prozess.
Paschik winkte übertrieben bescheiden ab, als ich ihm dankte. »Man tut, was man kann, Mr. Foster.« Es war einer seiner herzlichen Augenblicke. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, mitzukommen und zu warten, bis ich in meinem Büro Ordnung gemacht habe, möchte ich Sie zum Essen einladen. Ich gehe immer in ein spezielles Restaurant.«
Ich hätte gern abgelehnt; stattdessen nahm ich dankend an. Zu seinem Büro gehörte ein winziger Vorraum mit einer Milchglastür, auf der in Ölfarbe die Namen aller Zeitungen standen, die er vertrat. Die Liste war lang und imponierend, und das Büro dahinter bildete einen grotesken Gegensatz dazu. Es enthielt einen Schreibtisch, einen Tisch, zwei Stühle und ein paar Aktenregale. Das Fenster ging auf einen hohen Schacht mit Feuerleitern hinaus und ließ nur warme, schale Luft und schwaches Licht herein, sodass die Ecken des Zimmers im Dunkeln lagen. Auf einem der Aktenregale stand, auffallend gerahmt, als wäre es das Foto seiner Frau, ein Werbefoto von Myrna Loy mit dem Faksimile ihrer Unterschrift.
Er schaltete die Schreibtischlampe ein und machte sich daran, einen Stoß von Pressemeldungen durchzusehen. Die meisten wurden zerknüllt beiseitegeworfen; auf zwei oder drei schrieb er etwas und händigte sie einem Jungen mit einer Dienstmütze aus, der ihn hier erwartet hatte; einige klammerte er zusammen und legte sie in eine Mappe. Nachdem er bei der letzten Meldung angelangt war, gab er dem Jungen etwas Geld und schickte ihn fort. Dann hob er das Telefon ab und führte mit einer Frau ein Gespräch, von dem ich nichts verstand. Ihre Stimme tönte blechern aus der Muschel. Das Gespräch endete mit einem Crescendo von Verneigungen. Paschik stand auf und begann, den Schreibtisch aufzuräumen, stirnrunzelnd und sichtlich verstimmt.
Ich saß außerhalb des Lichtkreises seiner Lampe im Dunkeln und beobachtete ihn. Die kleinen Hände bewegten sich jetzt unsicher. Er rang sich offensichtlich zu einem Entschluss durch. Dann hörte er mit Aufräumen auf und blickte zu mir herüber, setzte sich wieder, lehnte sich zurück, zog eine Packung amerikanischer Zigaretten aus der Tasche und machte sie auf.
»Mr. Foster«, fing er sehr vorsichtig an, »da ist ein Problem, über das ich noch nicht mit Ihnen gesprochen habe.« Jetzt waren wir so weit.
»Ja – und das wäre?«
Er ließ die Augen nicht von dem Zigarettenpäckchen. »Das Problem der Zensur. Sie wissen natürlich, dass die Zensur hier sehr streng ist?«
»Ja – das wurde mir gesagt.«
»Gewöhnlich spielt sich die Sache so ab, dass ich das Manuskript der Zensurstelle unterbreite und es dann als Telegramm oder per Luftpost wegschicke.«
»Ich verstehe.«
»Ja, das ist der normale Ablauf.« Er betonte jedes einzelne Wort.
»Und Sie meinen, es wäre Ihnen am liebsten, wenn auch ich Ihnen meine Artikel gäbe, damit Sie sie der Zensur vorlegen und dann weiterbefördern? Stimmt das?«
Einen Augenblick zögerte er mit der Antwort, dann begann er langsam auf den hinteren Beinen seines Stuhls vor und zurück zu wippen.
»Mr. Foster – die Zeiten hier in diesem Land sind nicht normal«, sagte er.
Ich wartete. In seinen Brillengläsern blinkte das Licht der Schreibtischlampe regelmäßig auf, wenn er vorwärts wippte. Er fuhr fort: »Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Artikel satirische Elemente enthalten könnten, die die Regierung verunglimpfen und brandmarken.«
»Das ist wohl möglich.«
Er schüttelte feierlich den Kopf. »Ich kann Ihnen offen sagen, Mr. Foster: Das ist ausgeschlossen, völlig ausgeschlossen.«
»Nun, das werden wir ja sehen.«
»Hat man Sie in der Chefredaktion nicht gewarnt, dass hier alles etwas schwierig sein wird?«
Ich lächelte liebenswürdig. »Man sagte mir, dass Sie schwierig sein würden, Herr Paschik.«
Er hörte auf zu wippen. »Aber, aber, Mr. Foster! Sie verstehen mich ganz falsch. Die Zensur ist hier sehr mächtig. Wenn Sie Artikel gegen das Regime der Volkspartei schreiben, könnte Ihnen das gemäß der Februarverordnung Gefängnis und eine hohe Buße eintragen.«
»Ja, vielleicht könnte es das.«
»Zugegeben, in Ihrem Fall würde die Verordnung wohl kaum angewendet werden, aber man würde Ihnen den Spezialausweis für den Prozess sofort entziehen, und Sie hätten Unannehmlichkeiten mit der Polizei.«
»Auch daraus ließe sich ein Artikel machen.«
Seine Lippen wurden schmal. »Es versteht sich von selbst, dass Ihre Artikel konfisziert würden, Mr. Foster. Wenn Sie es amüsant finden, Artikel zu schreiben, damit sie konfisziert werden, so ist das Ihre Sache. Ich befasse mich mit konkreter Pressearbeit.«
Das saß. Ich tat das nicht. Aber ich merkte, dass er es im Moment auch nicht tat. Ich vermute, er wollte mir zeigen, wie hilflos ich ohne ihn wäre. Ich sagte so ruhig ich konnte: »Nun gut, Sie sind hier der Repräsentant der Zeitung, und Sie sagen mir, dass alles sehr schwierig sei. Ich verstehe. Also: Wie können wir die Schwierigkeiten umgehen?«
Ich musste eine Weile warten, während er sich eine Zigarette anzündete und den Rauch langsam an dem brennenden Ende vorbeiblies, wie ein schlechter Schauspieler, der so tut, als denke er nach. »Nun, Sie könnten ja versuchen, übers Wochenende nach Griechenland zu fahren und Ihre Artikel von dort wegzuschicken.« Die Rauchwolke wurde etwas dichter. »Natürlich würde die Polizei Ihnen auf die Schliche kommen. Ein Amerikaner von einer Chicagoer Zeitung hat es probiert.«
»Und?«
Nun sah er mich fest an. »Er hat bloß eine Menge Zeit verschwendet, Mr. Foster. Selbstverständlich hatte er kein Manuskript bei sich, als man ihn an der Grenze untersuchte; er hatte es auswendig gelernt; aber man machte ihm Schwierigkeiten mit seinem Visum, nahm ihm zwecks Überprüfung den Pass ab und hielt ihn eine Woche an der Grenze fest. Es war recht unangenehm für ihn.«
»Ich verstehe. Und nun, da Sie mir erzählt haben, auf welche Art man es nicht machen kann, schlagen Sie etwas anderes vor!«
Er wippte wieder. »Ich habe keinen Vorschlag, Mr. Foster. Es sind auch schon andere Methoden versucht worden. Eine Zeit lang benutzte man das Personal fremder Fluglinien als Kurier, aber nicht lange. Es ist zu gefährlich für die Leute. Ich habe mein Bestes getan, der Chefredaktion das alles begreiflich zu machen – wurde aber in London und New York nicht ernst genommen.«
»Sie halten es also für eine große Zeitvergeudung, dass ich überhaupt hier bin?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Dem Sinn nach haben Sie es gesagt.«
»Sie haben mich missverstanden. Ich selbst stehe Ihren Artikeln positiv gegenüber. Dieser Prozess ist dramatisch – hm –« Er brach ab und suchte das richtige Wort.
»Sie meinen – theatralisch?«
»Jawohl, theatralisch. Danke sehr. Ein aus ideologischen Gründen gegen einen Politiker geführter Prozess muss der westlichen Mentalität höchst theatralisch vorkommen. Daher finde ich es eine gute Idee unseres Redakteurs, einen hervorragenden Bühnendichter wie Sie, Mr. Foster, über den Prozess Deltschev berichten zu lassen. Ich selbst brenne auf Ihre Artikelserie. Aber« – er beugte sich eindringlich nach vorn – »Sie können sie nicht hier schreiben und nicht von hier ins Ausland schicken oder bringen; das heißt, wenn Sie nicht einfach die offiziellen Berichte des Propagandaministeriums zugrunde legen und ausschmücken und jede Seite von der Zensur abstempeln lassen wollen. Damit müssen Sie sich abfinden.«
»Aber –«
»Wohnen Sie dem Prozess bei, Mr. Foster, memorieren Sie« – er berührte mit dem Finger die Stirn, um mir zu zeigen, wo ich zu memorieren hätte –, »und fahren Sie dann nach Hause und schreiben Sie Ihre Artikel. Das ist der einzige Weg.«
Ich antwortete nicht gleich.
Ich hatte vier Tage lang im Zug gesessen und unterwegs wenig geschlafen. Um sieben Uhr morgens war ich in einer fremden Stadt angekommen, bei drückend heißer Sonne, in einer stickigen Atmosphäre, die mich einfach fertiggemacht hatte. Mein Gepäck stand in einem Hotel, das, was meine Erinnerung an das Straßennetz anbetraf, ebenso gut hundert Meter wie drei Kilometer von dem Büro entfernt sein konnte, in dem wir jetzt saßen; aber selbst wenn ich mein Hotel fand und mich an die Zimmernummer erinnerte – wie sollte ich nach dem Schlüssel fragen? Ich hatte Cafés und Ämter abgeklappert, Gespräche, die mich betrafen, in einer mir unverständlichen Sprache anhören müssen, immer im Schlepptau eines beleidigten, wichtigtuerischen Balkanesen mit fetten Hüften und unangenehmer Ausdünstung. Ich hatte eine Blase an der rechten Fußsohle und ein schmutziges Gesicht. Dazu kam, dass ich hungrig war und schon wünschte, ich wäre nie hergekommen.
Jetzt sagte man mir noch, es sei bedauerlich, dass ich überhaupt gekommen sei, aber ich dürfe hierbleiben und mir das Theater ansehen, falls ich mich anständig benähme und Lust hätte, meine Zeit zu vergeuden. So schien es mir damals wenigstens. Ich wurde wütend, beherrschte mich aber und antwortete dann mit ruhiger Stimme.
»Herr Paschik, Sie wissen genauso gut wie ich, dass diese Artikel als Kommentare zum Prozess gedacht sind. Später haben sie doch keinen Wert mehr.«
»So, glauben Sie das?« Er lächelte wissend-überlegen. »Deltschev wird zum Tode verurteilt werden, und Ihre Artikel bilden einen Teil der Kampagne gegen das Urteil.«
»Das entspräche nicht meinem Auftrag. Ich soll sie wegschicken, sobald sie geschrieben sind.«
»Und warum?« Er warf beide Hände hoch und zeigte beim Lächeln Zähne wie Salzmandeln. »Damit Sie, Mr. Foster, der berühmte Bühnendichter, keine Zeit haben, sich auf Spesenkonto zu amüsieren; oder einen Einfall für ein neues Stück über das Leben hinter dem düsteren Eisernen Vorhang ausarbeiten und Ihren Auftrag vergessen. Die Verleger behandeln uns alle wie Kinder.«
»Trotzdem – man wartet auf meine Artikel.«
»Nein, Mr. Foster. Man wartet nicht auf Ihre Artikel. Ich habe an die Chefredaktion gekabelt, dass sie vor Ihrer Rückkehr nicht verfügbar sein werden.«
»Ich muss schon sagen – Sie hätten mich fragen sollen, ehe Sie das taten.«
»Ich trage die Verantwortung, Mr. Foster.«
Eine peinliche Pause entstand. Dann sagte ich: »Herr Paschik, sind Sie Mitglied der Volkspartei? Ich habe ganz vergessen, Sie danach zu fragen.«
Er lächelte wieder, aber sein amerikanischer Akzent wurde noch betonter. »Oh, Mr. Foster, jetzt sind Sie mir böse. Ich kann es Ihnen nicht verdenken. Ich will offen zu Ihnen sein.«
»Gut.«
»Wenn es Scherereien mit der Zensur gibt über irgendeinen Artikel, der aus diesem Büro abgeschickt wird, so wird es einfach geschlossen. Das bedeutet für mich: Ich sitze auf der Straße und bin erledigt. Denn ich bin dafür verantwortlich.«
»Dann sind Sie aber auch verantwortlich, wenn diese Artikel nach dem Prozess erscheinen.«
»O nein. Lässt das Propagandaministerium Sie ins Land, so ist es seine Sache, wenn Sie nach Ihrer Abreise kritische Artikel veröffentlichen, nicht meine. Solange Sie aber hier sind, ist dieses Büro dafür verantwortlich, dass Sie den Ablauf des Prozesses nicht durch negative Berichterstattung beeinflussen.« Er zuckte die Achseln. »Das ist fraglos zweckdienlich für das Ministerium. Ich persönlich bin ein Feind des Regimes. Aber ich bin schon einmal wegen meiner Überzeugung ausgewiesen worden, und der ›Paneuropäische‹ hat als Repräsentant von 27 ausländischen Zeitungen nicht nur gegen Ihren Chefredakteur Verpflichtungen. Sehen Sie, Mr. Foster, deshalb muss ich mit der Regierung zusammenarbeiten.«
Ich wusste nichts Rechtes zu antworten. Am liebsten hätte ich meinen Spezialausweis für den Prozess aus der Tasche gezogen, auf Paschiks Schreibtisch gelegt und ihm gesagt, dass ich am nächsten Morgen abreisen würde. Und das war sicher genau das, was er sich erhofft hatte. Ich zögerte, weil ich mich meiner Aversion gegen ihn schämte. Er schob mir die Zigaretten hin.
Ich schüttelte den Kopf. »Wann haben Sie das Telegramm abgeschickt?«
»Vor vier Tagen, Mr. Foster.«
»Warum nicht eher?«
»Es stand nicht ganz fest, dass Sie kommen würden.«
»Aber das war doch seit drei Wochen fest abgemacht.«
»Das wusste ich nicht.«
»Bekamen Sie eine Antwort?«
»Ja, Mr. Foster.«
»Darf ich sie sehen, bitte?«
»Selbstverständlich.« Er zog eine Schublade heraus, entnahm ihr ein Telegramm und legte es vor mich hin. Ich las: Ihr 109 vom sechsten Juni verstanden benachrichtigen Sie Foster und arrangieren Sie Rückflug London sobald Prozess abgeschlossen.
»Das hätten Sie mir früher zeigen können«, sagte ich.
»Ich habe nicht gleich begriffen, dass Sie mir nicht trauen, Mr. Foster«, sagte er leise. »Das Telegramm besagt nur, dass ich Sie benachrichtigen und Ihnen die Rückreise per Flugzeug sichern soll. Es erklärt nichts von dem, was ich Ihnen erzählt habe. Sie müssen mir ganz einfach glauben, dass ich Ihnen die Wahrheit sage.«
Sein Lächeln verriet, dass er den Augenblick für gekommen hielt, da ich mir selbst dumm vorkommen und mich entschuldigen musste. Vielleicht war es dieses Lächeln, das mich davon abhielt. Ich sagte stattdessen: »Ich nehme an, die übrigen ausländischen Korrespondenten unterliegen denselben Bestimmungen?«
»Wenn sie gegen die Regierung sind, müssen sie sich dieselbe Zurückhaltung auferlegen.«
»Und die Geschichte von dem Amerikaner, der sein Wochenende in Griechenland verbringen wollte – die haben Sie vermutlich erfunden, für den Fall, dass ich auf diese Idee kommen sollte, ohne Ihnen etwas davon zu sagen?«
»Ich wollte Sie vor so plumpen Methoden warnen.«
»Sie pflegen auf Umwegen zu Ihren Zielen zu gelangen, nicht wahr?«
Er sah mich nachdenklich an. »Daran gewöhnt man sich, Mr. Foster«, sagte er. Nach einer kleinen Pause fuhr er fort: »Umwege sind manchmal die sichersten Wege. Nun, wie dem auch sei« – seine Miene veränderte sich, und er stand auf, Freundlichkeit und seine Ausdünstung verströmend –, »es tut gut, einen Menschen zu treffen, der die Offenheit vorzieht. Wir werden uns schon verstehen.« Er lächelte heiter. »Wir werden gut miteinander auskommen, Mr. Foster. Wir können einander behilflich sein – und so ist es richtig. Ich will es Ihnen beweisen.«
Er ging zu einem Aktenschrank, der ganz im Dunkeln stand, öffnete eine der Schubladen und begann darin herumzukramen.
»Wissen Sie, Mr. Foster«, murmelte er, während er die Akten durchsah, »es ist weder ehrenvoll noch lohnend, aus einem Lande ausgewiesen zu werden. Ein paar Stunden lang sind Sie der tapfere Mann, der es gewagt hat, die Wahrheit zu sagen. Aber am nächsten Tag, wenn der Händedruck der Freunde vergessen ist, sind Sie einer der vielen arbeitslosen Reporter – weiter nichts.«
Er kam wieder zum Schreibtisch, mit einem unordentlichen Aktenbündel und einem großen Briefumschlag.
»Wann passierte Ihnen das?«, fragte ich.
»1930, in Italien. Ich war damals auch noch verheiratet«, sagte er. Er zögerte ein paar Sekunden, dann stopfte er die Akten in den Umschlag und gab ihn mir, mit dem bekümmerten Lächeln eines reichen Onkels für seinen ungeratenen Neffen, den er aber gern hat.
»Die Büroakten über Jordan Deltschev, Mr. Foster. Sie werden Ihnen von Nutzen sein.«
»Danke sehr.«
»Nichts zu danken.« Er hob abwehrend die Hand. »Ich möchte Ihnen gern behilflich sein, Mr. Foster. Und ich möchte, dass Sie das auch wissen. Und das meine ich ehrlich. Avanti! Jetzt gehen wir essen, nicht wahr?«
In der Nacht war ich zu müde, um zu schlafen. Eine Weile versuchte ich es, dann gab ich es auf, machte Licht und las die Akten, die Paschik mir gegeben hatte.
Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich noch, dass ich über den Deltschev-Prozess schreiben würde.
3
Ich will kurz aufzeichnen, was ich aus den Akten erfuhr. Bis zum Frühjahr 1940, als sein Land ebenso wie zwei andere mit den Achsenmächten paktiert hatte, verfügte Jordan Deltschev über keine breite Gefolgschaft im Volk, obwohl er im Rate der agrarsozialistischen Partei eine bedeutende Rolle spielte. Ursprünglich Rechtsanwalt von Beruf, war er Abgeordneter eines Industriegebietes gewesen und dann, nachdem er der Monarchie und später der Republik auf verschiedenen untergeordneten Posten gedient hatte, Postminister geworden.
Damals galt er in unterrichteten Kreisen als ein sehr fähiger Mann, der entweder ehrlich oder noch nicht ernstlich in Versuchung geführt worden war. Begreiflicherweise traute man ihm damals noch nicht zu, dass er das Zeug zu einem großen Volksführer hätte. Sein besonderes Talent lag im Organisatorischen; und obwohl er als Redner nicht unbegabt war, schien seine sachliche Argumentation, die in der Debatte ausgezeichnet gewirkt hatte, durchaus nicht geeignet, die Herzen einer bäuerlichen Zuhörerschaft zu erobern. Dennoch geschah dies eines Tages; doch das ergab sich nur durch eine besondere Verkettung von Umständen. Deltschev selbst hatte herzlich wenig damit zu tun.
Er war einer der wenigen Abgeordneten und der einzige Minister, der sich energisch gegen das Bündnis mit der Achse ausgesprochen hatte; und während des Sommers 1940 hatte man ihn auf Drängen der deutschen Behörden interniert. Gegen Ende des Jahres wurde er freigelassen, blieb aber unter Polizeiaufsicht. Zwei Jahre vergingen, ehe diese Aufsicht so weit gelockert wurde, dass er sich der politischen Untergrundbewegung anschließen konnte, mit der sein Name in Zukunft so eng verknüpft werden sollte.
Vor diesem Zeitpunkt bestand der Widerstand gegen die deutschfreundliche Regierung hauptsächlich aus Sabotageakten gegen Werke, die Kriegsmaterial herstellten, und Propaganda gegen die Rekrutierung von Soldaten für die russische Front. Die Gruppen, die unter der Leitung kämpferischer Volksparteileute diese Sabotage durchführten, bestanden zu einem großen Teil aus Agrarsozialisten. Ihre Aktionen waren manchmal spektakulär und immer gefährlich, fügten jedoch dem Feind nur wenig Schaden zu, und die Wirkung im Volk war gering. Nach Deltschevs Meinung musste die Untergrundbewegung eine ganz andere Politik betreiben; sie sollte die Entscheidungen des Kriegs denen überlassen, die wirkungsvoll kämpfen konnten, und sich auf die Planung der Zukunft des Landes konzentrieren, für die Zeit, die unmittelbar auf den unvermeidlichen deutschen Zusammenbruch folgen würde. Er sah ein, dass das Schicksal des Landes, was die Siegermächte anbetraf, sehr davon abhängen würde, wie schnell es eine Provisorische Regierung zu stellen vermochte, die so wenig kompromittiert war, dass sie ohne Unterwürfigkeit verhandeln konnte, und zugleich stark genug, um einen Bürgerkrieg zu verhindern.
So entstand das Komitee der Nationalen Einheit; es war nicht von Deltschev allein geschaffen worden, aber ihm verdankte es seinen Erfolg. Die Untergrundbewegungen eines Staates bestehen meistens aus seinen opfermutigen, romantischen und geistig unausgeglichenen Männern und Frauen, die mehr Mut und Hingabefähigkeit als Organisationstalent und politische Geschicklichkeit besitzen. Da Deltschev der hellste Kopf des Komitees und zudem das einzige Mitglied mit praktischer Erfahrung in Regierungsgeschäften war, wurde er – obschon niemals offiziell dazu ernannt – faktisch Präsident, Generalsekretär und schließlich Wortführer dieses Komitees. Hunderttausende, die noch nie etwas vom Postminister Deltschev gehört hatten, lernten jetzt den Patrioten Deltschev kennen und verehren. Und als die Zeit kam, da er zu ihnen sprechen musste, waren seine feste Stimme und seine sachliche Art nach dem hysterischen Gefasel der Kriegsjahre Ausdruck von gesundem Menschenverstand und Güte. Das Volk fühlte, dass aus Deltschevs Mund die Wahrheit sprach.
Hätte sich die vom Komitee im Frühjahr 1944 gebildete Provisorische Regierung der Nationalen Einheit nur für einen raschen Friedensschluss eingesetzt, so hätte sie damit allein ihre Daseinsberechtigung schon bewiesen; denn dadurch bewahrte sie alle nördlichen Grenzprovinzen bis auf eine vor der Zerstörung und rettete die kleine Armee für polizeiliche Aufgaben. Sie tat aber viel mehr. Sie konnte die bedingte, aber ausreichende Anerkennung durch die Vereinten Nationen sichern und brachte es in diesen Tagen übereilter Verhandlungen und wechselnder Herrschaft fertig, die Diskussionen über territoriale Ansprüche und über Demontagen von Industrieanlagen zu verwirren und hinauszuzögern. Sie erreichte bei größter Schonung der nationalen Wirtschaft und des nationalen Stolzes, dass die meisten lebenswichtigen Entscheidungen über die Zukunft des Landes nicht im Siegestaumel, sondern in der freundlichen Atmosphäre langwieriger Friedenskonferenzen getroffen wurden. Das Verdienst an diesen Erfolgen wurde Deltschev zugeschrieben. Man fing an, ihn scherzhaft und liebevoll ›Väterchen Deltschev‹ zu nennen.
Ohne diesen Kosenamen hätte es vielleicht keine Volkspartei-Regierung und keinen Deltschev-Prozess gegeben.
Als die Provisorische Regierung zur Macht kam, sagten vernachlässigte Mitglieder aus Deltschevs eigener Partei, die Motive seiner Handlungen seien schon immer die eines gerissenen, ehrgeizigen Politikers gewesen; wenn man ihn auch nicht dafür tadeln könne, dass er sich als Mann von Bedeutung feiern lasse, so dürfe er doch seinen alten Freunden gegenüber nicht tun, als sei er es auch. Nun, sie sollten bald wünschen, sie hätten recht gehabt.
Ein Hauptpunkt des ursprünglichen Programms des Komitees war die Forderung nach freien Wahlen, und zwar so bald als möglich. Dieser Paragraph und der scheinheilige Wortlaut waren, wie jeder wusste, Zugeständnisse an die anglo-amerikanische Mentalität, die nichts schaden konnten. Zwar waren die Männer des Komitees keine Zyniker, die nichts von Wahlen gehalten hätten, jedoch fanden sie solche Worte wirklichkeitsfremd, solange sie gezwungen waren, Pläne für einen schwierigen Notstand zu machen, von dem sie nichts Genaues wussten und das Schlimmste erwarten mussten. Eine künstlich geschürte Notstandsstimmung wird man jedoch nicht so leicht wieder los, und so blieb der Wunsch nach Wahlen hartnäckig bestehen. Als daher die Mitglieder der Volkspartei in der Provisorischen Regierung anfingen, auf die Einlösung des Versprechens zu drängen, legte man ihr das zu Recht als Forderung nach mehr Macht aus, das heißt: nach einer größeren Zahl wichtiger Posten. Nur bei Deltschev lagen die Dinge offenbar anders.
Die Volkspartei war unterdessen stark und einflussreich geworden. Die Beteiligung der Agrarsozialisten an der Bildung und der Arbeit des Komitees verschaffte diesem breite öffentliche Unterstützung, zugleich wurde es aber auch zu einer wichtigen Rekrutierungsstelle der Volkspartei. Diese unliebsame Nebenerscheinung war längst Gegenstand erbitterter Wortwechsel und Klagen innerhalb der Regierung gewesen, und bei einer solchen Gelegenheit war Petra Vukaschin, der Führer der Volksparteileute, zu weit gegangen. Er hatte gesagt: ›Wer dumm genug ist, seiner Frau einen hübschen jungen Mann von schlechtem Ruf vorzustellen, darf sich nicht beklagen, wenn er die beiden zusammen im Bett findet.‹
Als Deltschev zum offensichtlichen Missfallen Vukaschins und der Volkspartei die Wahlen ernst nahm und dafür zu sprechen begann, nahmen seine rührend naiven Kollegen zuerst voll Freude an, ›Väterchen Deltschev‹ wolle bloß den Gegner dazu bringen, die Karten auf den Tisch zu legen. Sie wussten, und zwar schon seit einiger Zeit, dass die Provisorische Regierung von den Westmächten gebilligt und unterstützt wurde, die nicht auf die versprochenen Wahlen drangen, solange das Land unter sowjetischer Besetzung stand. Sie hatten Beweise, dass die Russen, beeindruckt von Deltschevs Tüchtigkeit, sich damit zufriedengeben würden, alles so zu lassen, wie es war. Manche Mitglieder fragten sich sogar, ob man nicht das Wort ›provisorisch‹ aus der Bezeichnung für eine Regierung mit so hoher Lebenserwartung streichen könne. Sie ahnten nicht, dass für ihren Führer Deltschev die Tage dieser Regierung schon gezählt waren.
Später versuchte man wiederholt, für Deltschevs damalige Handlung eine vernünftigere Erklärung zu finden als die, mit der sich die primitiveren Parteigenossen zufriedengaben: dass er ein von Gott inspirierter Patriot war, der sich selbst geopfert habe. Da aber fast jede andere Deutung davon ausging, dass Deltschev durch und durch korrupt war, vermochte keine zu überzeugen.
Die wesentlichen Tatsachen waren sehr einfach.
Nach der Sitzung, bei der die versprochenen Wahlen debattiert wurden, schien Deltschev befangen und nicht geneigt, die Angelegenheit in Gesprächen unter vier Augen aufzugreifen. Immerhin sagte er zu einem, der nicht lockerließ: ›Wenn wir reine Hände haben, kann uns niemand an den Pranger stellen.‹ Der Betreffende hielt das für einen Hinweis auf die starke Position der Regierung und die Sinnlosigkeit des Manövers der Volkspartei.
Das war an einem Donnerstag. Die nächsten Tage verbrachte Deltschev mit einer schweren Erkältung im Bett. Am folgenden Dienstag sollte er im Rahmen einer damals laufenden Kampagne im Rundfunk über den dringenden Bedarf von Viehfuttervorräten für den Winter sprechen.
Er kam direkt aus dem Bett ins Funkhaus und sah, wie der Intendant der Station sagte, aus ›wie ein Mann, der sich mit dem Leibhaftigen herumgeschlagen hat‹. Er sprach nur kurz über die Wintervorräte, zog dann nach kurzem Zögern ein handgeschriebenes Manuskript aus der Tasche und begann, eine Erklärung vorzulesen.
Fünf Minuten später wusste das Volk, dass nach Väterchen Deltschevs wohlerwogener Entscheidung nunmehr für die Regierung die Stunde gekommen sei, das feierliche Versprechen des Komitees auf Abhaltung freier Wahlen einzulösen.
Zu Beginn dieser Erklärung hatte er betont, er spreche nur für sich selbst, nicht für die Provisorische Regierung der Nationalen Einheit. Diese Feststellung wurde sowohl als Beweis seiner schamlosen Verachtung für die Zuhörerschaft als auch als Beweis seiner unbedingten Ehrlichkeit gewertet. Die einen behaupteten, nur ein Narr würde glauben, Deltschev könne seine private Meinung über ein solches Problem tatsächlich von der Meinung einer von ihm geführten Regierung trennen; die andern führten dagegen ins Feld, dass Deltschev bei seiner unleugbaren Integrität gar keine andere Möglichkeit gehabt habe als diese öffentliche Lossagung, wenn er das Volk nicht betrügen wollte. Da man fast jeden Satz seiner Rede so oder so auslegen konnte, buchte keine Seite Punkte. Deltschev selbst war vom Funkhaus direkt nach Hause zurückgekehrt und hatte sich wieder zu Bett gelegt; er blieb in seinem Krankenzimmer, schweigsam und unzugänglich, und ließ nur durch seinen Sekretär erklären, die Rundfunkansprache ›bedürfe keiner weiteren Ausführungen‹. Doch nach zwei Tagen war klar, dass der Sturm über die Rede, der unter den Politikern mit steigender Wut tobte, das Volk schon nicht mehr interessierte. In seinen Augen war jetzt die Provisorische Regierung unwiderruflich verpflichtet, die Wahlen in allernächster Zukunft abzuhalten, und ihm war klar, dass jeder, der Deltschev angriff, nur versuchte, diese Tatsache zu leugnen. Dennoch war es die Volkspartei, die am meisten von der Lage profitierte.
Die meisten der unglücklichen Agrarsozialisten waren klug genug einzusehen, dass sie nur mit Deltschev auf ihrem Schild siegen konnten, gleichviel was sie unter sich von ihm hielten; sie wurden aber behindert durch eine starke, rachsüchtige Minorität, die jetzt nur eines im Sinn hatte, nämlich ›Väterchen Deltschev‹ in aller Öffentlichkeit zu schmähen und zu bekämpfen. Die Volkspartei hingegen verfiel nicht in diesen Fehler, nützte ihn aber voll und ganz aus. Indem sie Deltschev gönnerhaft, aber achtungsvoll als eine Art älteren, erfahrenen und hochgeachteten Staatsmann behandelte (tatsächlich war er damals erst sechzig), gelang es ihr, den Eindruck zu erwecken, er sei hoffnungslos senil, womit sie auch seine weiterhin bestehende Mitgliedschaft bei den Agrarsozialisten entschuldigte. Durch die Verschiebung der Wahlen bis Anfang Sommer gewann die Volkspartei außerdem genügend Zeit, einen coup d’état vorzubereiten und ein paar Stunden vor der Veröffentlichung der Wahlergebnisse durchzuführen.
Es hätte ihn kaum gebraucht; dank Deltschev kam die Partei beinahe legal an die Macht.
Deltschev verhielt sich diesen Ereignissen gegenüber zuerst merkwürdig passiv. Zwar protestierte er gegen den coup d’état, aber nur formell, wie eine Pflichtübung und nicht aus innerer Überzeugung. Und wenn er im Ministerrat die neue Regierung angriff, erinnerten seine Attacken an die wohleinstudierten Paraden des Fechtmeisters, der einen neuen Schüler trainiert. Lange Zeit schien er die raschen, schlauen Schachzüge, durch die die Regierung ihre Position sicherte, nicht zu bemerken, oder nicht bemerken zu wollen. Bald fand sogar die Anti-Deltschev-Gruppe in seiner Partei gläubige Zuhörer für ihr Märchen von dem großen Vermögen, das am Tage nach der Radioansprache irgendwo im Ausland auf Deltschevs Namen deponiert worden sei. Selbst in der breiten Masse schien er seine Beliebtheit einzubüßen. Es war verständlich, dass die Stützen der neuen Regierung ihn schließlich als einen der Ihren ansahen.
Dann fand ›Deltschevs Fußballmatch‹ statt.
Gelegenheit dazu bot die offizielle Einweihung eines Sportstadions. Es war 1940 fertiggestellt und unmittelbar danach von den deutschen Truppen requiriert und als Durchgangslager verwendet worden. Später hatte die russische Armee es als Garnisonshauptquartier benutzt. Die Freigabe war ein Ausdruck sowjetischen Entgegenkommens, und die neue Regierung hatte pflichtschuldigst beschlossen, diese Geste mit so viel Publizität wie nur möglich zu würdigen. Wahrscheinlich war die Anwesenheit der diplomatischen Vertreter der Westmächte bei der Feier der Grund, dass Deltschev als Führer der ›Opposition‹ gebeten wurde, eine Rede zu halten.
Er begann heuchlerisch mit einem Dank an die Rote Armee und drückte die Anerkennung seiner Partei für die Großzügigkeit aus, die zur schnellen Freigabe des Stadions führte. Er hoffe, sagte er, dass es bald der Schauplatz eines denkwürdigen Fußballspiels gegen die hiesige Mannschaft sein würde.
Während dieser Vorschlag mit wildem Beifall begrüßt wurde, trat Deltschev näher an die Mikrophone. Diesmal zog er kein Manuskript aus der Tasche. Er wusste aufs Wort, was er sagen wollte. »Inzwischen aber, meine Landsleute, haben wir einen anderen, lebensgefährlichen Kampf zu bestehen – den Kampf für die Freiheit in unserem Staat.«
Er machte eine Pause. Völliges Schweigen folgte – man konnte die Fahnen im Winde flattern hören. Dann fuhr er fort:
»Vor zwei Tagen bot mir der Führer der Volkspartei, Petra Vukaschin, das Amt des Justizministers in der Regierung an, die jetzt an der Macht ist. Ich habe ihm für heute meine Antwort versprochen. Ich ergreife die Gelegenheit, sie ihm hier und jetzt zu geben. Ich antworte: Wenn er denkt, dass ich durch einen solchen Verrat an meinen agrar-sozialistischen Brüdern etwas an ihrem Entschluss ändern würde, zu kämpfen, bis diese neue Tyrannei mit Stumpf und Stiel ausgerottet ist – wenn er so etwas denkt, dann ist er dumm. Und wenn unser Widerstand gegen die verbrecherischen Pläne seiner Partei so stark ist, dass er versuchen muss, uns mit einem Anteil an der Beute zu bestechen, dann fürchtet er sich auch. Meine Landsleute, die Zeit ist knapp. Diese dummen, furchtsamen Männer sind gefährlich. Nicht weil sie dumm und furchtsam sind, sondern weil sie uns beherrschen wollen. Sie sind nicht …«
Bei diesem Wort wurden die summenden Lautsprecher abgeschaltet. In der Stille, die nun folgte, klang Deltschevs Stimme hoch und dünn im Wind, nur den wenigen vernehmbar, die ganz in seiner Nähe standen, während er den Satz vollendete.
Dann setzte brausender Beifall ein. Er rollte durch das überfüllte Stadion wie eine tosende, stöhnende Woge, die aufwallt, sich krachend und dröhnend wie eine Explosion überschlägt. Er hielt fast eine Minute an und ließ erst nach, als ein anderer Ton ihn verdrängte. Die Menge schrie in Sprechchören ununterbrochen Deltschevs Namen. Plötzlich entstand auf der andern Seite des Stadions in der Menschenmasse eine große wirbelnde Bewegung. Ein Handgemenge entwickelte sich. Aus der Nähe drangen Wutschreie. Deltschev, der während der Ovation reglos vor den abgeschalteten Mikrophonen gestanden hatte, winkte jetzt mit der Hand und wandte sich ab. Wieder gab es Beifallsgebrüll und Pfuirufe. Jetzt beschloss der russische Militärkapellmeister, der die Turnerriege ins Stadion führen sollte, nicht erst das Kommando abzuwarten. Durch diesen vernünftigen Entschluss wurden wahrscheinlich ernste Unruhen vermieden. Als die Kapelle mit klingendem Spiel einmarschierte, wurden die Hochrufe seltener, und Lachen und Händeklatschen setzten ein. ›Deltschevs Fußballmatch‹ war vorbei; vorbei bis auf die atemlose Erregung, mit der er diskutiert und mit der über ihn berichtet wurde. Aber er blieb unvergessen, und man erinnerte sich vieler Einzelheiten, die sich gar nicht zugetragen hatten. ›Väterchen Deltschev‹ war zu seinem Volk zurückgekehrt. Er hatte seiner Überzeugung Ausdruck verliehen, und das Volk hatte ihm gezeigt, dass es in seinem Kampf gegen die ›Mächtigen‹ auf seiner Seite stand.
Vier Tage später fand nachts ein Attentat auf ihn statt.
Haus und Hof von Deltschev waren nach alter Weise von einer Mauer umgeben. Als er aus seinem Wagen stieg, um ins Haus zu gehen, wurde eine Handgranate geworfen. Sie traf die Mauer, gleich neben dem Tor, und prallte auf die Straße zurück, ehe sie explodierte, sodass Deltschev, der schon durchs Tor getreten war, von der Explosion verschont blieb. Um diese Nachtzeit waren nur wenige Leute auf der Straße, und der Mann, der die Granate geworfen hatte, entkam.