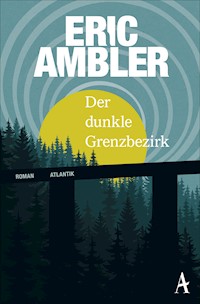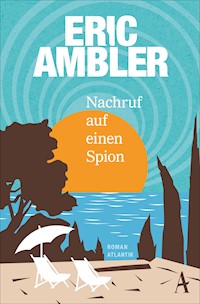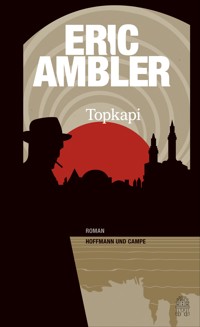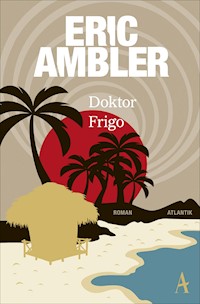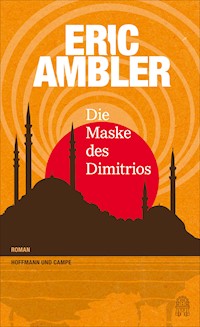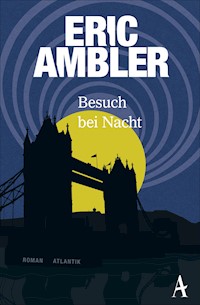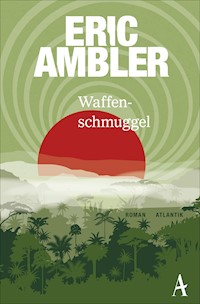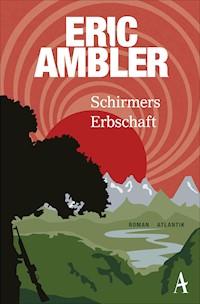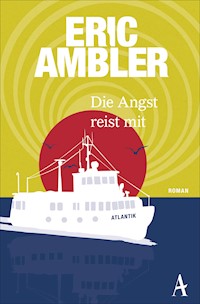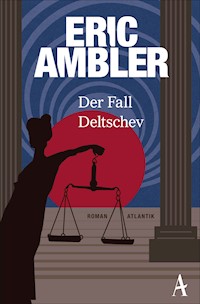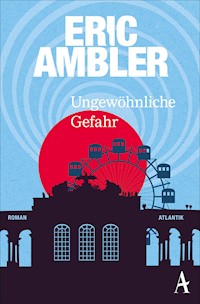
10,99 €
Mehr erfahren.
Kenton ist ein erfolgreicher Journalist: Er ist sprachgewandt, ein Experte auf dem Gebiet der Europäischen Politik und er hat ein kompetentes Urteilsvermögen - zumindest im Berufsleben. Privat wird ihm das Glücksspiel immer wieder zum Verhängnis. Als er eines Morgens nach einer durchzechten Nacht völlig abgebrannt im Zug Richtung Österreich sitzt, sieht er eine Chance, wieder zu Geld zu kommen: Ein Fremder braucht Hilfe beim Schmuggel von Wertpapieren über die Landesgrenze. Doch das lukrative Angebot birgt ungeahnte Gefahren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Eric Ambler
Ungewöhnliche Gefahr
Roman
Aus dem Englischen von Matthias Fienbork
Atlantik
Meiner Mutter
»Heute, da Europa einem Pulverfass gleicht, welches bei dem geringsten Anlass in die Luft fliegen und womöglich den ganzen Globus in Brand setzen kann, und die Sicherheit europäischer, aber auch anderer Staaten in erster Linie von der Stärke und Schlagkraft ihrer Armeen abhängt, sind Rohstoffe, zumal Erdöl, von allergrößter Bedeutung.«
World Petroleum
PrologIn der Gracechurch Street
An einem strahlenden Julivormittag setzte sich am Berkeley Square lautlos ein blauer Rolls-Royce in Bewegung, der wenig später Piccadilly überquerte und elegant in Richtung City verschwand.
Da Mr Joseph Balterghen ziemlich klein geraten, sein Rolls-Royce aber eine große Limousine war, hätten die paar Leute, die an der Nordseite von Trafalgar Square auf den Bus warteten, schon den Hals recken müssen, um ihn zu sehen. Doch niemand machte sich die Mühe. Das war bedauerlich, denn Mr Balterghen, obschon keine besonders attraktive Erscheinung, war der Direktor der Paneurasischen Erdölgesellschaft und fünfzehn anderer Unternehmen sowie Aufsichtsratmitglied von dreißig weiteren Firmen, einschließlich einer Bank. Er war, um es in der Sprache von Finanzkreisen auszudrücken, »überaus solide«.
Dass diese Formulierung nichts mit regelmäßigem Gottesdienstbesuch, frühzeitigem Zubettgehen und sauber zusammengerollten Regenschirmen zu tun hatte, verriet sein Gesicht, das von einem enttäuschten Geschäftspartner einmal mit einer »graubeerigen Weintraube« verglichen worden war. Er hätte hinzufügen können, dass die Beeren ziemlich verschrumpelt waren und im unteren Teil der Traube surrealistischerweise ein schwarzer Schnurrbart wuchs.
Mr Balterghen kaute nachdenklich an diesem Schnurrbart, während sein Rolls die Northumberland Avenue hinunterglitt. Der Chauffeur beobachtete ihn im Rückspiegel, murmelte dabei »hat bestimmt ’ne Sitzung, das Aas«, bog ins Embankment ein und sah dann nicht mehr in den Rückspiegel, bis er vor dem neuen Verwaltungsgebäude der Paneurasischen Erdölgesellschaft in der Gracechurch Street anhielt.
Mr Balterghen hörte auf, an seinem Schnurrbart zu kauen, betrat das Gebäude mit jenem ausdruckslosen Gesicht, das er im Dienst aufsetzte, und ließ sich von einem chromblinkenden Lift in die sechste Etage katapultieren. Dort betrat er sein Büro.
Der zweite Sekretär, Blundell, staunte immer wieder über das Büro des Chefs. Blundell war im Rahmen von Balterghens Akademikerprogramm direkt von der Universität zur Paneurasischen gekommen und hatte anschließend äußerst verwirrt festgestellt, dass er als einer der wenigen die Säuberung überlebt hatte, die unter dem Motto »Praxis statt Hochschule« durchgeführt worden war. »Balterghens Büro«, hatte er seiner Frau einmal erzählt, »sieht eher wie der Salon einer Lebedame aus. Roter Perserteppich auf dem Fußboden, grüngesprenkelte Tapeten an der Wand, ein Biedermeierschreibtisch, ein chinesisches Lackschränkchen, ein neubyzantinisches Bücherregal, sechs Barockstühle und obendrein eine drago-aztekische Hausbar, die sich auf Knopfdruck öffnet. Wenn man nicht aus eigener Erfahrung wüsste, was für ein Fiesling dieser Mensch ist – beim Anblick dieses Zimmers wüsste man es sofort.«
An diesem schönen Julitag ging Mr Balterghen erst einmal zu seiner Hausbar, entnahm ihr eine große Packung Magenpulver und mixte sich ein Glas. Dann zündete er sich eine Zigarre an, um den Geschmack loszuwerden, und drückte auf die fünfte Klingel auf seinem Schreibtisch. Kurz darauf betrat Blundell das Zimmer.
»Wann fängt die Sitzung an, Blundell?«
Mr Balterghen sprach, als hätte er eine heiße Kartoffel im Mund.
»Um elf, Mr Balterghen.«
»Es ist jetzt fünf vor. Sind die anderen Herren des Aufsichtsrats schon da?«
»Alle bis auf Lord Welterfield.«
»Wir fangen ohne ihn an.«
»In Ordnung, Mr Balterghen. Ich werde Mr Wilson Bescheid sagen. Hier sind Ihre Unterlagen.«
»Legen Sie sie dorthin. Einen Moment noch. Falls gegen Viertel vor eins ein gewisser Colonel Robinson hier aufkreuzt und mich sprechen will, dann bringen Sie ihn in ein freies Zimmer im fünften Stock. Haben Sie verstanden? Ich möchte nicht, dass er hier wartet.«
»Jawohl, Mr Balterghen.«
Die Sitzung des Aufsichtsrats der Paneurasischen Erdölgesellschaft begann um zwei Minuten nach elf.
Die Tagesordnung wurde diesmal mit erwartungsvoller Spannung in Angriff genommen. Jedermann wusste, dass es nur einen einzigen wirklich interessanten Punkt gab, der jedoch erst zum Schluss dran war. Als Lord Welterfield um Viertel vor zwölf eintraf und sich überschwänglich entschuldigte, winkten alle rasch ab. Im Grunde spielte es keine Rolle, ob Lord Welterfield anwesend war oder nicht.
»Ich sehe hier«, sagte Mr Balterghen schließlich, »dass der nächste Tagesordnungspunkt meine Verhandlungen mit den Rumänen betrifft.«
Er klang ein wenig überrascht, aber davon ließ sich niemand täuschen. Die Anwesenden lehnten sich zurück, und er fuhr fort:
»Wenn ich mich nicht irre, war Lord Welterfield bei der Sitzung, auf der erstmals über dieses Thema debattiert wurde, nicht anwesend. Ich möchte deshalb die wesentlichen Punkte kurz rekapitulieren. Sie alle werden sich erinnern, dass uns im Jahre 1922 von der rumänischen Regierung eine Bohrlizenz erteilt wurde, und zwar für ein Gebiet östlich von Jassy, in dem seinerzeit reiche Ölvorkommen vermutet wurden. Sie werden sich des Weiteren erinnern, dass diese Konzession aus unserer Sicht ein Reinfall war. Zwischen 1923 und 1924 wurden lediglich fünftausend Barrel gefördert, und Anfang 1925 versiegte das vielversprechendste Bohrloch völlig. Da nach Ansicht unserer Geologen nicht damit zu rechnen war, dass wir auf kommerziell lohnende Ölfelder stoßen würden, mussten wir die Konzession faktisch als Fehlinvestition abschreiben. Das war kein so großes Malheur, da die Produktion unserer Tochterunternehmen in Venezuela, Mexiko und im Nahen Osten ausgezeichnet lief – was ja bis heute der Fall ist.«
Es erhob sich beifälliges Gemurmel.
»Doch angesichts der politischen Entwicklung in Europa zwischen 1935 und 1936«, fuhr Mr Balterghen fort, »erscheint es sinnvoll, sich wieder Rumänien zuzuwenden. Die gegen Italien verhängten Sanktionen haben Mussolini immerhin eines klargemacht: Italien kann seinen Erdölbedarf nicht ausschließlich mit Importen aus dem karibischen Raum decken. Iran und Irak sind in britischer Hand, Russland wird von den Sowjets beherrscht. Die italienische Kriegsmarine benötigt Treibstoff, die Luftwaffe und die Panzerdivisionen wären bei Treibstoffmangel nicht einsatzfähig. Es gibt nur eine Lösung – Rumänien. Zurzeit importiert Italien große Mengen rumänischen Erdöls, und die Tendenz ist steigend. Das neue Rüstungsprogramm der Italiener – und ich stütze mich hier auf persönliche Informationen – gründet weniger auf einem Ausbau der Mannschaftsstärke als vielmehr auf einer Erweiterung des Bestandes an U-Booten, Bombern und neuartigen Kampfpanzern. Das ist wichtig, denn in allen drei Fällen« – Balterghen pochte mit einem Stummelfinger auf die Tischplatte –, »in allen drei Fällen kommen Dieselmotoren zum Einsatz.«
Die Anwesenden waren beeindruckt. Balterghen leckte sich die Lippen und fuhr fort:
»Meine Herren, ich musste Ihnen seinerzeit nicht erklären, dass sich hier ein gutes Geschäft für uns andeutete. Lord Welterfield wird mir sofort zustimmen. Vor zwei Monaten wurden wir bei der rumänischen Regierung vorstellig. Wir baten um eine Revision der bereits bestehenden Konzessionen und erklärten uns bereit, viel Geld zu zahlen, sehr viel Geld. Wir wollten nur in fairer Weise an den Ölvorkommen beteiligt werden, die zurzeit von unseren Konkurrenten ausgebeutet werden. Unsere Agenten in Bukarest wandten sich an die richtigen Leute, sorgten dafür – die Vorgehensweise steht hier nicht zur Debatte –, dass unsere Vorschläge in Regierungskreisen positiv aufgenommen würden. Es wurde arrangiert, dass ein hochrangiger Politiker unsere Vorschläge hinsichtlich einer Neuordnung der Förderlizenzen auf der November-Sitzung der rumänischen Abgeordnetenkammer als notwendige Reform bezeichnen sollte – was sie ja in der Tat sind.«
Die Anwesenden murmelten beifällig.
»Vor zehn Tagen«, fuhr Mr Balterghen mit ruhiger Stimme fort, »habe ich jedoch erfahren, dass das Gesetzesvorhaben auf der November-Sitzung nicht die notwendige Mehrheit erhalten wird.«
Einen Moment war es ganz still, dann sprachen alle durcheinander. Mr Balterghen hob die Hand.
»Meine Herren, ich kann Ihre Erregung gut verstehen«, sagte er jovial. »Mir ging es nicht anders, als ich davon erfuhr. Gestatten Sie mir aber, Ihnen die Gründe für diesen Rückschlag darzulegen. Ich möchte vorausschicken, dass unsere Agenten in Rumänien keinerlei Schuld trifft. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Dieser Misserfolg ist einzig und allein auf einen verleumderischen Artikel in einer Bukarester Zeitung zurückzuführen.« Er entnahm dem Ordner, der vor ihm auf dem Tisch lag, eine zerknitterte Zeitung und hielt sie hoch. »Hier, das ist das Blatt. Es heißt, frei übersetzt, Das arbeitende Volk und wird von der Sozialistischen Einheitspartei Rumäniens herausgegeben.«
»Rote!«, rief Lord Welterfield empört.
»Diese Partei gehört zwar nicht der Kommunistischen Internationalen an, aber es stimmt, diese Leute stehen sehr weit links.«
»Läuft doch auf dasselbe hinaus«, brummte Lord Welterfield mürrisch.
»Ich vermute«, fuhr Balterghen fort, »dass keiner von Ihnen Rumänisch spricht, im Gegensatz zu mir. Ich werde Ihnen also ein, zwei Stellen vorlesen. Die Überschrift lautet ›Die Geier sind schon auf der Lauer‹, und nach einer geschwätzigen Einleitung über den bösen Kapitalismus kommt der Autor zur Sache. Er fragt: Wer sind die Direktoren der Paneurasischen Erdölgesellschaft? Es ist eine rhetorische Frage, denn nun bringt er unser aller Namen, ergänzt durch biographische Angaben, die so offenkundig erlogen sind, dass ich es mir erspare, sie zu übersetzen.«
»Was sagen diese Lumpen über mich?«, fragte Lord Welterfield unvorsichtigerweise.
Mr Balterghen warf einen Blick in die Zeitung.
»Lord Welterfield«, las er, »Grubenbesitzer und Millionär. Berühmt als Sportmäzen. Weniger bekannt als der Mann, der mit Hilfe bezahlter Agenten Unruhe während eines Bergarbeiterstreiks schürte und in zahlreichen Fällen gegen die arbeitsrechtlichen Bestimmungen verstoßen hat.«
»Lüge!«, schimpfte Lord Welterfield erregt. »Es wurde nie bewiesen, wer die Männer angeheuert hat. Ich jedenfalls nicht!«
Mr Balterghen seufzte.
»Ganz recht, Lord Welterfield. Wir sind alle der Meinung, dass dieser Artikel sozialistische Propaganda ist. Ich denke, ich kann fortfahren.«
Von allen Seiten erhob sich zustimmendes Gemurmel.
»Also. Weiter heißt es: ›Es sind Kräfte am Werk, die eine umfassende Konzessionsreform anstreben. Was ist in diesem Fall unter Reform zu verstehen? Ganz einfach, die Regierung soll bestehende Förderlizenzen aufkündigen, damit die Paneurasische Erdölgesellschaft den Löwenanteil am wachsenden Export nach Italien erhält. Diese Angelegenheit ist in dreierlei Hinsicht dubios. Erstens dürfte es fraglos zu einer massiven Bestechung von Regierungsmitgliedern gekommen sein – anders ließe sich dieser plötzliche Wunsch nach einer Revision nicht erklären. Zweitens bietet sich uns das inzwischen vertraute Schauspiel von ausländischen Kapitalisten, die sich in die Belange des rumänischen Volkes einmischen. Drittens sind die offensichtlichen Gefahren einer solchen Revision zu bedenken. Die Paneurasische hat wahrscheinlich Verbündete unter den britischen und amerikanischen Konzernen, die in Rumänien bereits aktiv sind. Doch was ist mit den anderen Ländern? Nicolae Titulescu, der von der faschistischen Eisernen Garde abgesetzt wurde und einem Giftattentat zum Opfer fiel, kann nicht mehr für unsere Interessen eintreten. Das Volk muss ohne ihn weiterkämpfen. Unsere außenpolitischen Allianzen sind viel zu wertvoll, als dass sie von korrupten Beamten und kapitalistischen Strohmännern aufs Spiel gesetzt werden dürften …‹ Der Autor«, fuhr Mr Balterghen fort, »ergeht sich dann in wüsten Beschimpfungen. Der ganze Artikel ist natürlich eine krass wahrheitswidrige Darstellung. Wir sind Unternehmer, die mit der rumänischen Regierung Geschäfte machen wollen. Politik interessiert uns nicht.«
»Sehr richtig«, riefen einige der Anwesenden.
»Trotzdem hat uns dieser Artikel enorm geschadet. Die Zeitung wurde verboten und das Redaktionsgebäude von Jugendlichen mit Handgranaten verwüstet, jedoch zu spät, als dass die Verbreitung dieses Artikels hätte verhindert werden können. Der rumänische Generalstaatsanwalt sah sich gezwungen, gegen mehrere unserer Freunde in der Regierung Anklage wegen Bestechlichkeit zu erheben, die Öffentlichkeit ist alarmiert, und die Konzessionsreform liegt dem Parlament zwar entscheidungsreif vor, wird aber keine Mehrheit finden.«
Ein untersetzter Herr am anderen Ende des Tisches räusperte sich laut. »Wenn ich richtig sehe, können wir also nichts mehr tun.«
»Ganz im Gegenteil, Sir James«, sagte Mr Balterghen, »wir können einiges tun. Ich habe das Einverständnis der Anwesenden stillschweigend vorausgesetzt und mich der Dienste eines Mannes versichert, der in solchen Angelegenheiten außerordentlich erfahren ist. Er hat schon einmal für mich gearbeitet. Er ist nicht billig, aber ich bin sicher, dass das Ergebnis den Aufwand rechtfertigen wird.«
»Was soll er tun?«, schnaufte der untersetzte Herr spöttisch. »Die Sozialisten abknallen, das ganze Pack in Grund und Boden schießen?«
Die Anwesenden lachten herzlich, und die Spannung legte sich ein wenig.
Mr Balterghen verzog die Lippen. Das war seine Art zu lächeln.
»Derart extreme Maßnahmen sind bestimmt nicht notwendig. Der Betreffende ließe sich am besten als Propagandist bezeichnen.«
»Nun ja«, sagte Lord Welterfield, »solange er kein Roter ist, kann er sich von mir aus nennen, wie er will.«
»Meine Herren, ich kann also davon ausgehen, dass Sie einverstanden sind, dass ich Kontakt zu dieser Person aufnehme. Ich möchte Sie allerdings um Verständnis bitten, wenn ich mich zu der Natur der geplanten Maßnahmen vorerst nicht äußern werde.«
Die Anwesenden machten ein wissendes Gesicht, erklärten, dass man Mr Balterghen voll vertraue, erledigten noch ein paar Formalitäten und begaben sich dann mit wichtiger Miene zum Lunch.
Mr Balterghen kehrte in sein Büro zurück. Blundell kam hinter ihm herein.
»Colonel Robinson erwartet Sie in Zimmer 542, Mr Balterghen. Soll ich Sie hinbringen?«
Sie fuhren im Lift hinunter und gingen einen Korridor entlang.
»Hier, Sir.«
Mr Balterghen öffnete die Tür und trat ein. Blundell hörte seinen Chef »Ah, Stefan!« sagen und bemerkte, dass der Colonel ihm mit steifem Arm die Hand schüttelte. Sie unterhielten sich in einer fremden Sprache, die wie eine Kombination aus Russisch und Italienisch klang.
»Colonel Robinson, dass ich nicht lache!«, sagte Blundell an diesem Abend zu seiner Frau. »Wenn dieser Kerl Robinson heißt, dann heiße ich Hitler. Gib mir mal das Salz, bitte!«
Der Zug nach Linz
Einen dicken Wollschal doppelt um den Hals geschlungen, die Schultern hochgezogen und die Hände tief in den Manteltaschen vergraben – so wartete Kenton in Nürnberg auf den Zug nach Linz. Ein eisiger Novemberwind fegte über den verlassen daliegenden Bahnsteig, die Emaillampen schwangen hin und her und warfen verrückt tanzende Schatten. Kenton fror. Er stellte seinen Koffer ab und begann, im Windschatten eines kleinen Häuschens auf und ab zu gehen.
Der schlanke Mann mit dem klugen Gesicht war dreißig, sah aber älter aus. Vielleicht lag das an seinem Mund. Die vollen Lippen verrieten Humor und Besonnenheit. Man hätte ihn eher für einen Amerikaner als für einen Engländer halten können, aber er war weder das eine noch das andere. Sein Vater stammte aus Belfast, seine Mutter aus einer in Lille ansässigen bretonischen Familie.
Während er auf und ab ging, verstärkte sich mit dem Kältegefühl in den Füßen auch seine Selbstverachtung. Eigentlich war er ja kein Spieler, sagte er sich. Glücksspiele langweilten ihn, aber leider besaß er jene Unbekümmertheit, die dafür sorgt, dass man, wenn man einmal angefangen hat, so lange dabeibleibt, bis alles Geld verspielt ist. Kenton war das schon einmal passiert. Da er aber nicht viel Geld besaß – neben Leberzirrhose eine typische Journalistenkrankheit –, war das nicht so schlimm gewesen. Jetzt war es schon kritischer, denn an diesem Tag hatte er seine gesamte Barschaft, rund vierhundert Mark, verspielt.
Kenton war ein guter Journalist. Nicht dass er jenen wunderbaren Riecher hatte, mit dem man den Filmstar hinter der Sonnenbrille und dem schäbigen Regenmantel entdeckt. Seine Fähigkeiten lagen auf anderem Gebiet.
Die meisten Auslandsnachrichten kommen von den Korrespondenten größerer Blätter und von den Agenturen. Gegen sie hat der freie Journalist in der Regel keine Chancen. Kenton hatte allerdings drei wesentliche Vorzüge: Er war sprachbegabt, er kannte sich gut in der europäischen Politik aus, und er konnte sehr schnell wichtige Nachrichten von unwichtigen unterscheiden. Vor allem nützte ihm sein Sprachtalent. Die meisten Engländer, die im Ausland arbeiten, sprechen die Landessprache fließend, aber nur wenige sprechen sie akzentfrei. Kenton war so jemand. Auf diese Qualität kam es an, wenn man gelegentlich eine exklusive Nachricht aufschnappen wollte.
Die Suche nach einem solchen Schnäppchen hatte Kenton nach Nürnberg geführt, wo eine Konferenz hoher Nazifunktionäre stattfinden sollte. Es wurde mit wichtigen Entscheidungen gerechnet. Niemand wusste, worum es ging, aber jedermann ahnte, dass es sich um unerfreuliche, also schlagzeilenträchtige Entscheidungen handeln würde.
Die Tätigkeit von politischen Reportern besteht zu neunzig Prozent darin, auf das Ende von Konferenzen zu warten. Die Zeit schlägt man gewöhnlich in Bars tot. In Nürnberg war es die Bar des Hotels Kaiserhof. Als Kenton eintraf, hielten sich schon mehrere Korrespondenten dort auf, darunter auch der Vertreter der Agentur Havas, ein Pole, den er gut leiden konnte. Dieser Pole hatte mit dem Würfeln angefangen.
Kenton hatte in einem fort verloren.
Würfeln ist nichts für Leute, die nicht aufhören können, denn in diesem Spiel verbinden sich die gefährlichsten Aspekte des Pokerns mit der Einfachheit des Würfelns. Auf diese Weise kann man, rasch und mühelos, sehr viel Geld verlieren und gewinnen.
Als sich zeigte, dass an diesem Tag kein Pressekommuniqué herausgegeben, sondern die Konferenz am darauffolgenden Tag fortgesetzt würde, hatte Kenton nur noch fünf Pfennig in der Tasche. Er erklärte seinen drei Mitspielern, in welcher Lage er sich befand. Unter Worten des Bedauerns und der Anteilnahme wurden Drinks bestellt. Kenton wies darauf hin, dass seine Zahlungsunfähigkeit nur vorübergehender Natur sei und dass er in Wien über Geld verfüge. Der Havas-Mann bot ihm prompt hundert Mark an. Kenton, dem das ziemlich unangenehm war, hatte das Geld so würdevoll wie nur möglich akzeptiert, noch eine Runde spendiert und war wenig später zum Bahnhof aufgebrochen. Dort hatte man ihm erklärt, dass der einzige durchgehende Zug, der in dieser Nacht nach Wien ging, nur Waggons erster und zweiter Klasse führte. Wer dritter Klasse fahren wollte, musste mit einem Eilzug bis Linz vorliebnehmen und dort umsteigen. Kenton hatte sich für den Zug nach Linz entschieden.
Eine Dreiviertelstunde später fuhr der schneeverwehte Orientexpress aus Ostende ein. Hinter den beschlagenen Fenstern des Speisewagens eilten livrierte Kellner hin und her. Kenton hörte Geschirrklappern und Gläsergeklingel, sah an einem der Schlafwagen die Zuglauftafel: Wien–Budapest–Beograd–Sofia–Istanbul. Der Express strahlte Wärme und Behaglichkeit aus, und Kenton war froh, als der Zug abfuhr, denn in diesem Augenblick schien er all den physischen, finanziellen und gastronomischen Komfort zu verkörpern, nach dem er sich sehnte. Er zerfloss vor Selbstmitleid.
Alles wäre nur halb so schlimm gewesen, wenn seine forsche Behauptung, er habe Geld in Wien, den Tatsachen entsprochen hätte, doch davon konnte nicht die Rede sein. Kenton hatte keinen einzigen Pfennig in Wien, sondern nur die leise Hoffnung, dass ein befreundeter jüdischer Feinmechaniker ihm eventuell etwas leihen würde. Kenton hatte dem Mann und seiner Familie 1934 aus München herausgeholfen, und der Mann war ihm dankbar. Kenton war aber keineswegs sicher, ob dieser Mann noch in Wien wohnte. Vielleicht hatte er auch kein Geld, das er ihm leihen konnte. Das wäre noch schlimmer. Er würde erklären müssen, dass es nicht so wichtig sei, und der kleine Mann würde unglücklich dreinschauen. Juden waren in solchen Dingen empfindlich. Doch es war seine einzige Chance, die er hatte, und in jedem Fall hatte er nichts zu verlieren, wenn er nach Wien fuhr.
Er vergrub die Fäuste noch tiefer in den Manteltaschen. Schließlich hatte er schon öfter ohne einen Pfennig dagestanden – nicht immer durch eigenes Verschulden –, und immer hatte sich ein Ausweg gefunden. Manchmal war es eine gute Story gewesen, manchmal ein unerwarteter Scheck von seinem New Yorker Agenten für die Nebenrechte an einem längst vergessenen Beitrag. Einmal war er zufällig im Bahnhof von Sofia gewesen, als der bulgarische König mit unbekanntem Ziel abgereist war. Zufällig hatte er die Bemerkung eines Bahnbeamten gegenüber einem deutschen Handelsreisenden aufgeschnappt und war sofort zur nächsten Telefonzelle gelaufen, um als Erster vom bevorstehenden Treffen zwischen Boris und Karol zu berichten. Vielleicht saß Hitler im Zug nach Linz, weil er sich mit dem Chef der österreichischen Sozialdemokraten treffen wollte. Diese absurde Vorstellung fand Kenton sehr amüsant, und er malte sich aus, wie ihre Begegnung aussehen könnte. Seine Laune hob sich zusehends.
Schließlich fuhr sein Zug ein. Er war halbleer, sodass Kenton ein Abteil für sich allein hatte. Die Sitze waren hart, aber längst nicht so ungemütlich wie der Bahnsteig in Nürnberg. Er warf den Koffer in das Gepäcknetz, verdrückte sich in eine Ecke und schlief ein.
Kurz hinter Regensburg wachte er vor Kälte auf. Ein Reisender war ins Abteil gekommen und hatte das Fenster einen Spaltbreit geöffnet. Der eisige Luftstrom, in den sich Lokomotivenqualm mischte, vollendete, was Hunger und die unbequeme Sitzbank begonnen hatten. Kenton war plötzlich hellwach, saß steif und verfroren und hungrig da und fühlte sich elend. All der künstliche Optimismus, den er mühsam aufgebaut hatte, war plötzlich verpufft. Zum ersten Mal wurde ihm bewusst, in welch kritischer Lage er sich befand.
Was, wenn Rosen nicht in Wien war? Er konnte natürlich nach England telegraphieren und eine Zeitung um Geld bitten. Aber wahrscheinlich würde man ihm das abschlagen. Seine Beiträge waren zwangsläufig unregelmäßig, und wenn er lieber im Ausland arbeitete, als in London der geregelten Tätigkeit eines Gerichtsreporters nachzugehen, dann war das ganz allein sein Problem. Düster überlegte er schon, ob er den Konsularischen Dienst in Anspruch nehmen konnte. Unter welchen Voraussetzungen galt man als hilfsbedürftig? Ein englischer Matrose, dem er irgendwo begegnet war, hatte verächtlich von einem Rücktransport gestrandeter Briten in Kapstadt erzählt. Kenton sah sich schon, mit einem Schild um den Hals, als Stückgut von Wien nach London verfrachtet. Um auf andere Gedanken zu kommen, wandte er sich seinem Mitreisenden zu.
Kenton war oft genug mit kontinentaleuropäischen Zügen gefahren, sodass ihm jeder, der das Fenster auch nur einen Spaltbreit öffnete, einigermaßen verdächtig war. Dieser Unhold war klein und dunkelhaarig, hatte ein schmales Gesicht und ein schlechtrasiertes Kinn. Er trug ein verdrecktes Hemd mit einer riesigen graugeblümten Krawatte und einen zerknitterten dunklen Nadelstreifenanzug. Auf seinen Knien lag ein Aktenköfferchen, dem er in Papier eingewickelte Wurst und Brot entnahm. Neben ihm stand eine Flasche Mineralwasser.
Seine Augen waren dunkelbraun und glänzten. Er erwiderte Kentons Blick. Mit einem Stück Wurst in der Hand zeigte er auf das geöffnete Fenster.
»Was dagegen?«
Kenton schüttelte den Kopf. Der andere biss von der Wurst ab.
»Gut. Ich hab’s gern frisch.«
Er mampfte. Dann hatte er offenbar einen Einfall. Er zeigte auf das Aktenköfferchen.
»Bitte, bedienen Sie sich!«
Das automatische Nein, das in Kenton aufstieg, erstarb auf seinen Lippen. Er hatte Hunger.
»Danke, sehr nett von Ihnen.«
Er bekam ein Stück Wurst und ein Stück Brot. Die Wurst roch nach Knoblauch und schmeckte ausgezeichnet. Sein Gegenüber gab ihm noch ein zweites Stück. Kenton nahm dankbar an. Braunauge stopfte sich einen Kanten Brot in den Mund, spülte es mit einem Schluck Mineralwasser hinunter und begann, über seine Magenprobleme zu reden.
»Ärzte sind wirklich dumm. Wenn Sie mich hier so sitzen sehen, wie ich mit Ihnen esse, würden Sie doch nicht glauben, dass man mir vor zwei Jahren gesagt hat, ich soll mich wegen eines Dickdarmgeschwürs operieren lassen. Wirklich wahr. Ich habe einen Magen aus Eisen« – wie zum Beweis schlug er sich darauf und rülpste heftig –, »aber den verdanke ich nicht diesen Stümpern. Ich sage Ihnen, die haben keine Ahnung. Die wollen doch nur, dass man sich unters Messer legt. Aber ich habe nein gesagt. Ich lasse mich nicht aufschnippeln. Es gibt bessere Methoden. Sie wollten Genaueres wissen, aber ich habe ihnen ins Gesicht gelacht. Ich verrate diesen neugierigen Säcken doch nicht meine Geheimnisse. Aber Sie sind kein Arzt, Ihnen werde ich es erzählen. Pasta – so heißt das Geheimnis. Einfach Pasta. Sechs Monate habe ich nichts als Pasta gegessen. Jetzt bin ich gesund. Ich bin kein Italiener, aber ich versichere Ihnen: Pasta ist gut für den Magen. Maccheroni, Fettuccine, Tagliatelle, Spaghetti, ganz egal, alles ist gut für den Magen.«
Unaufhörlich ging das Loblied auf Mehl und Wasser weiter, und Kentons Gesicht verriet offenbar, dass er nicht bei der Sache war, denn der Besitzer des eisernen Magens hielt plötzlich inne und verkündete, dass er schlafen werde.
»Bitte wecken Sie mich vor der Grenze«, sagte er.
Er setzte den Hut ab, legte sich zum Schutz vor dem Ruß ein Exemplar des Völkischen Beobachters auf den Kopf, drückte sich in die Ecke und schien einzuschlafen. Kenton ging nach draußen, um zu rauchen.
Seine Uhr zeigte halb elf. Nach seiner Schätzung war es noch eine Stunde bis Passau. Er drückte seine Zigarette aus und bemerkte in diesem Moment, dass er nicht mehr allein im Korridor stand. Ein paar Abteile weiter lehnte ein Mann am Fenster und schaute hinaus zu den fernen Lichtern eines Dorfes. Kenton war, als hätte der Mann ihn beobachtet und in diesem Moment weggeschaut. Jetzt kam er näher. Kenton bemerkte, dass er dabei in jedes Abteil sah und dass seine stumpfen kleinen Augen in einem aufgedunsenen, ungesund wirkenden Gesicht saßen. Er drückte sich ans Fenster, um den Mann passieren zu lassen, doch der ging nicht vorbei. Aus den Augenwinkeln sah er, dass der Mann in das Abteil schaute, wo der schlafende Mitreisende saß, dann »Verzeihung« murmelte, wieder umkehrte und im nächsten Waggon verschwand. Kenton dachte nicht weiter darüber nach und setzte sich wieder auf seinen Platz.
Die Zeitung war dem kleinen Mann vom Kopf gerutscht. Seine Augen waren geschlossen. Er schien fest zu schlafen. Doch ihm Vorbeigehen sah Kenton, dass Schweißtropfen auf seiner Stirn standen.
Er setzte sich und beobachtete den Mann. Nach einer Weile schlug er die braunen Augen auf.
»Ist er weg?«
»Wer?«, fragte Kenton.
»Na, der Mann draußen im Flur.«
»Ja.«
Der andere setzte sich auf, suchte etwas in seiner Tasche und zog schließlich ein großes, schmutziges Taschentuch heraus, mit dem er sich Stirn und Hände abwischte. Dann sah er Kenton an.
»Sind Sie Amerikaner?«
»Nein, Engländer.«
»Aha. Es war nicht Ihr Akzent, sondern Ihre Kleidung …«
Seine Stimme wurde immer leiser. Plötzlich sprang er auf und schaltete das Licht aus. Es war dunkel im Abteil. Kenton blieb irritiert in seiner Ecke. Wenn er schon mit einem Verrückten in einem Abteil saß, war es vermutlich besser, sich zugeknöpft zu geben. Im nächsten Moment gefror ihm das Blut in den Adern, denn der Mann hatte sich neben ihn gesetzt. Er schnaufte heftig.
»Seien Sie unbesorgt, mein Herr.« Die Stimme klang gehetzt. »Ich bin Deutscher«, sagte er.
Kenton sagte »Ja«, war aber nicht überzeugt. Schon eine ganze Weile versuchte er, aus dem Akzent schlau zu werden.
Atemlos fuhr der Mann fort, erst langsam, dann immer schneller:
»Ich bin deutscher Jude. Mein Vater ist Christ, meine Mutter Jüdin. Deshalb werde ich verfolgt. Sie machen sich keine Vorstellung, was es heißt, als Deutscher eine jüdische Mutter zu haben. Man hat mich finanziell ruiniert. Ich bin Hütteningenieur von Beruf. Sie werden vielleicht sagen, dass ich nicht wie ein Hütteningenieur aussehe. Aber da irren Sie sich. Ich bin tatsächlich Hütteningenieur. Ich habe im Ruhrgebiet gearbeitet. Ich hatte meinen eigenen Betrieb, eine kleine Gießerei. Als Engländer werden Sie wissen, dass ein kleiner Betrieb manchmal besser ist als ein großer. Jetzt ist alles vorbei. Ich besitze etwas Geld. Ich möchte Deutschland verlassen und anderswo wieder anfangen. Ich möchte mein Geld mitnehmen, aber das ist verboten. Man darf kein Geld mitnehmen. Ich beschließe, es heimlich über die Grenze zu schmuggeln. Alles geht gut. Ich treffe einen freundlichen Engländer, wir essen etwas zusammen, wir plaudern miteinander. Dann sehe ich diesen Nazispitzel, und er sieht mich. Jetzt weiß ich: Man wird mich an der Grenze festhalten, eine Leibesvisitation vornehmen, mich ins Konzentrationslager stecken, mich zusammenschlagen. Haben Sie diesen Spitzel gesehen? Er ist stehen geblieben und hat mich beobachtet. Haben Sie es gesehen? Er hat mich erkannt. Ich habe es ihm angesehen. Ich habe zehntausend Mark in guten deutschen Wertpapieren dabei – das ist mein ganzer Besitz. Wenn Sie mir nicht helfen, wird man mir in Passau alles wegnehmen.«
Er machte eine Pause, wischte sich wieder den Schweiß von der Stirn.
Kenton war überzeugt, dass der Mann nicht die Wahrheit sagte. Hütteningenieur und Jude mochte er sein, aber er war ganz bestimmt kein Deutscher. Erstens sprach er schlechter Deutsch als er selbst, und zweitens wusste jeder deutsche Geschäftsmann, dass man Geld nur in Form von Bargeld aus Deutschland herausbekam, da deutsche Wertpapiere zum gegenwärtigen Zeitpunkt »eingefroren« waren und im Ausland nicht akzeptiert wurden. Und obendrein die Geschichte mit dem Spitzel. Nach allem, was er von den Nazis wusste, konnte er sich nicht vorstellen, dass sie sich die Mühe machen würden, in Dritter-Klasse-Waggons nach jüdischen Hütteningenieuren zu fahnden. Wenn sie den Mann haben wollten, hätten sie ihn in Regensburg gar nicht einsteigen lassen. Trotzdem, die Sache war nicht ganz geheuer. Der Mann im Korridor hatte sich tatsächlich etwas sonderbar verhalten, und Braunauges Angst stand offensichtlich mit diesem Mann in Zusammenhang. Kenton witterte eine Story.
»Ich wüsste nicht, wie ich Ihnen helfen könnte«, antwortete er.
Der andere beugte sich vor. Kenton spürte seinen Atem.
»Sie könnten meine Wertpapiere für mich über die Grenze schmuggeln.«
»Und wenn ich ebenfalls durchsucht werde?«
»Sie sind Engländer. Das würden die sich nicht trauen. Sie riskieren nichts. Für Sie ist das doch eine Kleinigkeit.«
Kenton war sich da nicht so sicher, ließ die Sache aber auf sich beruhen.
»Tut mir leid, diese verantwortungsvolle Aufgabe kann ich nicht übernehmen.«
»Sie kriegen auch Geld dafür …« Braunauge hielt inne, suchte in seiner Tasche und zog Kenton in das Licht herüber, das vom Korridor hereinfiel. Er hatte eine Brieftasche in der Hand. »Schauen Sie … Ich gebe Ihnen hundert, zweihundert, dreihundert Mark, wenn Sie meine Wertpapiere über die Grenze schmuggeln.«
In diesem Moment wurde der neutrale Beobachter Kenton zum Mitwirkenden. Dreihundert Mark! Abzüglich der hundert, die er dem Havas-Mann schuldete, blieben ihm zweihundert. Zweihundert! Damit konnte er nach Berlin zurückfahren, und es wäre noch immer reichlich übrig. Braunauge mochte ein ganz anderer sein, als er behauptete, und er selbst würde vielleicht auf direktem Weg in einem deutschen Gefängnis landen, aber dreihundert Mark waren das Risiko wert.
Er zögerte zunächst, ließ sich bitten und schließlich überreden. Tränen der Rührung liefen Braunauge über die Wangen, als er Kenton hundertfünfzig Mark Vorschuss aushändigte. Den Rest sollte er bei Rückgabe der Wertpapiere erhalten. Er erklärte sofort, dass sie auf seinen Namen, Hermann Sachs, ausgestellt und für andere Personen mithin wertlos seien.
»Mein Herr«, fuhr er fort und legte Kenton dabei die Hand auf den Arm, »ich vertraue Ihnen meine spärliche Habe an. Sie werden mich hoffentlich nicht enttäuschen.«
Seine glänzenden braunen Augen guckten unendlich traurig und mitleidheischend, doch sein Griff war erstaunlich kräftig.
Kenton versicherte ihn seiner Zuverlässigkeit, der Griff lockerte sich, und nach einem vorsichtigen Blick zum Korridor gab er ihm einen langen, dicken Umschlag. Kenton fühlte die Papiere darin. Er steckte den Umschlag ein.
Sachs atmete tief durch und ließ sich mit einem lauten Seufzer zurücksinken.
Kenton fand diese demonstrative Erleichterung ein wenig befremdlich. Mit zunehmendem Unbehagen, das er sich nicht recht erklären konnte, beobachtete er, wie Sachs sich eine schwarze Zigarre anzündete und einen großen, ramponierten Koffer öffnete. Er schien seinen Mitreisenden völlig vergessen zu haben.
Kenton sah von seinem Platz aus, dass der Koffer bis oben hin mit schmutziger Wäsche vollgestopft war. Sachs schien sich aber auszukennen. Seine Hand verschwand in einer Ecke des Koffers und kam mit einer großkalibrigen Pistole wieder zum Vorschein. Er schob die Waffe lässig in ein Schulterhalfter unter dem linken Arm.
Kenton hatte das Gefühl, dass mehr hinter diesem Mann steckte, als man ihm ansah.
Zur Zollabfertigung trennten sie sich voneinander.
Sachs stieg als Erster aus. Kenton, der sich den Umschlag in die rechte Socke gestopft und seine deutschen Geldscheine im linken Schuh versteckt hatte, folgte etwas später mit einem klammen Gefühl in der Magengegend.
In der Warteschlange vor dem deutschen Zoll sah er, dass Sachs nur die übliche Frage nach mitgeführten Zahlungsmitteln gestellt wurde. Der »Deutsche« wurde weder durchsucht noch festgenommen. Kenton sah seine Zweifel an Sachs’ Geschichte bestätigt und beglückwünschte sich zu seinem Scharfsinn. Außerdem fiel ihm noch der »Nazispitzel« auf, der gerade einen hellerleuchteten Hof zum österreichischen Zoll überquerte.
Er selbst wurde schnell abgefertigt und war sehr erleichtert, als alles vorbei war. Er stieg wieder in den Zug und wurde von Sachs nervös begrüßt.
»Ah, da sind Sie ja! Hat alles geklappt? Gut. Nein, nein, nicht hier!«, sagte er, als Kenton sich anschickte, den Umschlag hervorzuholen. »Erst später. Stecken Sie ihn wieder ein. Wir sind noch nicht sicher.« Er blickte verstohlen in den Korridor. »Der Spitzel ist im Zug! Die Gefahr ist noch nicht vorbei.«
Jetzt reichte es Kenton. Er fror, fühlte sich elend, und dieser Herr Sachs ging ihm mit seinen Geschäften auf die Nerven. Die kritische Situation am Zoll hatte ihn mitgenommen. Dieses Gerede von Spitzeln und Gefahr war doch lächerlich! Außerdem war ihm klargeworden, dass es sich bei den Wertpapieren entweder um Drogen handelte, um gestohlene Aktien, um einen Bericht über die Aussichten des Mädchenhandels in Westfalen oder um etwas ähnlich Inkriminierendes. Außerdem traute er Sachs nicht. Was immer dieser Typ vorhatte, er, Kenton, wollte damit nichts mehr zu tun haben.
»Ich bedaure«, sagte er, »ich muss Sie bitten, die Wertpapiere wieder an sich zu nehmen. Ich habe mich bereit erklärt, sie über die Grenze zu bringen. Das habe ich getan. Und jetzt geben Sie mir bitte die hundertfünfzig Mark!«
Sachs schwieg zunächst. Seine braunen Augen verdüsterten sich ein wenig. Dann beugte er sich vor und legte Kenton die Hand auf das Knie.
»Herr Kenton«, sagte er rasch, »bitte stecken Sie den Umschlag wieder ein. Ich erhöhe mein Angebot. Sie bekommen noch einmal dreihundert Mark, wenn Sie meine Wertpapiere bis ins Hotel Josef in Linz bringen.«
Kenton wollte schon ablehnen. Dann behauptete sich derselbe Leichtsinn, der ihn an diesem Tag schon einmal so teuer zu stehen gekommen war. Sechshundert Mark! Wenn schon, denn schon!
»Na schön«, sagte er.
Doch im selben Moment wusste er, dass er einen Fehler gemacht, sich diesmal in eine gefährliche Situation manövriert hatte.
Zaleshoff und Tamara
Das Büro der Zürcher Maschinenbaufirma Kießling & Pieper GmbH ist nicht ganz leicht zu finden. Man muss eine ruhige Straße unweit des Hauptbahnhofs entlanggehen, in eine schmale Gasse einbiegen, eine uralte, sehr schwere Tür öffnen und auf einer schlichten Holztreppe fünf Stockwerke hochsteigen. An der Tür dort oben steht der Name der Firma. Ein Pfeil mit dem Hinweis »Bitte läuten!« zeigt auf eine Klingel, die allerdings kaputt ist. Eine zweite Klingel funktioniert zwar, klingelt aber, was nur wenige wissen, durch Einführen eines Schlüssels. Die Firma Kießling & Pieper gibt sich ziemlich zugeknöpft.
Obwohl dieser Name noch immer an der Tür steht, haben Kießling und Pieper schon lange nichts mehr mit der Firma zu tun. Kießling starb 1910, Pieper 1924. Seitdem liegt die Firma darnieder – hauptsächlich, weil die Nachfolger Besseres zu tun hatten, als Vertikalbohrer, Fräsmaschinen und Drehbänke herzustellen. Vergilbte braune Fotografien von solchen Geräten hängen noch immer an den Wänden, aber sie sind das Einzige, was die Firma mit der Branche verbindet, in der tätig zu sein sie vorgibt.
Eines Nachmittags Ende November saß der Chef von Kießling & Pieper an seinem Schreibtisch und starrte nachdenklich auf eines dieser braunen Fotos. Es zeigte eine Drehbank von Schütte und Eberhardt, doch das wusste Andrej Prokowitsch Zaleshoff nicht.
Der inoffizielle Repräsentant der UdSSR in der Schweiz war ein breitschultriger, etwa achtunddreißigjähriger Mann, dessen braune Locken in einem Winkel von fünfundvierzig Grad von seiner Stirn abstanden. Sein glattrasiertes Gesicht war unattraktiv, ohne abstoßend zu wirken – »pockennarbig« wäre eine zu unfreundliche Bezeichnung gewesen, »zerfurcht« allzu romantisierend. Er hatte eine mächtige Boxernase und die Angewohnheit, den Unterkiefer vorzuschieben, wenn er seinen Worten Nachdruck verleihen wollte. Seine Augen waren erstaunlich blau und sehr scharf. Jetzt wanderten sie nach teilnahmsloser Betrachtung der Drehbank zu einem Papier auf dem Schreibtisch, verweilten dort einen Moment und wandten sich dann zur Tür, die zum Nebenzimmer führte.
»Tamara, komm doch mal!«, rief er.
Wenig später kam eine junge Frau herein.
Tamara Prokowna Zaleshoff war keine Schönheit. Ihr Gesicht konnte man als eine idealisierte Version des Gesichts ihres Bruders bezeichnen. Es hatte einen makellosen Teint und war gut geschnitten, aber vom Knochenbau her eine Spur zu maskulin. Ihre Hände waren gepflegt.
»Hast du die Briefe dechiffriert?«
»Ja. Es waren nur zwei.«
Post für die Firma Kießling & Pieper wurde nicht direkt zugestellt. Wer mit ihr in Verbindung treten wollte, schrieb an ein Fräulein Rosa Neumann, postlagernd. Zweimal täglich verwandelte sich Tamara in Rosa Neumann, um die Briefe abzuholen. Dann musste sie die endlosen Buchstaben- und Zahlenkolonnen in sinnvolle Sätze verwandeln und das Ergebnis in ein unauffälliges »Eingangsbuch« eintragen, das sie sodann ihrem Bruder vorlegte. Die meisten Botschaften waren langweilig, und das Dechiffrieren ging ihr ziemlich auf den Geist.
Sie zog ihren Mantel aus und hängte ihn an die Tür. Dann warf sie ihrem Bruder einen fragenden Blick zu.
»Was gibt’s, Andreas?«
»Während du die Briefe holen warst, hat Petrow aus Berlin angerufen.«
»Petrow? Was wollte er denn?«
»Gestern erhielt er aus Moskau die Information, dass Borowanskij übergelaufen ist.«
»Borowanskij?«
»Ja, die Zentrale hat festgestellt, dass er die B2-Mobilisierungspläne fotografiert und sich damit nach Deutschland abgesetzt hat. Er soll heute Nachmittag nach Regensburg gefahren sein und sich eine Fahrkarte nach Linz gekauft haben. Offenbar will er die Fotos dort übergeben.«
»Hat er sie bei sich?«
»Ja, in der Manteltasche.«
»Kann man ihn nicht aufhalten?«
Zaleshoff lächelte müde.
»Doch, doch, aber nicht im Moment. Petrow hat Ortega auf ihn angesetzt.«
»Ortega?«
»Diesen spanischen Gangster. Petrow, der selbst nicht gerade zimperlich ist, findet ihn ekelhaft, sagt aber, er leiste gute Dienste.«
»Ist er auch zuverlässig?«
»Aus Petrows Sicht schon. Ortega wird wegen Mordes gesucht – vor zwei Jahren hat er einer Frau in Lissabon die Kehle aufgeschlitzt –, und Petrow würde notfalls der Polizei einen Tipp geben.«
Tamara machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Borowanskij war mir nie sympathisch.«
Zaleshoff schüttelte den Kopf.
»Mir auch nicht. Ich fand immer, dass sie ihm zu sehr vertrauen. Aber es hieß, er ist nützlich, weil er lange in Deutschland gearbeitet hat und sich dort auskennt. So ein Quatsch! Borowanskij könnte sein ganzes Leben in einem Land arbeiten und würde nie wie ein Einheimischer sprechen, geschweige denn ihre Mentalität verstehen. Außerdem ist mir ein beschränkter, aber loyaler Mitarbeiter lieber als ein Experte, der mich womöglich verrät.«
Er zündete sich eine Pfeife an, legte sie aber sofort wieder beiseite.
»Es ist sinnlos, Tamara«, sagte er gereizt, »es geht nicht. Ich kann keine Pfeife rauchen. Mir wird schlecht davon.«
»Es ist besser als diese ewigen Zigaretten. Du darfst nicht so schnell aufgeben.«
Zaleshoff griff wieder zur Pfeife, klopfte aber nur mit dem Stiel gegen seine starken, weißen Zähne. Er schien schon wieder an etwas anderes zu denken. Die junge Frau beobachtete ihn eine Weile.
»Wie ernst ist diese Sache, Andreas?«, fragte sie schließlich.
Eine Weile glaubte sie, er habe sie nicht gehört. Dann sagte er achselzuckend:
»Das ist noch nicht klar. Verstehst du, wo das Problem liegt, Tamara? Borowanskij hat nur Fotos von den Dokumenten dabei, man könnte also in die Welt setzen, dass sie gefälscht sind. Aber wir haben so wenig in der Hand. Wenn wir wenigstens wüssten, für wen er arbeitet, könnten wir etwas unternehmen. Diese B2-Anweisungen sind eben nicht bloß militärische Unterlagen. Wenn es sich um Details von Geschützbestückungen oder Verteidigungsanlagen handelte, würde das Zeug wahrscheinlich in Brüssel auftauchen, und wir würden wissen, woran wir sind. Aber es ist nun einmal nicht so. Ich habe das dumme Gefühl, dass diese Geschichte einen politischen Hintergrund hat, und das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn Borowanskij etwas verkaufen wollte – es gibt so viele andere interessante Objekte, die er hätte anbieten können. Warum ausgerechnet diese Pläne? Warum? Das frage ich mich.«
»Weil er nicht die Zeit hatte, sich etwas anderes zu besorgen, oder aber, weil ihm jemand Geld dafür geboten hat.«
»Genau. Wenn er aber bloß etwas fotografieren wollte, um viel Geld damit zu verdienen, musste er sich sagen, dass die B2-Unterlagen aus seiner Sicht wertlos sind. Würde er sein Leben riskieren, wenn finanziell nichts für ihn herausspränge? Nein. Jemand anderes will das Zeug, und Borowanskij bekommt Geld dafür, dass er es beschafft. Das Schlimmste daran ist, dass wir nichts unternehmen können, solange er nicht in Österreich ist. Berlin sucht einen Vorwand für eine antisowjetische Aktion, und wir wollen sie den Deutschen nicht liefern. Wir können nur hoffen, dass er die Dokumente nicht schon vor der österreichischen Grenze abliefert.«
»Warum hat man ihn denn nicht aufgehalten, bevor er die Sowjetunion verlassen konnte?«
»Weil niemand misstrauisch geworden ist. Borowanskij fungierte als Verbindungsmann zwischen Moskau und unseren Leuten in Riga. Wenn derjenige, der die Fotos gemacht hat, nicht Verdacht geschöpft und Meldung gemacht hätte, wüssten wir vermutlich noch immer nichts. Borowanskij war aber auch dumm. Die Sache wäre erst ein paar Tage später aufgeflogen, wenn er sich in Riga gemeldet hätte, statt direkt nach Deutschland zu fahren.«
»Na ja, es geht uns nichts an.«
»Nein, vermutlich nicht.«
Doch er schaute noch immer nachdenklich. Plötzlich ging er zu einem Schrank in der Zimmerecke, entnahm ihm einen dicken Aktenordner und begann, darin zu blättern.
»Heute Nachmittag kam ein Bericht von unserem Mann in Basel«, sagte Tamara. »Der britische Agent ist umgezogen. Er hatte ein Büro in der Badenstraße, unter dem Namen Imexco-Suisse. Jetzt arbeitet er in der Wohnung eines Zahnarztes namens Bouchard. Sehr clever. Die vielen Leute, die in eine Zahnarztpraxis kommen, kann man ja unmöglich im Auge behalten.«
Zaleshoff, noch immer in den Aktenordner vertieft, brummte etwas.