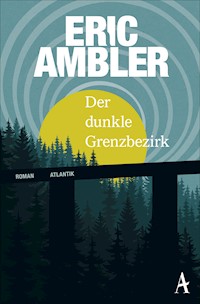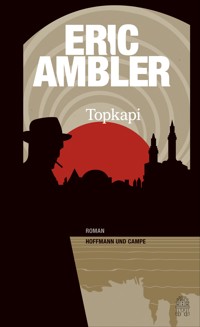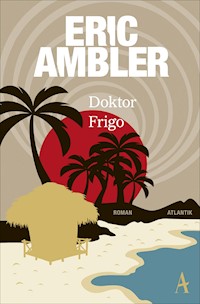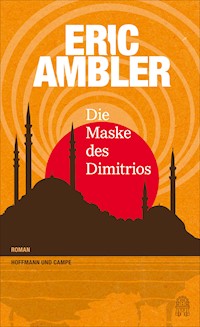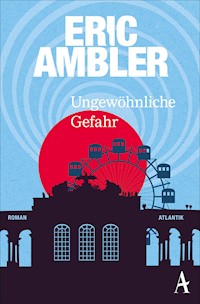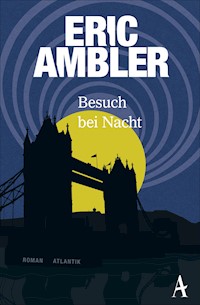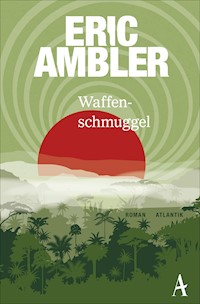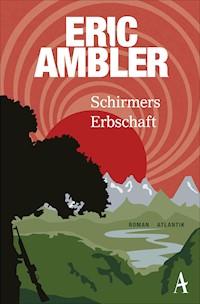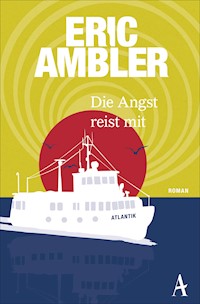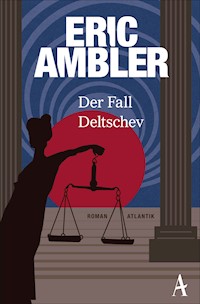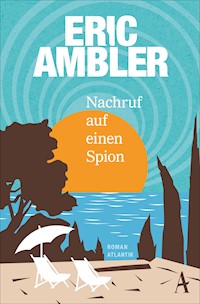
10,99 €
Mehr erfahren.
Joseph Vadassy, jugoslawischer Sprachlehrer und Hobbyfotograf, gönnt sich nach Jahren endlich wieder einen Urlaub. Ein kleines Hotel an der südfranzösischen Riviera soll es sein. Als er aber nur zwei Tage nach seiner Ankunft in einer Drogerie seine ersten Urlaubsfotos entwickeln lassen will, wird er plötzlich festgenommen. Der Vorwurf: Er sei ein Spion und gefährde die französische Staatssicherheit. Vadassys einzige Chance, seine Unschuld zu beweisen, ist ein Deal mit der Polizei. Als verdeckter Ermittler wird er zurück in sein Hotel geschickt, um dort den wahren Spion zu entlarven. Aber wer ist hier Freund - und wer Feind?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Eric Ambler
Nachruf auf einen Spion
Roman
Aus dem Englischen von Matthias Fienbork
Atlantik
1
Am 14. August, einem Dienstag, traf ich, aus Nizza kommend, in St. Gatien ein. Am Donnerstag, dem 16. August, um 11.45 Uhr wurde ich von einem Kriminalbeamten festgenommen und in Begleitung eines Polizisten auf das Kommissariat gebracht.
Diese beiden Sätze zu schreiben fiel mir nicht schwer. Ich starrte auf das Blatt Papier und überlegte, welche Wirkung diese Worte auf mich haben würden. Vor nicht allzu langer Zeit hätte mein Herz schon bei ihrem Anblick schneller geklopft, ich wäre hinausgelaufen, um unter Menschen zu sein, um den Staub der Straße einzuatmen und mich zu vergewissern, dass ich nicht allein war. Doch jetzt kann ich sie niederschreiben, ohne dass sie mich berühren. Man vergisst schnell. Oder liegt es daran, dass man die Realität immer nur bruchstückhaft, ausschnittweise wahrnimmt, dass eine Linie, die einem heute als kurzer Strich erscheint, sich tags darauf als Teil eines vollständigen Kreises herausstellt? Schimler würde dem zustimmen. Aber er ist nach Deutschland zurückgekehrt, und ich glaube nicht, dass ich ihn je wiedersehen werde. Die anderen vermutlich genauso wenig. Einer von ihnen schrieb mir vor ein paar Wochen einen Brief, der mir von der neuen Direktion des Hôtel de la Réserve nachgeschickt wurde. Er sprach von den »angenehmen Stunden«, die er in meiner Gesellschaft verbracht habe, und bat mich abschließend um ein Darlehen von ein paar hundert Francs. Der Brief steckt, noch immer unbeantwortet, in meiner Tasche. Wenn ich tatsächlich angenehme Stunden in der Gesellschaft dieses Mannes verbracht habe, so erinnere ich mich nicht daran. Ich habe auch kein Geld, das ich ihm leihen könnte. Das ist einer der Gründe, weshalb ich diese Geschichte schreibe. Der andere Grund … Aber urteilen Sie selbst.
Die Eisenbahnlinie von Toulon nach La Ciotat verläuft mehrere Kilometer lang dicht neben der Küste. Sooft der Zug aus einem der vielen Tunnels auftaucht, die sich auf dieser Strecke aneinanderreihen, sieht man für kurze Zeit das strahlendblaue Meer unterhalb der Gleise, die roten Felsen, die weißen Häuser in den Pinienwäldern. Es ist, als würden einem in großer Hast bunte Lichtbilder vorgeführt. Dem Auge bleibt keine Zeit, Einzelheiten wahrzunehmen. Selbst wenn man von St. Gatien weiß und nach dem Ort Ausschau hält, sieht man nur das leuchtendrote Dach und die blassgelben Mauern des Hôtel de la Réserve.
Von St. Gatien und seinem Hotel hatte mir ein Bekannter in Paris erzählt. Die Zimmer des Réserve seien komfortabel, es liege schön, die Küche sei épatant und der Ort selbst noch nicht »entdeckt«. Für vierzig Francs pro Tag mit Vollpension könne man dort angenehm leben.
Vierzig Francs waren ziemlich viel Geld für mich, doch nach zwei Tagen im Réserve machte ich mir über diesen Luxus keine Gedanken mehr. Im Gegenteil, ich wünschte, ich hätte meinen dreiwöchigen Urlaub von vornherein dort verbracht, statt auf dem Rückweg nach Paris nur Zwischenstation zu machen. Das Réserve war eines von diesen kleinen Hotels.
St. Gatien liegt malerisch auf der windgeschützten Seite der kleinen Landzunge, auf der das Hotel steht. Die Häuser sind, wie die meisten Fischerdörfer am Mittelmeer, weiß, hellblau oder rosarot getüncht. Felsige Anhöhen, deren pinienbestandene Hänge auf der anderen Seite der Bucht steil ins Wasser abfallen, schützen den kleinen Hafen vor dem Mistral, der manchmal heftig aus Nordwest weht. Der Ort hat 743 Einwohner, die zum größten Teil von der Fischerei leben. Es gibt zwei Cafés, drei Bistros, sieben Geschäfte und, etwas weiter außerhalb an der Bucht, eine Polizeistation.
Vom Ende der Terrasse, auf der ich an diesem Morgen saß, waren das Dorf und die Polizeiwache jedoch nicht zu sehen. Das Hotel steht auf dem höchsten Punkt der Landzunge, und die Terrasse erstreckt sich an der Südseite des Gebäudes. Hinter der Terrasse geht es etwa fünfzehn Meter steil hinunter. Die Zweige der Pinien, die weiter unterhalb wachsen, berühren die Balustrade. Aber weiter draußen, in Richtung Landspitze, steigt das Gelände wieder an. Zwischen den trockenen grünen Büschen schimmert rötliches Felsgestein. Ein paar windzerzauste Tamarisken mit ihren knorrigen Ästen heben sich vor dem Tiefblau des Meeres ab. Bisweilen spritzt unten bei den Felsen eine weiße Gischtwolke hoch. Es ist schön und friedlich.
Es war schon ziemlich heiß, und im Garten zirpten die Grillen. Wenn ich den Kopf etwas bewegte, sah ich durch das Terrassengeländer den kleinen Badestrand, der zum Hotel gehörte. Zwei große bunte Sonnenschirme waren im Sand aufgepflanzt. Unter einem schauten zwei junge, tiefbraune Beinpaare hervor, ein männliches und ein weibliches. Leises Gemurmel verriet mir, dass noch andere Gäste, für mich nicht zu erkennen, sich im schattigen Teil des Strands aufhielten. Der Gärtner, Kopf und Schultern durch einen breitkrempigen Strohhut vor der Sonne geschützt, malte gerade einen blauen Streifen auf ein kleines, kieloben aufgebocktes Boot. In diesem Moment bog ein Motorboot um die Landzunge und näherte sich dem Strand. Bald erkannte ich am Ruder die schmale, schlaksige Gestalt unseres Hoteldirektors. Der andere Mann trug eine grobe Segeltuchhose und war vermutlich ein Fischer aus dem Ort. Vermutlich waren sie seit Morgengrauen unterwegs. Vielleicht würde es Rote Meerbarbe zum Mittagessen geben. Draußen auf dem Meer sah ich einen Dampfer des Niederländischen Lloyd auf seinem Weg von Marseille nach Villefranche.
Ich dachte daran, dass ich am Abend des nächsten Tages meinen Koffer packen und am Samstag früh mit dem Bus nach Toulon fahren und dort in den Zug nach Paris einsteigen würde. In Arles war es sicher schon sehr heiß, auf den unbequemen Lederbänken des Dritte-Klasse-Abteils klebte man fest, und alles bedeckte eine Schicht von Staub und Ruß. In Dijon würde ich müde und hungrig sein. Ich durfte nicht vergessen, eine Flasche Wasser mitzunehmen, in die ich vielleicht einen Schuss Wein geben könnte. Ich würde mich auf die Ankunft in Paris freuen. Aber nur kurz. Ich dachte an den langen Fußweg vom Bahnsteig des Gare du Lyon bis zur Metro. Mit dem schweren Koffer. Richtung Neuilly bis zur Place de la Concorde, umsteigen, von dort weiter Richtung Mairie d’Issy bis Gare Montparnasse. Umsteigen, weiter Richtung Porte d’Orléans bis Alésia. Den Ausgang hoch. Montrouge. Avenue de Chatillon. Hôtel de Bordeaux. Und am Montagmorgen Frühstück am Tresen des Café de l’Orient, wieder zur Metro, Denfert-Rochereau bis Etoile, dann zu Fuß die Avenue Marceau hinunter. Monsieur Mathis würde mich schon erwarten. »Guten Morgen, Monsieur Vadassy! Gut schauen Sie aus! In diesem Semester übernehmen Sie den Grundkurs Englisch, Deutsch für Fortgeschrittene und den Grundkurs Italienisch. Ich selbst werde Englisch für Fortgeschrittene unterrichten. Wir haben zwölf neue Studenten. Drei Geschäftsleute und neun Restaurantiers (er sagte nie Kellner). Alle haben sich für Englisch eingeschrieben. Für Ungarisch gibt es keine Interessenten.« Wieder ein Jahr.
Aber noch lagen die Pinien und das Meer vor mir, die roten Felsen und der Sand. Ich streckte mich. Eine Eidechse huschte über die Terrasse. Jenseits des Schattens, den mein Stuhl warf, hielt sie plötzlich inne, um sich zu wärmen. Ich sah ihre pulsierende Kehle. Ihr Schwanz bildete einen eleganten Halbkreis, dem sich die diagonale Fuge zwischen den Fliesen wie eine Tangente anschmiegte. Eidechsen haben einen erstaunlichen Sinn für geometrische Formen.
Beim Anblick dieser Eidechse fielen mir meine Fotos wieder ein.
Ich besitze nur zwei Wertgegenstände auf dieser Welt: einen Fotoapparat sowie einen vom 10. Februar 1867 datierten Brief Ferenc Deáks an den Grafen von Beust. Wenn mir jemand Geld für den Brief böte, würde ich es dankbar annehmen. Aber meinen Fotoapparat liebe ich, und hergeben würde ich ihn nur, wenn ich kurz vor dem Verhungern stünde. Dabei bin ich kein besonders guter Fotograf. Zwar wurde eines meiner Bilder in Paris bei der Ausstellung ›Fotografien des Jahres‹ gezeigt, aber wie alle Fotografen wissen, kann jeder Amateur, der über eine gute Kleinbildkamera, etliche Filme und etwas Erfahrung verfügt, früher oder später eine gute Aufnahme machen. Wie bei all diesen Geschicklichkeitsspielen, die auf englischen Jahrmärkten so beliebt sind, ist es vor allem eine Frage des Zufalls.
Ich hatte im Réserve ein wenig fotografiert und den belichteten Film tags zuvor zum Entwickeln in die Dorfdrogerie gebracht. Nun würde es mir normalerweise nicht im Traum einfallen, meine Filme von einem anderen Menschen entwickeln zu lassen. Das Vergnügen des Amateurfotografen liegt ja nicht zuletzt darin, dass er seine Filme selber entwickelt. Aber ich hatte ein wenig herumexperimentiert, und wenn ich die Ergebnisse nicht vor meiner Abreise aus St. Gatien sah, würde es mir nichts nützen. Also hatte ich den Film dem Drogisten anvertraut. Er schien sich auszukennen und hatte meine Angaben sorgfältig notiert. Um elf Uhr sollte mein Film fertig entwickelt sein.
Ich sah auf meine Uhr. Es war halb zwölf. Wenn ich ihn jetzt abholte, blieb mir noch genügend Zeit, um vor dem Essen schwimmen zu gehen und anschließend einen Aperitif zu nehmen.
Ich stand auf und ging über die Terrasse in den Garten und über das kleine Steintreppchen hoch zur Straße. Die Sonne brannte schon so stark, dass die Luft über dem Asphalt flimmerte. Ich hatte keinen Hut auf, und meine Haare fühlten sich ganz warm an, als ich sie berührte. Ich legte mir ein Taschentuch über den Kopf und ging, erst bergan, dann bergab, die Straße zum Hafen hinunter.
In der Drogerie war es kühl, und es roch nach Parfüm und Desinfektionsmitteln. Kaum war die Türglocke verklungen, als der Drogist schon auf der anderen Seite des Ladentisches stand. Er sah mir in die Augen, schien mich aber nicht wiederzuerkennen.
»Monsieur désire?«
»Ich habe gestern einen Film zum Entwickeln abgegeben.«
Langsam schüttelte er den Kopf.
»Er ist noch nicht fertig.«
»Sie haben ihn mir aber für elf Uhr versprochen.«
»Er ist noch nicht fertig«, wiederholte der Drogist gleichmütig.
Ich schwieg. Irgendetwas an seinem Verhalten war merkwürdig. Seine Augen, die durch die dicken Brillengläser sehr viel größer erschienen, fixierten mich noch immer. Ein seltsamer Ausdruck lag in ihnen. Dann wurde mir klar, was der Blick besagte. Der Mann hatte Angst.
Ich weiß noch, dass mich diese Erkenntnis ziemlich verdutzte. Dieser Mann hatte Angst vor mir – ich, der ich mein Lebtag Angst vor anderen gehabt hatte, war also imstande, Furcht einzuflößen! Am liebsten hätte ich laut gelacht. Gleichzeitig ärgerte ich mich aber, denn ich ahnte schon, was passiert war. Der Mann hatte meinen Farbfilm mit einem gewöhnlichen Entwickler behandelt und damit ruiniert.
»Ist alles in Ordnung mit dem Film?«
Er nickte heftig.
»Ja, ja. Er muss nur noch trocknen. Wenn Sie mir freundlicherweise Ihren Namen und die Anschrift nennen, schicke ich meinen Sohn mit dem fertigen Film vorbei.«
»Schon gut. Ich komme später wieder.«
»Es ist überhaupt kein Aufwand, Monsieur.«
Seine Stimme klang sonderbar gezwungen. In Gedanken zuckte ich mit den Schultern. Wenn der Mann den Film versaut hatte und eine kindische Angst davor hatte, sein Missgeschick einzugestehen, dann war das nicht mein Problem. Ich selbst hatte mich mit dem Verlust meiner Fotoexperimente schon abgefunden.
»Na schön.« Ich nannte ihm Namen und Adresse.
Laut wiederholte er die Angaben, während er sie notierte.
»Monsieur Vadassy, Hôtel de la Réserve.« Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und sagte dann, nicht mehr ganz so laut: »Ich werde Ihnen den Film bringen lassen, sobald er fertig ist.«
Ich bedankte mich und trat zur Tür. Ein Mann mit Strohhut und einem schlechtsitzenden schwarzen Anzug stand draußen. Da der Gehsteig schmal war und der Mann keinerlei Anstalten machte, mir Platz zu machen, schob ich mich mit einer leisen Entschuldigung an ihm vorbei. In diesem Moment legte er mir eine Hand auf den Arm.
»Monsieur Vadassy?«
»Ja?«
»Ich muss Sie bitten, aufs Kommissariat mitzukommen.«
»Wieso das denn?«
»Bloß eine kleine Passformalität, Monsieur.« Er war unbeirrbar höflich.
»Sollte ich dann nicht meinen Pass aus dem Hotel holen?«
Statt zu antworten, sah er nur an mir vorbei und nickte fast unmerklich. Eine Hand packte meinen anderen Arm. Ich blickte über meine Schulter. Hinter mir im Laden stand ein uniformierter Polizist. Der Drogist war verschwunden.
Die Hände schoben mich nicht allzu sanft vorwärts.
»Das verstehe ich nicht«, sagte ich.
»Sie werden schon verstehen«, sagte der Kriminalbeamte. »Allez, file!«
Er war jetzt nicht mehr höflich.
2
Den Weg zur Polizeiwache legten wir schweigend zurück. Nachdem der Polizist anfänglich seine Autorität demonstriert hatte, blieb er jetzt ein paar Schritte zurück, sodass ich mit dem Kriminalbeamten vorangehen konnte. Darüber war ich froh, denn ich legte keinen Wert darauf, wie ein Strauchdieb durch den Ort geführt zu werden. Ein paar neugierige Blicke gab es aber trotzdem, und ich hörte zwei Passanten scherzhaft von le violon sprechen.
Französischer Slang ist sehr schwer zu verstehen. Eine Geige hat ja wirklich keine Ähnlichkeit mit einem Kommissariat. Das einzige richtig hässliche Gebäude in St. Gatien ist ein abstoßender Klotz aus grauem Beton mit kleinen Fenstern wie Augen. Es befindet sich ein paar hundert Meter außerhalb des Ortes auf der anderen Seite der Bucht, und seine Größe verdankt sich der Tatsache, dass darin die Polizeiverwaltung eines Gebietes untergebracht ist, dessen geographischer Mittelpunkt zufällig St. Gatien ist. Dass St. Gatien außerdem eines der kleinsten, gesetzestreuesten und unzugänglichsten Dörfer der Region ist, wurde von den zuständigen Behörden offensichtlich ignoriert. St. Gatien ist stolz auf seine Polizeistation.
Das Zimmer, in das man mich führte, war bis auf einen Tisch und ein paar Holzbänke leer. Der Kriminalbeamte verschwand mit wichtiger Miene und ließ mich mit dem Polizisten zurück, der sich neben mich auf die Bank setzte.
»Wird es lange dauern?«
»Sprechen ist verboten.«
Ich schaute zum Fenster hinaus. Auf der anderen Seite der Bucht erkannte ich die bunten Sonnenschirme am Strand des Réserve. Für das Bad im Meer würde mir keine Zeit mehr bleiben, überlegte ich, und den Aperitif konnte ich vielleicht auf dem Rückweg in einem der Cafés trinken. Das Ganze war wirklich sehr ärgerlich.
»Achtung!«, rief mein Aufpasser plötzlich.
Die Tür ging auf, und ein älterer Mann ohne Mütze, der sich das Jackett aufgeknöpft und einen Bleistift hinter das Ohr geklemmt hatte, machte uns ein Zeichen herauszukommen. Der Polizist neben mir knöpfte sich den Kragen zu, strich die Uniformjacke glatt, setzte sich die Mütze korrekt auf und führte mich mit unnötig festem Griff zu einem Zimmer am anderen Ende des Korridors. Er klopfte energisch an und öffnete die Tür. Dann schob er mich hinein.
Ich spürte einen dünnen Teppich unter den Füßen. Hinter einem mit Papieren übersäten Tisch saß ein geschäftsmäßig wirkendes Männchen mit Brille. Das war der Kommissar. Neben dem Tisch, in einen kleinen Stuhl mit runden Armlehnen gezwängt, saß ein ziemlich dicker Mann in einem Anzug aus Tussaseide. Bis auf die mausgrauen Stoppeln, die sich auf den Speckfalten seines Nackens zeigten, war er glatzköpfig. Die schlaffe Gesichtshaut hing faltig herab, sodass die Mundwinkel gleich mit heruntergezogen wurden. Dadurch bekam sein Gesicht etwas Weiches. Die Augen waren außerordentlich klein, die Lider schwer. Der Schweiß lief ihm über das Gesicht, und er fuhr sich mit einem zerknüllten Taschentuch ständig über den Nacken. Er sah mich nicht an.
»Josef Vadassy?«
Die Frage hatte der Kommissar gestellt.
»Ja.«
Der Kommissar nickte dem Polizisten hinter mir zu, der daraufhin hinausging und die Tür leise hinter sich schloss.
»Ihren Ausweis bitte.«
Ich entnahm ihn meiner Brieftasche und reichte ihn hinüber. Der Mann zog ein Blatt Papier heran und begann, Notizen zu machen.
»Ihr Alter?«
»Zweiunddreißig.«
»Sie sind Lehrer, wie ich sehe.«
»Ja.«
»Wo sind Sie beschäftigt?«
»In der Sprachenschule Bertrand Mathis, Avenue Marceau 114a, Paris, sechstes Arrondissement.«
Während er diese Angaben aufschrieb, studierte ich den Dicken. Er hielt die Augen geschlossen und wedelte sich mit dem Taschentuch Luft zu.
»Und? Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?«, sagte der Kommissar scharf.
»Ja.«
»Vorzeigen!«
»Sie ist in Paris. Ich verbringe hier meinen Urlaub.«
»Sie sind Jugoslawe?«
»Nein, Ungar.«
Der Kommissar guckte erstaunt und funkelte mich an. Mich verließ der Mut. Wieder einmal würde ich die lange und verwickelte Geschichte meiner Staatsangehörigkeit, genauer gesagt meiner Staatenlosigkeit, erklären müssen. Bei Beamten löste das unweigerlich die übelsten Reaktionen aus. Der Kommissar wühlte in den Papieren auf seinem Tisch. Plötzlich stieß er einen Ruf der Befriedigung aus und hielt mir etwas unter die Nase.
»Und wie erklären Sie das hier, Monsieur?«
Erschrocken erkannte ich, dass »das hier« mein Pass war – der Pass, den ich törichterweise in meinem Koffer im Hotel Réserve vermutet hatte. Das bedeutete, dass die Polizei in meinem Zimmer gewesen war. Mir wurde allmählich mulmig.
»Ich warte auf Ihre Erklärung, Monsieur. Wie kommt es, dass Sie als Ungar einen jugoslawischen Pass benutzen? Einen Pass überdies, der seit zehn Jahren ungültig ist?«
Aus den Augenwinkeln sah ich, dass der Dicke sich nicht mehr Luft zuwedelte. Ich begann, die Erklärung zu geben, die ich längst auswendig kannte.
»Ich bin in Szabadka in Ungarn geboren. Nach dem Vertrag von Trianon 1919 fiel Szabadka an Jugoslawien. 1922 beschloss ich, in Budapest zu studieren. Zu diesem Zweck ließ ich mir von den jugoslawischen Behörden einen Pass ausstellen. Während meines Studiums wurden mein Vater und mein älterer Bruder von der jugoslawischen Polizei wegen einer politischen Sache erschossen. Meine Mutter war während des Kriegs gestorben, und ich hatte sonst keine Verwandten oder Freunde. Man riet mir, nicht nach Jugoslawien zurückzukehren. In Ungarn herrschten schlimme Verhältnisse. 1922 ging ich nach England. In der Nähe von London bekam ich eine Stelle als Deutschlehrer. 1931 wurde meine Arbeitserlaubnis dann nicht mehr verlängert. Vielen Ausländern wurde seinerzeit die Arbeitserlaubnis nicht mehr verlängert. Als mein Pass abgelaufen war, beantragte ich bei der jugoslawischen Gesandtschaft in London eine Verlängerung, die aber mit der Begründung abgelehnt wurde, dass ich kein jugoslawischer Staatsangehöriger mehr sei. Daraufhin stellte ich bei den englischen Behörden einen Antrag auf Einbürgerung, da ich aber keine Arbeitserlaubnis hatte, musste ich mich anderswo nach Arbeit umsehen. Ich ging nach Paris. Ich durfte dort bleiben und bekam von der Polizei Papiere, mit der Maßgabe, dass man mich bei einer eventuellen Ausreise nicht wieder hereinlassen würde. Seitdem bemühe ich mich um Einbürgerung. Nächstes Jahr um diese Zeit leiste ich hoffentlich schon meinen Militärdienst«, sagte ich mit einem möglichst gewinnenden Lächeln.
Mein Blick wanderte vom einen zum anderen. Der Dicke war im Begriff, sich eine Zigarette anzuzünden, während der Kommissar verächtlich mit meinem wertlosen Pass herumspielte und zu seinem Kollegen blickte. Ich sah gerade den Kommissar an, als der Dicke das Wort ergriff. Beim Klang seiner Stimme zuckte ich zusammen, denn von diesen dicken Lippen, diesem kräftigen Kinn, aus diesem massigen Leib kam ein ganz dünner, piepsiger Tenor.
»Was war das für eine politische Sache, deretwegen Ihr Vater und Bruder erschossen wurden?«
Er sprach langsam und sorgfältig, als befürchtete er, die Stimme könne ihm versagen. Als ich mich zu ihm wandte, zündete er sich die Zigarette an, wie man eine Zigarre anzündet, und blies eine Rauchwolke über das brennende Ende.
»Sie waren aktive Sozialisten«, sagte ich.
Der Kommissar sagte »Aha!«, als hätte sich alles auf mysteriöse Weise aufgelöst.
»Das könnte erklären …«
Doch der Dicke machte eine abwehrende Geste. Seine Patschhand sah aus wie die eines Babys.
»Welche Sprachen unterrichten Sie, Monsieur Vadassy?«, fragte er sanft.
»Deutsch, Englisch und Italienisch, manchmal auch Ungarisch. Mir ist aber nicht klar, was diese Fragen mit meinem Pass zu tun haben.«
Er ignorierte meine letzte Bemerkung.
»Sind Sie schon mal in Italien gewesen?«
»Ja.«
»Wann war das?«
»Als Kind. Wir haben dort Ferien gemacht.«
»In der letzten Zeit nicht mehr?«
»Nein, aus naheliegenden Gründen.«
»Haben Sie Kontakte zu Italienern in Frankreich?«
»An der Schule arbeitet ein Italiener. Er ist Lehrer wie ich.«
»Name?«
»Rossi, Filippino.«
Der Kommissar notierte alles.
»Sonst niemand?«
»Nein.«
Ich war verwirrt. Worauf wollten sie hinaus? Was hatten Italiener mit meinem Pass zu tun? Ich wusste es noch nicht, aber es sollte lange dauern, bis ich eine Antwort auf diese Frage bekam.
»Sie sind Fotograf, Monsieur Vadassy?« Jetzt sprach wieder der Kommissar.
»Hobbyfotograf, ja.«
»Wie viele Fotoapparate besitzen Sie?«
Das war verrückt.
»Einen. Aber wenn Sie mir freundlicherweise erklären würden …«, hob ich an.
Der Kommissar beugte sich vor und schlug wütend auf den Tisch.
»Sie haben hier keine Fragen zu stellen, sondern nur zu antworten«, rief er. Nach einer Pause fuhr er fort: »Sie sagen also, Sie besitzen eine Kamera?«
»Ja.«
»Welches Fabrikat?«
»Eine Zeiss Kontax.«
Er öffnete eine Schublade seines Tisches.
»Ist sie das?«
Ich erkannte meine geliebte Kamera.
»Ja«, rief ich erregt, »und ich möchte wissen, mit welchem Recht Sie meine Sachen aus meinem Zimmer entfernen. Bitte geben Sie sie mir zurück!«, sagte ich und streckte die Hand aus.
Der Kommissar legte den Fotoapparat wieder in die Schublade.
»Haben Sie nur diese Kamera? Keine andere?«
»Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Nein!«
Der Kommissar verzog das Gesicht zu einem triumphierenden Grinsen und öffnete erneut die Schublade.
»Wie erklären Sie dann, mein lieber Monsieur Vadassy, dass der hiesige Drogist dieses Stück Kinofilm von Ihnen zum Entwickeln bekommen hat?«
Ich starrte den Kommissar verdutzt an. Mit ausgestreckten Händen hielt er den entwickelten Film, den ich dem Drogisten überlassen hatte. Im Gegenlicht erkannte ich meine Fotoexperimente: vierundzwanzig Aufnahmen von einem einzigen Gegenstand – Eidechsen. Dann sah ich den Kommissar wieder grinsen. Ich lachte so spöttisch wie nur irgend möglich.
»Offensichtlich verstehen Sie nichts vom Fotografieren, Monsieur«, sagte ich herablassend. »Das da ist kein Kinofilm.«
»Nein?« Er schaute skeptisch.
»Nein. Ich gebe zu, er sieht so ähnlich aus. Aber Sie werden feststellen, dass Kinofilm einen Millimeter schmaler ist. Das da ist ein ganz normaler Rollfilm für eine Kontax, mit sechsunddreißig Aufnahmen im Format vierundzwanzig mal sechsunddreißig Millimeter.«
»Dann wurden diese Fotos also mit dieser Kamera hier aufgenommen, die wir in Ihrem Zimmer fanden?«
»Ja.«
Es entstand eine bedeutungsschwere Pause, die beiden Männer wechselten Blicke, und dann sprach wieder der Dicke:
»Wann sind Sie in St. Gatien angekommen?«
»Am Dienstag.«
»Von woher?«
»Aus Nizza.«
»Wann sind Sie in Nizza abgefahren?«
»Mit dem Zug neun Uhr neunundzwanzig.«
»Und wann sind Sie im Réserve eingetroffen?«
»Kurz vor dem Abendessen, so gegen sieben Uhr.«
»Der Zug aus Nizza ist aber um halb vier in Toulon. Um vier gibt es einen Bus nach St. Gatien. Sie hätten um fünf ankommen müssen. Warum sind Sie erst später gekommen?«
»Das ist doch lächerlich.«
Er schaute rasch hoch. Seine kleinen Augen waren kalt, bedrohlich.
»Beantworten Sie meine Frage. Warum sind Sie später gekommen?«
»Na schön. Ich habe meinen Koffer in Toulon bei der Gepäckaufbewahrung im Bahnhof gelassen und einen Bummel durch den Hafen gemacht. Ich war noch nie in Toulon, und um sechs ging ja auch noch ein Bus.«
Nachdenklich wischte er sich über den Hals.
»Was verdienen Sie eigentlich, Monsieur Vadassy?«
»Tausendsechshundert Francs im Monat.«
»Das ist nicht besonders viel, wie?«
»Nein.«
»So eine Kontax ist teuer.«
»Aber gut.«
»Sicher, aber ich frage Sie: wie viel haben Sie dafür bezahlt?«
»Viereinhalbtausend Francs.«
Er pfiff leise.
»Du lieber Himmel, das ist eine ganze Menge. Fast drei Monatsgehälter, hm?«
»Ja. Fotografieren ist mein Hobby.«
»Ein sehr kostspieliges Hobby. Sie scheinen mit Ihren tausendsechshundert Francs im Monat ja sehr geschickt umzugehen, Monsieur Vadassy. Ferien an der Côte d’Azur, und dazu noch im Hôtel de la Réserve! Mehr, als wir armen Polizisten uns leisten können, was, Kommissar?«
In seiner Stimme lag ein humorvoller Ton. Der Kommissar lachte hämisch. Ich spürte, wie ich puterrot anlief.
»Ich habe mir die Kamera zusammengespart«, sagte ich wütend. »Und was die Ferien angeht – es ist mein erster Urlaub seit fünf Jahren. Den habe ich mir auch zusammengespart.«
»Ja, sicher!«, spottete der Kommissar.
Seine höhnische Art brachte mich auf.
»Jetzt reicht es mir aber!«, polterte ich los. »Zur Abwechslung verlange ich jetzt eine Erklärung. Was wollen Sie eigentlich von mir? Sie haben durchaus das Recht, Fragen über meinen Pass zu stellen. Ich bin auch bereit, sie zu beantworten. Aber Sie haben kein Recht, mein Eigentum zu entwenden. Ebenso wenig haben Sie das Recht, mich in dieser Weise über meine Privatangelegenheiten zu verhören. Was diesen Film von mir angeht – auch der ist mein Eigentum, dem Sie irgendeine geheimnisvolle Bedeutung zuschreiben. Mir ist aber nicht bekannt, dass es verboten wäre, Eidechsen zu fotografieren. Also, meine Herren, ich habe mich nicht strafbar gemacht, aber ich habe Hunger, und es wird Zeit, dass ich zum Mittagessen ins Hotel zurückkehre. Sie werden mir die Kamera, die Fotos und meinen Pass auf der Stelle zurückgeben. Andernfalls werde ich unverzüglich einen Rechtsanwalt aufsuchen.«
Zum Schluss donnerte ich die geballte Hand auf den Tisch. Ein Füllfederhalter fiel zu Boden. Für einen Moment war es totenstill. Ich sah vom einen zum anderen. Reglos saßen sie da.
»Na schön«, sagte ich schließlich und wandte mich zum Gehen.
»Einen Moment, Monsieur«, sagte der Dicke.
Ich blieb stehen.
»Ja?«
»Bitte ersparen Sie sich und uns diese Sperenzchen. Der Polizist draußen vor der Tür wird Sie nicht gehen lassen. Es gibt da noch ein paar Fragen, die wir Ihnen stellen müssen.«
»Sie können mich zwangsweise festhalten«, sagte ich grimmig, »aber Sie können mich nicht zwingen, Ihre Fragen zu beantworten.«
»Natürlich nicht«, sagte der Dicke langsam, »so ist die Rechtslage. Wir können Ihnen nur empfehlen, sie zu beantworten – in Ihrem eigenen Interesse.«
Ich schwieg.
Der Dicke nahm den Film vom Tisch des Kommissars, hielt ihn gegen das Licht und spulte ihn ab.
»Mehr als zwei Dutzend Fotos«, sagte er. »Und alle von ein und demselben Gegenstand. Das finde ich kurios. Sie nicht, Vadassy?«
»Ganz und gar nicht«, erwiderte ich schnippisch. »Wenn Sie eine Ahnung von der Fotografie hätten oder auch nur genau hinschauten, würden Sie bemerken, dass jedes Bild ein wenig anders ist. Das heißt, auf jedem Bild sind die Schatten anders. Dass ich jedes Mal dieselbe Eidechse fotografiert habe, ist unwesentlich. Der Unterschied liegt in der Ausleuchtung des Gegenstandes und in der Komposition. Und überhaupt, selbst wenn ich hundert Fotos von sich sonnenden Eidechsen machen würde, wüsste ich nicht, was Sie das angeht.«
»Eine sehr geschickte Erklärung, Vadassy. Sehr geschickt. Und jetzt werde ich Ihnen sagen, was ich denke. Ich glaube, dass Ihnen ganz egal ist, was auf diesen sechsundzwanzig Aufnahmen war, und dass Sie den Film nur möglichst schnell vollknipsen wollten, um die anderen zehn Aufnahmen entwickelt zu bekommen.«
»Die anderen zehn? Was reden Sie da?«
»Stellen Sie sich nicht dumm, Vadassy, das ist doch nur Zeitverschwendung.«
»Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinauswollen.«
Er stemmte sich hoch und trat näher.
»Nein? Was ist mit den ersten zehn Bildern, Vadassy? Möchten Sie dem Kommissar und mir nicht erklären, warum Sie diese Aufnahmen gemacht haben? Ich bin sicher, es wird uns brennend interessieren.« Er tippte mir mit dem Finger auf die Schulter. »Waren es die Lichtverhältnisse, Vadassy, oder waren es die Schatten, die Sie an den neuen Verteidigungsanlagen vor dem Kriegshafen von Toulon so interessiert haben?«
Sprachlos starrte ich ihn an. Dann stotterte ich: »Soll das ein Witz sein? Ich habe nur noch ein paar Bilder von einem Festumzug in Nizza geknipst, der am Tag vor meiner Abreise dort stattfand.«
»Sie geben also zu, dass die Aufnahmen auf diesem Film von Ihnen sind?«, fragte er gezielt.
»Das habe ich doch schon gesagt.«
»Gut, dann schauen Sie ihn sich an.«
Ich nahm den Film, hielt ihn gegen das Licht und rollte ihn langsam ab. Eidechsen, Eidechsen, Eidechsen. Manche Aufnahmen sahen ganz brauchbar aus. Eidechsen. Noch mehr Eidechsen. Plötzlich hielt ich inne. Was zum Teufel war das? Ich schaute hoch. Die beiden Männer beobachteten mich aufmerksam.
»Nur zu, Vadassy!«, rief der Kommissar ironisch. »Sie brauchen gar nicht so überrascht zu tun!«
Ich traute meinen Augen nicht, betrachtete den Film noch einmal. Das erste, aus großem Abstand aufgenommene Foto zeigte einen Küstenabschnitt, teilweise verdeckt, vielleicht durch einen Zweig, der vor das Objektiv geraten war. Irgendetwas war auf diesem Küstenabschnitt zu erkennen – ein schmaler grauer Streifen. Die nächste Aufnahme, etwas näher und aus einem anderen Winkel, zeigte denselben grauen Streifen. Einzelne Details sahen wie Schießluken aus. Weitere Aufnahmen. Zwei von derselben Stelle aus gemacht. Die nächste Aufnahme zeigte den grauen Streifen aus noch kürzerer Entfernung und etwas von oben. Dann kamen drei Fotos, die durch einen dunklen Schatten in der Mitte kaum zu erkennen waren. Der Rand des Schattens war verschwommen und leicht gemustert wie ein Stück Stoff. Dann sah man, offenbar aus großer Nähe aufgenommen, eine unscharfe Betonfläche. Die letzte Aufnahme war überbelichtet, aber nur in einer Ecke verschwommen. Sie zeigte einen breiten, betonierten Laufgang mit merkwürdig schimmernden Lichtern. Für einen Moment konnte ich nichts damit anfangen. Doch dann begriff ich: Auf dem Foto waren lange, schmale Geschützrohre zu sehen.
3
Die offizielle Begründung meiner Festnahme lieferte der Ermittlungsrichter, ein nervöser kleiner Mann, der mich auf Geheiß des Dicken einem flüchtigen Verhör unterzog, bevor er den Haftbefehl unterschrieb. Ich erfuhr, dass ich der Spionage beschuldigt wurde, insofern ich mich unbefugt in einem militärischen Sperrgebiet aufgehalten und dort fotografiert hatte und im Besitz entsprechenden Fotomaterials sei, das die Sicherheit der Republik gefährde. Nachdem mir der Haftbefehl verlesen worden war und ich zu verstehen gegeben hatte, dass ich den Inhalt verstanden hatte, nahm man mir (wohl um zu verhindern, dass ich mich aufhängte) meinen Gürtel ab, sodass ich mir die Hose hochhalten musste, und ließ mich sämtliche Taschen leeren. Dann wurde ich zu einer Zelle im hinteren Teil des Gebäudes gebracht. Dort war ich allein.
Mit dem Wort »verblüfft« wäre meine Verfassung nur unzureichend beschrieben. Ich war dermaßen durcheinander, dass ich all die Proteste, die ich vorbringen wollte, im letzten Moment als aussichtslos hinuntergeschluckt hatte. Das Ergebnis war, dass ich kein Wort gesagt hatte. Die Kriminalbeamten hatten mein Schweigen gewiss auf ihre Weise interpretiert.
Doch jetzt, ganz allein in der Zelle, begann ich, etwas ruhiger nachzudenken. Es war lachhaft. Es war ungeheuerlich. Es war unvorstellbar. Und doch war es passiert. Ich befand mich in Polizeigewahrsam, weil man mich der Spionage verdächtigte. Bei einer Verurteilung musste ich mit vier Jahren in einem französischen Gefängnis rechnen, und anschließender Deportation. Das Gefängnis würde ich überstehen, sogar ein französisches, aber die Deportation! Ich fühlte mich elend und merkte, dass ich ziemliche Angst hatte. Wohin sollte ich gehen, wenn die Franzosen mich auswiesen? In Jugoslawien würde man mich sofort verhaften. Die Ungarn würden mich ebenso wenig einreisen lassen wie die Deutschen und Italiener. Selbst wenn ein verurteilter Spion ohne Pass nach England käme, würde er dort nicht arbeiten dürfen. Für die Amerikaner wäre ich nur ein unerwünschter Ausländer. Die südamerikanischen Republiken würden als Kaution viel Geld verlangen, das ich nicht besitze. Die Russen konnten einen verurteilten Spion ebenso wenig gebrauchen wie die Engländer. Selbst die Chinesen bestanden auf einem Pass. Ich konnte nirgends hin, nirgends. Und schließlich, wen interessierte es schon. Was mit einem staatenlosen Sprachlehrer passierte, interessierte kein Schwein. Keine Regierung würde sich schützend vor ihn stellen, kein Konsul sich für ihn verwenden, kein Parlament Anteil an seinem Schicksal nehmen. Offiziell existierte er nicht, er war eine Abstraktion, ein Geist. Im Grunde konnte er sich nur das Leben nehmen, und zwar auf so anständige Weise, dass keine Leiche übrig blieb. In diesem Fall wäre Feuer vielleicht geeignet. Asche zu Asche, Staub zu Staub.
Ich riss mich mit aller Macht zusammen. Ich war hysterisch. Das Urteil stand noch nicht fest. Ich saß noch nicht in einem regulären Gefängnis. Ich war noch immer in Frankreich. Ich musste meinen Verstand gebrauchen, nachdenken und selber die ganz einfache Erklärung dafür finden, warum diese Aufnahmen in meinem Fotoapparat waren. Ich musste sehr sorgfältig vorgehen, durfte kein Detail übersehen. Ich musste mich in Gedanken wieder nach Nizza zurückversetzen.
Ich entsann mich, dass ich den neuen Film am Montag eingelegt und anschließend die Fotos vom Volksfest gemacht hatte. Dann war ich in mein Hotel zurückgekehrt und hatte die Kamera in meinen Koffer getan. Als ich am Abend nachgesehen hatte, war sie noch da gewesen. So weit, so gut. Sie war in meinem Koffer geblieben, bis ich sie am Dienstagabend im Hotel Réserve ausgepackt hatte. In Toulon war der Koffer in der Gepäckaufbewahrung gewesen. Konnte jemand während der zwei Stunden, die ich in der Stadt spazieren gegangen war, den Fotoapparat benutzen? Nein. Unmöglich. Der Koffer war verschlossen gewesen, und niemand konnte ihn in der Gepäckaufbewahrung aufbrechen, die Kamera entwenden, diese riskanten Fotos machen und die Kamera wieder hineinpacken – alles innerhalb von zwei Stunden. Und außerdem, wieso sollte der Betreffende die Kamera wieder zurückpacken? Nein, so konnte es nicht gewesen sein.
Dann fiel mir etwas anderes ein. Natürlich, ich hätte schon längst darauf kommen sollen! Wie dumm von mir! Die Fotos, die ich angeblich gemacht hatte, waren die ersten zehn des Films. So musste es gewesen sein, denn mein letztes Eidechsenfoto trug die Nummer sechsunddreißig. Einen Rollfilm kann man nicht zurückspulen, und es gab keine Doppelbelichtungen. Da ich in Nizza beim Volksfest einen Film eingelegt hatte, musste für die Fotos von Toulon ein neuer Film eingelegt worden sei.
Erregt sprang ich von meinem Bett, auf dem ich gesessen hatte, zog die Hose hoch, die mir dabei heruntergerutscht war, und lief, die Hände in den Hosentaschen, in der Zelle auf und ab. Natürlich! Jetzt erinnerte ich mich wieder! Als ich mit den Fotoexperimenten begann, war ich etwas überrascht gewesen, dass der Bildzähler auf elf stand. Mir war, als hätte ich in Nizza nur acht Bilder verknipst. Aber man verliert leicht den Überblick, zumal bei einem sechsunddreißiger Film, und ich hatte nicht weiter darüber nachgedacht. Ja, der Film war ganz bestimmt ausgetauscht worden. Nur wann? Vor meiner Ankunft im Réserve konnte es nicht passiert sein, und mit den Eidechsen hatte ich erst am nächsten Tag nach dem Frühstück begonnen. Die Sache sah also folgendermaßen aus: Zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr (Frühstückszeit) hatte jemand meine Kamera aus meinem Zimmer genommen, einen neuen Film eingelegt, war nach Toulon gefahren und in ein militärisches Sperrgebiet eingedrungen, hatte die Fotos gemacht, war ins Réserve zurückgekehrt und hatte die Kamera wieder auf mein Zimmer gebracht.
Es klang ziemlich abwegig. Ganz abgesehen von anderen Einwänden, stellte sich einfach die Frage nach den Lichtverhältnissen. Um acht Uhr abends war es praktisch dunkel, und da ich erst um sieben Uhr eingetroffen war, schied der Dienstag aus. Selbst wenn man annahm, dass der Betreffende nachts losgezogen war und bei Sonnenaufgang fotografiert hatte, hätte er sich sehr beeilen und geschickt vorgehen müssen, wenn er meine Kamera zurückbringen wollte, während ich im Bett lag und aus dem Fenster guckte. Und überhaupt, warum sollte er mir die Kamera inklusive Film zurückgeben? Fast schien es, als wollte mir jemand etwas anhängen. Wodurch war die Polizei aufmerksam geworden? Hatte der Betreffende ihnen einen anonymen Tipp gegeben? Da war natürlich der Drogist. Offensichtlich hatte die Polizei den Besitzer des Films erwartet. Vielleicht war der Drogist mit den Fotos erwischt worden und hatte geschworen, dass sie mir gehörten. Aber das erklärte nicht, warum sie zusammen mit den Experimentalaufnahmen auf einem Film waren. Irgendwelche Klebestellen waren auch nicht zu sehen. Es war ein einziges Rätsel.
Fieberhaft ging ich alles zum dritten Mal durch, als ich draußen auf dem Flur Schritte hörte. Die Zellentür flog auf, der Dicke in dem Anzug aus Tussaseide kam herein, und die Tür schloss sich hinter ihm wieder.
Einen Moment stand er da und wischte sich mit dem Taschentuch über den Nacken, dann nickte er mir zu und setzte sich auf das Bett.
»Setzen Sie sich, Vadassy.«
Während ich mich auf die einzige andere Sitzgelegenheit hockte, ein emailliertes Bidet mit Holzdeckel, überlegte ich, welcher Schlag mir nunmehr bevorstand. Die kleinen, gefährlichen Augen musterten mich nachdenklich.
»Möchten Sie einen Teller Suppe und etwas Brot?«
Das hatte ich nicht erwartet.
»Danke, nein. Ich habe keinen Hunger.«
»Eine Zigarette vielleicht?«
Er holte eine zerknüllte Packung Gauloises heraus. Diese aufmerksame Geste kam mir äußerst verdächtig vor, aber ich griff trotzdem zu.
»Vielen Dank.«
Er hielt mir seine Zigarette zum Anzünden hin, dann wischte er sich sorgfältig den Schweiß von der Oberlippe und hinter den Ohren.
»Warum haben Sie zugegeben, dass Sie die Aufnahmen gemacht haben?«, sagte er schließlich.
»Ist das ein offizielles Verhör?«
Mit dem inzwischen feuchten Taschentuch wischte er sich Zigarettenasche vom Bauch.
»Nein. Offiziell wird Sie der Untersuchungsrichter des Bezirks verhören. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin Angehöriger der Sûreté Générale, Abteilung Marinenachrichtendienst. Sie können ganz offen mit mir reden.«
Ich verstand nicht, wie er erwarten konnte, dass ein Spion mit einem Mitarbeiter des Marinenachrichtendienstes offen reden würde, ging auf diesen Punkt aber nicht weiter ein. Ich persönlich hatte sehr wohl die Absicht, so offen wie möglich zu sein.
»Na gut. Ich habe es zugegeben, weil ich die Aufnahmen tatsächlich gemacht habe. Das heißt, alle bis auf die ersten zehn.«
»Schön. Und wie erklären Sie sich die ersten zehn?«
»Ich vermute, dass der Film in meiner Kamera ausgetauscht wurde.«
Er runzelte die Stirn. Ausführlich schilderte ich, was ich seit meiner Abreise aus Nizza alles unternommen und welche Überlegungen hinsichtlich des Urhebers der mich belastenden Fotos ich angestellt hatte. Er hörte mir zu, war aber sichtlich nicht beeindruckt.
»Das ist natürlich kein Beweis«, sagte er schließlich.
»Ich wollte auch nichts beweisen. Ich versuche nur, eine vernünftige Erklärung für diese absurde Geschichte zu finden.«
»Der Kommissar glaubt die Erklärung schon gefunden zu haben. Ich verstehe ihn sogar. Die Indizien sprechen eindeutig gegen Sie. Die Fotos sind auf einem Film, der, wie Sie selbst zugegeben haben, Ihr Eigentum ist. Außerdem sind Sie eine verdächtige Person. So einfach ist das.«
Ich sah ihm in die Augen.
»Aber überzeugt sind Sie nicht.«
»Das habe ich auch nicht behauptet.«
»Nein, aber sonst säßen Sie kaum hier und würden sich mit mir unterhalten.«
Er verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen.
»Sie überschätzen sich. Ich bin nicht an einzelnen Spionen interessiert, sondern an den Leuten, für die sie arbeiten.«
»Dann vergeuden Sie Ihre Zeit!«, rief ich wütend. »Die Aufnahmen sind nicht von mir, ich selbst arbeite ausschließlich für Monsieur Mathis, der mich dafür bezahlt, dass ich Sprachen unterrichte.«
Doch er schien nicht zuzuhören. Es entstand eine Pause.
»Der Kommissar und ich waren uns darin einig«, sagte er schließlich, »dass Sie entweder ein sehr geschickter oder ein sehr dummer Spion sind oder aber unschuldig. Ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass der Kommissar eher von der zweiten Möglichkeit überzeugt ist. Ich selbst war mir von Anfang an ziemlich sicher, dass Sie unschuldig sind. Sie waren viel zu einfältig. Kein Profi würde sich derart trottelig anstellen.«
»Besten Dank.«
»Ihre Dankesbezeugungen können Sie sich schenken, Vadassy. Es war eine Schlussfolgerung, die mir überhaupt nicht gefiel. Jedenfalls kann ich in der jetzigen Situation nichts für Sie tun. Verstehen Sie bitte. Der Kommissar hat Sie festnehmen lassen. Vielleicht sind Sie unschuldig, aber es wird mich nicht im Geringsten stören, wenn Sie ins Gefängnis wandern.«
»Davon bin ich überzeugt.«
»Andererseits«, fuhr der Dicke fort, »muss ich unbedingt wissen, wer die Aufnahmen tatsächlich gemacht hat.«
Wieder entstand eine Pause. Mir schien, als erwartete er eine Reaktion von mir. Doch ich schwieg. Nach einer Weile fuhr er fort.
»Sollte der wahre Schuldige entdeckt werden, Vadassy, dann könnten wir etwas für Sie tun.«
»Etwas für mich tun?«
Er räusperte sich laut.
»Nun ja, Sie haben keinen Konsul, der sich für Sie verwenden könnte. Es ist daher unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Sie anständig behandelt werden. Wenn Sie mit uns kooperieren, brauchen Sie sich diesbezüglich keine Gedanken zu machen.«
Ich ahnte schon, worauf diese dunklen Andeutungen hinausliefen. Ich packte meine Knie, um zu verhindern, dass ich dem Dicken an die Gurgel sprang.
»Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß …« Ich stockte. Ein Kloß saß in meiner Kehle. Ich brachte kein Wort mehr heraus. Der Dicke glaubte offenbar, dass ich seinen Namen wissen wollte.
»Beghin«, sagte er, »Michel Beghin.«
Er machte eine Pause und schaute wieder auf seinen Bauch. Es war unerträglich heiß in der Zelle. Sein gestreiftes Hemd wurde immer feuchter. »Trotzdem glaube ich,« fügte er hinzu, »dass Sie uns helfen können.«
Er stand auf, ging zur Zellentür und schlug einmal mit der Faust dagegen. Ein Schlüssel drehte sich laut im Schloss, dann sah ich draußen die Uniform eines Polizisten. Der Dicke murmelte etwas Unverständliches, die Tür ging wieder zu, er blieb stehen und zündete sich eine Zigarette an. Eine Minute später ging die Tür auf. Er nahm von dem Polizisten etwas entgegen, die Tür ging wieder zu, er drehte sich um. In seiner Hand war ein Fotoapparat.
»Erkennen Sie ihn?«
»Natürlich.«
»Schauen Sie genau hin! Ich möchte wissen, ob Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.«
Ich nahm die Kamera, drückte auf den Auslöser, überprüfte den Sucher und den Entfernungsmesser. Ich nahm das Objektiv heraus und öffnete die Rückwand. Ich guckte in sämtliche Ecken. Schließlich steckte ich ihn wieder in die Tasche.
»Mir fällt nichts Besonderes auf. In genau diesem Zustand habe ich ihn zum letzten Mal in der Hand gehabt.«
Der Dicke holte einen zusammengefalteten Zettel aus der Hosentasche und hielt ihn hoch.
»Das hier haben wir in Ihrer Brieftasche gefunden, Vadassy. Schauen Sie es sich an.«
Ich nahm das Papier und faltete es auseinander. Dann blickte ich zu ihm hoch.
»Na und?«, sagte ich vorsichtig. »Das ist der Versicherungsschein für die Kamera. Sie haben ja selber darauf hingewiesen, dass es ein teurer Apparat ist. Ich habe ein paar Francs aufgewendet, um mich gegen Verlust und«, fügte ich spitz hinzu, »gegen Diebstahl abzusichern.«
Mit einem geduldigen Seufzer nahm er den Zettel wieder an sich.
»Sie können froh sein«, sagte er, »dass die französischen Justizbehörden sich nicht nur um Verbrecher, sondern auch um Vollidioten kümmern. Diese Police besagt, dass Josef Vadassy bei Verlust einer Zeiss Kontax mit der Seriennummer F/64523/2 Anspruch auf Entschädigung hat. Bitte schauen Sie nach, welche Seriennummer der Apparat hat, den Sie in der Hand halten.«
Ich sah nach. Mein Herz blieb stehen. Die Kamera hatte eine andere Seriennummer.
»Demnach ist das nicht meine Kamera«, rief ich erregt. »Aber wieso waren meine Aufnahmen auf dem Film?«
Im Nachhinein muss ich zugeben, dass der Ausdruck der Verzweiflung auf dem Gesicht des Dicken mehr als gerechtfertigt war. Ich hatte wirklich nichts begriffen. Mit noch höherer Fistelstimme antwortete er:
»Weil nicht der Film vertauscht wurde, Sie Dämlack, sondern die Kamera. Dieser Fotoapparat ist ein sehr gebräuchliches Standardmodell. Mit dieser Kamera, in der sich der Film mit den Aufnahmen von Toulon befand, haben Sie Ihre blödsinnigen Eidechsen fotografiert. Sie haben sogar bemerkt, dass im Fensterchen eine andere Zahl zu sehen war als in Ihrem eigenen Fotoapparat. Anschließend haben Sie den Film herausgenommen und ihn zur Drogerie gebracht. Der Inhaber hat die zehn Aufnahmen gesehen und wie jeder Dummkopf erkannt, was darauf war, und den Film zur Polizei gebracht. Ist jetzt der Groschen bei Ihnen gefallen, Sie Hornochse?«
»Das heißt«, sagte ich, »als Sie so großmütig davon sprachen, dass Sie mich nicht für den Täter hielten, waren Sie von meiner Unschuld schon längst überzeugt. In Anbetracht dieser Tatsache möchte ich gern wissen, mit welchem Recht Sie mich hier noch festhalten.«
Er fuhr sich mit dem Taschentuch über die Glatze und beobachtete mich mit halb geschlossenen Augen.
»Nein, dass Sie unschuldig sein müssen, wurde mir erst durch Ihr Verhalten während des Verhörs klar. Sie sind offenkundig etwas beschränkt. Der Haftbefehl war