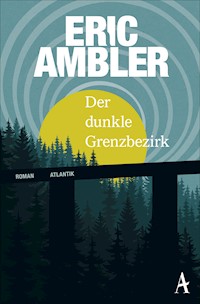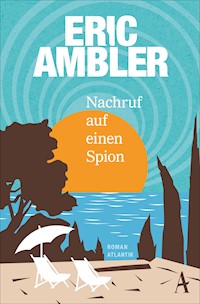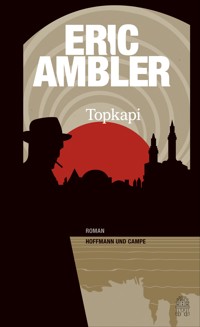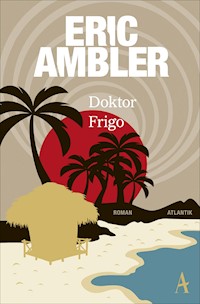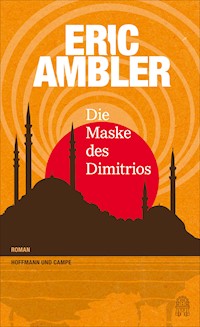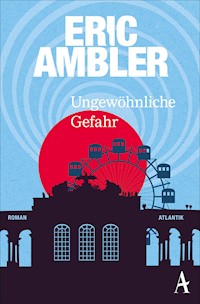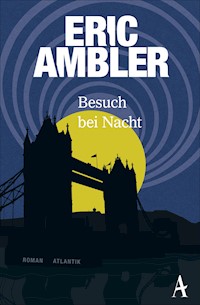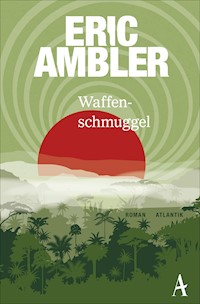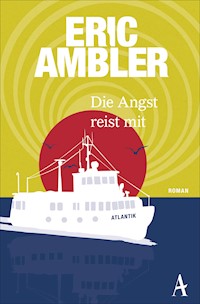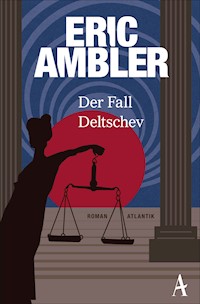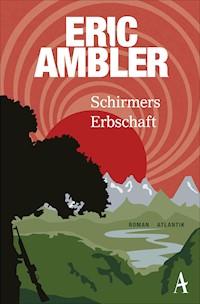
10,99 €
Mehr erfahren.
1807. Sergeant Franz Schirmer ist durch und durch Söldner und für unterschiedliche Herrscher tätig. Als die Schlacht bei Preußisch Eylau unentschieden ausgeht, sieht er sich in einer hoffnungslosen Lage und desertiert. In der entvölkerten Landschaft trifft er die halb verhungerte Maria Dutka, die entschlossen ist, ihn zu töten. Doch er verspricht ihr und ihrem entkräfteten Vater Nahrung, wenn sie ihm hilft. Als sich die Verhältnisse wieder normalisiert haben verlassen die beiden die Gegend und gründen nach Schirmers Namensänderung eine Familie. 1938 stirbt in den USA die Witwe Amelia Schneider-Johnson und hinterlässt ein Millionenvermögen. Franz Schirmer bleibt im Zweiten Weltkrieg 1944 verwundet in Griechenland zurück und sieht keine Möglichkeit mehr, nach Deutschland zurückzukehren. Er wird schließlich vom amerikanischen Anwalt George Carey und seiner Übersetzerin Maria Kolin, einer kühlen distanzierten Frau, unter abenteuerlichen und gefährlichen Umständen als rechtmäßiger Erbe ausfindig gemacht. Der Seargant hatte 1807 nach einer wohlüberlegten Entscheidung eine mutige Frau getroffen und konnte ein neues Leben beginnen. Auch der deutsche Wehrmachtssoldat von 1944 trifft in Maria Kolin eine solche Frau an - welche Entscheidungen verlangt ihm das Leben ab?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Eric Ambler
Schirmers Erbschaft
Roman
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl
Atlantik
Für Sylvia Payne
Prolog
Im Jahre 1806 schickte Napoleon sich an, den König von Preußen aufs Haupt zu schlagen. In der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt erlitten die preußischen Armeen eine vernichtende Niederlage. Was von ihnen übrig blieb, marschierte nach Osten und stieß zu einer russischen Armee unter Bennigsen. Auf diese vereinigte Streitmacht traf Napoleon im Februar des Folgejahrs bei dem Städtchen Preußisch-Eylau nahe Königsberg.
Eylau war eine der blutigsten und schrecklichsten Schlachten Napoleons. Sie begann bei Schneesturm und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Beide Heere waren halb verhungert und kämpften schon um das jämmerliche Obdach der Gebäude von Eylau mit verzweifeltem Ingrimm. Beide Seiten erlitten schwere Verluste: Es fielen fast ein Viertel der an der Schlacht Beteiligten. Als die Kämpfe am zweiten Tag bei Einbruch der Dunkelheit endeten, geschah es eher aus Erschöpfung, nicht weil eine Entscheidung herbeigeführt worden war. Dann, im Laufe der Nacht, begann sich die russische Armee Richtung Norden zurückzuziehen. Damit hatten die Überlebenden des preußischen Korps, dessen Flankensicherungsaktion gegen Neys Truppen fast den Sieg gebracht hätte, keinen Grund mehr zum Verweilen. Sie zogen durch das Dorf Kutschitten Richtung Osten ab. Ihre Nachhut abzusichern fiel den Dragonern von Ansbach zu.
Diese Einheit stand in einem widersprüchlichen, für die damalige Zeit in Mitteleuropa jedoch nicht ungewöhnlichen Verhältnis zur übrigen preußischen Armee. Wenige Jahre zuvor – die älteren Soldaten konnten sich noch gut daran erinnern – war das Regiment die einzige berittene Streitmacht des unabhängigen Fürstentums Ansbach gewesen und hatte seinen Fahneneid dem herrschenden Markgrafen geschworen. Dann waren schlimme Zeiten für Ansbach angebrochen, und der letzte Markgraf hatte sein Land und sein Volk an den König von Preußen verkauft. Ein neuer Fahneneid war zu leisten. Der neue Herr freilich erwies sich als ebenso wankelmütig wie der Alte. Im Jahr vor der Schlacht von Eylau hatte sich die Staatsangehörigkeit der Dragoner abermals geändert. Preußen hatte das Gebiet von Ansbach an Bayern abgetreten. Da Bayern mit Napoleon verbündet war, hätten die Ansbacher streng genommen gegen die Preußen und nicht an ihrer Seite kämpfen müssen. Die Dragoner allerdings standen dieser widersinnigen Situation ebenso gleichgültig gegenüber wie der Sache, für die sie kämpften. Der Begriff der Nationalität bedeutete ihnen wenig. Sie waren Berufssoldaten in dem Sinne, den das Wort im achtzehnten Jahrhundert hatte. Wenn sie zwei Tage und eine Nacht lang gekämpft und gelitten hatten, marschiert und gefallen waren, dann weder aus Liebe zu Preußen noch aus Hass auf Napoleon, sondern weil man sie entsprechend gedrillt hatte, weil sie auf Kriegsbeute hofften und weil sie die Folgen des Ungehorsams fürchteten.
So konnte Wachtmeister Franz Schirmer, während sein Pferd sich in jener Nacht einen Weg durch die Wälder am Rande von Kutschitten suchte, ohne größere Gewissensbisse über seine Situation nachdenken und Pläne machen, wie er sich daraus befreien könnte. Von den Ansbacher Dragonern waren nicht mehr viele übrig, und von denen, die es waren, würden nur wenige die kommenden Strapazen überleben. Die Verwundeten und diejenigen, die schwere Erfrierungen erlitten hatten, würden als Erste sterben; dann, wenn die Pferde verendet oder aufgegessen waren, würden Hunger und Krankheit nur die jüngsten und widerstandsfähigsten übrig lassen. Vierundzwanzig Stunden zuvor hätte der Wachtmeister mit Fug und Recht erwarten dürfen, zu den wenigen Überlebenden zu zählen. Nun nicht mehr. Am späten Nachmittag war er selbst verwundet worden.
Die Wunde hatte eine seltsame Wirkung auf ihn gehabt. Ein französischer Kürassier hatte den Wachtmeister mit einem Säbelhieb am rechten Arm getroffen. Die Klinge hatte die Deltamuskeln knapp über dem Ellbogen schräg bis auf den Knochen durchschnitten. Es war eine hässliche Wunde, doch der Knochen war nicht gebrochen, sodass sich Schirmer wenigstens nicht der Tortur der Feldscher aussetzen musste. Ein Kamerad hatte ihm die Wunde verbunden und den Arm mit einem Bandelier an den Körper geschnallt. Der Arm pochte schmerzhaft, doch die Blutung war offenbar zum Erliegen gekommen. Schirmer fühlte sich schwach, aber das schrieb er eher dem Hunger und der Kälte als schwerem Blutverlust zu. Seltsam fand er nur, dass mit all seiner körperlichen Qual ein Gefühl außerordentlichen Wohlbefindens einherging.
Es hatte sich eingestellt, während die Wunde verbunden wurde. Die Überraschung und das Entsetzen über das seinen unbrauchbaren Arm hinabströmende Blut hatten sich plötzlich gelegt, und an ihre Stelle war ein absurdes, großartiges Gefühl der Freiheit und Unbeschwertheit getreten.
Er war ein etwas schwerfälliger, praktisch veranlagter junger Mann, der sich keine Illusionen machte. Mit Wunden kannte er sich ein wenig aus. Die seine hatte noch geblutet, als sie verbunden worden war, und konnte daher als sauber gelten; seine Chancen, dem Tod durch Wundbrand zu entgehen, standen trotzdem nicht besser als fünfzig zu fünfzig. Auch mit dem Krieg kannte er sich aus, und er begriff deshalb nicht nur, dass die Schlacht wahrscheinlich verloren war, sondern auch, dass der Rückzug sie durch eine Gegend führen würde, die von durchziehenden Armeen bereits restlos ausgeplündert war. Doch diese Erkenntnis erfüllte ihn keineswegs mit Verzweiflung. Es war, als wäre ihm mit seiner Wunde eine besondere Vergebung seiner Sünden zuteil geworden; eine durchgreifendere und umfassendere Absolution, als sie ihm jeder sterbliche Priester hätte erteilen können. Er spürte, dass Gott selbst ihn angerührt hatte und dass jedweder drastische Schritt, den er ergreifen musste, um zu überleben, von Gott gebilligt würde.
Sein Pferd kam ins Straucheln, während es sich aus einer Schneewehe kämpfte, und der Wachtmeister fasste den Zügel kürzer. Die Hälfte der Offiziere war gefallen, und man hatte ihm den Befehl über eine der Außenabteilungen übertragen. Er hatte Order, sich weitab von der Straße auf der Flanke zu halten, und eine Zeit lang war das nicht schwer gewesen; nun aber hatten sie den Wald verlassen und kamen im tiefen Schnee nur mit Mühe voran. Ein, zwei Dragoner hinter ihm waren bereits abgesessen und führten ihre Pferde am Zügel. Er konnte sie am Schluss der Kolonne durch den Schnee stapfen hören. Falls er selbst gezwungen sein würde, sein Pferd zu führen, würde er womöglich nicht mehr die Kraft haben, wieder aufzusitzen.
Er dachte einen Moment darüber nach. Nach einer derart verbissen geführten zweitägigen Schlacht war es äußerst unwahrscheinlich, dass es noch französische Kavallerietrupps gab, die imstande waren, den Rückzug von der Flanke her zu stören. Die Flankensicherung war daher nichts weiter als eine Vorsichtsmaßnahme nach dem Reglement. Sie war es keinesfalls wert, dass man dafür Risiken einging. Er gab ein kurzes Kommando, und die Kolonne schwenkte wieder zur Straße hin in den Wald ein. Er hatte keine große Angst davor, dass sein Ungehorsam entdeckt wurde. Falls doch, würde er einfach behaupten, er habe die Orientierung verloren; man würde ihn nicht schwer dafür bestrafen, dass er sich der Aufgabe eines Offiziers nicht gewachsen zeigte. Er hatte jedenfalls Wichtigeres zu bedenken.
Etwas zu essen war am vordringlichsten.
Glücklicherweise enthielt die Provianttasche unter seinem langen Mantel noch den größten Teil der erfrorenen Kartoffeln, die er tags zuvor in einem Bauernhaus erbeutet hatte. Er musste sie sparsam – und heimlich – essen. Wer in Zeiten wie diesen Nahrungsmittel hortete, lebte gefährlich, ganz gleich, welchen Rang er besaß. Die Kartoffeln jedoch würden nicht lange vorhalten, und am Ende dieses Marsches warteten keine blubbernden Suppentöpfe. Selbst die Pferde waren besser dran. Von den Trosswagen war keiner verloren gegangen, und sie enthielten noch eine Tagesration Futter. Die Menschen würden zuerst hungern.
Er zwang ein aufsteigendes Panikgefühl nieder. Er würde bald etwas unternehmen müssen, und Panik würde ihm dabei nichts nützen. Schon spürte er, wie die Kälte an ihm zehrte. Es konnte nur noch wenige Stunden dauern, bis Fieber und Erschöpfung unwiderruflich ihren Tribut forderten. Er presste unwillkürlich die Knie gegen die Sattelklappen, und in diesem Augenblick kam ihm die Idee.
Das Pferd hatte unter dem Schenkeldruck leicht gescheut und war seitwärts gegangen. Wachtmeister Schirmer lockerte die Oberschenkelmuskeln, beugte sich vor und tätschelte dem Tier mit der linken Hand liebevoll den Hals. Er lächelte vor sich hin, während das Pferd sich wieder beruhigte. Als die Abteilung die Straße erreichte, war sein Plan gefasst.
Den Rest der Nacht und den größten Teil des folgenden Tages über zog das preußische Korps langsam ostwärts auf die Masurischen Seen zu; dann wandte es sich nordwärts Richtung Insterburg. Bald nach Einbruch der Nacht verließ Wachtmeister Schirmer unter dem Vorwand, einen Nachzügler holen zu müssen, die Abteilung und ritt südwärts über die gefrorenen Seen in Richtung Lotzen. Am Morgen befand er sich südlich der Stadt.
Außerdem war er beinahe am Ende seiner Kräfte. Schon der Marsch von Eylau bis zu der Stelle, wo er desertiert war, hatte ihm alles abverlangt; der Querfeldeinritt von dort wäre selbst für einen Unverwundeten eine Strapaze gewesen. Inzwischen waren die Schmerzen in seinem Arm zuweilen unerträglich, und das Fieber und die bittere Kälte schüttelten ihn so sehr, dass er sich kaum im Sattel halten konnte. Er begann sich sogar schon zu fragen, ob er Gottes Absichten nicht vielleicht doch falsch eingeschätzt hatte und ob das, was ihm wie ein Zeichen göttlicher Gnade erschienen war, sich am Ende als Ankündigung seines nahenden Todes erweisen würde. Jedenfalls war ihm klar, dass er sterben würde, wenn er nicht bald ein Obdach fände, wie es sein Plan erforderte.
Er verhielt sein Pferd und hob mit Mühe abermals den Kopf, um sich umzusehen. Weitab zu seiner Linken, jenseits der weißen Öde eines zugefrorenen Sees, konnte er den flachen schwarzen Umriss eines Bauernhauses ausmachen. Sein Blick ging weiter. Womöglich gab es ja ein näher gelegenes Gebäude zu erforschen. Aber da war nichts. Ohne Hoffnung lenkte er sein Pferd auf das Bauernhaus zu und setzte seinen Ritt fort.
Die Gegend, in der sich der Wachtmeister mittlerweile befand, war zu jener Zeit zwar Teil des Königreichs Preußen, wurde jedoch im wesentlichen von Polen bewohnt. Sonderlich wohlhabend war sie nie gewesen; nun, nach dem Durchzug der russischen Armee, die die Wintervorräte an Getreide und Futter requiriert und das Vieh weggetrieben hatte, war sie kaum mehr als eine Einöde. In manchen Dörfern hatten die Kosakenpferde noch das Stroh von den Dächern gefressen, und in anderen waren die Häuser ausgebrannt. Die Feldzüge des heiligen Russland konnten sich für seine Verbündeten verheerender auswirken als für seine Feinde.
Als erfahrener Soldat hatte der Wachtmeister durchaus mit Verwüstung gerechnet. Sein Plan fußte sogar darauf. Ein Gebiet, das gerade eine russische Armee versorgt hatte, würde eine Zeit lang keine andere anziehen. Ein Deserteur durfte sich hier einigermaßen sicher fühlen. Nicht gerechnet hatte Schirmer freilich damit, dass der Hunger die Bevölkerung vertrieben haben könnte. Seit dem Morgengrauen war er an mehreren Bauernhäusern vorbeigekommen, und sie waren allesamt verlassen gewesen. Mittlerweile war ihm klar geworden, dass die Russen (vielleicht weil sie es mit Polen zu tun hatten) noch schlimmer als sonst gehaust und dass die Bewohner – außerstande, genügend Nahrungsmittel zu verstecken, um bis zum Frühjahr zu überleben – sich in Gebiete weiter südlich geflüchtet hatten, die vielleicht verschont geblieben waren. Falls sämtliche Bauern in der Nähe sich den anderen angeschlossen hatten, war er verloren. Er hob abermals den Kopf, zwinkerte, um seine Wimpern von dem daran haftenden Eis zu befreien, und spähte voraus.
In diesem Moment sah er den Rauch.
Er stieg als dünner Faden vom Dach des Hauses empor, auf das Schirmer zuhielt, und er sah ihn nur einen Moment lang, ehe er wieder verschwand. Obwohl Schirmer ein ganzes Stück davon entfernt war, wusste er, dass er sich nicht getäuscht hatte. In dieser Gegend wurde Torf gestochen, und das war Rauch von einem Torffeuer. Seine Stimmung hob sich, während er sein Pferd vorwärtstrieb.
Er brauchte noch eine halbe Stunde, bis er das Gehöft erreichte. Im Näherkommen sah er, dass es ärmlich und heruntergekommen war. Es bestand aus einer niedrigen Holzkate – Wohnhaus und Stall in einem –, einer leeren Schafhürde und einem kaputten Wagen, der fast vollständig unter einer Schneewehe begraben war. Das war alles.
Die Pferdehufe verursachten im gefrorenen Schnee nur ein leises Knirschen. Ein Stück vom Haus entfernt löste Schirmer sorgfältig seinen Karabiner aus dem langen Sattelschuh. Nachdem er die Waffe schussfertig gemacht hatte, klemmte er sie quer über den Satteltaschen an den zusammengerollten Decken am Sattelknopf fest. Dann nahm er die Zügel wieder auf und ritt weiter.
Am einen Ende des Gebäudes befand sich ein kleines Fenster mit geschlossenen Läden und daneben eine Tür. Im Schnee davor waren Fußspuren zu erkennen, doch abgesehen von dem dünnen Torfrauchgekräusel über dem Dach gab es kein Zeichen von Leben. Schirmer hielt an und blickte sich um. Das Gatter der Schafhürde stand offen. Neben dem Karren erhob sich ein kleiner Schneebuckel, vermutlich die Überreste eines Heuhaufens. Es war kein Kuhdreck im frischen Schnee zu sehen, kein Gegacker von Federvieh zu hören. Bis auf das leise Seufzen des Windes herrschte tiefe Stille. Die Russen hatten alles mitgenommen.
Er ließ die Zügel durch die Finger gleiten, und das Pferd schüttelte den Kopf. Das Klirren des Gebisses kam ihm sehr laut vor. Er blickte rasch zur Tür des Hauses hin. Falls man das Geräusch dort gehört hatte, würde die erste Reaktion Angst sein; und Angst wäre nützlich, vorausgesetzt, sie führte dazu, dass man ihm umgehend die Tür öffnete und seinen Wünschen prompt entsprach. Falls sie allerdings dazu führte, dass man die Tür vor ihm verrammelte, kam er in Schwierigkeiten. Er würde die Tür aufbrechen müssen, und er konnte es erst riskieren abzusitzen, wenn er sicher war, dass sein Ritt hier endete.
Er wartete. Von drinnen war kein Laut zu hören. Die Tür blieb geschlossen. Seinem Dragonerinstinkt hätte es entsprochen, mit dem Gewehrkolben dagegenzuhämmern und den Bewohnern zuzubrüllen, sie sollten herauskommen, wenn ihnen ihr Leben lieb sei; aber er widerstand der Versuchung. Der Gewehrkolben würde vielleicht später noch Verwendung finden, doch zunächst wollte er es wie geplant mit Freundlichkeit probieren.
Er versuchte »Heda!« zu rufen, doch der Laut, der ihm aus der Kehle drang, war nichts weiter als ein Schluchzen. Verzweifelt versuchte er es erneut.
»Heda!«
Diesmal gelang es ihm, das Wort zu krächzen, doch zugleich überfiel ihn ein tödliches Gefühl der Hilflosigkeit. Er, der eben noch erwogen hatte, mit seinem Gewehr gegen eine Tür zu hämmern, ja sie einzuschlagen, hatte nicht einmal mehr genügend Kraft, um zu rufen. In seinen Ohren war ein Dröhnen, ihm wurde schwindlig. Er schloss die Augen und kämpfte das schreckliche Gefühl nieder. Als er sie wieder aufschlug, sah er die Tür langsam aufgehen.
Das Gesicht der Frau, die in der Tür stand und zu ihm aufblickte, war so vom Hunger verwüstet, dass es schwerfiel, ihr Alter zu schätzen. Wären die um ihren Kopf gewundenen Haarflechten nicht gewesen, hätten auch hinsichtlich ihres Geschlechts Zweifel bestanden. Die wallenden Bauernlumpen, die sie anhatte, waren völlig formlos und ihre Füße und Beine nach Männerart mit Sackleinen umwickelt. Sie starrte ihn dumpf an, sagte dann etwas auf Polnisch und machte Anstalten, wieder ins Haus zu gehen. Er beugte sich vor und sprach sie auf Deutsch an.
»Ich bin ein preußischer Soldat. Es hat eine große Schlacht gegeben. Die Russen sind geschlagen.«
Er sagte das, als verkündete er einen Sieg. Sie hielt inne und blickte erneut auf. Ihre tief in den Höhlen liegenden Augen waren völlig ausdruckslos. Er hatte die merkwürdige Vorstellung, dass das auch dann so bliebe, wenn er seinen Säbel zöge und sie niederhaute.
»Wer ist sonst noch da?«, fragte er.
Wieder bewegten sich ihre Lippen, und diesmal sprach sie deutsch. »Mein Vater. Er war zu schwach, um mit unseren Nachbarn fortzugehen. Was wollt Ihr hier?«
»Was fehlt ihm?«
»Er hat die Schwindsucht.«
»Ah!« Wenn es die Pest gewesen wäre, wäre er lieber im Schnee gestorben, als hierzubleiben.
»Was wollt Ihr?«, wiederholte sie.
Anstatt eine Antwort zu geben, löste er die Schließen seines Mantels und schlug ihn über seinem verwundeten Arm zurück.
»Ich brauche Obdach und Ruhe«, sagte er, »und jemanden, der mir mein Essen kocht, bis meine Wunde geheilt ist.«
Ihr Blick huschte von seinem blutbefleckten Rock zu dem Karabiner und den prallen Satteltaschen darunter. Er nahm an, dass sie überlegte, ob sie die Kraft hatte, das Gewehr an sich zu reißen und ihn zu töten. Er legte die Hand fest auf die Waffe, und ihre Blicke trafen sich wieder.
»Es gibt nichts zu essen«, sagte sie.
»Ich habe reichlich zu essen«, antwortete er. »Genug, um mit denen zu teilen, die mir helfen.«
Sie starrte ihn immer noch an. Er nickte beruhigend, dann schwang er, den Karabiner fest in der linken Hand, das rechte Bein über den Sattel und ließ sich vom Pferd gleiten. Als seine Füße den Boden berührten, gaben sie unter ihm nach, und er schlug der Länge nach in den Schnee. Von seinem Arm schoss ein brennender Schmerz in jede Faser seines Körpers. Er schrie auf und lag ein, zwei Momente lang schluchzend da. Endlich rappelte er sich, den Karabiner immer noch fest in der Hand, benommen auf.
Die Frau hatte keinerlei Anstalten gemacht, ihm zu helfen. Sie hatte sich nicht einmal gerührt. Er drängte sich an ihr vorbei durch die Tür ins Innere der Hütte.
Drinnen blickte er sich wachsam um. In dem von der Tür einfallenden Licht, das durch den Torfqualm sickerte, konnte er verschwommen ein grobes Holzbett ausmachen, auf dem etwas lag, das wie ein Haufen Sackleinen aussah. Von dort kam nun ein wimmernder Laut. In einem primitiven Lehmofen in der Mitte glomm trübe das Torffeuer. Der gestampfte Boden war weich von Asche und Torfstaub. Der stinkende Dunst machte Schirmer würgen. Er wankte um den Ofen herum und zwischen den Stützbalken des Daches hindurch in den Teil der Kate, in dem man die Tiere gehalten hatte. Das Stroh unter seinen Füßen war schmutzig, doch er schob es an der Rückseite des Ofens zu einem Haufen zusammen. Er wusste, dass die Frau ihm gefolgt und zu dem Kranken hinübergegangen war. Nun hörte er die beiden flüstern. Er machte sich aus dem Strohhaufen so etwas wie ein Lager und breitete, als er fertig war, seinen Mantel darüber. Das Geflüster war verstummt. Er nahm eine Bewegung hinter sich wahr und drehte sich um.
Die Frau stand ihm gegenüber. Sie hatte eine kleine Axt in den Händen.
»Das Essen«, sagte sie.
Er nickte und ging wieder vors Haus. Sie folgte ihm und sah zu, wie er sich, den Karabiner zwischen die Knie geklemmt, mühte, die Decken abzuschnallen. Es gelang ihm schließlich, und er warf die Rolle in den Schnee.
»Das Essen«, wiederholte sie.
Er hob den Karabiner, drückte sich den Kolben gegen die linke Hüfte und ließ die Hand zum Schloss hinabgleiten. Mit Mühe gelang es ihm, den Hahn zu spannen und den Zeigefinger an den Abzug zu legen. Dann setzte er dem Pferd knapp unterm Ohr die Mündung an den Kopf.
»Da ist unser Essen«, sagte er und drückte den Abzug.
Vom Knall des Schusses klangen ihm die Ohren, während das Pferd mit zuckenden Beinen zu Boden sank. Der Karabiner war Schirmer aus der Hand gerissen worden und lag rauchend im Schnee. Er hob die Decken auf und klemmte sie sich unter den Arm, ehe er die Waffe wieder an sich nahm. Die Frau beobachtete ihn immer noch. Er nickte ihr zu, wies auf das Pferd und ging zum Haus zurück.
Noch bevor er die Tür erreichte, lag sie neben dem sterbenden Tier auf den Knien und machte sich mit der Axt darüber her. Er blickte sich um. Da war der Sattel samt Inhalt, außerdem sein Säbel. Damit könnte sie ihn ohne weiteres umbringen, während er hilflos dalag. Die flache Ledertasche unter seinem Uniformrock enthielt, nach ihren Begriffen, ein Vermögen. Einen Moment lang betrachtete er die raschen, hektischen Bewegungen ihrer Arme und den dunklen Blutfleck, der sich im Schnee unter ihr ausbreitete. Sein Säbel? Sie würde keinen Säbel brauchen, wenn sie vorhatte, ihn umzubringen.
Dann spürte er den periodischen Schmerz in seinem Arm wiederkehren und hörte sich selbst stöhnen. Er wusste plötzlich, dass er nun nichts mehr tun konnte, um die Welt außerhalb seines Körpers zu ordnen. Er taumelte durch die Tür zu seinem Lager. Den Karabiner legte er unter dem Mantel auf den Boden. Dann nahm er seinen Helm ab, rollte seine Decken aus und legte sich in der warmen Dunkelheit nieder, um den Kampf um sein Leben aufzunehmen.
Die Frau hieß Maria Dutka und war achtzehn, als Wachtmeister Schirmer sie zum ersten Mal zu Gesicht bekam. Sie hatte schon als Kind ihre Mutter verloren, und da es keine weiteren Kinder gab und ihr Vater keine zweite Frau fand, hatte sie früh die Arbeit eines Sohnes und Hoferben verrichten müssen. Überdies war die chronische Krankheit, an der Dutka litt, nun schon von langer Dauer, und die Phasen der Besserung waren immer seltener geworden. Maria war es bereits gewohnt, selbstständig zu denken und zu handeln.
Sie war jedoch nicht eigensinnig. So kam es ihr zwar in den Sinn, den Wachtmeister umzubringen, um das tote Pferd nicht mit ihm teilen zu müssen, aber sie besprach die Sache zuerst mit ihrem Vater. Sie war von Natur aus zutiefst abergläubisch, und als er andeutete, dass beim glücklichen Auftauchen des Wachtmeisters womöglich eine übernatürliche Macht die Hand im Spiel gehabt hatte, begriff sie, wie gefährlich ihre Absicht war. Sie begriff außerdem, dass die übernatürlichen Mächte, selbst wenn der Wachtmeister an seiner Wunde stürbe – und er war dem Tod in den ersten Tagen sehr nahe –, womöglich annahmen, ihre, Marias, Mordgedanken hätten den Ausschlag gegeben.
Infolgedessen pflegte sie ihn mit so etwas wie banger Hingabe, die für den dankbaren Wachtmeister leicht misszuverstehen war. Später dann tat sie etwas, was ihn noch mehr für sie einnahm. Als er während seiner Genesung den Versuch machte, ihr dafür zu danken, dass sie ihren Teil der Vereinbarung so getreu eingehalten hatte, setzte sie ihm in aller Schlichtheit und Offenheit ihre Beweggründe auseinander. Damals belustigte und beeindruckte ihn das zugleich. Als er hinterher darüber nachdachte, was sie gesagt und dass sie es ihm überhaupt gesagt hatte, überkamen ihn noch erstaunlichere Empfindungen. Während das Essen, das sie miteinander teilten, ihr jugendliches Aussehen und ihre Vitalität wiederherstellte, folgte er immer häufiger den Bewegungen ihres Körpers und begann seine früheren Zukunftspläne auf angenehme Weise abzuändern.
Er blieb acht Monate lang im Hause Dutka. Unter dem Schnee konserviert, versorgte der Pferdekadaver sie alle mit Frischfleisch und, als Tauwetter einsetzte, mit den geräucherten und getrockneten Überresten. Bis dahin war der Wachtmeister auch imstande, mit seinem Karabiner in den Wald zu gehen und Wild mitzubringen. Gemüse begann zu wachsen. Dann erholte sich der alte Dutka ein paar bemerkenswerte Wochen lang so weit, dass er, mit dem Wachtmeister und Maria als Gespann, schließlich sogar sein Land pflügen konnte.
Dass der Wachtmeister blieb, galt mittlerweile als ausgemacht. Weder Maria noch ihr Vater erwähnte jemals seine militärische Vergangenheit. Er war, wie sie, ein Opfer des Krieges. Auch die zurückkehrenden Nachbarn fanden an seiner Anwesenheit nichts Seltsames. Sie hatten den Winter über selbst für Fremde gearbeitet. Wenn der alte Dutka einen kräftigen, arbeitsamen Preußen gefunden hatte, der ihm half, alles wieder in Ordnung zu bringen, umso besser. Und wenn Neugierige sich darüber verwunderten, wie der alte Dutka ihn bezahlte oder warum ein Preuße sich die Mühe machte, einen so jämmerlichen Flecken Land zu bearbeiten, gab es immer jemanden, der sie auf Marias breite Hüften und kräftige Beine hinwies und welche Ernte ein so kerniger junger Bursche zwischen ihnen halten konnte.
Es wurde Sommer. Die Schlacht von Friedland wurde geschlagen. Auf einem Floß, das im Niemen verankert war, trafen der französische und der russische Kaiser zusammen. Der Vertrag von Tilsit wurde unterzeichnet. Preußen verlor alle seine Gebiete westlich der Elbe und sämtliche polnische Besitzungen. Bialla, nur wenige Meilen südlich von Dutkas Gehöft, lag mit einem Mal an der russischen Grenze, und Lyck wurde Garnisonsstadt. Preußische Infanteriepatrouillen suchten Rekruten, und der Wachtmeister flüchtete mit den anderen jungen Männern in die Wälder. Während einer dieser Zeiten seiner Abwesenheit starb Marias Vater.
Nachdem die Beerdigungszeremonien vorüber waren, holte der Wachtmeister seine lederne Geldtasche hervor und setzte sich mit Maria zusammen, um seine Ersparnisse zu zählen. Die Erträge zahlreicher Beutezüge und Durchstechereien seiner vier Jahre als Unteroffizier waren eine mehr als ausreichende Ergänzung der bescheidenen Summe, die Maria aus dem Verkauf des väterlichen Besitzes an einen Nachbarn erzielen würde. Denn dass sie weiterhin das Land bearbeiteten, kam nun nicht mehr infrage. Sie hatten erlebt, was passieren konnte, wenn die russischen Armeen kamen, und angesichts der neuen Grenze waren die Russen nicht mehr als einen Tagesmarsch entfernt. Dies war in ihren Augen ein gewichtigeres Argument für die Aufgabe des Besitzes als die heikle Lage des Wachtmeisters als Deserteur. Für sie lag es nahe, in eine Gegend zu ziehen, wo es weder Russen noch Preußen gab und wo Maria, die schon schwanger war, ihre Kinder in der Gewissheit großziehen konnte, dass sie nicht hungern mussten.
Anfang November 1807 machten sie sich mit einem Handkarren, den sie aus Dutkas altem Wagen fabriziert hatten, zu Fuß Richtung Westen auf. Es war eine beschwerliche, gefahrvolle Reise, denn ihr Weg führte durch Preußen, und sie wagten nur bei Nacht zu marschieren. Hunger allerdings litten sie nicht. Sie führten ihr Essen auf dem Karren mit sich, und es hielt bis Wittenberg vor. Dies war auch die erste Stadt, die sie am helllichten Tag betraten. Sie hatten preußischen Boden endgültig hinter sich gelassen.
Sie blieben jedoch nicht in Wittenberg. Für den Wachtmeister war die Stadt der preußischen Grenze unangenehm nahe. Gegen Mitte Dezember erreichten sie Mühlhausen, das soeben dem Königreich Westfalen angegliedert worden war. Dort kam Marias erster Sohn Karl zur Welt; und dort heirateten Maria und der Wachtmeister. Eine Zeit lang arbeitete der Wachtmeister als Stallknecht; später jedoch, als er seine Ersparnisse aufgebessert hatte, etablierte er sich als Pferdehändler.
Sein Geschäft florierte. Die Wogen der napoleonischen Kriege erreichten den Hafen, den er und Maria gefunden hatten, nur mehr als sanftes Plätschern. Mehrere Jahre lang schien es, als seien die schlimmen Zeiten vorüber. Dann wurde Maria von der Krankheit befallen, unter der schon ihr Vater gelitten hatte. Sie starb zwei Jahre nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Hans.
Nach einer gewissen Zeit heiratete Wachtmeister Schirmer wieder und hatte mit seiner zweiten Frau zehn Kinder. Er starb im Jahre 1850 als angesehener und erfolgreicher Mann.
Nur ein einziges Mal in all den glücklichen Jahren in Mühlhausen suchten Franz Schirmer unerfreuliche Erinnerungen an seine Fahnenflucht heim. 1815 wurde Mühlhausen durch den Vertrag von Paris zur preußischen Stadt.
Es war das Jahr, in dem der Wachtmeister zum zweiten Mal heiratete; zwar hielt er es für unwahrscheinlich, dass man die Kirchenbücher nach den Namen von Deserteuren durchgehen würde, doch es bestand jederzeit die Möglichkeit, dass man sie zur Überprüfung von Mobilisierungslisten heranzog. Er konnte dieser Gefahr gegenüber einfach nicht gleichgültig bleiben. Nach so vielen Jahren der Straflosigkeit hatte er es sich abgewöhnt, für den Augenblick zu leben. Die Aussicht, vor einem Peloton zu sterben, ließ sich, so verschwindend gering sie auch war, nicht mit der früheren Seelenstärke ertragen.
Was also war zu tun? Er dachte eingehend über das Problem nach. Früher, machte er sich klar, hatte er auf Gott vertraut; und in Zeiten großer Gefahr war Gott stets gut zu ihm gewesen. Aber konnte er denn auch weiterhin schlicht auf Gott vertrauen? Und war dies, so fragte er sich kritisch, wirklich eine Zeit großer Gefahr? In den preußischen Armeelisten standen schließlich unzählige Schirmers, und einige davon hießen sicherlich auch Franz. War es wirklich nötig, sich an Gott zu wenden, um sich gegen die Möglichkeit zu versichern, dass die Liste der Mühlhausener Bürger, die sich vom Kriegsdienst freigekauft hatten, mit der Liste der Deserteure in Potsdam verglichen wurde? Und war es überhaupt klug? Könnte es nicht sein, dass Gott, der schon so viel für Seinen Diener getan hatte, verstimmt darüber wäre, mit einer solchen Lappalie behelligt zu werden, und deshalb gar nicht reagieren würde? Gab es denn nichts, was Sein Diener selbst in dieser Angelegenheit unternehmen konnte, ohne die Hilfe des Allmächtigen zu erflehen?
Aber gewiss!
Er beschloss, seinen Namen in Schneider zu ändern.
Dabei stieß er nur auf eine einzige, geringfügige Schwierigkeit. Seinen Nachnamen und den des Kindes Hans zu ändern war einfach. Er hatte gute Freunde im Rathaus, und dass es in einer nahe gelegenen Stadt einen anderen Pferdehändler gleichen Namens gab, wurde als Vorwand ohne weiteres akzeptiert. Doch sein Erstgeborener Karl stellte ein Problem dar. Der inzwischen siebenjährige Knabe war von den preußischen Militärbehörden soeben zwecks künftiger Rekrutierung erfasst worden, und in preußischen Militärkreisen hatte der Wachtmeister keine Freunde und suchte sie auch nicht. Außerdem könnte ein amtlicher Antrag, den Namen des Knaben zu ändern, ja gerade die Nachforschungen hinsichtlich seiner Herkunft auslösen, die er so sehr fürchtete. Am Ende ließ er, was Karls Namen anging, alles beim alten. So kam es, dass die Söhne von Franz und Maria zwar unter dem Namen Schirmer getauft wurden, jedoch mit verschiedenen Nachnamen aufwuchsen. Karl blieb Karl Schirmer; Hans wurde Hans Schneider.
Der Namenswechsel bereitete dem Wachtmeister niemals auch nur die geringste Sorge oder Unannehmlichkeit. Was sich an Sorgen und Unannehmlichkeiten daraus ergab, hatte über hundert Jahre später Mr. George L. Carey auszubaden.
1
George Carey kam aus einer Familie in Delaware, die aussah, als wäre sie einer Werbung für eine teure Automarke entsprungen. Sein Vater war ein wohlhabender Arzt mit schlohweißem Haar. Seine Mutter entstammte einer alten Familie in Philadelphia und war ein wichtiges Mitglied des Gartenclubs. Seine Brüder waren hoch gewachsen, kernig und gut aussehend. Seine Schwestern waren schlank, kräftig und lebhaft. Alle hatten schöne, regelmäßige Zähne, die man sah, wenn sie lächelten. Die ganze Familie wirkte derart glücklich, sorglos und erfolgreich, dass einem unwillkürlich der Verdacht kam, die Wahrheit über sie sähe womöglich ganz anders aus. Aber nein, sie waren tatsächlich glücklich, sorglos und erfolgreich. Sie waren außerdem ungemein selbstgefällig.
George war der jüngste Sohn, und obwohl seine Schultern nicht so breit waren wie die seiner Brüder und sein Lächeln nicht so selbstzufrieden, war er der Begabteste und Intelligenteste in der Familie. Seine Brüder hatten, als der Ruhm ihrer Zeit als Footballspieler verblasst war, ohne rechtes Ziel den Weg ins Geschäftsleben genommen. George hatte von dem Moment an, als er von der High-School abging, klare Zukunftspläne. Ungeachtet der Hoffnungen seines Vaters auf einen Nachfolger für die Arztpraxis hatte George es abgelehnt, ein Interesse für Medizin vorzugeben, das er nicht empfand. Er wollte sich auf die Jurisprudenz legen; und zwar nicht auf den Zweig, der sich mit Verbrechen befasst und im Gerichtssaal abspielt, sondern den, der schon im mittleren Alter in den Vorstand von Eisenbahngesellschaften und Stahlfirmen oder in hohe politische Ämter führt. Der Krieg, der kurz nach seinem Examen in Princeton ausbrach, nahm ihm viel von seinem Ernst und seiner Selbstgefälligkeit und wirkte sich günstig auf seinen Sinn für Humor aus, vermochte ihn jedoch nicht von seinem gewählten Berufsweg abzubringen. Nach viereinhalb Jahren als Bomberpilot studierte er Jura in Harvard. Anfang 1949 legte er cum laude sein Examen ab. Dann, nach einem nutzbringenden Jahr als Sekretär eines gelehrten und berühmten Richters, trat er bei Lavater ein.
Die Anwaltskanzlei Lavater, Powell und Sistrom in Philadelphia zählt zu den wirklich bedeutenden Kanzleien im Osten der Vereinigten Staaten, und die lange Liste ihrer Teilhaber liest sich wie eine Auswahl vielversprechender Kandidaten für einen frei werdenden Sitz im Supreme Court. Bis zu einem gewissen Grad rührt ihr gediegener Ruf sicherlich noch von der Erinnerung an den gewaltigen Handel mit Versorgungsanleihen her, mit dem sie in den Zwanzigern befasst war; andererseits hat es in den letzten dreißig Jahren kaum einen wirtschaftsrechtlichen Fall von einiger Größenordnung gegeben, in dem die Kanzlei nicht ein wichtiges Mandat innegehabt hätte. Sie ist nach wie vor ein tatkräftiges, vorausschauendes Unternehmen, und eine Stelle von ihr angeboten zu bekommen stellt für einen jungen Anwalt ein höchst schmeichelhaftes Zeichen der Anerkennung dar.
George hatte somit allen Grund, mit dem Fortgang seiner Karriere zufrieden zu sein, während er sich mit seinen Habseligkeiten in einem der komfortabel ausgestatteten Büros der Kanzlei einrichtete. Gewiss, für die etwas untergeordnete Position, die er einnahm, war er schon ein bisschen alt, aber er war schlau genug, um sich klarzumachen, dass seine vier Jahre bei der Luftwaffe aus beruflicher Sicht keine völlig verlorene Zeit und dass seine Kriegsauszeichnungen für sein Hiersein ebenso ausschlaggebend gewesen waren wie seine Leistungen auf der Universität und die warmen Empfehlungen des gelehrten Richters. Wenn daher alles gut ging (und warum sollte es das nicht?), konnte er mit einem raschen Aufstieg, wertvollen Kontakten und wachsendem persönlichem Ansehen rechnen. Er hatte das Gefühl, es geschafft zu haben.
Die Nachricht, dass er sich mit dem Fall Schneider-Johnson beschäftigen sollte, war daher ein unangenehmer Schlag. Sie war auch in anderer Hinsicht überraschend. Die Fälle, mit denen Lavater normalerweise zu tun hatte, waren von der Art, die ebenso gewiss Ansehen wie Geld einbrachte. Nach allem, was George noch von dem Fall Schneider-Johnson wusste, handelte es sich dabei um eine jener grotesken Affären, die sich jeder Wirtschaftsanwalt, der auf seinen Ruf bedacht ist, auf Armeslänge vom Leibe hält.
Es handelte sich um eine der notorischen Absurditäten der Vorkriegsjahre, bei denen es um den fehlenden Erben eines Vermögens ging.
1938 war Amelia Schneider-Johnson, eine senile alte Dame von einundachtzig Jahren, in Lamport, Pennsylvania, gestorben. Sie hatte allein in dem heruntergekommenen Holzhaus gelebt, das ihr der verblichene Mr. Johnson zur Hochzeit geschenkt hatte, und ihre letzten Jahre in einer Atmosphäre vornehmer Armut zugebracht. Nach ihrem Tode jedoch hatte man festgestellt, dass zu ihrem Nachlass drei Millionen Dollar in festverzinslichen Wertpapieren gehörten, die sie in den zwanziger Jahren von ihrem Bruder Martin Schneider, einem Soft-Drink-Magnaten, geerbt hatte. Aufgrund eines übersteigerten Misstrauens gegen Banken und Schließfächer hatte sie die Wertpapiere in einer Blechschatulle unter ihrem Bett aufbewahrt. Sie hatte auch Anwälten misstraut und daher kein Testament gemacht. Die seinerzeit in Pennsylvania geltende Erbfolge war durch ein Gesetz von 1917 geregelt worden, welches besagte, dass noch der entfernteste Blutsverwandte des Erblassers unter Umständen Anspruch auf einen Teil des Nachlasses hatte. Amelia Schneider-Johnsons einzige bekannte Verwandte war Miss Clothilde Johnson, eine ältere Jungfer, gewesen. Aber sie war lediglich mit Amelia verschwägert und kam daher als Erbin nicht in Betracht. Unter begeisterter und sich verheerend auswirkender Mithilfe der Presse hatte eine Suche nach Amelias Blutsverwandten begonnen.
Der Eifer der Presse war in Georges Augen nur allzu verständlich. Sie hatte einen zweiten Fall Garrett gewittert. Die alte Mrs. Garrett war 1930 gestorben und hatte siebzehn Millionen Dollar hinterlassen, ohne ein Testament zu machen – nun, acht Jahre später, war die Sache immer noch munter im Gange und hielt bei mittlerweile sechsundzwanzigtausend Anwärtern auf das Geld dreitausend Anwälte in Lohn und Brot, und über allem schwebte ein leichter Hautgout von Korruption. Der Fall Schneider-Johnson konnte sich ebenso lang hinziehen. Er hatte zwar nicht die gleiche Größenordnung, doch Größe war nicht alles. Er war dafür reich an menschlichen Aspekten – das auf dem Spiel stehende Vermögen, die romantische Zurückgezogenheit der alten Dame in ihren letzten Jahren (ihr einziger Sohn war in den Argonnen gefallen), ihr einsamer Tod ohne einen Verwandten am Sterbebett, die ergebnislose Suche nach dem Testament –, es gab keinen Grund, warum der Fall nicht ebenso zählebig sein sollte. Der Name Schneider und seine amerikanischen Varianten waren weit verbreitet. Die alte Dame musste irgendwo Blutsverwandte gehabt haben, selbst wenn sie diese – oder ihn! Oder sie! – nicht gekannt hatte. Ja, es konnte durchaus sein, dass es nur einen einzigen Erben gab, der nicht zu teilen brauchte! Schön und gut, aber wo steckte er? Oder sie? Auf einer Farm in Wisconsin? In einem Immobilienbüro in Kalifornien? Hinter dem Ladentisch eines Drugstores in Texas? Wer von den Tausenden von Schneiders, Snyders und Sniders in Amerika würde der Glückliche sein? Wer war der ahnungslose Millionär? Kitsch? Nun ja, vielleicht, aber immer gut für eine Story und von landesweitem Interesse.
Und landesweit war das Interesse tatsächlich gewesen. Bis Anfang 1939 war der Nachlassverwalter von über achttausend Anwärtern auf das Erbe in Kenntnis gesetzt worden, ein Heer von Winkeladvokaten hatte sich eingeschaltet, um sie auszubeuten, und die ganze Sache war zügig in ein Wolkenkuckucksheim von Phantasterei, Schwindel und juristischer Farce entschwebt, wo sie verblieb, bis sie bei Ausbruch des Krieges plötzlich in Vergessenheit geriet.
Was Lavater für ein Interesse daran haben konnte, einen derart unappetitlichen Leichnam wiederauferstehen zu lassen, konnte George sich beim besten Willen nicht vorstellen.
Mr. Budd, einer der Seniorpartner, klärte ihn darüber auf.
Die Hauptlast des Nachlasses Schneider-Johnson war von Moreton, Greener und Cleek getragen worden, einer altmodischen, hochangesehenen Anwaltskanzlei in Philadelphia. Als Anwälte von Miss Clothilde Johnson hatten sie auf deren Anordnung hin die offizielle Suche nach einem Testament durchgeführt. Nachdem das Fehlen eines solchen von Amts wegen festgestellt worden war, kam die Angelegenheit vor das Waisengericht in Philadelphia, und das Testamentsregister hatte Robert L. Moreton als Nachlassverwalter eingesetzt. Das war er bis Ende 1944 geblieben.
»Und nicht zu seinem Nachteil«, sagte Mr. Budd. »Wenn er nur so viel Verstand gehabt hätte, es dabei zu belassen, hätte ich ihm keinen Vorwurf gemacht. Aber nein, der alte Zausel hat seine eigene Kanzlei zum Rechtsvertreter des Nachlassverwalters bestellt. Heiliger Strohsack! In einem solchen Fall war das der reinste Selbstmord!«
Mr. Budd war ein hühnerbrüstiger Mann mit länglichem Schädel, einem ordentlich gestutzten Schnurrbart und einer Bifokalbrille. Er war immer schnell mit einem Lächeln bei der Hand, hatte die Angewohnheit, veraltete Redewendungen zu gebrauchen, und trug eine Miene sorgloser Gutgelauntheit zur Schau, der George zutiefst misstraute.
»Das Gesamthonorar«, sagte George vorsichtig, »muss bei einem Nachlass dieser Größenordnung ziemlich hoch gewesen sein.«
»Kein Honorar«, erklärte Mr. Budd, »ist so groß, dass es sich für eine anständige Kanzlei lohnte, sich mit einer Bande von Unfallgeiern und Schurken gemein zu machen. Auf der ganzen Welt gibt es Dutzende unabgeschlossener Erbschaftsfälle. Sehen Sie sich nur den Nachlass Abdul Hamid an! Den haben die Briten am Bein, und das nun schon seit über dreißig Jahren. Er wird vermutlich nie geregelt. Oder sehen Sie sich den Fall Garrett an! Überlegen Sie nur, wie viele Menschen er ihren guten Ruf gekostet hat. Alles Quatsch! Es ist doch immer das Gleiche. Ist A ein Hochstapler? Ist B geistesgestört? Wer ist vor wem gestorben? Ist das auf dem alten Foto Tante Sarah oder Tante Flossie? War hier ein Fälscher mit blässlicher Tinte am Werk?« Er wedelte wegwerfend mit den Armen. »Ich sage Ihnen, George, der Fall Schneider-Johnson hat Moreton, Greener und Cleek als ernst zu nehmende Anwaltskanzlei so gut wie erledigt. Und als Moreton vierundvierzig krank wurde und in den Ruhestand treten musste, war das das Ende. Sie haben sich aufgelöst.«
»Hätte denn nicht Greener oder Cleek die Nachlassverwaltung übernehmen können?«
Mr. Budd heuchelte Entsetzen. »Mein lieber George, ein solches Amt übernimmt man doch nicht einfach. Es ist eine Belohnung für gute und treue Dienste. In diesem Fall war unser gelehrter, hochgeachteter und verehrter John J. Sistrom der Glückliche.«
»Aha. Ich verstehe.«