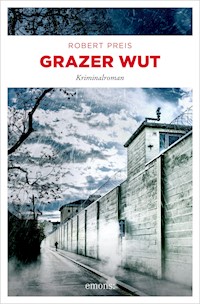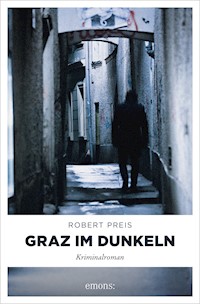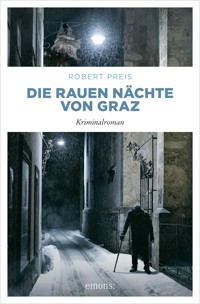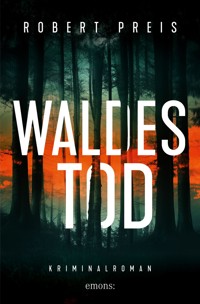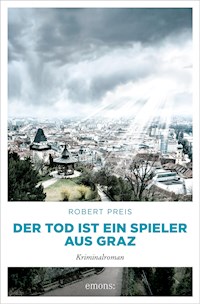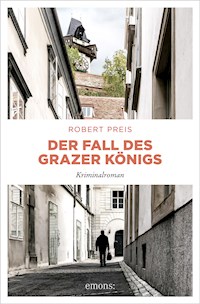
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Armin Trost
- Sprache: Deutsch
Ritualmord in der Steiermark Ein ehemaliger Richter kommt auf der A9 ums Leben, getötet durch einen zweitausend Jahre alten Pfeil in seiner Brust. Armin Trost vermutet einen Zusammenhang mit den umstrittenen Ausbauplänen der Autobahn, gegen die sich massiver Protest formiert. Als er auf Parallelen zu einer geheimnisvollen Keltenlegende stößt, aus deren Zeit die Tatwaffe zu stammen scheint, nimmt der Fall eine spektakuläre Wendung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Preis wurde 1972 in Graz geboren. Nach dem Publizistik- und Ethnologiestudium in Wien lebt er heute mit seiner Familie wieder in der Nähe seiner Heimatstadt. Er ist Journalist, Autor zahlreicher Romane und Sachbücher sowie Initiator des FINE CRIMEKrimifestival™ in Graz.www.robertpreis.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang befindet sich ein Glossar.
©2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv und Karte: Niki Schreinlechner, www.nikischreinlechner.at
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Susanne Bartel
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-736-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
Für
die Schmidis.
»Brauch ma net reden
Prolog
113 v.Chr., Noreia
Wolken zogen auf. Das Blättermeer des Waldes rauschte im Wind, der dem Gewitter vorauseilte. Doch noch achtete niemand darauf. Nichts als das tobende Geschrei Tausender und Abertausender war zu hören. Großer Helden, die im Dreck lagen und elend verreckten.
Selten wurde ein Gewitter so sehr herbeigesehnt wie an diesem Nachmittag. Allein es kam zu spät. Bis zuletzt hielt es der römische Konsul Gaius Papirius Carbo für undenkbar, dass dieser Tag sein letzter als großer Heerführer sein sollte. Seine Soldaten waren Richtung Norden gelaufen, um den Germanen in den Rücken zu fallen und sie über die Berge und hinaus aus Noricum zu drängen.
Doch es kam anders. Carbo machte mit dem berüchtigten »Furor teutonicus« Bekanntschaft, der teutonischen Raserei, und sah sich plötzlich mit einer ihnen zahlenmäßig zehnfach überlegenen Horde aus brüllenden Ungetümen konfrontiert. In der schwülen Nachmittagshitze durchbrachen die Riesen mit den zotteligen Bärten bald die starre römische Schlachtformation und hatten kein Mitleid. Mit ihren Keulen und Äxten schlugen sie um sich wie von allen Göttern verlassen, und selbst die Schwerverwundeten unter ihnen hieben noch auf ihre Gegner ein, bis sie ihnen schließlich die Gliedmaßen halb vom Leib gehackt hatten. Es war schlimmer als alle Geschichten, die Carbo über diese Völker gehört hatte. Die Geschichten, die von Grauen und unaussprechlichen Gewaltorgien erzählten.
Die Stämme der Kimbern und Ambronen waren aus Nordjütland vor einer Sturmflut geflohen. Ihrem Zug hatte sich der Stamm der Teutonen angeschlossen, und gemeinsam begannen sie, sich durch die mährische Pforte zu rauben. So zogen die Germanen wie eine Plage bis in den Alpenraum, ins Regnum Noricum, ein Königreich von dreizehn keltischen Stämmen, das sich großteils im heutigen Kärnten und in der Steiermark befand. Die dort lebenden Älpler waren zwar ein hartgesottener Menschenschlag, gegen die kriegserprobten und zahlenmäßig weit überlegenen Fremden aber machtlos.
Dass nun ausgerechnet dieses friedliche Noricum in Gefahr war, war den Römern Grund genug, eine gewaltige Armee nach Norden zu entsenden. Hunderte Reiter und Tausende schwer bewaffneter Fußsoldaten, die unter dem Kommando des Konsuls Carbo marschierten, sollten sich gegen die germanische Übermacht stemmen.
Vor der vernichtenden Schlacht hatte Carbo mit den in Felle gehüllten nordländischen Fürsten Boiorix und Teutobod so lange verhandelt, bis diese tatsächlich versprochen hatten, weiterzuziehen. Aber die Römer hatten eine List geplant. Für die Rückkehr zu ihrem Lager in der befestigten Keltenstadt Noreia wurden den Germanen ortskundige Älpler zur Seite gestellt, Taurisker, die sie auf Umwege leiten sollten. Die Römer hingegen nahmen den direkten Weg. Carbo wollte die wilde Horde aus dem Norden ihrer Lebensgrundlage berauben, ihre Frauen und Kinder, die Alten und Schwachen ermorden und Noreia einnehmen. Zurück sollten nur mehr seelenlose Wilde bleiben, deren Lebenswille bald erlöschen würde.
Doch Noreia fiel nicht.
Stattdessen fanden sich die Römer ihrerseits in einer Falle wieder, da sie alle Warnungen in den Wind geschlagen hatten. Niemals könnten die Germanen mit mehr als dreihunderttausend Menschen– Kindern, Frauen, Alten und Kriegern– quer durch Europa ziehen, hatten sie gedacht. Und niemals könnte das römische Heer besiegt werden. Davon waren sie überzeugt gewesen.
Die Probleme begannen schon mit der verzweifelten Flucht der Plänkler, deren Aufgabe es üblicherweise war, die Schlachtordnung des Gegners mit kleinen Nadelstichen durcheinanderzubringen. Als Vorhut bewarfen sie die Feinde in der Regel mit Steinen und Speeren, stachelten sie auf, sodass sie unüberlegt angriffen. Was die Plänkler meist überlebten, weil sie keine schwere Ausrüstung mit sich führten und geübt im Laufen waren.
Doch dieser Schritt der römischen Kriegsführung erwies sich als unnötig. Niemand musste die Germanen provozieren, sie stürmten von sich aus drauflos. Und sie waren schnell: Sie überrannten ihre Gegner einfach. Die ersten Reihen der römischen Fußsoldaten waren binnen weniger Minuten in einen verzweifelten Überlebenskampf verwickelt, und selbst die Taurisker an den Flanken mussten viel zu schnell ins Geschehen eingreifen; letztlich war auch die römische Kavallerie völlig überfordert. In einer normal verlaufenden Schlacht wäre sie erst auf dem Schlachtfeld aufgetaucht, wenn es dort schon von Leichen wimmelte und der vom Gemetzel zum tiefen Morast gewordene Boden es den Fußsoldaten nahezu unmöglich machte zu kämpfen. Doch während der Schlacht bei Noreia stürmten die Germanen von allen Seiten auf die Römer zu und verwickelten sie an mehreren Linien gleichzeitig in gnadenlose Zweikämpfe. Das Toben war ohrenbetäubend, das Stechen und Schlagen endete in einem unsagbaren Blutbad. Versprengte römische Soldaten wurden bis tief in die Wälder verfolgt, ihre Todesschreie hallten über die Berge.
Die germanischen Krieger waren so zahlreich wie die Bäume des Waldes. Sie schwangen ihre Waffen und verschonten keinen Gegner.
Und dann setzte endlich das Gewitter ein. Bereits die ersten dumpfen Donnerschläge geboten den Germanen Einhalt. Ein letztes Mal bohrten sich ihre Waffen in schon am Boden liegende und um ihr Leben flehende Gegner. Weit aufgerissene Augen starrten in den sich verfinsternden Himmel, aufgerissene Münder stießen den letzten Todesschrei aus. Vor lauter Matsch und Blut war kaum zu erkennen, welche Leichen welcher Seite angehörten. Verwundete Kämpfer krochen über zerhackte Körperteile, zerbrochene Helme und im Morast liegende Waffen, untermalt von fürchterlichen Schreien. Die Söhne brüllten ihre Sehnsucht nach der Mutter hinaus. Die Väter weinten im Sterben, während sie ihre Kinder vor sich tanzen sahen. Und die Ehemänner hoben im Todeskampf ihre zitternden Hände, um noch einmal über die Gesichter ihrer Frauen zu streichen.
Kein Wunder, dass die Blitze über den schmutzig grauen Himmel zuckten. Dass die Götter zornig waren. Was die Kämpfer einander antaten, war abscheulich. Und so zogen sich die germanischen Wilden zurück. Ließen von ihren Gegnern ab und suchten Schutz vor ihren wütenden Göttern.
Dass das Abschlachten ringsum trotzdem noch lange kein Ende nahm, davon berichten römische Überlieferungen. Demnach dauerte es noch drei Tage, bis die versprengten Reste des römischen Heers wieder zueinanderfanden. Der römische Historiker Appian schrieb zweihundert Jahre später, dass damals mehr als zwanzigtausend Römer ihr Leben auf dem Schlachtfeld gelassen hätten, nicht mehr als sechstausend Mann sollten überlebt haben. Es mag sein, dass er, was die Zahlen betrifft, wie damals üblich etwas übertrieb, aber es war das erste Mal, dass die Stämme der Germanen schriftlich in den römischen Annalen Eingang fanden. Ihre rohe Gewalt brannte sich somit ins kollektive Bewusstsein der Römer, die nie wieder aufhören sollten, die Stämme des Nordens zu fürchten.
Nach dieser siegreichen ersten Schlacht hielten sich die Germanen an ihr Versprechen und zogen nördlich der Alpen weiter bis nach Gallien, ein Gebiet im heutigen Frankreich. Konsul Carbo erwartete wegen der Niederlage in Rom ein Prozess. Wie er ausging, ist unklar
Heute
Donnerstag
1Alexia Morgentaus Kopf verschwand und tauchte plötzlich an einer anderen Stelle der staubigen Grube wieder auf. Ein warmer Wind wischte über die Lichtung und trocknete den Schweiß auf ihrer Stirn. Sie kroch auf allen vieren und pinselte den Staub von der Oberfläche eines Steins mit einer Hingabe, als erwartete sie darunter etwas Kostbares, etwas lange Gesuchtes.
Unter dem Stein blitzte ein Gegenstand hervor. Ein scharfkantiger Gegenstand, den sie freilegte, fotografierte und schließlich vermaß. Die Daten trug sie in ein Handbuch ein, das sie dafür aus ihrer Hosentasche gezogen hatte. Ihre Schrift war winzig, aber deutlich, die Linien klar mit akribisch exakten Abständen dazwischen. Alexia Morgentau führte den Bleistift mit der linken Hand. Kurze Finger mit kurz geschnittenen Nägeln. Beim Schreiben tauchte die Spitze ihrer Zunge zwischen ihren Lippen auf, die ein Lächeln andeuteten. Ihr Haar wirkte wegen des Staubs heller, in wirren braunen Locken stand es vom Kopf ab und verlieh ihr den Anschein einer Wissenschaftlerin, die über ihre Arbeit ihr Äußeres völlig vergisst. Was in gewisser Weise auch stimmte.
Morgentau hatte in den neunziger Jahren das Doktoratsstudium der Archäologie an der Universität Graz absolviert und ihre akademische Laufbahn mit zusätzlichen Magistertiteln in den Fachbereichen Philosophie und Kunstgeschichte garniert. Inzwischen leitete sie ein Team, das aus Experten des Archäologiemuseums und der Universität Graz bestand. Ihr Forschungsprojekt, das sich schon seit einigen Jahren hinzog, lieferte neue Erkenntnisse zur Keltenzeit rund um Neuberg an der Mürz. Selbst an den Wochenenden war sie hier draußen und genoss die Ruhe der Einöde.
Morgentau pinselte die nächste Scherbe ab, und hätte sie sich selbst dabei beobachten können, wäre ihr vielleicht viel früher aufgefallen, dass sie auf ein besonderes Fundstück gestoßen war. Ihre Stirn warf bereits Falten, ihre Augen fixierten leuchtend das Etwas vor ihr, die Finger zitterten leicht. Doch während ihrem Körper die Besonderheit des Moments längst bewusst war und er darauf reagierte, war sie in Gedanken noch weit weg. In einer anderen Welt. Sie dachte daran, wie es wäre, durch die Zeit reisen zu können. Ein Wunsch, der unter Archäologen weitverbreitet war, kämpften Menschen dieses Berufs doch jeden Tag mit der Schwierigkeit, aus den kläglichen Überresten der Geschichte Rückschlüsse auf ebenjene zu ziehen. Wie hatte man vor Christi Geburt gelebt? Hatte die Luft wie heute gerochen? Wie hatte die Welt ausgesehen, damals, als die Menschen diesen Landstrich schon besiedelt hatten? Es gab Handelsrouten, die heimischen Kelten stellten Münzen nach dem Vorbild der Vorgehensweise auf den griechischen Inseln her, bauten ihre Behausungen meist aus Holz, und ihre Friedhöfe waren weithin sichtbar.
Ja, all das ließ sich theoretisch rekonstruieren– aus Wandmalereien, Scherben und den wenigen historischen Quellen. Und dennoch brauchte man eine gehörige Portion Phantasie, um sich das Leben damals einigermaßen vorstellen zu können.
Der Kopf der Archäologin hielt in seiner Bewegung inne. Als er sich wieder regte, wurde nach und nach auch immer mehr von dem dazugehörigen Körper sichtbar. Morgentau stieg in verstaubten Jeans und einer schmutzigen Jacke aus der Grube und lief zu einem Zelt am Rand der Grabungsstelle. Dessen Seitenwände waren hochgebunden und gaben den Blick auf einen weißen Opel Astra Kombi frei, dessen Heckklappe geöffnet war. Im Kofferraum lag die Matratze, auf der die Archäologin in der kommenden Nacht schlafen würde, auf dem Beifahrersitz eine kleine Tasche mit allem für die Morgentoilette sowie Wechselkleidung.
Der Wind wirbelte verspielt eine Staubfontäne durch das Zeltinnere, während Alexia Morgentau ihr jüngstes Fundstück auf den kleinen Tisch legte und eine Mineralwasserflasche aus der Kiste zog, die sich darunter befand. Sie nahm einen großen Schluck und wischte sich einen Tropfen von der Oberlippe, dann betrachtete sie das, was sie gefunden hatte, noch einmal. Später würde sie Fotos von dem Artefakt machen, es einer exakten Prüfung unterziehen, es dokumentieren und dabei immer wieder ehrfürchtig anstarren. Doch zuvor griff sie zum Handy, schaltete es ein, drückte eine Taste und wartete.
»Hi, Bernd«, sagte sie, als jemand abhob. »Ich hab wieder eins gefunden.« Sie lachte. »Ja, sieht so aus, als hätten wir ziemliches Glück. Vielleicht schreiben wir ja endlich Geschichte, wenn uns nicht wieder der Geldhahn abgedreht wird.« Sie blickte sich um, winkte Wanderern zu, die mit einem kläffenden Hund in Sichtweite vorübergingen. »Und solange hier keiner auf die Idee kommt, auf eigene Faust weiterzugraben, wenn wir nicht da sind…«
Sie drehte die eiserne Pfeilspitze, die sie soeben der Erde entrissen hatte, in ihrer Hand. Ihrer ersten Schätzung zufolge war sie in einem Jahrhundert hergestellt worden, in dem auch die Venus von Milo entstanden war, rund hundert Jahre nachdem Hannibal über die Alpen auf Rom zumarschiert war. Vor rund zweitausendzweihundert Jahren. Als Tausende Römer auf einem Schlachtfeld ihr Leben gelassen hatten. Genau hier.
2Schwarze, rußige Trümmer lagen neben dem Baumstumpf, der im Garten emporragte wie ein mahnender Finger. Asche wurde über die Wiese geweht, im Restehaufen der Holzlatten waren Nägel und Schrauben auszumachen.
Unweit des niedergebrannten Baumhauses drängte sich der dichte, urige Wald an den Gartenzaun, dessen Baumriesen wild und ungezähmt schienen. Am Himmel über den Wipfeln mischten bedrohliche Wolkenformationen ein schmutziges Grau, durch das die Sonne nadeldünne Strahlen sendete. Windböen wehten übers Feld und wirbelten wie ein Sturmauge die trockene Erde um Armin Trost herum auf.
Trost hockte minutenlang mit bebenden Schultern inmitten all der Zerstörung. Als er sich erhob, ging er auf das Haus zu, dessen Fenster ihn so trüb wie ein Tier im Dämmerschlaf anstarrten. Die Fensterbalken ächzten im Wind, und aus der Regenrinne war das Tapsen von Amseln zu vernehmen.
Dass die Tür jetzt aufschwang und ihm Elsa entgegenlief, bildete er sich nur ein. Dass Jonas auf der Veranda im Rattan-Schaukelstuhl saß und ihm zuwinkte, ebenso. Ganz zu schweigen von Frederik, dem kleinen Mann, dessen Schreie oft weit und breit zu hören gewesen waren. Und Charlotte? Auch von ihr keine Spur. Alles, was ihn hätte trösten können, entstammte einzig seiner Phantasie. Trost war allein.
Er zog sein Handy heraus, so wie er es in den letzten Tagen zigmal getan hatte, und wählte Charlottes Nummer. Nichts. Sie war untergetaucht. Anfangs hatte er seine Familie noch vor der Welt versteckt, jetzt versteckte sich seine Familie vor ihm.
Wieder bebten seine Schultern, und er lief zum Wagen, ehe ihn noch jemand dabei ertappen konnte, wie er heulend vor seinem eigenen Haus hockte. Seinem Haus, das er, so hatte er sich geschworen, nie wieder ohne seine Familie betreten würde.
3Der steirische Landeshauptmann Konrad Wachmann legte den Kopf in seine Hände. Sein Herz schlug hart gegen den Brustkorb. Er versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, und scheiterte daran. Zu viel ging ihm durch den Kopf. Er wandte sich dem Regal an der Wand zu, auf dem die Statue des heiligen Urban stand, seines Zeichens Schutzpatron der Weinbauern. Spätestens mittags würde es wieder losgehen mit den ersten Achterln, hier einem Trinkspruch, da einem Schwank und dort einem Scherz. Am liebsten hätte er sich jetzt schon einen Schluck genehmigt, dabei war es erst kurz vor sieben Uhr morgens.
Wachmann stand grunzend auf, wobei er seine Arme zu Hilfe nehmen musste, um sich vom Schreibtisch hochzustemmen. Sie zitterten unter dem Gewicht seines Körpers. Er war außer Form. Natürlich war er das, er ging schließlich auf die fünfundsechzig zu und hatte die letzten zwanzig Jahre so gut wie keinen Sport betrieben– davor war er wenigstens manchmal am Wochenende mit dem Fahrrad zum Eisessen gefahren oder von Buschenschank zu Buschenschank gewandert.
Ein paar Minuten lang starrte er vom Balkon seines Arbeitszimmers in den hinteren Garten der Grazer Burg. Es war eine Eigenheit der Steiermark, die ihm immer schon gefallen hatte, dass das Oberhaupt des Landes es von einem sicheren Gemäuer aus regierte und dabei auf einen Garten blickte. Die Blätter des Buschwerks glänzten im Morgentau. Er fröstelte.
Als er sich umdrehte, fiel sein Blick auf die vielen Gemälde von Professor Wolfgang Hollegha, eines in Kärnten geborenen Künstlers, der mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet worden war. Schon allein deshalb hatten es Holleghas Bilder verdient, in Wachmanns Büro zu hängen.
Wenn er ehrlich war, hatte Wachmann Holleghas irrwitzige Farbkleckskunst nie ganz verstanden. Sie war unergründlich. Aber das war auch der eigentliche Grund, warum die Bilder ihn seit Jahren begleiteten. Er hoffte, dass etwas von dieser geheimnisvollen Unergründlichkeit auf denjenigen abfärbte, der sie besaß. Dass die Bilder seinen Besitzer interessanter und unberechenbarer machten, als es die altehrwürdigen Biedermeier-Möbel um den runden Sitzungstisch und die Siebziger-Jahre-Ledercouch neben dem Eingang je vermocht hätten.
Wachmanns Büro hatte die Größe einer Gemeindebauwohnung, der Parkettboden knarrte unter seinen Schritten, während er es gedankenverloren durchmaß. Auf einer Kommode lachten ihm die Gesichter seiner Familie aus Bilderrahmen entgegen. Manchmal hatte er das Gefühl, die Gören lachten ihn aus. Zum wiederholten Mal ging er zum Schreibtisch, wo sein Blick auf den Brief fiel, den er vor wenigen Minuten gelesen hatte. Dann drückte er kurz entschlossen einen Knopf an seiner Telefonanlage.
Sein Sekretär hob ab.
»GehnS’, stellen Sie mich zum Landespolizeidirektor durch und«, er machte eine Pause, um noch einmal darüber nachzudenken, »bringenS’ mir ein Glas vom Weißen, bitte.«
4»Lass den Chauffeur warten«, schimpfte Rosalia Gstrein, und Helmut Ludwig Gstrein, Doktor der Rechte und ehemaliger Richter, schlurfte wieder zurück auf die Terrasse, wo seine Frau sich gerade eine Tasse heißen Thymiantee aus der Porzellankanne einschenkte.
»Dass das einfach nicht in seinen Schädel geht!«, meckerte sie weiter. »Wenn ich sage, halb acht, dann meine ich auch halb acht und nicht zehn nach sieben.«
Ihr Mann erwiderte nichts, ließ sich ächzend in den Sessel fallen und schlug die »Große Tageszeitung« auf. Wie immer begann er seine Lektüre mit dem Leitartikel, las dann die Kommentare– den »Denkzettel« und den »Aufwecker«– und schmunzelte schließlich über die Karikatur. Ins Schmunzeln hinein schlürfte er wenig vornehm seinen Milchkaffee, was seine Frau stets mit einem missmutigen Seitenblick kommentierte, den er zwar bemerkte, der ihn aber nicht daran hinderte, es weiterhin zu tun. Es war ein Morgen wie jeder andere auch.
»Verstehst du, warum die Post mit der Zeitung manchmal mitten in der Nacht kommt? Das ist ja auch nicht normal. Früher war alles besser«, nörgelte Rosalia Gstrein weiter. »Hörst du mir überhaupt zu?«
»Natürlich, mein Schatz. Ich hör dir zu. Ich hör dir immer zu«, sagte er und sah dabei kein einziges Mal von der Zeitung auf. Er hörte, wie seine Frau die Briefe öffnete und dabei immer noch Geräusche von sich gab, die dem Grummeln eines vorüberziehenden Unwetters nicht unähnlich waren.
Über den Lokalteil der Zeitung gelangte er schließlich zur Wirtschaft, überflog die Überschriften, las einige Todesanzeigen und schlug schließlich den Sportteil auf. Er freute sich über jeden Bericht der 99ers. Eishockey war immer schon seine Leidenschaft gewesen, Fußball konnte ihm gestohlen bleiben. Seine Frau hatte den Sport stets abstoßend gefunden, all die blutenden Nasen unter den Helmen und die riesenhaften Gestalten in ihren seltsam bunten Rüstungen, aber Helmut Ludwig Gstrein gefiel einfach alles daran. Auf dem Eis gab es Regeln und Gesetze, und Verstöße wurden schnell geahndet. Manchmal auch hart bestraft. Da wurden die Spieler minutenlang vom Platz genommen und in kleine Kojen gesteckt, in kleine Gefängnisse. Alles sehr ähnlich dem richtigen Leben, in dem er einst selbst als Richter über das Schicksal anderer entschieden hatte.
Heute wurde seine Expertise nur noch ab und zu als Gutachter gebraucht, weil sich kaum jemand mit Raumordnungsrecht besser auskannte als er. Er betrachtete diese Arbeit nur noch als Hobby, als Zeitvertreib. Früher jedoch, als Richter… Schon allein das Rauschen seiner Robe, wenn er den Saal betrat, hatte für Stillschweigen gesorgt.
»Helmut?«
Er musste wieder schmunzeln. Ein Sonnenstrahl kitzelte ihn an der Nase.
»Heli?«
»Ja, mein Schatz?«, säuselte er.
»Lies das mal.«
Ohne sie anzusehen, griff er nach dem Brief, den ihm seine Frau reichte, und überflog die Zeilen, die erst nach und nach sein Interesse weckten. Nach dem letzten Wort blickte er zum ersten Mal während des Frühstücks auf und sah seiner Frau in die Augen. »Ein Scherz?«
»Lache ich vielleicht?«
Doktorin Rosalia Gstrein, Landesrätin für Umwelt, Klimaschutz, Energie, Regionalentwicklung, Raumordnung und wahrscheinlich noch für allerhand andere Dinge, erhob sich langsam von ihrem Stuhl.
Ihr Mann nickte ihr beruhigend zu, während er den Brief zurück auf den Frühstückstisch legte und nach seinem Handy griff. »Ich regle das. Fahr du schon einmal los.«
»Soll ich nicht lieber hierbleiben?«
»Das musst du wirklich nicht. Aber ruf vom Auto aus deine Kollegen an. Vielleicht bist du ja nicht die Einzige, die heute Post bekommen hat.«
Als sich seine Frau entfernt und er den Anruf getätigt hatte, fiel sein Blick noch einmal auf den Brief, der aus ausgeschnittenen und auf weißes DIN-A4-Papier geklebten Buchstaben bestand, vielleicht sogar aus jenen der »Großen Tageszeitung«. In seiner aktiven Zeit als Richter hatte er es mit Leuten jeglicher Couleur zu tun gehabt. Mit Mördern, Dieben, Vergewaltigern– eigentlich gab es keine Art von Mensch, der er nicht begegnet war. Und doch hatte er nie einen solchen Brief gesehen, geschweige denn erhalten. Eine Morddrohung. Gerichtet an seine Frau, verfasst in überzogener Wortwahl. Und doch war sie ernst zu nehmen. Schließlich wurde recht eindeutig beschrieben, auf welche Weise Rosalias Leben zu Ende gehen sollte.
Also doch kein Morgen wie jeder andere.
5Die acht Regierungsmitglieder der Steiermark saßen um den ovalen Tisch in einem Raum, der so groß wie ein Tanzsaal war. Vier Frauen und vier Männer.
Deren PR-Berater verteilten Zettel oder tippten auf ihren Handys herum. Der stämmige Sicherheitsoffizier der Burg musterte jeden Anwesenden mit wissendem Lächeln. Vielleicht malte er sich dabei aus, wie er sie nacheinander mit Handkantenschlägen und Judorollen zu Boden strecken würde. Zwei Sekretärinnen verteilten Wasserkaraffen und Saftgläser, während der offizielle Fotograf des Landeshauptmanns eifrig nach geeigneten Motiven suchte.
Konrad Wachmann war unübersehbar schlecht gelaunt und schickte mit einem herrischen Wink und einem »Kommts, passt schon, lassts uns allein« alle, die nicht am Tisch saßen, aus dem Raum.
Stuhlbeine kratzten über den Parkettboden, Brillen wurden nervös von Nasenrücken auf Nasenspitzen geschoben, um bald darauf wieder in ihrer Ausgangsposition zu landen.
Wachmann faltete die Hände vor seinem Gesicht und berührte mit den Fingerspitzen seine Augenbrauen. Sein Blick darunter wanderte über die Runde. Doktorinnen, Magistrae und ein Professor– einzig er selbst besaß keinen akademischen Grad. Allesamt gescheite Leute, dachte er. Allesamt wirkten sie souverän und überlegen, doch er wusste es besser. Sie waren unsicher, hatten im Augenblick womöglich sogar Angst.
»Also«, hob er an, als die Tür endlich zugefallen war. Der Sicherheitsoffizier hatte sie geschlossen, war aber selbst im Raum geblieben und verharrte neben ihr mit versteinertem Gesichtsausdruck. Wachmann blickte ihn ernst an, entschied sich aber dafür, den Mann nicht hinauszukomplimentieren. »Soweit wir wissen«, sagte er stattdessen zur Runde, »gibt es bisher fünf Briefe. Die Landesräte für Landwirtschaft, Umwelt, Zukunft, Infrastruktur und ich haben je einen bekommen. Offenbar weisen alle den gleichen Wortlaut auf.«
Er nahm den Zettel vor sich, eine Kopie jenes Briefs, den er selbst erst vor wenigen Stunden erhalten hatte, in beide Hände und begann, laut zu lesen.
»Sehr geehrte Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung, honorige Damen und Herren, Magistrae und Doktoren, Wichtigtuer und Rampensäue,
wir, die Nachfahren der Trümmerfrauen, Habsburger, Babenberger, Bayern, Slawen, Römer und Atnamechs, sind unzufrieden mit Ihrer Politik des Drüberfahrens. Sie betonieren unsere Geschichte zu. Sie wollen eine Autobahn ausbauen, wo doch alle wissen, dass mehr Straßen nur mehr Verkehr verursachen. Sie sind unfähig und gefährlich. Nach Ihnen folgt nur noch Asphalt. Unser Land, unser wunderschönes, heiliges Innerösterreich, Karantanien, die Mark, alles wird vergessen sein. Deshalb müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Sie innerhalb der nächsten Woche hinrichten werden.
Sie sind schuldig!
Ob Sie durch Enthaupten, Ertränken, Verbrennen oder durch unsere Pfeile, Schwerter oder Äxte sterben werden, entscheiden wir.
Genießen Sie Ihr restliches Leben. Nutzen Sie die Zeit, die Ihnen bleibt.
Lang lebe der König!«
Unwirsch legte Wachmann das Blatt zur Seite. »Natürlich habe ich keinen Grund zu der Annahme, dass wir uns wegen so einer Spinnerei fürchten müssen, aber lassen Sie uns die Sache dennoch ernst nehmen. Jeder von uns wird Personenschutz erhalten, dafür wurde bereits alles in die Wege geleitet.«
»Das mit dem Personenschutz ist aber schon etwas übertrieben«, konnte Rosalia Gstrein ihre üble Laune nicht länger verbergen. »Wegen dieser leeren Drohung musste ich heute bereits zwei Termine absagen.«
Ihr Tonfall hatte nichts damit zu tun, dass sie einer anderen politischen Fraktion als Wachmann angehörte. Umweltlandesrätin Rosalia Gstrein war bekannt dafür, bis zur Mittagszeit mit schlechter Laune nicht zu sparen. Normalerweise brachte erst das Mittagessen, vorzugsweise eingenommen im »Landhauskeller«, eine leichte Milderung ihrer fatalen Stimmung.
Wachmann nahm die Brille von seiner Nase. »Der Personenschutz bleibt, und wir werden den Anweisungen der Exekutive Folge leisten.« Er betrachtete konzentriert die Brillengläser. »Dieser Unterredung folgt ein Krisenstab, dem auch Mitarbeiter der Sicherheitsdirektion und unsere Kommunikationsexperten beiwohnen werden.«
»Und wie willst du dabei auftreten? Etwa wie die Regierung während der Corona-Krise? Willst du dich auf Pressekonferenzen vielleicht hinter Plexiglas verschanzen?«
»Plexiglas ist gut, aber ein schusssicheres Material wäre besser«, äußerte sich jetzt der Landesrat für Landwirtschaft und suchte mit glänzenden Augen nach einem Lächeln in der Runde. Da niemand in Stimmung für seinen Humor zu sein schien, huschte sein Blick verschämt zurück auf sein Handy, das vor ihm auf dem Tisch lag.
»Wir werden auf den Rat der Experten hören«, sagte Wachmann in einer Stimmlage, die keinen Widerspruch duldete. »Wir sind das Gesicht des Landes, und das muss gewahrt werden. Wir dürfen keine Furcht ausstrahlen, nur Entschlossenheit.« Sehr ernst, fast grimmig fixierte er die Anwesenden. »Und ich erwarte mir von jedem von euch den Willen zur Geschlossenheit. Wir sind eine Einheit.« Auf Rosalia Gstrein ruhte sein Blick besonders lange, ehe er wiederholte: »Wir sind eine Einheit.«
Freitag
1Nur der vermag das Leben um sich herum zum Stillstand zu zwingen, der selbst stillsteht. Nach all den Erlebnissen und Vorfällen der letzten Monate gab es für Armin Trost nur eine Option. Innehalten. All die Gewalt und all die schlechten Einflüsse würden dann einfach weiterziehen. Möglicherweise.
In dieser Phase des Stillstands verharrte Armin Trost nun schon seit Wochen. In seinem aktuellen Zuhause, einem leer stehenden Wirtshaus, hatte er dem Schnarchen seines riesigen Hundes namens Zeus gelauscht. Oder den schweren Schritten seines Nachbarn und Vermieters Stefan Hollermann, eines Journalisten, der seine besten Zeiten hinter sich hatte und sich mehr schlecht als recht durchs Leben schrieb. Im Schattenwurf des durch die Vorhänge dringenden Laternenlichts hatte Trost dann die Fotografien seiner Familie betrachtet. Wie ihnen allen das Lächeln ins Gesicht gefroren war, was ihm jedes Mal ein eigenes, echtes auf die Lippen zauberte.
Ein- und ausatmen.
Trost brauchte Zeit. Zu viel von all dem Bösen und Schlechten dieser Welt war zuletzt auf ihn eingeprasselt. Manchmal hatte er sich unsichtbar gemacht, dann war er sich selbst nicht mehr sicher gewesen, ob er noch am Leben war. Manchmal spürte er das Böse in seinem Nacken, so nah, dass er vor Furcht hätte schreien können.
Ob er verrückt wurde? Vielleicht.
Doch jetzt, in diesem Augenblick, spürte er nur Vorfreude. Er saß im VW-Bus und konnte es kaum erwarten, in einer halben Stunde mit einem Weinbauern und einem Glas Weißburgunder in dessen Garten zu sitzen. Ein banaler Wunsch in einer zunehmend banalen Welt, all dem Bösen und der Gewalt zum Trotz. Ein Weinkauf, wie er sich für einen Steirer gehörte: direkt beim Winzer mit einer Verkostung in der prallen Frühlingssonne, untermalt vom Spritzmittelgeruch. Wann hatte er das zuletzt gemacht? Die Dimension seiner Vorfreude darauf war fast bedenklich.
Als er aus dem Fenster blickte, wurde ihm bewusst, dass er sich schon seit geraumer Zeit keinen Meter weiterbewegt hatte. Aus den Tagträumen gerissen schalt er sich sogleich für seine Dämlichkeit, an einem Freitagnachmittag mit dem Auto in die Südsteiermark fahren zu wollen. Genau dann, wenn halb Graz die gleiche Idee hatte und ins Wochenende im Grünen tingelte. Jetzt stand er im Stau. Noch mehr Stillstand. Auf der Rückbank hechelte Zeus.
Als der erste Wagen durch die Rettungsgasse an ihm vorüberraste, dachte er sich noch nichts dabei. Auch nicht bei den weiteren Fahrzeugen. Feuerwehr, Rettung, Polizei, das ganze Geschwader.
Trost klopfte mit den Fingern auf das Lenkrad. Jetzt macht schon!
Die Pyhrnautobahn, dieA9Richtung Slowenien, weckte in ihm Erinnerungen an seine Kindheit. Wie oft hatte er mit seinen Eltern hier früher im Stau gestanden, unten an der Grenze in Spielfeld, bevor es über holprige Straßen weiter bis ans kroatische Meer ging. Der Schweiß brach ihm aus. Trotz der Hainbuchen und Feldahorne am Straßenrand knallte die Frühlingssonne durch die Windschutzscheibe. Wenigstens boten die Bäume streckenweise einen für eine Autobahn verhältnismäßig idyllischen Anblick. Wäre Trost Pflanzenexperte gewesen, wären ihm auch Sträucher wie Haselnuss und Hartriegel aufgefallen, die sich mit Zitterpappeln, Schwarz- und Grauerlen zu einer Einheit verbanden, die den Eindruck vermittelte, die Autobahn sei durch einen dschungelartigen Landstrich geschlagen worden. Das grüne Band bis nach Leibnitz war mitunter so exakt geschnitten, dass es aussah wie eine grüne Wand. Eine Wand, die auf Autofahrer beruhigend wirken und für die dahinter Wohnenden die Blechlawine verstecken und deren Lärm dämpfen sollte. Das Grün war also nur dazu da, darüber hinwegzutäuschen, dass der Verkehr von Jahr zu Jahr in erschreckend hohem Ausmaß zunahm.
Trosts Kleinbus stand keine zwanzig Meter vor einer Unterführung, an der eine blaue Tafel darauf hinwies, dass die Abfahrt nach Wundschuh noch tausendeinhundert Meter entfernt war. Wundschuh, die letzte der kleinen Ortschaften, die das Ende des Grazer Beckens Richtung Süden markierten.
Als er das Fenster öffnete, wehte ihm ein heißer Wind entgegen. Und wieder rasten Fahrzeuge an ihm vorbei.
Doch diesmal spürte Trost ganz deutlich, dass die Zeit des Stillstands vorüber war. Dass ihn das Böse immer und immer wieder einholen würde. Selbst hier im Stau. Auf der Autobahn.
Denn diesmal waren zivile Fahrzeuge an ihm vorbeigefahren. Fahrzeuge, deren Insassen er kannte.
2Er ignorierte die Gänsehaut, die sich über seine Unterarme zog, öffnete den Sicherheitsgurt, stieg aus und warf einen Blick nach vorn und zurück. Der Stau musste bereits eine beträchtliche Länge haben, und es gab keine Anzeichen dafür, dass er sich demnächst auflösen würde. Trost zog den Wagenschlüssel ab, ließ Zeus auf die Straße springen, versperrte seinen VW-Bus und marschierte los.
Die meisten Fahrer der Wagen, an denen er vorüberlief, hatten den Motor abgestellt. Eine für diese Umgebung ungewöhnliche Stille hing in der Luft. Die Einmaligkeit des Moments wurde ihm bewusst, denn in seinem bisherigen Leben war er noch nie über eine Autobahn gelaufen. Kein Wunder, schließlich war es bei sechzigtausend Fahrzeugen, die pro Tag die Pyhrnautobahn entlangfuhren, auch nicht wirklich ratsam.
Trost spürte, wie die Hitze vom Asphalt durch seine Schuhsohlen drang. Seltsam, dass es im Frühling schon so heiß war. Er bückte sich und berührte mit den Fingerspitzen den Straßenbelag. Nach einem Blick zu Zeus, der ihn munter erwiderte, befand Trost, dass der Asphalt noch nicht heiß genug war, um dem Tier Schmerzen zuzufügen, und sie gingen weiter.
Als Trost an Lkw, Vans und Pick-ups vorüberlief, erinnerte ihn der Anblick an Endzeitfilme, in denen die ganze Dynamik einer aus den Fugen geratenen Welt an einer Autobahn sichtbar wurde, auf der nichts mehr ging.
Langsam näherte er sich jener Stelle, wo sich der Grund für den Stau befand, vor dem auch schon im Radio eindringlich gewarnt worden war. Der Sprecher hatte zum großräumigen Umfahren über die Landesstraßen geraten.
Linker Hand tauchten die Hallen des Cargo Centers von Werndorf in Trosts Blickfeld auf. Sie sahen aus wie überdimensionierte Schuhschachteln. Fensterlos und langweilig. Einer weiteren Tafel am Straßenrand nach waren es noch fünfhundert Meter bis zur nächsten Abfahrt mit der Nummer197. Eine Stromleitung verlief rechts neben der Autobahn. Eine Beobachtung, die Trost aus unerfindlichen Gründen trübselig machte.
Mit der Abbiegespur nach Wundschuh wurde die Autobahn hier kurzfristig dreispurig. Ein dichtes Wäldchen drängte sich an den Pannenstreifen. Orangefarbene Hütchen markierten den Beginn einer Baustelle und zwangen die Abbieger dazu, das Tempo zu reduzieren. Baufahrzeuge waren jedoch nirgendwo auszumachen.
Hektisch rannten Feuerwehrmänner hin und her, zwei davon direkt auf ihn zu. Sie hoben ihre Arme und machten dabei grimmige Gesichter. Trost hatte Verständnis für ihre Reaktion, würde er sich selbst doch ähnlich verhalten, wenn plötzlich ein Autofahrer, wahrscheinlich einer, der »ganz dringend wohin« musste, nach vorn zum Stauanfang eilte, um sich zu beschweren. Noch dazu einer mit Hund. Womöglich ein verwirrter Kerl, der den Stau dazu nutzte, um mit seinem Hund mal auf der Autobahn Gassi zu gehen.
Hinter den Männern bemerkte Trost etwas, das untypisch für Verkehrsunfälle war. Normalerweise bestand die Aufgabe der Feuerwehrleute darin, Eingeklemmte aus ihren Fahrzeugen zu schneiden und ausgeronnene Öle zu binden. Normalerweise landete bald nach dem Unfall auch ein Rettungshubschrauber in der Nähe, der ein Sanitätsteam des Roten Kreuzes ausspuckte. Normalerweise. Doch hier wurden Absperrbänder ausgerollt, und Männer und Frauen schlüpften in weiße Plastikoveralls. Der Rettungswagen kam ihm ohne Eile und Blaulicht entgegen und fuhr davon. Trost hatte das unbestimmte Gefühl, dass stattdessen bald ein Leichenwagen eintreffen würde. Normal war an dieser Situation also nichts.
3»Was wollen Sie denn hier? Gehen Sie zurück zu Ihrem Wagen«, hörte Trost die Stimme des bulligeren, größeren Feuerwehrmanns und wunderte sich noch darüber, wie dünn sie klang. Auf der Gegenfahrbahn hinter der Leitschiene kam der Verkehr indes ebenfalls zum Stocken. Trost sah heruntergelassene Scheiben und Gaffer mit offenen Mündern, ein Phänomen, das Einsatzkräfte seit Jahren beobachteten und gegen das sie kaum etwas tun konnten. Menschen starrten nun einmal. Waren fasziniert von allem, was nicht der Norm entsprach.
»Haben Sie mich nicht verstanden?«
Trost war einfach weitergegangen. Nicht etwa, weil er sich den Anweisungen des Feuerwehrmannes widersetzen wollte, sondern einfach deshalb, weil er keine andere Wahl hatte. Dabei war es nicht die Faszination der Gaffer, die ihn antrieb, sondern vielmehr etwas, von dem er eigentlich gedacht hatte, sein freiwilliger wochenlanger Rückzug habe ihn davon befreit. Nun riss ihn die Gewissheit, dass dem nicht so war, wie eine Lawine mit. Sein hart erarbeitetes Selbstbewusstsein fiel in sich zusammen wie ein Kartenhaus aus pickigen Doppeldeutschen. Von gar nichts war er befreit worden. Nichts hatte sich verändert, alles war noch da. Dieser ganze vermaledeite Drang, sich dem Bösen gegenüberzustellen, Auge in Auge, war so stark wie eh und je. Das Böse zog ihn unwiderstehlich an. Also stapfte er einfach weiter mit schweren Schritten, mit denen er auch durch Tiefschnee gekommen wäre.
Auch ein Motorradpolizist in Lederkluft bewegte sich nun auf ihn zu und massierte sich mit einer Hand die andere, als hätte er allen Ernstes vor, ihn mit Gewalt aufzuhalten. Plötzlich rief eine Trost bekannte Stimme: »Lasst den Mann unverzüglich durch!« Ja, die Stimme sagte wirklich »unverzüglich«, ein Wort, das man hierzulande nur aus juristischen Texten kennt. Er gehöre zu ihr, fügte die Stimme noch hinzu. Er gehöre zu ihnen allen.
Und als er aufblickte und sich zur Stimme umwandte, sah er Annette Lemberg vor sich, die seinen Blick ebenso verwundert wie erleichtert erwiderte. Sie nahm ihre Sonnenbrille ab, wischte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, als stünde sie auf dem Set eines Werbefilms, und kam auf ihn zu. Trost wusste um ihre Wirkung und war gegen sie gefeit, die anderen Anwesenden machten allerdings allesamt einen verlegenen Schritt zurück. Lemberg hatte die Gabe, Menschen zu beeindrucken. Vor allem Männer.
Sie blieb ein kleines Stück zu nahe vor ihm stehen. Einen Moment lang hatte es den Anschein, als wollte sie ihn umarmen, was ihn mindestens ebenso sehr irritierte wie der Umstand, dass er das gern getan hätte.
»Was machst du hier?«, unterbrach sie die unangenehme Stille zwischen ihnen, während sich die Feuerwehrleute zurückzogen.
»Ich war auf dem Weg, Wein zu kaufen.«
»Wein?«
»Ja, Welschriesling, Morillon, Alkohol halt.«
Sie beugte sich zu Zeus hinunter und streichelte seinen Kopf. Er lehnte sich sogleich dankbar gegen ihr Bein.
»Ist das ein Privatgespräch, oder hat es etwas mit dem Tatort zu tun?«
Den Motorradpolizisten hatten sie völlig vergessen.
»Lassen Sie es bitte unsere Sorge sein, wie wir diesen Mordfall lösen. Kümmern Sie sich lieber darum, dass uns keine Autofahrer belästigen, und regeln Sie den Verkehr. Okay?«
»Dann leinen Sie den Hund wenigstens an«, maulte der Polizist.
»Das muss er nicht. Noch was?«, versetzte Lemberg.
Eine Sekunde lang schien der Mann zu überlegen, etwas zu erwidern, ließ es dann aber bleiben und ging wortlos davon.
»Tatort, Mordfall?«, sagte Trost.
»Ein simpler Verkehrsunfall ist das jedenfalls nicht.«
Zum ersten Mal warf Trost jetzt einen Blick auf das zerbeulte, rauchende Autowrack, das am Ende einer kurzen schwarzen Brems- und Schleifspur mitten auf der Fahrbahn der Abzweigung von derA9 nach Wundschuh auf dem Dach lag.
4Dem Mann, der im Sicherheitsgurt mit dem Kopf nach unten hing, fehlte es nicht nur an Haltung, er sah zwangsläufig auch würdelos aus. Sein Hals war verdreht, der Kopf lag in unnatürlicher Haltung auf der Schulter. Die Augen verrieten, dass er im letzten Moment seines Lebens an etwas gedacht hatte, das ihm wichtig war, ihn aber keineswegs mit Schrecken erfüllte. Als fesselte ein Punkt in unbestimmter Ferne seinen Blick. Trost hatten Tote schon immer fasziniert. Je kürzer der zeitliche Abstand zu ihrem Ableben, desto intensiver waren die Eindrücke. Der Leichnam in dem Wagen erweckte beinahe den Anschein, als wäre er nicht tot, so seltsam wach wirkten seine Augen.
Der Mann trug einen Oberlippenbart, der blutverklebt von der Wunde seines gebrochenen Kiefers war. Auch der schlaff aus dem Armaturenbrett hängende Airbag war rot und konnte die durchnässte Hose des Fahrers nicht verbergen.
Die groteske Haltung seiner Arme verlieh ihm das Aussehen einer achtlos weggelegten Marionette. Eine Gesichtshälfte wurde von der Krawatte verdeckt, die Beine waren unter dem Lenkrad verkeilt. Trost vermied es, den Mann noch länger anzustarren. Er tat ihm leid. Die Mitglieder der Tatortgruppe, die Feuerwehrleute, die Polizisten, alle starrten sie ihn an, schossen Fotos, machten Messungen, tasteten mit Latexhandschuhen seine Umgebung ab. Ja, Mitgefühl machte sich in Trost breit, und das irritierte ihn.
Er blinzelte. Er hatte niemals Mitgefühl.
Nicht, weil er unfähig war, Empathie zu empfinden, sondern weil er normalerweise seine Arbeit zu machen hatte, wenn er eine Leiche sah. Was verlangte, dass er sämtliche Gefühle vermied. Sich konzentrierte.
Endlich wanderte Trosts Blick zu jener Stelle des Leichnams, die ihn am meisten faszinierte und gleichzeitig abstieß. Im Hals der männlichen Leiche steckte ein fingerdicker Stock, genauer gesagt ein gefiederter Pfeil aus Holz.
5»Hast du so etwas schon einmal gesehen?«
Lemberg hatte sich zu ihm hinuntergebeugt, unter ihren Schuhsohlen knirschten Glassplitter. Gemeinsam starrten sie durch die von der Feuerwehr zuvor aufgeschweißte Wagentür die seltsame Mordwaffe an. Dann sah Trost zu Lemberg.
»Nein, noch nie.«
Sie hob die Augenbrauen. »Ich meinte eigentlich die Mordmethode.«
Trost lächelte. »Ich auch.«
Sie erwiderte sein Lächeln, und ihm wurde bewusst, wie sehr er das vermisst hatte.
»Und?«, sagte sie. »Wirst du mir helfen, der Sache auf den Grund zu gehen?«
Trost antwortete nicht. Er richtete sich auf, ging um das Fahrzeug herum und sah sich die Umgebung an. Die Ausfahrt der Autobahn nach Westen machte einen Bogen in Richtung einer Wiesenlandschaft. Eine Waldinsel sorgte für ein gewisses Maß an Idylle. Sein Blick streifte die im Stau stehenden Fahrzeuge. Ganz vorn bemerkte er den Motorradpolizisten, der ihn mit verschränkten Armen noch immer nicht aus den Augen ließ. Trost wusste, dass er nicht der Einzige war. Auf ihm lagen die Blicke von Dutzenden. Von denen, die ihn bewunderten und versuchten herauszufinden, was das Geheimnis seines Erfolgs war. Und von den anderen, die auf ein Zeichen von ihm hofften, um die Straße für den Verkehr wieder freigeben zu können.
Bei dem auf dem Dach liegenden Wagen handelte es sich um ein mattschwarzes Porsche-Cayenne-Cabrio. Ein sündteures Auto, das in seinem jetzigen Zustand– um das zu sagen, musste man kein Experte sein– nicht viel mehr wert war als Trosts angerostetes Fahrrad.
Sein Blick fiel auf eine offen stehende Aktentasche, aus der eine Handvoll Zettel herausschaute. Dann auf die Leitplanke, gegen die der Porsche geprallt war, und die umgestürzten orangefarbenen Hütchen. Als Trost sich in Bewegung setzte, folgte ihm Lemberg.
»Wohin gehst du?«
»Zum Schützen.«
»Wie lange wirst du hier noch brauchen?«
Er gab keine Antwort. Sah vom Straßenrand zum Gebüsch und zeigte auf eine Stelle etwa dreißig, vierzig Meter weiter vorn, wo mehrere Baracken einer Hundeschule zwischen Wäldchen und Autobahnabzweigung standen.
»Sucht das Gstauder ab, der Pfeil wurde mit Sicherheit von dort abgeschossen. Vielleicht haben die Leute von der Hundeschule etwas gesehen. Und schau dir den Inhalt der Aktentasche von dem Typen an. Die Papiere sehen mir nach einem Bauprojekt aus. Lass den Pfeil untersuchen. Ich kann mich täuschen, aber wenn ich richtigliege, ist es keiner, den Sportbogenschützen verwenden. Weißt du schon etwas über das Opfer?«
Lemberg blickte über die Schulter zurück. »Armin, ich…«
»Name?«
»Helmut Ludwig Gstrein.«
»Gstrein? Etwa der Gstrein?«
»So wie es aussieht, ja.«
Trost blähte die Backen. »Wo ist der Graf?« Erst gerade war ihm aufgefallen, dass Lembergs Partner Reinhard Maria Hinterher, genannt der »Graf«, am Tatort fehlte. In diesem Moment hörte er jemanden seinen Namen rufen und drehte sich um.
Aus dem Gebüsch hinter ihm trat soeben ein Mann. »Ich bin doch hier.«
»Ah, gut.«
Lemberg machte einen Schritt auf ihn zu. »Ich brauch dich hier, Armin.«
»Nein, Anne, das tust du nicht. Ich bin raus, und das weißt du auch.«
»So ein Blödsinn. Du kannst jederzeit zur Mordgruppe zurückkommen.«
Trost fixierte sie. In ihrem Blick glaubte er Spott auszumachen.
»Du kannst doch gar nicht ohne uns.«
Trost wischte sich fahrig über den Mund. Einen Augenblick lang hatte er tatsächlich gedacht, sie habe gesagt: »Du kannst doch gar nicht ohne mich.« Ihm war unbegreiflich, warum er so nervös war. »Gstrein war früher ein hohes Tier«, sagte er schnell. »Riegelt alles ab und sorgt dafür, dass der Leichnam abgeschirmt wird. Vor allem den Pfeil darf niemand sehen. Warum ist das nicht schon längst passiert?«
Damit drehte er sich um und ging in geduckter Haltung davon, als hätte er etwas angestellt. Oder als befürchtete er, erkannt zu werden. Zeus schien es nicht anders zu gehen, er lief immer zwei, drei Schritte vor ihm und trieb Trost auf diese Weise an.
»Das war’s jetzt, oder was? Du lässt mich einfach hier stehen und fährst wie geplant Wein kaufen? Ist dir eigentlich bewusst, was los sein wird, wenn bekannt wird, wer der Tote ist?«
Er hob die Hand zum Gruß und murmelte: »Ja. Trotzdem fahr ich jetzt Wein kaufen.«
Lemberg trat von einem Bein aufs andere. Einen Moment sah sie so aus, als wollte sie ein Loch in den Asphalt treten und darin verschwinden.
Plötzlich stand der Motorradpolizist neben ihr. »Und das war jetzt dienstlich, oder wie?«
Lemberg rollte mit den Augen und schob sich an dem Kerl vorbei in Richtung Tatort.
6Ob er ein vorbildlicher Mensch war? Gar ein vorbildlicher Polizist? Ginge es nach Trost, sollten diese Fragen andere beantworten. Er jedenfalls spürte den Geschmack des Grauburgunders immer noch auf der Zunge, als er Stunden später– nach einer ausgiebigen Verkostung im Garten des südsteirischen Weinbauern– wieder Richtung Graz hinterm Steuer saß. Doch der Geschmack war eine Sache, die Gedanken eine andere. Anders ausgedrückt: Auch mit der Südsteiermark am Gaumen wollte ihm der Grazer Süden nicht aus dem Kopf gehen.
Natürlich hatte ihm das Ereignis auf der Autobahn einen Strich durch seine ursprüngliche Rechnung gemacht. Er hatte vorgehabt, zwei, drei Winzer anzusteuern und mit einem Kofferraum voller Wein heimzukehren. Er hatte gern ein paar Varianten der steirischen Weißweinsorten vorrätig. Trost rieb sich die Nase, die seit dem Spritzmittelduft im Weingarten juckte.
Der Tag neigte sich schon dem Ende zu, als er jene Stelle erreichte, wo die Gaffer Stunden zuvor vom Gas gegangen waren. Jetzt starrte auch er einen Augenblick lang auf die Gegenfahrbahn zur Unfallstelle, die natürlich längst geräumt war, und nahm dann kurzerhand die Ausfahrt.
Er fuhr die Schleife über die Brücke auf die Westseite und bog dann in eine Nebenstraße ein. Im Schritttempo dahintuckernd sah er sich die Umgebung an. So zumindest hätte es ein Beobachter interpretiert. In Wahrheit war Trosts Aufmerksamkeit selten auf das Offensichtliche gerichtet. Vielmehr folgte er seinem inneren Kompass, der ihn verlässlicher leitete als seine Sinnesorgane. Trost taxierte die Gegend wie ein Rutengeher ein Haus auf der Suche nach Wasseradern, indem er auf die Regungen in seinem Inneren hörte und der Spur des Bösen folgte. Denn genau das war es, woran er glaubte: Für ihn stand fest, dass alles Böse, was einen Menschen motivierte, Verbrechen zu begehen, greifbar war. Es war Materie. Und demzufolge aufspürbar.
Der Süden von Graz war nach dem Marchfeld in Niederösterreich das zweitgrößte Gemüseanbaugebiet Österreichs. Eine riesige Ebene, die allerdings im Lauf der letzten zehn, zwanzig Jahre immer mehr mit Lagerhallen und Fabriken zugebaut worden war. Das Industrie- und Gewerbegebiet hatte sich wie Krebs ins fruchtbare Ackerland gefressen, die Zahl der Bauern im Bezirk hatte sich halbiert. Die Lebensmittel, die einst vor der Haustür produziert worden waren, mussten nun zum Teil aus fernen Gegenden herangekarrt werden. Viele Bauern konnten von den Erträgen ihrer Felder nicht mehr leben.
An diesem Freitagnachmittag kam es Trost so vor, als durchquerte er eine seelenlose Asphaltwüste. Das Wochenende war angebrochen, Zauntore waren geschlossen, Parkplätze leer, die Rollläden an den Lagerhallen heruntergelassen. Nur Traktoren von Nebenerwerbsbauern krochen vereinzelt über die Felder. Zwischen den Hallen mit den spiegelnden Fassaden wirkten sie wie anachronistische Wesen, wie eine vom Aussterben bedrohte Art.
Trost ließ den Wagen am Straßenrand ausrollen, schaltete den Motor ab und stieg aus. Weit und breit war kein Mensch auszumachen, die Ebene erstreckte sich bis zu den im diffusen Licht verschwimmenden Baumwipfeln am Horizont. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite entdeckte er eine Trainingseinrichtung für Fußballer. Eine Halle, in der die Spieler in einer virtuellen Umgebung spezielle Fähigkeiten üben konnten. Trost hatte davon in der Zeitung gelesen und erinnerte sich, beeindruckt gewesen zu sein. Ein Computerprogramm simulierte Spielsituationen, die die Spieler innerhalb einer bestimmten Zeit zu bewältigen hatten. Ein Training, das Reaktionsfähigkeit und kognitive Fähigkeiten schärfte und für großes Aufsehen gesorgt hatte. Sogar Mannschaften aus der deutschen Bundesliga waren darauf aufmerksam geworden und hatten es getestet. Dass die Einrichtung hier im kahlen Nirgendwo neben einer Autobahn stand, hatte Trost jedoch nicht erwartet.
Erst vor ein paar Monaten hatte ihn ein Fall ins Hochschwabgebirge verschlagen. In eine Gegend, in der er zuvor nie gewesen war, eine raue, menschenunfreundliche Region. Und dennoch– er blickte über die Kukuruzfelder und bemerkte vereinzelte Kirchturmspitzen, die aus der Ebene ragten wie mahnende Zeigefinger– fühlte er sich hier weitaus bedrohter. Als stünde er in einer Schusslinie.
Er dachte an den Pfeil, der in Helmut Ludwig Gstrein gesteckt hatte, und überlegte, aus welcher Entfernung er abgeschossen worden sein musste, um ihn tödlich zu treffen. Ein Buch, das er gelesen hatte, kam ihm in den Sinn. In ihm war die Rede davon gewesen, dass englische Langbogenschützen zur Zeit des Hundertjährigen Kriegs aus einer Distanz von dreihundertfünfzig Metern zielsicher getroffen hätten. Er blickte sich wieder um. Die Kukuruzäcker waren keine fünfzig Meter entfernt. Schützen könnten sich darin verstecken, ihre Pfeile könnten ihn aus den verschiedensten Richtungen treffen. Plötzlich wurde aus dem latenten Unwohlsein eine kleine Panikattacke. Während Trost zurück zum Auto stolperte, fürchtete er, jeden Moment durchbohrt zu werden. Aus dem Inneren des VW-Busses glotzte ihn Zeus mit großen Augen an. Trost hätte schwören können, dass sich der Hund Sorgen um ihn machte.
Wieder in Sicherheit fuhr er bis zu einer Tankstelle mit angeschlossenem Beisl, das den seltsamen Namen »Wurmschach« trug. Dahinter begann ein großes Waldgebiet.
Da die Nadel seines inneren Kompasses auf das Gebäude zeigte, stieg Trost aus, ging darauf zu und fühlte sich mit jedem Schritt einer Antwort näher.
Vor einiger Zeit hatte er diese Todessehnsucht gehabt, damals war die Welt um ihn herum verstummt. Jetzt war es ähnlich, wenngleich es sich diesmal nicht so anfühlte, als hielte die Welt den Atem an. Hier draußen gab es einfach keine Geräusche außer dem steten Hintergrundrauschen der nahen Autobahn. Diesmal war es die Stille einer sprachlosen Welt.
7Die Ladenlokale von Tankstellen sind zauberhafte Orte, denn wenn man über ihre Schwelle tritt, eröffnet sich einem stets eine neue Welt. Auch dieser Ort strahlte eine Art von Magie aus, als sich die Schiebetür schmatzend öffnete und Trost mit einem lauten »Grüß Sie!« eintrat. Das Draußen war schlagartig vergessen, Kaffeearoma und Zigarettenqualm überlagerten den Benzingeruch. Hinter den Regalreihen mit Naschzeug, Energydrinks, Extrawurstsemmeln in Frischhaltefolie und Pornoheften ging es in den Nebenraum, dem »Wurmschach«, wo sich ein halbes Dutzend Männer um einen Kaffeeautomaten drängte. Eine dicke graue Rauchwolke hing in dem Raum, Bierdosen standen auf Stehtischen. Trost hatte nie verstanden, warum ausgerechnet in den Hinterzimmern von Tankstellen so viel getrunken und geraucht wurde. Warum das erlaubt war. Die schummrige Atmosphäre, die von den schräg durchs Fenster fallenden Strahlen der Abendsonne verstärkt wurde, zog ihn unweigerlich in den Bann, und er quittierte das plötzliche Verstummen der Anwesenden bei seinem Eintreten mit einem wissenden Lächeln. Ihre Reaktion hatte nichts mit ihm persönlich zu tun. Auf dem Land verstummten die Leute immer, wenn ein Fremder ihr Wirtshaus betrat. Und für Trost ging das Hinterzimmer der Tankstelle als Wirtshaus durch– als Wirtshaus mit Zapfsäulen.
Er griff nach einem Bier in der Kühlvitrine und ging damit zur Kasse, hinter der ein drahtiger Mann stand, der ihn mit Schlafzimmerblick, an dem seine Schlupflider schuld waren, stumm musterte. Während Trost bezahlte, wurden die Gespräche im Nebenzimmer wieder aufgenommen.
Als er sich zu dem Raum umdrehte, stellte er fest, dass die an drei Tischen stehenden Männergruppen anscheinend zusammengehörten, denn immer wieder kommentierte einer, was einer am anderen Tisch gesagt hatte. Trost fiel auch auf, dass die Gäste einander ähnlich sahen, als wären sie alle miteinander verwandt, was in kleinen Dörfern schon mal vorkommen konnte. Erneut lächelnd nippte er an seinem Dosenbier.
»Was gibt’s da zu grinsen?« Einer der Männer, ein mächtiger Kerl mit schulterlangem Haar, schwieligen Händen und schlechten Zähnen, kam näher.
Trost blickte auf und merkte in diesem Moment, dass das Bier ein Fehler gewesen war, spürte er doch immer noch den Wein.
Der Tankwart, dessen Adern sich jetzt auf seinen beeindruckend dicken Unterarmen abzeichneten, wandte sich dem großen Gast zu. »Lass gut sein, Harti. Reg dich ab.«
Der Kerl, der Harti genannt wurde, musterte Trost, verzog die Lippen und murmelte ein: »Holt di Goschn«, wobei unklar blieb, wem von ihnen die Bemerkung galt– Trost oder dem Tankwart–, ehe er sich davontrollte.
Die anderen schienen den kurzen Zwischenfall nicht bemerkt zu haben und unterhielten sich weiter. Trost hörte ihnen zu.
»Wird die Autobahn jetzt ausgebaut oder nicht?«
»Ich sag dir was, ganz sicher wird sie das. Denen da oben sind die Leut ja eh wurscht. Es schert sie einen Dreck, was wir wollen. Und ob da jetzt einer von denen tot ist oder nicht, ist auch egal. Da geht’s doch nur ums Geld.«
»Ja, aber die Bürgerversammlung werdens’ deshalb ja wohl nicht absagen, oder?«
Mittlerweile hatte sich der streitlustige Harti wieder zu ihnen gesellt. »Und? Was glaubst du, was die ändern wird?«, fragte er. »Glaubst du etwa, da hört dir jemand zu? Da reden doch nur die Großkopferten, irgendwelche Anwälte und gescheite Leut, und am Ende bist sogar noch für den Ausbau, weil sie dir das Gehirn gewaschen haben.«
»Geh bitte, hörts doch auf. Was redets denn da? Sicher haben wir noch eine Chance, wir dürfen jetzt nur nicht aufgeben.«
»Stimmt, wir müssen etwas tun.«
»Vielleicht noch jemanden umbringen?«
Stille. Alle Köpfe drehten sich in Trosts Richtung.