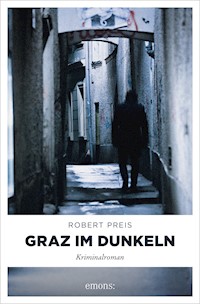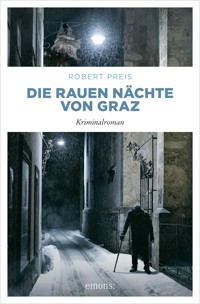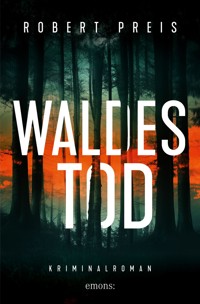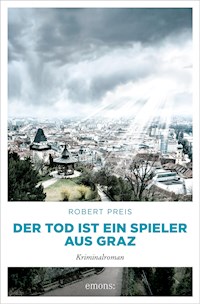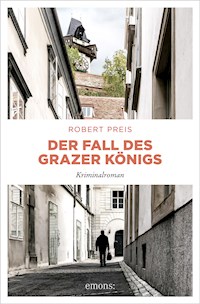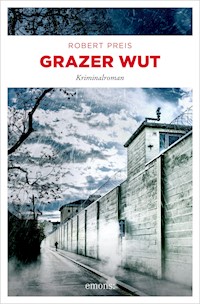
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Armin Trost
- Sprache: Deutsch
Ein pechschwarzer Alpenwestern. Mordermittler Armin Trost wird zum Spielball eines perfiden Racheplans: Während ein Schneesturm von biblischem Ausmaß Graz heimsucht, spült eine Gefängnisrevolte das versunkene Böse zurück an die Oberfläche der Gesellschaft. Wenig später wird Trost von Unbekannten entführt. Eingeschlossen in ein winterliches Bergdorf muss er einsehen, dass nicht nur sein eigenes Leben in Gefahr ist. Auch auf seine Familie haben es die Täter abgesehen. Und dann schnappt die Falle zu. Die Falle, die dem Ermittler den Verstand raubt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Preis wurde 1972 in Graz geboren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Publizistik- und Ethnologiestudium in Wien lebt er heute mit seiner Familie wieder in der Nähe seiner Heimatstadt. Er ist Redakteur einer Tageszeitung und hat zahlreiche Sachbücher und Romane geschrieben. In der Reihe seiner Graz-Krimis erschienen bisher: »Trost und Spiele«, »Graz im Dunkeln«, »Die Geister von Graz« und »Der Engel von Graz«.www.robertpreis.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2017 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Niki Schreinlechner, www.nikischreinlechner.at
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, Tobias Doetsch
Lektorat: Susanne Bartel
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-288-5
Originalausgabe
Mit Unterstützung durch das Land Steiermark
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Günter, der mich ins Geistthal lockteund dessen Begeisterung immer wieder ansteckend ist
Es gibt keinen schnelleren Weg in den Wahnsinn.
Seneca in »De ira« (Über die Wut)
Prolog
Landesgericht, Graz, Dezember 2012
»Eins, zwo … Können wir?«
Erst jetzt wurde die Diva mit der Löwenmähne und dem durchdringenden Blick des Signallichts an der Kamera gewahr. Ein eisiger Wind wehte, ihre Nase lief rot an. Doch sie ließ sich davon nicht aus der Fassung bringen und wischte sich noch schnell eine Strähne aus dem Gesicht.
Der Kameramann kontrollierte das Bild auf dem Display und betrachtete das im ganzen Land bekannte TV-Gesicht, das ihm auf dem Monitor entgegenblickte. Er bewunderte, wie die Frau es schaffte zu reden, ohne dabei ein einziges Mal zu blinzeln.
»Vor dem Landesgericht für Strafsachen in Graz ist der Medienrummel heute besonders groß. Zahlreiche Fernsehstationen und Journalisten aus dem In- und Ausland warten gespannt auf das Urteil eines der aufsehenerregendsten Fälle der vergangenen Jahre. Wird es vorweihnachtlich milde ausfallen? In wenigen Stunden wissen wir mehr, denn für den heutigen achten Verhandlungstag darf mit einer gerichtlichen Entscheidung gerechnet werden.«
***
Die barbarischen Zeiten, gekennzeichnet durch unbändige Wut und himmelschreiendes Unrecht, liegen hinter uns, dachte er bei sich. Folter und Todesstrafe sind längst abgeschafft.
Nur eingesperrt werden Menschen noch. In kleine, weiß verputzte Räume – ausgestattet mit Bett, Tisch und Klo. Das Einzige, was den so von der Außenwelt Abgetrennten dann noch aufrecht hält, ist der Umstand, dass es für das Eingesperrtsein ein Ablaufdatum gibt, denn jede Strafe hat schließlich ein Ende.
Jede?
Mit dieser zermürbenden Frage im Kopf betrat er den Großen Schwurgerichtssaal und spürte sogleich den strengen Blick des überdimensionalen Bundesadlers, der an der Wand hinter den drei Berufsrichtern angebracht war. Außerdem stellte er fest, wie nüchtern das Holz der Stühle, der Tische und die bis zur Mitte der Raumhöhe reichende Holzvertäfelung wirkten. Und wie kalt.
Er nahm kaum Notiz von den Menschen, die ihn aufmerksam beobachteten. Schon gar nicht von den zehn Geschworenen – fünf Männer und fünf Frauen –, die ihn wie eine Schaufensterpuppe betrachteten.
Er wusste, dass sie wie die meisten anderen Leute waren und ihn für grobschlächtig hielten; wegen der tellergroßen Hände und der Narbe, die sein Gesicht entlang der Nase bis zum rechten Mundwinkel teilte.
Aber er wusste auch um seine irritierende Ausstrahlung auf sie. Denn so aggressiv, so immerwährend wütend seine eine Gesichtshälfte wegen einer alten Verletzung erschien, so attraktiv und spitzbübisch freundlich zeigte ihn die andere.
Er wirkte unkalkulierbar. Wie Jekyll und Hyde, so gegensätzlich wie Tag und Nacht. Seine Wirkung konnte sich von einer Sekunde auf die andere ändern – je nach Perspektive.
Welche seiner beiden Seiten würde wohl heute zum Vorschein kommen? Würde ihm die eine schmeicheln oder ihn die andere vollends ins Verderben stürzen?
Egal, heute war der letzte Verhandlungstag, Richter und Geschworene waren zu einem Urteil gekommen, und auch das Murmeln der rund sechzig Zuhörer im bis auf den letzten Platz besetzten Gerichtssaal verriet, dass die Aufregung unter ihnen groß war.
Was würde er künftig in ihren Augen sein? Ein kaltblütiger Killer oder ein irres, nicht zurechnungsfähiges Monster?
Er ignorierte die Floskeln der Berufsredner. Wie sich Richter, Staatsanwalt und Rechtsanwalt Fragen und Satzkonstrukte zuwarfen, um sich gegenseitig noch einmal ihre unerschütterliche Kompetenz zu beweisen. Sogar sein eigener Anwalt, der während des Prozesses tatsächlich ab und zu den Eindruck erweckt hatte, ihn aus ehrlichem Antrieb aus dem Schlamassel boxen zu wollen, gab nur noch juridische Lippenbekenntnisse von sich.
»Nein, keine weiteren Zeugen.« – »Nein, wir haben dem nichts hinzuzufügen.« – »Ja, wir nehmen das Urteil zur Kenntnis.«
Was war denn schon großartig passiert? Sie hatten dieses dämliche Spiel gespielt, und jemand war besser als er gewesen. Da hatte er eben kurz die Waffe getauscht, statt Schaumstoff eine echte Klinge verwendet und seinen Gegner aufgeschlitzt.
Niemand hätte davon erfahren, wenn nicht ein paar Jugendliche im Wald herumgekrochen wären und ihn dabei beobachtet hätten. Und wenn er nicht gewesen wäre. Sein alter Freund, der Polizist. Dieser frustrierte Arsch mit seinem paragrafenschwangeren Scheißleben und seiner Ich-hab-dich-durchschaut-Miene.
Schuld, Unschuld, ein Leben mehr oder weniger. Meine Güte, na und?
Die Moralapostel taten so, als wäre er nicht ganz richtig im Kopf. Schon allein wegen der Tatsache, dass er bei dem Spiel mitgemacht hatte, bei dem man sich verkleidete, in eine andere Identität schlüpfte und sich dann bekämpfte.
Aber was war schon großartig dabei? Ja, gut, er hatte sich als Teufel verkleidet – als griechischer Hirtengott Pan, um genau zu sein –, hatte Leute erschreckt und tatsächlich ein paarmal die Klingen gekreuzt. Die Konkurrenz schlief bekanntlich nie. Auch nicht im Maskenland.
Aus diesem Grund war er immer wieder wie aus dem Nichts aufgetaucht. Hatte die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Und ein paar massakriert, was aber gewissermaßen ja auch zum Spiel gehörte. So hatten sie Ehrfurcht vor ihm, schließlich galt er seit Ewigkeiten als unschlagbar.
Meine Güte, na und? Viele Leute machten Live-Rollenspiele. Was glaubten die denn, wie oft dabei getrickst wurde? So häufig wie im richtigen Leben auch.
Auch Richter und Anwälte machten da mit. Vielleicht sogar einer von denen, die im Raum waren, der sich dafür spitze Ohren aufsetzte und verzweifelt versuchte, Elbisch zu reden.
Er grinste bei dem Gedanken. Was für Tölpel – Elben, das waren doch die Opfer des Spiels.
»Was amüsiert Sie daran so?« Die Stimme des Obersten Richters schnarrte durch den Saal, und er spürte, wie sich alle Blicke auf ihn richteten.
Er reagierte auf die Frage mit einem Schulterzucken, das einem trotzigen Kind zur Ehre gereicht hätte. »Nix«, sagte er leise.
»Wie bitte? Ich kann Sie nicht verstehen.«
Er blieb stumm, sah den Richter an, stach ihm mit seinem Blick ins Herz. Mehr noch, er wühlte damit in seinen Eingeweiden herum, bis dieser wegschaute. Jedenfalls wünschte er sich das, doch der Richter schaute nicht weg. Der Richter-Wichser schaute einfach nicht weg.
»Ich hab gesagt: ›Nix.‹ Soll ich dich aufschlitzen, oder was?«
Es wurde still. Kein Räuspern, kein Hüsteln war zu vernehmen, keine aufgebrachte Zurechtweisung ertönte.
Meine Güte, waren die alle verstockt.
Der Richter, den man immer mit »Herr Rat« anzureden hatte, dieser öde Kerl, der mit seiner pfeilspitz zulaufenden Nase, die wie ein ständiger Fingerzeig wirkte, wie ein Oberlehrer aussah, blickte ihn stirnrunzelnd an. Seine Augen waren blau wie der Himmel, aber kalt wie das Eismeer. Die hängenden Wangen und das kantige Kinn ließen ihn wie eine absurde Mischung aus einer Person von »Max und Moritz« und einer Bordeauxdogge wirken.
Wieder konnte er sich ein Lächeln nicht verkneifen.
Prompt erklang die schnarrende, überhebliche Stimme: Er möge aufstehen und hören, wie das Urteil ausgefallen war.
Der Stuhl, den er mit den Kniekehlen zurückschob, kratzte unangenehm laut über den Parkettboden. Ein Schweißtropfen kullerte zwischen seinen Schulterblättern hinab. Ein kleiner Beweis dafür, dass auch er Nerven zeigte.
Er konnte das Bild vom Eismeer nicht aus seinem Gedächtnis verdrängen. Er hatte es noch nie gesehen und stellte es sich glasklar vor. So klar, dass man Hunderte Meter bis zum Grund sehen konnte, und wenn man darin schwamm, musste das sein, als würde man schweben. Die Sehnsucht, die ihn plötzlich überkam, hätte ihn vor allen Leuten fast übermannt.
Reiß dich zusammen, du Arsch, wies er sich zurecht. Wenn du jetzt heulst, stecken sie dein Ich in einen Sack und werden ein Leben lang auf dir herumtrampeln.
Das Eismeer. Er hätte so gern die Welt gesehen. Die ganze Welt. Alles von ihr.
Doch stattdessen stand er dem Oberlehrer-Richter gegenüber. Wie der ihn jetzt anstarrte. Mit einem grimmigen Lächeln. Tatsächlich, die richterlichen vollen Lippen, die harmlos weich geschwungen durch die frische Rasur noch besser zur Geltung kamen, formten sich zu einer amüsierten Grimasse.
»Die barbarischen Zeiten liegen hinter uns«, sagte der Richter.
Er erschrak. Wie konnte er nur aussprechen, was er zuvor gedacht hatte?
»Nur eingesperrt werden Menschen noch. Und in Ihrem Fall ist das auch nötig. Für eine lange Zeit.« Er fügte hinzu, dass man dann sehen müsse, ob eine Besserung eintrete. »Sie werden gemäß den gehörten Gutachten unter ärztliche Obhut gestellt. Wir werden Sie beobachten. Menschen wie Sie muss man beobachten. Sollte sich an Ihrem Zustand nichts ändern, so ändert sich auch nichts an Ihrer Haft.« Alles andere sei bis auf Weiteres zu gefährlich. Die Strafe betrage also definitiv mehr als fünf Jahre. Es werde keine konkrete Dauer festgelegt, vielleicht würden sich die Jahre zu einer Ewigkeit ausdehnen.
Ewig.
»Ich möchte die Menschen vor Leuten wie Ihnen schützen und gebe hiermit dem Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für abnorme Rechtsbrecher statt. Die Sitzung ist beendet.«
Meine Güte, was sagte der Typ da? Die wollten ihn doch nicht für immer hinter Schloss und Riegel bringen, oder? Oder?
Der Anwalt erhob sich, schaute ihn flüchtig an, ja, plötzlich nur noch flüchtig, und drückte ihm die Hand.
»Wie lange sperrt ihr mich weg?«, fragte er.
Die Hand des Anwalts fühlte sich wie ein Feuchttuch an. Dann rauschte er, ohne eine Antwort zu geben, davon und ging in dem Getümmel der aufgesprungenen Zuschauer unter. Auch die Journalisten drängten aus dem Saal, damit sie mit der Urteilsverkündung bald überall für Schlagzeilen sorgen konnten, und die Jus-Studenten, die sich unters Publikum gemischt hatten, sprachen aufgeregt durcheinander und verabredeten sich im nächsten Gasthaus.
Verdammt, was hatte der Richter noch mal gesagt? Was bedeutete »ewig«? Wie lange musste er in diese Anstalt? Konnte er vorher noch mal nach draußen, an die frische Luft? Wartet, so wartet doch auf mich, verdammt!
Seine Hände wurden fest und unnachgiebig gepackt und an seinem Rücken zusammengedrückt.
Au!
Als sie den Mann hinausschoben, warf der noch immer fragende Blicke durch den Raum.
»Was soll das heißen? Seids ihr deppert? Wie lange sperrt ihr mich weg, will ich wissen!«
Er schien nicht zu begreifen, was soeben passiert war. Den Polizisten, die ihn hinausschoben, waren seine Schreie sichtbar unangenehm. Sie zischten ihm zu, damit aufzuhören, stießen leise Flüche aus und schoben ihn an den Handgelenken unsanft auf die Seitentür zu.
Doch der Verurteilte ließ sich nicht beruhigen. »Ihr Schweine!«, tobte er noch immer. Und: »Das zahl ich euch heim. Hört ihr? Ich zahl euch alles heim. Dafür …«
Sein Gesicht war rot angelaufen, und es hatte nicht den Anschein, als bestünde es noch immer aus zwei unterschiedlichen Hälften. Nur mehr eine Seite war sichtbar, die finstere, die hasserfüllte, die vor Wut entstellte. Seine Worte kamen nur noch unartikuliert aus seinem Mund, die Adern am Hals traten hervor, und die Wächter hatten alle Hände voll zu tun, ihn zu bändigen.
Die letzten Zuschauer, die sich noch im Gerichtssaal befanden, starrten ihm fasziniert nach. Seine Wut, die Inhalt ihrer Gespräche sein würde, zog sie an und stieß sie zugleich ab. Die Wut eines anderen war immer ein Gesprächsthema, vor allem, wenn sie hautnah miterlebt wurde.
Als die Seitentür ins Schloss fiel, verstummte das Gebrüll abrupt. Die meisten der Anwesenden waren überzeugt davon, dass der Verurteilte jetzt zunehmend unsanft zur Räson gebracht werden würde. Hinter verschlossenen Türen wurden die Zügel der Gewalt stets gelockert.
Im Schatten der hintersten Reihe wartete Armin Trost regungslos, bis er der Letzte im Gerichtssaal war. Keine Gemütsregung war auszumachen, kein Muskel in seinem glatt rasierten Gesicht bewegte sich.
Erst sein tiefes Durchatmen bewies, dass er doch keine Statue war. Langsam richtete er sich auf, wobei seine vom langen Sitzen steif gewordenen Gelenke knackten. Noch vor ein paar Wochen hatte er seinen Job an den Nagel hängen wollen, aber dann war ihm dieser Fall dazwischengekommen. Und jetzt? Er ging bis zur Anklagebank vor, als erwartete er, dort eine Antwort zu finden.
Seine kräftigen Finger krallten sich um die Lehne jenes Stuhls, in dem zuvor der Mann mit den zwei Gesichtern gesessen hatte. Kurz schloss er die Augen. Er sah die tiefe Kerbe einer Schnittwunde vor sich, die den Mann entstellte. Als er die Augen wieder öffnete, stand der Oberste Richter vor ihm. Trost bekam beim Anblick seiner eisblauen Augen Fernweh und wusste nicht, warum.
»Was man nicht im Kopf hat …« Der Rat griff nach einer Aktenmappe, die er offenbar vergessen hatte, und rauschte wieder aus dem Saal, wobei sich sein Talar unvorteilhaft bauschte. An der Türschwelle drehte er sich noch einmal um, musterte Trost und sagte: »Sie und Ihre Leute haben gute Arbeit geleistet, Herr Chefinspektor. Verrückte Typen wie der sind wirklich eine Gefahr.«
Um das Gerichtsgebäude verlassen zu können, musste Trost den Flur entlanggehen, wo sie ihn bereits erwarteten. Mit Mikrofonen und Notizblöcken bewaffnete Presseleute, die ihn mit Fragen bombardierten. Wie es ihm jetzt gehe, nachdem der Mörder verurteilt sei. Und ob er zufrieden damit sei, dass er in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht werde.
Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, Journalisten so gut es ging zu ignorieren, blieb Trost stehen und musterte die Runde. In der Frau, die ihm ein Mikro unter die Nase hielt, erkannte er eine TV-Reporterin. Im Fernsehen sah sie hübscher aus.
Er dachte daran, dass die Realität generell weniger aufregend als die Vorstellung davon war. Alles war nur aufbereitet und zurechtgerückt, Bilder, Filme, Träume. Die Wirklichkeit war immer hässlicher. Und schon war es passiert. Schwermut erfasste ihn wie eine Welle und spülte alles aus ihm heraus, was tolerant und gutmütig war. Was blieb, war ein undefinierbarer Grimm.
»Das kommt darauf an, wie es weitergeht«, knurrte er grantig. »Sollten ihm die Ärzte eines Tages bescheinigen, wieder normal zu sein, dann bin ich nicht zufrieden.«
Ob er den Ärzten so etwas zutraue, hakte die Reporterin nach. Sie war stark geschminkt und hatte sich schon während der wenigen Sekunden, die ihre Unterhaltung dauerte, mehrmals eine lästige Haarsträhne aus dem Gesicht gewischt.
»Ich traue grundsätzlich allen Leuten alles zu. Und wer mit Verrückten arbeitet, ist nicht davor gefeit, selbst eines Tages verrückt zu werden, oder?«
Allgemeines Gelächter folgte.
»Sie halten Ärzte also für verrückt?«
Er hatte diese Art der Fragerei so was von satt.
Die Frau blinzelte nicht ein einziges Mal.
»Manche sind genauso verrückt wie viele Journalisten.«
Wieder Gelächter, wenn auch verhalteneres.
»Und Polizisten? Sind die davor gefeit?«
Er musste zugeben, dass diese Erwiderung mutig war, und bemerkte in diesem Moment, was für einen Blödsinn er zuvor von sich gegeben hatte. Blödsinn, den sie schreiben würden oder bereits live gesendet hatten.
Trost starrte auf das rote Signallicht einer Kamera, die auf ihn gerichtet war, und zwang sich zu einem souveränen Lächeln, das nicht zu seinem unergründlichen Antlitz passte. »Polizisten verlieren in der Regel nicht den Verstand. Und wenn doch, dann nur, wenn ihn die Welt schon lange zuvor verloren hat.« Das klang doch gut. Kryptisch.
Erneutes Lachen.
Trost bedankte sich, drehte sich um, um endlich das Gericht zu verlassen – und stieß mit einem Mann zusammen.
Der andere verlor das Gleichgewicht, stolperte und stürzte rücklings auf den Boden, wobei seine Brille verrutschte. Einen Moment lang sah er schrecklich verloren aus, wie ein verwirrter Professor, der nicht wusste, was er zuerst tun sollte: wieder aufstehen oder doch lieber den Gedanken zu Ende denken, der ihn gerade noch beschäftigt hatte.
Trost reichte ihm die Hand und zog ihn wieder auf die Füße. Ein Blitzlichtgewitter setzte ein.
»Tut mir leid«, murmelte Trost. An die Journalisten gewandt sagte er laut: »Sie sind hoffentlich kein Arzt, der leicht umfällt?« Dabei tippte er sich mit unmissverständlicher Geste an die Stirn. »Also bitte, stellen Sie keine verrückten Diagnosen über verrückte Leute. Die sollen schließlich bleiben, wo man sie hinsperrt. Wie übrigens die meisten irren Irrenärzte auch.«
Die Kamera hielt drauf. Das Bild von Trost mit dem kleinen Mann an seiner Seite, dessen Brille noch immer schief saß, könnte es in den nächsten Tagen auf die Titelseiten schaffen.
Er ließ sein Lächeln noch für zwei, drei Sekunden gefrieren, dann machte er sich endlich aus dem Staub.
Doch so schnell sollte Trost nicht davonkommen. Als er sich dem Ausgang des Gerichtsgebäudes näherte, fiel ihm der gedrungene Kerl, der dort auf ihn wartete, zunächst gar nicht auf.
Dessen aknenarbiges Gesicht war bereits rot angelaufen, als er Trost gewahr wurde. Schroff schubste er seine Begleiterin in ihren hochhackigen Schuhen zur Seite. Doch die Behandlung schien die junge Dame, die ihren mageren Körper in einen weiten Pelzmantel gehüllt hatte und an deren Hals trotz des Make-ups Pickel zu erkennen waren, nicht besonders zu stören. Sie wühlte unbeirrt weiter in ihrer silbern glitzernden Handtasche, offenbar auf der Suche nach einem Feuerzeug, denn in ihrem Mundwinkel steckte eine Zigarette. Ganz undamenhaft maulte sie: »Ja, hau dem Oasch ane aufs Maul.«
Doch nichts dergleichen geschah.
Als der Kerl auf Trost zustürmte und ihm den Zeigefinger gegen die Brust drückte, waren zwei Beamte, die den Eingang sicherten, sofort zur Stelle.
»Pass auf, was du jetzt sagst«, raunte einer der Polizisten dem gedrungenen Schnauzbartträger zu, der sich auf die Zehenspitzen stellte, um mit Trost annähernd auf Augenhöhe zu sein.
Der etwas zu füllige Kerl mit der gewaltigen Knollennase und einem Haarschnitt, wegen dem man seinen Friseur verklagen sollte, schnappte nach Luft. Er sah aus, als hätte ihm jemand einen Kochtopf aufgesetzt und einfach an der Unterseite einmal herumgeschnitten. Wie die Tonsuren im Film »Im Namen der Rose«. Noch immer drückte sein Zeigefinger schmerzhaft gegen Trosts Brust.
»Ich sag … eines Tages. Sonst nix, aber das sag ich: Eines Tages wird es passieren.« Sein Blick ruhte so lange auf Trost, bis dieser wegschaute und weiterging, als wäre nichts gewesen.
Doch eines wusste der Ermittler nun ganz genau: Auch manche Menschen, die nicht in eine Anstalt gesperrt wurden, hatten nicht alle Tassen im Schrank.
Als Trost wenig später die Conrad-von-Hötzendorf-Straße entlangmarschierte, konnte er regelrecht spüren, wie hinter ihm das Gerichtsgebäude immer kleiner wurde. Mit jedem Schritt entspannten sich seine Rückenmuskeln ein wenig mehr. Dafür nahm eine neue Anspannung zu. Er musste ein passendes Weihnachtsgeschenk für seine Frau und die Kinder finden.
Und so verdrängte sein Gedächtnis bald die Worte des Mannes, wenngleich er schon ahnte, dass er sich irgendwann wieder an sie erinnern würde. Was immer eines Tages passieren sollte. Es würde passieren. Eines Tages.
Trost war bereits hinter einem Häuserblock verschwunden, als im Flur des Gerichts das Signallicht der Kamera erlosch.
»Alles im Kasten?«
»Alles im Kasten.«
»War ich gut?«
»Okay.«
»Nur okay?«
»Nein, eh gut. War’s das jetzt bis Weihnachten?«
»Weihnachten? Scheiße, was ist das noch mal?« Wieder eine Strähne, die ihr ins Gesicht hing.
Ein Sturm kommt auf
Jahre später
1 Die ersten Vorboten des nahenden Schnees nennt man hierzulande Flankerl. Zarte Flankerl wurden also vom Wind zu lustigen Wirbeln gedreht und landeten auf der klaffenden Kopfwunde der Frau.
Dabei hatte der Tag so wunderbar begonnen.
Weihnachtszeit in Graz, in der Stadt mit dem schönsten Adventmarkt Österreichs, wie eine Umfrage unter Touristen vor Kurzem ergeben hatte. Wobei die Verwendung des Singulars in diesem Fall etwas untertrieben war, bestand doch die halbe Grazer Innenstadt quasi aus einem riesigen Adventmarktzentrum.
In den engen Gassen und auf den gepflasterten Plätzen des UNESCO-Weltkulturerbes waren die Holzhütten in kleinen Grüppchen arrangiert. Die Standbetreiber boten neben Schilcher-Glühwein und Langos auch noch Selbstgestricktes und Glasperlen an – wobei jeder wusste, dass die Kunsthandwerker lediglich die Legitimation für das öffentliche Saufgelage darstellten, das sich während der stillsten Zeit des Jahres auf dem Hauptplatz, dem Franziskanerplatz, im Joanneumsviertel, am Eisernen Tor und auf dem Schloßberg abspielte. Ein Saufgelage für Tausende und Abertausende Besucher.
Sie quetschte sich nicht in die Zahnradbahn, um den Markt in den Kasematten des Schloßbergs zu sehen. Sie war ja keine vertrottelte Touristin. Auch die süßen, mit Rum versetzten Punschgetränke, die es vor dem Rathaus gab, ersparte sie sich und bemitleidete die Trinker für deren Kopfweh am nächsten Tag.
Zusammen mit ihrem Mann hatte sie an den vergangenen Wochenenden den viel kleineren, aber beschaulicheren Märkten in der Umgebung einen Besuch abgestattet, in der Weihermühle von Gratwein, in Kainbach, Stainz und Hitzendorf. Dem Massenauflauf in Graz wollte sie wenn möglich aus dem Weg gehen.
Dennoch war es einmalig, montags ganz allein durch die Grazer Häuserschluchten zu flanieren und den Duft von Zimt und Vanillezucker einzuatmen. Wie bestellt hielt sich der Smog hartnäckig, und es blieb grau und trüb. So kam die bunte Weihnachtsbeleuchtung in den Auslagen erst richtig zur Geltung.
Für ihren Johann hatte sie bereits Pyjama und Eau de Toilette beim Kastner in der Sackstraße besorgt. Das war genug. Ihr Mann schenkte ihr zu Weihnachten stets eine kurze Städtereise, die er schon für Mitte Jänner buchte. So war die Vorfreude bereits am Heiligen Abend groß. Wo würde es heuer hingehen?, überlegte sie. Amsterdam? Paris? Wolgograd, das ehemalige Stalingrad?
Sie musste schmunzeln. Das war ein Faible vom Hansi, sich Kriegsschauplätze anzuschauen. Da leuchteten seine Augen immer wie die kleiner Buben, wenn sie Lego-Polizeistationen oder Spielzeugpistolen geschenkt bekommen. Das hatte sie bei ihrer Schwägerin gesehen, die drei Kinder hatte. Sie und Hansi hatten keine. Kinder. Spielzeugpistolen auch nicht. Gott sei Dank.
Aber konnte man Wolgograd überhaupt noch anschauen? War das nicht total zerstört worden? Bei den unweihnachtlichen Gedanken schüttelte sie den Kopf.
Mit ihrem Johann hatte sie es gut getroffen. Eine Führungskraft mit fixen Arbeitszeiten, ein Mann, der zu genießen verstand, auf sein Äußeres achtete und jenes seiner Frau sehr zu schätzen wusste. Dass sie keinen Nachwuchs hatten, tat ihrer Lebensfreude gerade in der Weihnachtszeit keinen Abbruch. So hatte sie weniger Stress mit dem Besorgen von Geschenken und mehr Zeit für sich. Zum Beispiel für eine Feuerzangenbowle mittags und ein Glaserl Sekt im »Kaiserfeld« oder im Operncafé am Nachmittag.
Das Einzige, was sie störte, war der Weihnachtsmann, der ihr dauernd nachstellte.
Natürlich war es nicht immer derselbe Weihnachtsmann, das wäre ja noch schöner gewesen. Obwohl sie sich nicht hundertprozentig sicher sein konnte, diese Typen schauten ja alle gleich aus. Aber wenn es nicht derselbe war, dann war das Vorkommen der Weihnachtsmänner in dieser Anzahl allein schon empörenswert. Sie nahm sich vor, am Abend einen Leserbrief an die »Große Tageszeitung« zu schreiben. Im katholischen Graz gab es das Christkind und keinen Weihnachtsmann. Der sollte von ihr aus in der Cola-Werbung auftreten und in Amerika, Deutschland oder sonst wo bleiben, aber nicht in Graz.
Nicht, dass sie besonders gläubig gewesen wäre, ganz und gar nicht, sie gingen ja nicht einmal zu Weihnachten in die Mette, dennoch bestand sie auf das echte Weihnachten, das keiner Verkaufsveranstaltung ähnelte. Reichte es denn nicht, dass das melancholische Allerheiligen mit seinen Kerzen, dem ersten Jungwein und den Kastanienschalen, die auf den Gehsteig fielen, schon seit Jahren mit dem bizarr-schrillen Halloween konkurrieren musste? Mit »Süßes oder Saures« drohenden Teufelsfratzen? Musste man jetzt auch noch Weihnachten verfremden?
Als sie zwischen den Hütten von einem »Last Christmas« zum nächsten flanierte, glaubte sie, den roten Mantel und die lächerliche lange Mütze immer wieder auftauchen zu sehen. Aber sie konnte sich natürlich täuschen, zu dieser Jahreszeit war schließlich alles bunt und schillernd.
Im Bus täuschte sie sich dann nicht mehr. Ein Weihnachtsmann saß ihr gegenüber und döste vor sich hin. Er trug keinen Bart, sah jugendlich aus und dürfte schon einiges getrunken gehabt haben. Seine Mütze war ihm wie ein Basecap über die Stirn gerutscht, und er schnarchte. Plötzlich bekam sie Mitleid mit den Weihnachtsmännern von Graz. Es schien, als wären sie entweder nur verkleidete Besoffene oder Männer, die für einen Hungerlohn in irgendeinem Kaufhaus Zuckerl verteilen und sich zum Affen machen mussten.
Sie begann zu kichern. Mitleid mit dem Weihnachtsmann, das war lustig.
Als der 85er-Bus an der Endstation stehen blieb, stieg sie aus und ging die Plabutscherstraße entlang bis zu ihrem Haus. Ein Haus mit Garten und Garage in dieser Gegend von Graz, dachte sie lächelnd. Ja, mit ihrem Hansi hatte sie Glück gehabt.
Sie öffnete die Gartentür, während sie »Last Christmas« vor sich hin pfiff und sich sogleich zurechtwies, weil ihr der Ohrwurm einfach nicht aus dem Kopf gehen wollte. Da sah sie aus den Augenwinkeln eine rote Mütze auf sich zustürzen.
Und jetzt die zärtlich kühlenden Flankerl. Wie schön. Dabei waren für Graz grüne Weihnachten vorhergesagt worden. Wie fast jedes Jahr.
Sie versuchte, sich aufzurichten, doch der Kreislauf spielte ihr einen Streich. Ihr war so schwindelig, dass nichts in ihrer Umgebung sie an ihr Haus oder ihren Garten erinnerte. Nicht einmal an ihre Stadt. Nur Bäume um sie herum und ein schmaler Forstweg.
Sie wollte etwas sagen, hatte es aber im nächsten Moment schon wieder vergessen. Wollte sie um ihr Leben flehen? Aber warum?
Das Duo »Wham!« tauchte vor ihrem geistigen Auge auf, der Blonde mit der Dauerwelle und der andere an der Gitarre, von dem man später nur noch selten etwas hören sollte. George und Andrew. Prompt vernahm sie schon wieder die ersten Klänge des Refrains von »Last Christmas« und sah einen Weihnachtsmann, der zu einem Lieferwagen ging, kurz einstieg und das Radio ausschaltete.
Die Musik verstummte augenblicklich, auch wenn sie nicht mit Bestimmtheit hätte sagen können, ob nicht noch ein letztes Echo aus dem Wald zurückgeworfen wurde.
Die darauffolgende Stille war einen Moment lang wohltuend. Aber nur einen Moment lang. Dann flößte sie ihr Angst ein.
Sie blickte an sich hinunter und konnte nicht glauben, was sie sah. Ihr Mantel, der wunderschöne schwarze mit dem unechten Pelzkragen, war verschmutzt. Erde und Staub klebten an ihm – sie lag tatsächlich auf dem Boden eines Waldweges. Wann hatte sie jemals auf dem Boden gelegen?
Ihre Hände waren an den Innenflächen aufgeschürft und zitterten. Erst als sie ihren Kopf abtastete, kehrte jener Schmerz zurück, vor dem ihr Bewusstsein offenbar in die Ohnmacht geflüchtet war.
Sie erinnerte sich: an die Schläge und Tritte des Weihnachtsmannes. Er hatte sie an den Haaren mit sich gezerrt und in den Lieferwagen geworfen. Alles war so schnell gegangen. Alles war so schmerzvoll gewesen.
Nach einer halben Ewigkeit in völliger Dunkelheit und einer holprigen Fahrt, die mit Sicherheit blaue Flecken zur Folge haben würde, war die Schiebetür aufgegangen, der Grobian hatte sie wieder an den Haaren gezogen, neuerlich nach ihr getreten und sie auf die Straße geworfen.
Meine Güte, Johann, wo bist du? Hast du gesehen, was der mir angetan hat? Den musst du einsperren.
Sie dachte daran, dass sie stets auf ihr Äußeres Wert legte, auf eine schöne Wohnung, ein schönes Leben, auf schöne Weihnachten. Mit einem selbst gebundenen Adventkranz und dem gemütlichen Beisammensein mit Freunden bei Hot Aperol und Vanillekipferln am Sonntag.
Gestern war der vierte Adventsonntag gewesen, heute somit Montag. Als befürchtete sie, ihr Gehirn könnte sich abschalten, war ihr die zeitliche Bestimmung des Jetzt plötzlich wichtig. Nur noch ein paar Tage bis zum Heiligen Abend. Dann würden sie und Johann Eierlikör und vielleicht einen Schnaps gegen das Sodbrennen trinken.
Die Frau blinzelte fassungslos. Die Ahnung, dass dies alles bald nicht mehr von Bedeutung sein würde, stieg in ihr auf. Wenn sie nur verstehen könnte, warum.
Sie befanden sich am Rande eines ihr fremden Dorfes, so viel konnte sie jetzt erkennen. Vor ihr stand eine Scheune, die Bretter waren bereits morsch, dahinter begann der Wald.
»Lassen Sie mich gehen«, brachte sie hervor, doch mit jedem Wort ging ein ganz spezieller Kopfschmerz einher, der sich so anfühlte, als würde jeder Laut ein anderes Nervenbündel verärgern.
Als sie abermals an den Haaren emporgerissen wurde, konnte sie den Schmerz nicht fassen, so entwürdigend und pietätlos war er. Ja, pietätlos. Mit ihrem Haar hatte sie immer ein Heil. Sprays gehörten zur Grundausstattung, Wind hasste sie, weil er Strähnen löste und sie ihr ins Gesicht blies. Jetzt griff ihr jemand in die Locken und zerrte daran. Zerrte damit auch an ihrer Kopfhaut und löste damit einen Schmerz aus, der ihr hinter die Augen schoss. Sie brüllte. Um Himmels willen, der riss ihr noch die Kopfhaut ab. Doch alles Flehen und Bitten blieb ungehört. Hinter dem Tränenschleier glaubte sie, ganz in der Nähe Licht aufflammen zu sehen. Ein Hoffnungsschimmer glomm auf, vielleicht würde ein Bewohner der umliegenden Häuser aus dem Fenster sehen. Sie schrie um Hilfe, doch das Licht erlosch wieder, und sie wurde fortgezogen, in die Scheune hinein.
Ihre Bluse war zerrissen, die schöne, neue, beige Bluse, die sie erst vergangene Woche erstanden hatte. Sie konnte sich nicht erinnern, dass sie in den letzten Jahren auch nur eins ihrer Kleidungsstücke jemals derart ruiniert hatte.
Sie zwang sich, nicht weiter daran zu denken. Sie musste herausfinden, was dieser Weihnachtsmann von ihr wollte, und ihn beruhigen. Ihn in ein Gespräch verwickeln. Vielleicht überreden, mit ihr ein Glas Grauburgunder zu trinken. Sie würde den Wein mit einem Schluck leeren, vielleicht betäubte das den Schmerz ihrer in Mitleidenschaft gezogenen Kopfhaut.
Am Boden liegend und hustend beobachtete sie, wie sich die schwarzen Stiefel des Fremden wieder näherten. Erneut umfasste er ihren Kopf und stülpte etwas darüber, das kurz darauf an ihrem Kehlkopf kratzte. Als er daran zog, wurde ihr Hals unsagbar eng, sodass ihr die Zunge aus dem Mund quoll.
Sie bekam keine Luft mehr. Wurde am Hals hochgezerrt, verlor den Boden unter den Füßen. Spürte, wie das eigene Gewicht ihr die Luft zum Atmen nahm. Nur noch ihre Zehenspitzen berührten den Boden.
Verzweifelt versuchte sie mit ihren Händen, das, was ihren Hals umschlang, zu lockern.
Als verstünde ihr Peiniger ihre Qual, gab er etwas nach und ließ sie ein Stück hinunter. Die Füße der Frau ertasteten den Boden, mit zitternden Knien fand sie Halt, während sie nicht verhindern konnte, dass ihre Blase sich entleerte. Die Luft, die sie gierig in sich einsog, schmerzte mit jedem Atemzug. War das ein Haarbüschel neben ihren Fußspitzen?
»Bitte nicht«, weinte sie. »Sagen Sie mir, was Sie wollen. Aber tun Sie mir nicht mehr weh, bitte.«
Sie starrte den Weihnachtsmann an, dessen Maskierung sie jetzt endgültig als Tarnung zur Kenntnis nahm. Sein weißer Rauschebart hing lose hinab, sogar das Band, an dem er befestigt war, war sichtbar. Die Mütze war verrutscht, und ein Stoffzipfel lugte unter seinem Mantel hervor. Vermutlich gehörte er zu jenem Polster, der für seinen dicken, gemütlichen Bauch verantwortlich war.
Doch es war nicht die Erscheinung, die ihr Verstand so verzweifelt einzuordnen versuchte. In seinen Augen sah sie ihr Spiegelbild und glaubte zu träumen. Das konnte einfach nicht wahr sein. Das war sie? So also sah ihr Ende aus.
»Frohe Weihnachten«, dröhnte eine tiefe Stimme höhnisch, dann zog sich die Schlinge um ihren Hals neuerlich zu. Diesmal fester. Unnachgiebiger.
Hansi …, dachte sie noch.
2 Fast gleichzeitig blinkte das Display seines Handys in der Jacke, doch Armin Trost bemerkte es nicht. Wie auch? Es war auf lautlos gestellt.
Allerdings hätte er das Klingeln dort, wo er sich gerade aufhielt, ohnehin nicht gehört. Ein Schrei aus Hunderten Kehlen rollte mit jedem neuen Angriff über ihn hinweg. Wie eine Glocke stülpte sich das Flutlicht über das durch weiße Linien markierte Feld. Was für ein Traum.
Denn natürlich war das ein Traum. Seit Jahren schon ging er nicht mehr auf den Fußballplatz.
Spannend werden Träume aber erst, wenn man sich ihrer bewusst wird. Wenn man sich zurücklehnt, die Bilder seines Unterbewusstseins zu deuten versucht und überlegt, was sie einem mitteilen wollen.
Da saß Trost also im Stadion. Der Leiter der Ermittlungsgruppe Leib und Leben, umgangssprachlich Mordgruppe genannt, der vehementeste Gegner des Bösen, und fieberte inmitten eines Rudels Roter Teufel dem Sieg entgegen. Rote Teufel, der Name der Fans des Grazer Athletiksport Klubs, dessen Farben Rot und Weiß waren.
Ein Verein mit einem unwürdigen Schicksal: 1902 gegründet, ehemals Meister, Cupsieger und Champions-League-Teilnehmer, stolperte er in den letzten Jahren von einer Kuhweide zur nächsten, durch die untersten Fußballklassen Österreichs, die die untersten der ganzen Welt sein mussten. Die Spieler tingelten durchs Land wie die Mitglieder eines maroden Wanderzirkus, weil ein Finanzskandal den Klub vor Jahren deklassiert und zurück in die Niederungen des Sports gezwungen hatte. Aber auch grundsätzlich war es Trosts unwürdig, hier zu sitzen. Natürlich war es nur ein Traum, dennoch hätte man meinen können, jemand wie er würde ständig über einem Fall brüten. Ständig grübeln und forschen und nachdenken und beinharte Verhöre führen. Selbst dann noch, wenn er eigentlich schlief.
Er konzentrierte sich. Worauf lief das also hinaus? Er blickte sich lächelnd, fast selig um, bis ihn eine Stimme aufschreckte.
»Hör auf damit. Du starrst schon wieder Leute an und versuchst, sie zu analysieren.«
Der Mann an seiner Seite grinste. Seine Wangen bewegten sich kaum, so klein war sein Mund in dem massigen Gesicht. Seine Zurechtweisung kümmerte Trost nicht besonders, viel eher weckte die Tatsache sein Interesse, dass er sich so detailreich an Johannes Schulmeisters Züge erinnern konnte. Es war immerhin schon mehrere Monate her, dass sein Kollege spurlos verschwunden war.
Schulmeister beobachtete ihn eine Zeit lang von der Seite, ehe er sich wieder auf das Fußballspiel konzentrierte. »Kennst du das alte Stadion der Roten überhaupt noch?«
»Sicher«, erwiderte Trost und musste schmunzeln. Gleich würde sein Kollege wieder zu dozieren beginnen. Das hatte weniger damit zu tun, dass er fast zwanzig Jahre älter war als er, sondern war Resultat einer angeborenen Veranlagung. Schulmeister hatte seinem Namen stets alle Ehre gemacht und aus seinem Wissen keine Mördergrube. Bestimmt hatte er jeden Tag bis spät in die Nacht gelesen oder ZDF History geschaut, sonst wäre es unerklärbar gewesen, woher er ständig seine Weisheiten nahm.
»Wennst denkst«, hob er prompt an, »hat alles mit einem Medizinstudenten angefangen. Der hat aus Prag einen Ball mitgebracht und ein paar Freunde um sich geschart. Auf einer Wiesn am heutigen Messegelände hat er ihnen das neue Spiel erklärt, und ein Jahr später, Ende des 19. Jahrhunderts, fand im Stadtpark das erste offizielle Fußballmatch auf österreichischem Boden statt.«
Trost driftete ab. Was redete Schulmeister da wieder für ein Zeug? Und was machte er überhaupt hier?
Er war hin- und hergerissen zwischen der Freude, seinen Kollegen endlich wiederzusehen, und dem Ärger darüber, dass der Kerl sich prompt als personifizierte Wikipedia aufspielte. Der Nachteil an der schulmeisterlichen Variante der Internetenzyklopädie war noch dazu, dass sie Wissen ausspuckte, das man gar nicht wissen wollte. Schulmeister plapperte einfach drauflos, und niemand konnte sagen, ob aus Angeberei oder einfach nur aus einem Drang heraus. Sicher war: Der Kollege würde regelrecht platzen, könnte er sein Wissen nicht ausplaudern. Selbst im Traum.
»Und 1902 wurde dann der Athletiksport Klub gegründet …«
Irgendetwas stimmte hier nicht. Trost blickte sich um und sah einen Mann, der ebenfalls kein Interesse an dem Spiel zu haben schien. Stattdessen nahm der andere ihn und Schulmeister ins Visier. Eine Sekunde lang fixierten sie einander, dann riss der Fremde seinen Mund so weit auf, als säße er beim Zahnarzt. Der Unterkiefer spannte seine Gesichtshaut, seine Miene verzerrte sich.
»Heast, du hast ja ein Geschichtsbuch mitgebracht!«, rief nun jemand von hinten.
Trost drehte sich um. Es war ein kantiger Typ mit hellen Augen, der für sein Wortspiel prompt ein paar Lacher erntete. Der Mann streckte ihm die Zunge entgegen und rollte mit den Augen wie jemand, der den Verstand verloren hatte.
Was ging hier vor?
Der Platzsprecher leierte ein paar Autokennzeichen herunter und erinnerte die Lenker daran, dass ihr Fahrzeug demnächst abgeschleppt werden würde, wenn sie es weiterhin vor den diversen Einfahrten und in den Halteverbotszonen im Umkreis des Stadions stehen ließen.
Wieder Schulmeister: »Der Koleznik, das war einer. So wie der Stering auch. Und der Gamauf. Und der … na … jetzt will mir der Name wieder nicht einfallen. Das waren damals halt noch Typen. Die sind Cupsieger geworden. 82. Das werde ich nie vergessen.«
Neuerlich unterbrach der Platzsprecher Schulmeisters Vortrag. »Tooor, Tooor!«
Sie umarmten einander. Lachten. Jubelten. Und als sie sich im Lärm des Siegestaumels kurz in die Augen sahen, hatte Trost plötzlich eine schreckliche Gewissheit. Er hatte ihn bemerkt. Hinter den Pupillen lauernd. Schwarz und leblos. Den Tod.
Rasch schaute er weg, wollte sich aber nichts von seinem Schrecken anmerken lassen und betrachtete wieder die Profile der Umstehenden.
Doch als sich drei Reihen vor ihm eine Männerrunde mit beginnenden Glatzen zu ihm umdrehte, erschrak er erneut. Die drei mittelalterlichen Herren musterten ihn Grimassen schneidend. Sie hätten albern ausgesehen, hätten sie ihre Fratzen für ein Kind geschnitten, aber hier, im Stadion, in einem Traum, wirkten sie gruselig.
Trost schauderte, als er nun auch im Stehplatzsektor Zuschauer bemerkte, die zu ihm herüberstarrten.
Ja, es war deutlich zu sehen. Jetzt senkten sie ihre soeben noch geschwungenen Fahnen und blickten ihn geradewegs an.
Plötzlich verdrehte jemand seinen Kopf auf dem Hals, das Gesicht einer Frau, die nahe bei ihm stand, verschwand und wich einer augen- und nasenlosen Fläche, so als hätte es jemand wegradiert.
Trost sprang auf. Wie kam er nur wieder heraus? Aus dem Stadion? Aus dem Traum?
Wie um die Dramatik der Situation zu untermalen, fuhr in diesem Moment eine Kolonne an Polizeiwägen vorüber. Ihre blinkenden Blaulichter erhellten das von bengalischen Feuern eingenebelte Stadion wie das zurückgeworfene Licht einer Discokugel, und der aufgeregte Ton der Martinshörner vermischte sich mit dem Lärm der Zuschauer.
Doch Trost achtete auf nichts davon, schrie stattdessen auf, als er bemerkte, wie Schulmeisters Augäpfel rollten und ein schrecklich ausdrucksloses Weiß in den Höhlen zurückließen. Einige Menschen in seinem Block drehten sich verärgert um, manchen von ihnen fehlten Teile des Kopfes, als wären sie nichts weiter als unvollständige Erinnerungen oder unfertige Computer-Renderings.
Trost drängte sich durch die Sitzreihe und achtete darauf, die Leute nicht direkt anzusehen. Es schien, als würde jeder Einzelne von ihnen nach und nach die Kontrolle über sein Äußeres verlieren.
Als eine Frau hysterisch lachend kreischte, hob er doch den Kopf und sah, wie sie sich dabei krümmte, als litte sie unter extremen Schmerzen. Ihr Mund war so weit aufgerissen, dass sich das Fleisch ihrer Wangen in groteske Falten legte, in denen ihre Nase vollends verschwand. Ein Mann an ihrer Seite streckte Trost wieder die Zunge entgegen.
Verlor er den Verstand? Trost hastete weiter.
»Warum hebst du nicht ab?«, rief eine Stimme, die er, vielleicht weil sie aus dem Lautsprecher kam, nicht zuordnen konnte.
Trost zwängte sich weiter an den Beinen der Sitzenden vorbei. Unterdrückte aufsteigende Panik.
Als er endlich das Stadionareal verließ, hatte er schon das Handy am Ohr, Schulmeisters weißen Blick noch immer vor Augen.
Die Stimme dröhnte neuerlich an seinem Ohr, diesmal allerdings nicht die des Stadionlautsprechers. »Warum hebst du nicht ab, Armin? Spinnst du? Jetzt komm schon, wach endlich auf.«
Balthasar Gierack, wer sonst? Sein Chef, der aus jeder Mücke einen Elefanten, wenn nicht gar Dinosaurier machte. Und war der erst einmal groß genug, zwängte Gierack sich vor die Fernsehkameras, um von ihm zu berichten. Trosts Vorgesetzter war ein Typ, der im Rampenlicht stehen musste. Der schon als Kind Chef hatte werden wollen, egal von was. Hauptsache, Bühne, Hauptsache, vorne.
Ein weiteres Tor musste gefallen sein, denn wieder brandete Jubel auf.
»Du träumst vom Fußball? Meine Güte, geht’s noch? Hier ist die Hölle los, und du holst dir Hämorrhoiden beim Träumen von der Rumpelliga?«
Träumen? Trost öffnete die Augen. »Welche Hölle? Welcher Traum?«
Er spürte sofort, dass er mit Gieracks Antwort eine Schwelle überqueren würde, die höher sein musste als jene zwischen Schlafen und Wachen. Dass er durch eine Tür gehen würde, die er nicht geöffnet sehen wollte. Niemand wollte das. Trotzdem wiederholte er: »Welche Hölle ist los?«, und blickte dabei in die Augen seiner Kollegin Annette Lemberg, die über ihm stand und ihm ein Handy ans Ohr hielt.
Nun war er restlos verwirrt.
3 Um zu sehen, wie der Wagen davonfuhr, musste sie den Vorhang nur ein wenig zur Seite schieben. An normalen Tagen würde sie jetzt, wo sie schon mal wach war, gleich die Küche aufräumen und das Frühstück vorbereiten.
Danach würde sie sich die Liste zum Abarbeiten vornehmen – jene Liste, auf der stand, wo was gerade im Angebot war und wo es etwas zu gewinnen gab. Außerdem waren auf ihr sämtliche Flohmarkttermine der Umgebung, die Internetseiten, auf denen sie Dinge verkaufte, sowie die Telefonnummern diverser Interessenten oder Gewinnspiel-Anbieter vermerkt.
Doch heute ließ sie sich nicht von einer Aufgabe zur nächsten treiben. Heute blieb sie am Fenster stehen – noch lange nachdem der Wagen mit ihrem Mann und seiner Kollegin Annette Lemberg fortgefahren war.
Es war ihr unmöglich, sich auch nur einen Zentimeter zu rühren. Es schien, als würde sie die Atmosphäre, die sie umgab, daran hindern, sich zu bewegen. Unsichtbare Hände griffen nach ihr und klammerten sich an sie. Aber natürlich war das ausgemachter Blödsinn. Charlotte Trost war eine intelligente Frau und vor allem keine, die an Geister und andere Mächte glaubte, jedenfalls nicht wirklich.
Und doch ahnte sie, worauf das wieder hinauslaufen würde. Die Muskeln in ihrem Körper spannten sich an, wehrten sich gegen die Gedanken, die in ihrem Gehirn auftauchten. Natürlich war das Aufbegehren zwecklos. Kein Körper, keine Muskeln waren imstande, sich gegen Gedanken zu wehren.
Allerdings konnte sie sie zulassen. Indem der Körper innehielt und zur Ruhe kam. Indem sie nur noch starr aus dem Fenster blickte – auf eine Stelle, an der vor wenigen Minuten noch ein Auto gestanden hatte.
Sie hatte gehört, wie der Wagen näher kam, parkte und sich die Fahrertür öffnete. Zuerst war sie bestürzt über die Erscheinung gewesen, die dem Fahrzeug entstieg, denn auch, wenn sie Annette Lemberg schon einige Male gesehen hatte, konnte sie die Eifersucht kaum bremsen, die sie bei dem Gedanken überfiel, dass sie und ihr Mann die meiste Zeit des Tages miteinander verbrachten.
Als sie dann mit wippendem Zopf auf das Baumhaus zusteuerte, wäre sie beinah hinausgestürzt, um sie zur Rede zu stellen. Doch sie wartete ab. Es war schon von Weitem an ihrem Stechschritt zu erkennen gewesen, dass es bei dem Besuch um die Arbeit ging, nichts weiter. Dass sie ihren Mann dienstlich brauchte, wenngleich sie sich nach all den Jahren immer weniger vorstellen konnte, wozu eigentlich.
Lemberg ließ die Wagentür offen stehen und rannte durch den Garten. Hatte sie nicht doch einen Blusenknopf zu viel geöffnet? Und wie ihre Brüste beim Laufen hüpften. Und wie schlank sie war. Und teuflisch jung.
Es waren ein paar Minuten vergangen, in denen Charlotte mit rasendem Herzen wie angewurzelt am Fenster gestanden und gewartet hatte.
Was war im Baumhaus passiert? Hatten sie einander geküsst? Hatte er sie zu sich auf die taufeuchte Matratze gezogen? Aber so, wie Armin aussah, war er doch bestimmt nicht ihr Typ.
Charlotte atmete aus, sammelte sich, als ihr jener Gedanke kam, vor dem sie sich schon so lange fürchtete: Was war das eigentlich zwischen ihnen, zwischen ihr, Charlotte, und Armin, ihrem Mann? Einem Mann, der in einem Baumhaus lebte und nicht einmal zur Morgentoilette ins Haus kam. Ganz zu schweigen davon, dass er ihnen nicht einmal einen guten Morgen wünschte, so wie früher, als sie noch Haus und Bett miteinander geteilt hatten. Damals, als er sich auch noch gewaschen hatte.
Die Gedanken wurden gnadenloser: Interessiert mich der Grund?, fragten sie Charlotte. Interessiert mich Armins Zustand? Interessiert mich dieser Mann überhaupt noch?
Sie wollte ihren Platz am Fenster verlassen, doch es war zu spät. Ein Gedanke folgte unerbittlich dem nächsten.
»Das alles ist doch absurd«, flüsterte sie. »Armin bekommt nicht einmal mit, wie sehr du leidest. Er hat keine Ahnung davon, wie glücklich du früher mit ihm warst.«
Bei dem Gedanken an jenen Nachmittag, an dem er für sie bei einem Gewinnspiel auf allen vieren durchs Autohaus gekrochen war, um einen Schlüssel in einem Luftballon zu ergattern, musste sie lächeln. Sie erinnerte sich daran, dass er ihr aus Hölzern im Wald ein Insektenhotel gebastelt hatte, das fast so groß wie sein späteres Baumhaus gewesen war. Na ja. In ihrer Erinnerung war es jedenfalls imposant. Ein imposanter Liebesbeweis. Und als sie an jenen Morgen zurückdachte, als er ihr im Dunklen geholfen hatte, den wackeligen Tapeziertisch für den Flohmarkt aufzubauen, und sie so wilden Sex auf ihm gehabt hatten, dass er unter ihnen zusammenbrach, wurde aus ihrem Lächeln ein tränenschimmerndes Schluchzen.
Warum nur hatte sich alles so verändert?
Es kostete sie enorme Kraft, ihren Blick von dem Fleck zu lösen, den sie seit Minuten angestarrt hatte. Und es gelang ihr auch nur, weil ihr ein Gedanke plötzlich suggerierte, dass es nicht der Fleck war, der sie in seinen Bann zog, sondern etwas am Rande ihres Sichtfeldes.
Sie ließ den Blick vorbei am Magnolienbaum schweifen. Vorbei an der Plastikrutsche, die in eine kleine viereckige Sandkiste mündete. Vorbei an dem Fahrrad, das in der Wiese lag, bis hin zu dem Baum, der in seiner Mächtigkeit das Erscheinungsbild des Gartens bestimmte und an dessen Stamm eine Leiter zum Eingang von Armin Trosts Baumhaus führte.
Das Baumhaus. Der Grund für die Veränderung. Für das Ende der Gemeinsamkeiten.
»Warum bist du schon auf?«
Sie drehte sich um. Jonas, ihr ältester Sohn, stand in der Tür und wischte sich wie ein Kleinkind mit ganzer Hand den Schlaf aus den Augen. Ein seltsamer Anblick, weil er sie mit seinen achtzehn Jahren längst an Körpergröße überragte. Er war zu einem Mann herangewachsen, nicht ganz so bullig wie Armin, aber mit einem ähnlich kantigen Gesicht, das er ungleich seinem Vater rasierte. Jonas trug sein Haar zudem an den Seiten kurz, ganz so, wie es die aktuelle Mode jungen Männern vorgab.
»Ist er wieder fort, ohne ein Wort zu sagen?« Jonas’ Stimme hatte sich verändert und einen bitteren Ton angenommen.
Sie schaltete den Wasserkocher ein und goss kurz darauf das heiße Wasser in eine Kanne, in der bereits ein Teesieb mit Kräutern aus dem eigenen Garten hing.
Darauf war Charlotte stolz. Auf die eigenen Kräuter, die eigenen Früchte und das eigene Gemüse, die selbst gekochten Marmeladen. Außerdem backte sie regelmäßig Brot, stellte Säfte und manchmal auch Liköre und Schnäpse her.
Mit dem Geld, das sie durch die Gewinnspiele einnahm, richtete sie das Haus so gemütlich wie in Kinderbüchern beschrieben ein. Mit Blumenarrangements auf den Fensterbänken, warmem Licht, unzähligen Büchern und dazu mit einem Duft, der durch die Räume zog wie die Jahreszeiten durch die Täler.
Sie rieb sich die Hände mit selbst gemachter Creme ein, ließ diese kurz einziehen und schlüpfte dann mit einer dampfenden Teetasse in der Hand in die Gartenschuhe.
»Wohin gehst du?«, wollte Jonas wissen. »Es ist ja noch nicht einmal richtig hell.«
Charlotte erwiderte immer noch nichts, stellte die Tasse auf das Flurtischchen, zog sich wie in Trance eine Weste über, griff wieder nach dem Tee und ging in den Garten. Obwohl es wie in den letzten Jahren leider so oft vor Weihnachten kaum nach Schnee aussah, stand der Winter vor der Tür. Er nahte, wie sie es selbst gerne formulierte, weil es theatralischer klang. Und weil sie ihn so sehr herbeisehnte.
Jonas stand wie zuvor seine Mutter am Fenster und beobachtete sie. Sie hatte sich die Scheibtruhe hinter dem Schuppen geschnappt und stapfte damit auf den Wald zu, dessen Bäume im Morgennebel aussahen wie das Gebiss eines überdimensionierten Drachen. Bücher über solche Themen hatte er in seinem Zimmer zuhauf. Schon als kleines Kind hatte er Fantasyliteratur geliebt, und eines Tages, das wusste er, würde er solche Geschichten selbst schreiben. Die Wahrheit war, dass er es bereits tat. Eine unglaubliche Geschichte schrieb. Aber noch sollte niemand davon erfahren.
Er blickte wieder in den Garten hinaus. Was machte er hier eigentlich? Ach ja, er beobachtete seine übergeschnappte Mutter, die im winterlichen Morgengrauen mit einer Scheibtruhe durch den Garten rannte.
Mittlerweile war sie dreimal zum Waldrand und wieder zurück gelaufen, jedes Mal mit einem Turm aus Reisig und trockenen Ästen auf der Scheibtruhe, die sie kaum noch manövrieren konnte.
Beim ersten Rückweg war ihr das Ding vor Papas Leiter zum Baumhaus umgekippt. Beim zweiten stellte er interessiert fest, dass diese Stelle bewusstes Ziel seiner Mutter sein musste, und beim dritten Mal beschloss er, nach draußen zu gehen, um ihr bei ihrer Arbeit zu helfen.
Das Haus lag am Waldrand und duckte sich so sehr in die Baumreihen, dass seine Bewohner erst bemerkten, wie weit der Tag fortgeschritten war, wenn sie in den Garten gingen, in dem die klamme Feuchte des Morgens am späten Vormittag verschwand. Was im Sommer ganz angenehm war, konnte im Winter gehörig auf der Seele lasten. Kein Wunder, dass man auf schlechte Gedanken kam.
Jonas stand neben dem Baum, als seine Mutter die vierte Fuhre ablud. Das Häuflein war bereits zu einem ansehnlichen Haufen angewachsen.
Jonas hatte sich eine Mütze aufgesetzt, die er nun über seinen Hinterkopf zog. Stirn und Haaransatz sahen hervor. Seine Hände verbarg er in den Taschen seiner Jeans, die er über der Pyjamahose trug.