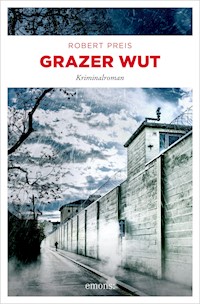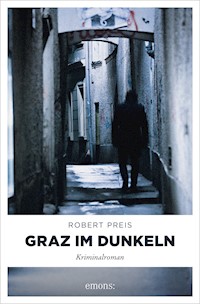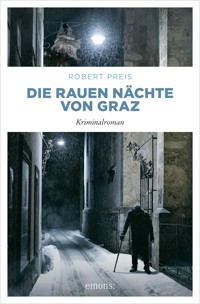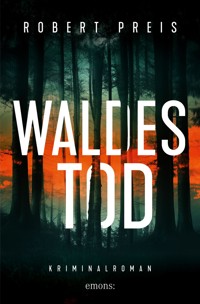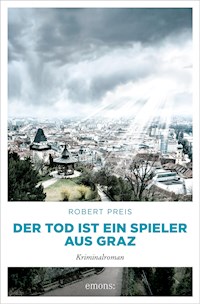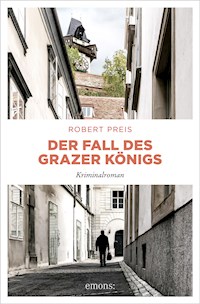Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historischer Roman
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer unmöglichen Liebe und der Entstehung des Grazer Gottesplagenbildes. 1463: Stjepan Tomašević, der letzte Despot Serbiens und König von Bosnien, wird von osmanischen Reitern enthauptet. Seine hochschwangere Frau Helena beobachtet die Ermordung und kann mit einem kleinen Gefolge fliehen. Hilfe erhält sie auch von einem Pilger namens Johannes, der sie Richtung Norden ins sichere Graz des Heiligen Römischen Reiches führen will. Doch die Osmanen sind ihnen dicht auf den Fersen, und in einer Zeit von Krankheiten, Plagen und Kriegen scheint am Ende nur noch ein Bild die Hoffnung auf eine Zukunft zu nähren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Preis wurde 1972 in Graz geboren. Nach dem Publizistik- und Ethnologiestudium in Wien lebt er heute mit seiner Familie wieder in der Nähe seiner Heimatstadt. Er ist Journalist, Autor zahlreicher Romane und Sachbücher und Initiator des FINE CRIME-Krimifestivals™ in Graz.
www.robertpreis.com
Viele Figuren in dem Roman sind historische Persönlichkeiten, die es tatsächlich gegeben hat, einige sind jedoch auch frei erfunden. Der Autor hat sich an den tatsächlichen historischen Begebenheiten orientiert. Für die Spannung der Geschichte ist er hier und da jedoch davon abgewichen. Erklärungen dazu finden sich im Anhang.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Leonardo Magrelli, unter Verwendung der Motive von istockphoto.com/malerapaso, wikimedia-commons/gemeinfrei
Lektorat: Jana Budde
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-081-5
Historischer Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Leo Toifl, mit großem Dank für seine stets spannenden Geschichten aus der Geschichte
[1480 Umb uns Fraunta]g der [schie]ung sind hie zu [Gr]a[tz gots plag drei] gewesen Haberschreckh Türkn und [pestilentz] und yede so grosz dasz [dem] Menschn unerhörlich ist got sey uns gndi.
Inschrift im Landplagenbild, einem Fresko an der Südseite des Grazer Doms. Es wird auch das Gottesplagenbild genannt.
Vatter vnser du do bist in den himeln geheyliget werd dein nam. Zu kum din reich. Dein wil der werd: als im himeln vnd in der erd. Vnser teglich brot gib vns heut. Vnd vergib vns vnser schuld: als vnd wir vergeben vnsern schuldigern. Vnd fúr vns nit in versuchung: sunder erloeß vns von den vbeln Amen.
Aus der ersten gedruckten Bibelübersetzung von Johannes Mentelin, wahrscheinlich Straßburg 1466
Historische Figuren
Thomas Artula (geb. zwischen 1435 und 1440, gest. zwischen 1523 und 1529)
Besser bekannt als Thomas von Villach, Maler von Fresken und Tafelbildern. Gilt als Schöpfer des Gottesplagenbildes (auch Landplagenbild genannt) an der Außenseite des heutigen Grazer Doms.
Andreas Baumkircher (1420–1471)
Ein Söldner, der sich mehrmals für Kaiser Friedrich III. verdient gemacht hatte. Weil er um seinen ausstehenden Sold kämpfte und daraufhin mehrere Fehden gegen den Kaiser austrug, wurde er 1471 zu vermeintlichen Verhandlungen nach Graz gelockt. Er wurde zwischen den Murtoren enthauptet.
Michael Beheim (1420 bis späte 1470er Jahre)
Schriftsteller, der unter anderem auch am Kaiserhof in Wien tätig war. Berühmt sind seine Schilderungen der Belagerung von Wien (»Michael Beheim’s Buch von den Wienern, 1462–1465«) und ein Gedicht über das Wüten von Vlad III. Drăculea.
Bessarion (1399/1408–1472)
Byzantinischer Herkunft, unter anderem Philosoph und Diplomat. Ab 1439 Kardinal, ab 1463 lateinischer Patriarch von Konstantinopel im Exil, der nach dem Fall der Stadt – erfolglos – für einen Kreuzzug gegen die Osmanen warb.
Johannes Capistranus (1386–1456)
Franziskanermönch, der mit Johann Hunyadi in Belgrad gegen die Türken kämpfte. Auch Giovanni da Capistrano, Ioannes Capistranus oder Johannes Kapistran genannt.
Matthias Corvinus (1443–1490)
König von Ungarn und erbitterter Gegner Friedrichs III.
Vlad III. Drăculea (1431–1476/77)
1462 bis 1474 war Vlad Gefangener von Matthias Corvinus – wahrscheinlich, damit er Corvinus nicht die Rolle als führender Kämpfer gegen die Türken streitig machen konnte. Vlad soll vom orthodoxen zum katholischen Glauben konvertiert sein und heiratete eine Cousine von Corvinus. Er übernahm das militärische Kommando über eine ungarische Streitmacht und führte Feldzüge gegen die osmanischen Truppen in Bosnien. Dabei soll er unter anderem achttausend Muslime gepfählt haben. Ihm wurde vermutlich erst nach seinem Tod der Beiname Țepeș gegeben – der »Pfähler«.
Balthasar Eckenperg (1425–1493)
Münzmeister des Kaisers, einer der reichsten Bürger in Graz. Heutige Schreibweise: Eggenberg.
Radegunde Eckenperg, geb. Seidennatter (gest. vor 1480)
Erste Frau Balthasars.
Friedrich III. (1415–1493)
Mit neun Jahren wurde er zum Herzog der Steiermark, von Kärnten und Krain, mit vierundzwanzig Herzog von Österreich, mit fünfundzwanzig römisch-deutscher König, und ab seinem siebenunddreißigsten Lebensjahr bis zu seinem Tod war er Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Es war die längste Herrschaft aller römisch-deutschen Kaiser. Zudem war er der letzte, der in Rom gekrönt wurde. Er hinterließ rund fünfzigtausend Urkunden, aufgrund einer stark unvollständigen Quellenlage wurde er aber lange Zeit von der Wissenschaft als »untätig« beschrieben. Er hatte wegen Fehden innerhalb des Reichs und zahlreicher äußerer Feinde mit ständigen Geldproblemen zu kämpfen, führte das Reich dennoch zur bis dahin größten Ausdehnung.
Andreas von Greißenegg (1425/26–1471)
Rechte Hand von Andreas Baumkircher, zuweilen auch sein Gegner. Er wurde ebenso wie der berühmte Söldner 1471 in Graz enthauptet, nicht zuletzt deshalb, weil er mit dessen Schwester verheiratet war.
Jan Holup (gest. 1469)
Söldnerhauptmann, der die kaiserlichen Truppen in der Schlacht von Fürstenfeld (21. Juli 1469) gegen Andreas Baumkirchers Streitmacht anführte. Er wurde schwer verwundert nach Graz gebracht, wo er noch im selben Jahr starb.
Ludwig XI. (1423–1483)
Von 1461 bis 1483 König von Frankreich. Er wurde »der Listige« genannt – oder auch »die Spinne«.
Nicolaus Machinensis (1427–1480)
Kirchlicher Würdenträger (Bischof von Modruš/Modrussa), Schriftsteller und Diplomat. Unter anderem vermittelte er zwischen Matthias Corvinus und Stjepan Tomašević, verließ nach dem Sturz des Bosnischen Königreichs das Land Richtung Italien und nahm an Seeschlachten teil.
Mehmed II. (1432–1481)
Osmanischer Herrscher, der 1453 Konstantinopel eroberte und nach einem zeitweiligen Frieden mit Venedig (ab 1478) die ersten konkreten Angriffe auf das Gebiet der heutigen Steiermark diktierte.
Cristoforo Moro (1390–1471)
Wurde 1462 zum 67. Dogen von Venedig gewählt. Er erklärte im Jahr darauf den Osmanen den Krieg, dem er selbst aber entgegen seiner Ankündigung nicht als Kreuzfahrer beiwohnte.
Christoph von Mörsberg (gest. um 1478)
Entstammte einem Adelsgeschlecht aus dem Elsass und begründete die steirische Linie der Familie. Er war kaiserlicher Rat, Burggraf von Graz, Landschreiber des Herzogtums Steier und zählte als Kreditgeber des Kaisers zu den reichsten Männern im Land.
Hans Niesenberger (um 1415–1493)
Wurde in Graz geboren und als Steinmetz »Hans von Graz« genannt. Er leitete den Grazer Dombau von 1438 bis 1450 und war 1459 in Regensburg Gründungsmitglied der Steinmetzbruderschaft. Er war Mailänder Dombaumeister, Bürger von Luzern und Baumeister an der Basler Leonhardskirche. Er gilt als Baumeister für besonders schwierige Projekte – 1491 wurde er aber wegen angeblicher Baufehler entlassen.
Ishak Pascha (1444–1487)
Osmanischer General und Großwesir.
Ulrich Pesnitzer (geb. um 1415)
War lange Zeit im Gefolge Kaiser Friedrichs III. Er kämpfte 1462 gegen die aufständischen Wiener Bürger, wechselte 1469 aber die Fronten und kämpfte an der Seite Andreas Baumkirchers gegen den Kaiser. Landeshauptmann Wilhelm von Thierstein belagerte seine Burg Weitersfeld an der Mur (1472), diese Burg wurde 1475 sogar beschlagnahmt. 1476 wurde Pesnitzer aber wieder in die Gnade des Kaisers aufgenommen. Sein Sohn Ulrich wurde später berühmter Baumeister in Landshut.
Sigmund von Roggendorf (gest. um 1471)
In den 1430er Jahren ließ er sich im Herzogtum Steier nieder. Er war »Judenrichter«, gehörte dem Gremium der »Landesanwälte« an und war Landschreiber für Steier. 1461 wurde er Verweser der steirischen Landeshauptmannschaft. Während der Baumkircher-Fehde war er damit beauftragt, eine Landessteuer zur Finanzierung des Kampfes einzutreiben.
Johann Siebenhirter (gest. 1508)
Der ehemalige Küchenmeister Kaiser Friedrichs III. wurde 1469 in Rom zum ersten Hochmeister des St.-Georgs-Ritterordens ernannt, mit dem der Kaiser hoffte, eine schlagkräftige Heerschar gegen die Osmanen aufstellen zu können.
Leutold von Stubenberg (vor 1429–1466)
Steirischer Landeshauptmann.
Maria Tomašević (geb. 1447)
Helena Branković wurde im Alter von zwölf Jahren im Jahre 1459 mit Stjepan Tomašević verheiratet. Sie nahm dabei den Namen Maria an. Sie floh mit ihrem Mann vor den Türken, kurz vor dessen Hinrichtung teilten sich ihre Wege aber. Über ihren weiteren Verbleib gibt es zahlreiche Legenden, doch keine gesicherten Berichte.
Stjepan Tomašević (1438–1463)
Letzter bosnischer König. Wurde von Akindschi-Scharen auf einer später »Zarenfeld« genannten Stelle bei Jajce im Juni 1463 enthauptet.
Christoph Ungnad (vor 1429–1481)
Hauptmann von Cilli und kaiserlicher Rat.
Jakob Unrest (um 1430–1500)
Pfarrer in Sankt Martin am Techelsberg (Kärnten) und bedeutender Chronist des Spätmittelalters.
Thomas Weiß
Wahrsager im 15. Jahrhundert, der unter anderem in Salla (heutige Gemeinde Maria Lankowitz) in der Weststeiermark gelebt haben soll.
Fiktive Figuren
Bruder Dejan
Ein fanatischer Mönch der Kartause Seiz.
Eneas
Ein Kaufmann in Visegrád, der als Mittelsmann für Balthasar Eckenpergs geheime Geschäfte im Königreich Ungarn tätig ist.
Haris
Als junger Mann hat er in den Hussitenkriegen (1419–1436) mitgewirkt, doch niemand weiß noch, ob aufseiten König Wenzels oder als Verfechter der Glaubengrundsätze der Anhänger von Jan Hus. Als er Johannes das erste Mal begegnet, ist er bereits rund fünfundvierzig Jahre alt und damit ein erfahrener, aber nicht minder hitzköpfiger Haudegen. Helena und später Johannes ist er treu ergeben.
Konrad von Hartstein
Der an Aussatz erkrankte Herr über die Burg Hartstein.
Ulf von Hartstein
Nachdem Ulf seinen Vater Konrad und seinen Bruder hat ermorden lassen, wird er zum sadistischen Herrn über die (ebenfalls erfundene) Burg Hartstein in der südlichen Grenzregion des Habsburgerreichs.
Helena
Sie ist die Witwe des enthaupteten bosnischen Königs, aber etwas älter als ihr historisches Vorbild. Sie mutiert, ganz untypisch für ein mittelalterliches Frauenschicksal, zu einer tatkräftigen und selbstbestimmten Frau, wenngleich ihr das Leben harte Prüfungen auferlegt.
Johannes Kreuzer
Soweit ich weiß, hatten Balthasar und Franz Eckenperg keinen Halbbruder. Aber was weiß man schon? Johannes fungiert in dieser Geschichte jedenfalls als Angehöriger der einst reichsten Familie von Graz.
Manderdinger
Ein Koch, ein Mönch, ein Krieger. Er kann alles. Erlebte die Hussitenkriege, taucht seit Jahren immer wieder an Haris’ Seite auf. Markant ist, dass er einen Kriegswagen aus den Hussitenkriegen kutschiert, der von einer alten, aber zähen Mähre namens Cherub gezogen wird.
Mesar
Der Name bedeutet auf Kroatisch »Fleischer«. Angesichts seiner anfangs widerlichen Rolle erschien mir dieser Name für Ulfs Hauptmann durchaus passend.
PROLOG
1485, Graz, Residenzstadt des Heiligen Römischen Reichs
Das große Tuch fiel wie der Vorhang eines Theaters, und zum Vorschein kam das Grauen dieser Welt.
Hässlich verstümmelte Opfer taumelten zwischen brennenden Gebäuden. Mit Fackeln, Ruten und Steinen wehrten sich Verzweifelte gegen riesenhafte Heuschrecken, haufenweise wurden Leichen verscharrt, und die Heerscharen fremdartiger Krieger steckten Dorf um Dorf in Brand und hinterließen schreckliches Leid.
Nichts wirkte tröstlich.
Nicht einmal Gottes erleuchtende Strahlen, die alles Unbill in ihrem irisierenden Licht auflösen wollten. Sie wirkten ganz im Gegenteil eher wie todbringende Blitze.
Und all die Engel an seiner Seite, sogar der Papst als Gottes Stellvertreter, sie alle starrten nur vom Himmel herab und schienen gebannt von der obszönen Brutalität, mit der ihre Botschaften von Nächstenliebe und Gottesfurcht beantwortet wurden. Denn auf Erden herrschte das reinste Chaos, welchem der Himmel nur mit fassungsloser Abscheu begegnen konnte.
Ein immerwährender Schrecken, dem etwas Endgültiges, etwas Unausweichliches anhaftete.
Deshalb diese flehenden Bitten, die über den Bildern geschriebenen Worthülsen der Menschen, die geradezu um Beistand und ein Ende allen Leids bettelten. Um das Ende aller Plagen.
Thomas Artula, den viele nur als Thomas von Villach kannten, stand klopfenden Herzens vor der Südseite der Grazer Ägidiuskirche und harrte betreten der Reaktionen der Schaulustigen.
Mit belegter Stimme verkündete er: »Dieses Fresko trägt den Namen Gottesplagenbild. Es schildert unser Grauen, und es fleht um göttlichen Beistand. Möge es uns beschützen und kommenden Generationen eine Warnung sein.«
Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, bis der bereits fast siebzigjährige Kaiser Friedrich III. schließlich ächzend auf die Knie sank und sein Haupt hinter den gefalteten Händen verbarg. Der einfache Mantel, den er sich übergeworfen hatte, war scheckig vom Staub, die schwarzrandigen Nägel seiner beringten Finger ragten unter den Ärmeln der weit ausgeschnittenen Tunika hervor. Das strähnige graue Haar fiel dem Monarchen lose auf den Hermelinkragen, seine Krone saß schief am Haupt, da er sich ständig die Wanzen von der Kopfhaut kratzen musste.
Die Mönche zu seiner Linken gehörten dem Orden der Franziskaner an, die in ihren braunen Kutten, die von mit drei Knoten versehenen Kordeln um die Hüften eng geschnürt waren, schmächtiger und einfacher aussahen als die Landstreicher vor den Stadtmauern. Es waren bleiche Männer mit Tonsuren, deren Gesichtszüge ausgemergelt und kantig wirkten.
Zur Rechten des Kaisers verharrten die Dominikanermönche mit ebenso ernsten, versteinerten Mienen. Sie trugen die traditionellen weißen Habite, über die sie schwarze Chormäntel geworfen hatten.
Weder die Mitglieder des einen noch jene des anderen Ordens hatten Anstalten gemacht, dem greisen Kaiser auf die Knie zu helfen. Seine knackenden Gelenke und sein verbittertes Antlitz sahen sie als das Mindestmaß an Leidensfähigkeit an. Auch sie versteckten ihre Häupter nun hinter den gefalteten Händen und skandierten schließlich inbrünstig und gleichsam lautstark wie der Kaiser das Paternoster.
Erst nach und nach fielen auch die Umstehenden auf die Knie und stimmten unsicher grummelnd in den Chor ein. Kaum jemand aus dem einfachen Volk war des Lateinischen mächtig, und ein vollständiges Gebet fehlerfrei aufzusagen war ohnehin niemandem möglich. Zudem waren die Leute noch immer fasziniert davon, dass der Kaiser tatsächlich unter ihnen war, denn üblicherweise hielt dieser nicht allzu viel von Volksnähe und blieb meist unsichtbar hinter den dicken Mauern seiner Burg. Ganz hinten gingen die Schaulustigen nicht einmal in die Knie; wenigstens bekreuzigten sie sich immerfort und starrten auf die Hinterköpfe der hohen Damen und Herren.
Nach dem Paternoster räusperte Thomas Artula sich und begann mit lauter Stimme zu erklären, was das große Tuch da freigegeben hatte, was dieses verstörende Bild eigentlich darstellen sollte. Es handle sich um ein Inferno, das sich den Menschen darbiete, ein Schlachtfeld, das vom Bösen heimgesucht werde wie nichts zuvor. Und dieses Schlachtfeld sei ihre Welt, Steier, Graz, ihr aller Lebensumfeld.
Ganz oben auf dem Gemälde war die Heilige Dreifaltigkeit zu sehen, Gott, der Sohn und der Heilige Geist. Aus Gottes Herz brachen drei Blitze aus, die mit Spruchbändern versehen waren. Maria und Johannes der Täufer fingen mit einem Tuch ein weiteres Blitzbündel auf, Gnade und Erbarmen wurden erbeten. Sämtliche Engel und Erzengel hatten sich versammelt, und an der Seite des Allmächtigen harrten dessen legendenhafte Begleiter, die überirdischen Wesen Cherubim und Seraphim, der Dinge.
Der irdische Bereich des Freskos wurde vom Papst angeführt; der heilige Franziskus und der heilige Dominikus flankierten den obersten Hirten. Darunter waren die Plagen und Leiden der Menschen in wüste Bilder gegossen worden. Türken, die grausame Verstümmelungen hinterlassend durchs Land zogen, Pestkranke, die wie abscheuliche Fratzen der Verwüstung folgten, und schließlich Heuschrecken, die das letzte bisschen Hoffnung von den Feldern fraßen.
Beim Betrachten des Gemäldes bekreuzigten sich die Schaulustigen immer wieder, einige schluchzten, da die Bilder Erinnerungen wachriefen, die sie erfolgreich verdrängt hatten.
Später würden sie erzählen, auch der Kaiser, dieser gemütsarme, am Leid der Untertanen stets uninteressierte Herrscher, habe eine Träne vergossen, als er das Bild zu Gesicht bekommen habe. Man würde sich auch erzählen, dass ein Seufzen durch die Menge gegangen sei und ein Jammern und Klagen eingesetzt habe, als habe man gehofft, der Herr im Himmel würde seine Augen nun endlich auf Graz richten, diese Stadt, die ihm ein Bild gewidmet hatte, in der Hoffnung, alle Plagen, alles Leid würde nun vertrieben sein.
Kaiser Friedrich wandte sich um und schaute kühl auf sein Volk hinab. Wolken veränderten das Tageslicht, und Friedrichs Haar hatte nun die Farbe schmutzigen Schnees angenommen, seine Augen schimmerten seltsam farblos und blass. Seine lange Nase war derart gekrümmt und das Kinn so mürrisch nach vorn gereckt, dass es niemanden verwundert hätte, hätten die beiden sich berührt.
Der greise Monarch, ein großer, dürrer Mann, stand gebeugt vor der Menge, und nun wurde es bis hinunter zum Judenviertel und auf der anderen Seite bis zur Gasse der Sporer ganz still. Sogar die Beutelschneider hielten inne, und die Stadtwachen versuchten, so leise wie möglich die Standbeine zu wechseln, um durch das Scheppern und Schaben ihrer Rüstungen niemanden zu verärgern. Alles hing nun an den Lippen des Kaisers.
Friedrich raunte: »Deus, miserere nobis.«
Es hatte zunächst den Anschein, als wollte er sich mit diesen Worten sogleich umdrehen und fortmarschieren, doch als würde er in diesem Moment gewahr, dass sich die Leute mehr von ihrem Herrscher erwartet hatten als eine lateinische Phrase, gab er sich einen Ruck und schickte die Übersetzung hinterher. »Gott, erbarme dich unser!«, rief er fast trotzig. »Möge dieses Werk des Thomas von Villach unsern Herrgott besänftigen. Möge es uns beschützen, und möge es kommende Generationen darüber unterrichten, wie sehr wir gelitten haben.«
Als er sich schließlich abrupt umwandte, hörten die ersten Reihen noch, wie Kaiser Friedrich »Das genügt« sagte, während er mit weiten Schritten den kleinen Platz Richtung Burg verließ.
Die Franziskaner und Dominikaner senkten ihre Häupter und ließen sich in ihren Mienen nicht anmerken, ob sie das Verhalten des Monarchen missbilligten oder sogar schätzten. Lautlos schlichen sie ihm nach.
Thomas Artula verbeugte sich tief, auch wenn er sich keinen Reim darauf machen konnte. War sein Auftraggeber nun zufrieden mit seinem Werk oder nicht?
Als die Obrigkeit den Platz verlassen und das Bild von Stadtwachen flankiert zurückgelassen hatte, strömte die Masse heran. Jeder wollte es sehen und manche auch den Künstler, den sie am Rock berührten und dabei »Gott segne Euch« murmelten.
Ganz hinten im Geschehen stand ein Mann, dessen Gesicht von einer Kapuze bedeckt war, als plötzlich eine Stimme an seiner Seite knurrte wie die eines schnarchenden Untiers: »Hast du heute das Bild des Kaisers in der Kirche gesehen? Das, das ihn als den heiligen Christophorus darstellt?«
»Was? Nein.«
»Dann wirst du heute sterben.« Und nach einer effektvollen Pause: »›De aere nigro‹.«
Der Mann schrak hoch, stieß den Fremden zur Seite und drängte sich durch die Menschenmenge. Dann lief er um sein Leben.
I
Die Flucht der letzten Königin
1
Juni 1463, Jajce im Königreich Bosnien
Im Morgenlicht schimmerte silbriger Tau auf den Bäumen der Ebene.
Nebelwolken zogen in kleinen Gruppen durch das Unterholz, das die Lichtung umgab. Es hatte in der Nacht geregnet und roch nach feuchtem Moos. Ein Morgen wie aus den alten Geschichten. Und doch lag in seinem Zauber bereits eine finstere Ahnung vom nahenden Tod.
Helena kroch neben Haris durchs Laub. Eingehüllt in braune Umhänge aus grobem Leinen, die Köpfe mit Kapuzen bedeckt, näherten sie sich dem Rücken einer Böschung.
Behutsam schob Helena einige Zweige beiseite. Die Flügel ihrer Nase bebten, ihre Unterlippe zitterte.
Ihr Begleiter war ein riesenhafter Kerl, dem zwei schwarze Zähne aus dem Mund ragten wie die Türme einer vermodernden Burg. Seine Stirn warf tiefe Falten, und die dichten Augenbrauen verdeckten die Lider, von denen eines von einer hässlichen Narbe verunstaltet war.
Die beiden blickten auf eine Lichtung hinab, die von drei Seiten von dichtem Wald umgeben war, der Fluss Vrbas grub sich vor ihnen tief ins Gelände und rauschte in Richtung Südosten. Sie lagen im dichten Unterholz des Waldrands am Ufer des Flusses, vermeintlich sicher und doch so nah.
Hinter den Wäldern im Südwesten waren die Mauern der Festung von Jajce zu sehen. Sie glaubten dort Gestalten auszumachen, die ebenso verstohlen auf die Lichtung blickten wie sie selbst. Die Banner flatterten in einer leichten Brise, zeigten sechs gelbe Lilien auf blauem Grund, diagonal unterbrochen von einer geschwungenen grauen Linie, die mit Kreuzen gespickt war.
Kreuze.
Wolkenhaufen spielten harmlos am Himmel. Wenn man sie länger betrachtete, konnten die Gebilde an Gesichter erinnern. Etwa an einen alten Mann mit weißem Rauschebart, der mahnend hinabstarrte. Ob Gott sie in diesem Augenblick tatsächlich beobachtete? Doch das Wolkengebilde verwischte seine Züge wieder und scherte sich nicht um die Tragödien, die sich auf der Erde abspielten.
Als wollte auch er das Drama nicht unterbrechen, schien sogar der Vrbas sein unablässiges Rauschen einzustellen und für eine Weile zu verstummen. Die flehenden Stimmen der Geschundenen drangen nun von der Lichtung bis an den Waldesrand. Eine Gruppe von fünf, sechs Männern wurde in die Mitte des Wiesenfeldes gedrängt. Sie stolperten über ihre eigenen Beine, schluchzten, fielen auf die Knie. Die aufgerissenen Kleider, das Blut an ihren Körpern – auf die Entfernung hin waren ihre Verletzungen bestenfalls zu erahnen.
Nun waren auch das Klirren und Scheppern der Waffen an den Gurten der Hundertschaft, die die Männer umringte, weithin hörbar. Ein auf den ersten Blick bunter Haufen, den die rot-schwarz-weißen Fahnen, die manche von ihnen trugen, einten. Sie brüllten einander Bemerkungen zu, einige deuteten auf die Gruppe der Flehenden, was wiederum andere zum Lachen brachte. Sie wirkten wie eine Räuberbande, die sich zufällig gefunden hatte. Und zufällig auf Opfer gestoßen war.
»Es sind Akindschi«, hauchte Haris. Eine Feststellung, die keiner weiteren Erklärung bedurfte. Und als hätte er damit das Schicksal der Männer auf der Lichtung besiegelt, schimmerte die Morgensonne noch einmal unbeschwert übers kniehohe Gras, als ein Säbel aufblitzte und dem ersten der Gefangenen den Hals aufriss. Nichts geschah hier zufällig.
Während die Stimme des Ermordeten für immer verebbte, wurde das Klagen der anderen noch herzzerreißender. Wieder ein Säbel. Und wieder Blut. Einer nach dem anderen endete als kopfloser Torso, bis nur noch ein Mann am Boden kniete und zitternd seine Arme hob. Stjepan … Helena schluckte. Sein Flehen richtete er an einen Reiter, der sein nervöses Pferd um ihn herumtrieb, als wollte er den Todgeweihten noch einmal von allen Seiten betrachten.
Das Zaumzeug klimperte. Der Reiter trug einen hohen weißen Turban, steckte in einem schwarzen Kettenhemd und in weiten blauen Hosen, die in rote Schaftstiefel mündeten. Er trug einen ebenso roten Umhang, der über die Hüften des gedrungenen Streitrosses fast bis an den Boden reichte. Ein Oberlippenbart umspielte die Mundwinkel, eine Bartinsel akzentuierte sein Kinn, und auch in seiner Hand blitzte eine gekrümmte Klinge im Sonnenlicht.
Selbst auf diese Entfernung hin war unschwer zu erkennen, dass es sich um einen Bey, den Anführer einer räuberischen Bande, die dem osmanischen Heer vorauseilte, handelte. Das gemeine Volk nannte diese marodierenden Truppen »Renner und Brenner«, weil sie genau das taten: übers Land stürmen und alles niederbrennen, Angst und Schrecken verbreiten. Aber was machten die Akindschi so weit im Norden?
Helena zitterte, schluchzte auf, und augenblicklich schnellte die Hand ihres Begleiters vor.
»Nicht«, zischte Haris. »Bitte. Keinen Laut. Nicht schreien. Wir sollten uns das nicht ansehen.«
Trotzig schlug sie die Hand aus ihrem Gesicht und warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Sie schüttelte den Kopf und machte keine Anstalten, sich zurückzuziehen.
Stjepan wurde auf der Lichtung nun an den Haaren auf die Beine gezerrt. Seine Schmerzensschreie klangen spitz und hell und echoten durch das Tal. Das Pferd des Bey näherte sich ihm. Der Klang einer Ohrfeige schallte bis zu ihnen in den Wald. Stjepan weinte, bot Münzen und Gold. Er bot seine gesamte Festung und die Stadt Jajce mit allem, was in ihr lebte. Und schließlich zeigte er auch noch in Richtung der im Dickicht Verborgenen, in Richtung des Waldes, aus dem Helena und Haris fassungslos auf die Lichtung starrten. Er würde alles tun, wenn sie nur sein Leben verschonten.
»Dort!« rief er. »Nehmt sie. Nehmt meine Frau. Sie ist ein Schatz, der Euch reich macht. Sie sind in diese Richtung gerannt.«
Offenbar spielte er auf die weithin bekannte Gier der Akindschi an, die von Beutezügen lebten und Sklavenhandel betrieben.
»Und ich …«, rief er weiter, als würde er sich seines eigenen Wertes als Lebender entsinnen, »… ich bin doch auch kostbar. Ihr könnt mich eintauschen. Gegen viele Dörfer. Gegen viele Leben.«
Der Wind wehte den beiden heimlichen Beobachtern diesen Verrat deutlich entgegen. Doch die grobschlächtigen Akindschi verstanden anscheinend kein Wort, ansonsten hätten sie wohl reagiert und sofort einen Trupp in besagte Richtung losgeschickt. Mit ihren legendär schnellen und ausdauernden Pferden hätten sie sie rasch eingeholt.
Der Bey machte eine Handbewegung, und Stjepan wurde wieder vornüber auf die Knie gerissen. Dieser gab nun nur noch Hilferufe und Stoßgebete von sich. Sein Kopf kam auf einem Baumstumpf zum Liegen. Einer der Akindschi hielt ihn an seinem langen Haar fest, ein anderer drückte seine Knie auf den Boden, ein dritter hob seinen Säbel. Das Wimmern und Klagen war mittlerweile ein unerträglicher Singsang geworden. Wieder blitzte eine Waffe im Morgenlicht auf, und einen Herzschlag später rollte der Kopf des letzten bosnischen Königs, Stjepan Tomašević, über den Waldboden.
Drei Dinge wurden Helena in diesem Augenblick bewusst: Die Krähen, die, seit sie auf die Böschung zugekrochen waren, verstummt waren, kreischten wieder auf. Aufgeregt krächzte das nachtschwarze Federvieh durcheinander, als hätte es etwas gesehen, das es umgehend weitererzählen musste.
Die Nachricht von Stjepans Tod würde sich tatsächlich wie ein Lauffeuer im Land verbreiten. Ein Königreich war soeben untergegangen. Ein kleines, kurzweiliges Königreich.
Auch der Vrbas schien seinen Stromschnellen nun wieder freien Lauf zu lassen. Und dann registrierte Helena auch, dass in einem Waldstück auf der anderen Seite des Tals weitere Pferde aufgetaucht waren. Eine Gruppe ganz in Schwarz gerüsteter Reiter auf ebenso schwarzen Rössern war aus dem Dickicht geschritten und hatte die Hinrichtung tatenlos beobachtet. Als Stjepan die Hand in Helenas und Haris’ Richtung gehoben hatte, hatten sich auch die schwarzen Reiter ihnen zugewandt, und Helena konnte dem unbändigen Drang, die Beine in die Hand zu nehmen und zu fliehen, kaum noch widerstehen.
Zuvor sah sie aber noch einmal auf den kopflosen Körper, aus dessen Hals eine Blutfontäne im Takt des immer schwächer werdenden Herzschlags schoss. Einer der Akindschi stieß ihn mit dem Fuß an, der Körper sackte auf die Seite und verschwand im hohen Gras.
Die Krieger wandten sich ab, stiegen wieder auf ihre Pferde und ritten auf Jajce zu. Helena konnte nicht erkennen, ob sie Anstalten machten, dem Verrat Stjepans Folge zu leisten und ihre Spur aufzunehmen. Aber selbst wenn sie es vorhatten, müssten sie zunächst nach Jajce zur Brücke über die Pliva, die kurz darauf in einem Wasserfall in den Vrbas mündete. Ein Umweg, der ihnen ein paar Stunden Vorsprung brachte. Vielleicht sogar einen halben Tag.
Die geheimnisvollen Männer auf den schwarzen Pferden, die von den Akindschi offenbar nicht bemerkt worden waren, ritten indes am Waldrand entlang Richtung Norden, machten einen weiten Bogen um das Tal. Sie würden sie wie die räuberische Vorhut des osmanischen Sultans erreicht haben, noch bevor die Sonne am Zenit stand – nur eben von der anderen Seite. Helena schnappte nach Luft und setzte sich rückwärts kriechend in Bewegung.
»Schnell« zischte sie Haris zu. »Wir müssen fort von hier.« Ob sie dabei Geräusche machten oder nicht, hörte sie nicht. Ihr Herz schlug ihr bis zu den Ohren. Sie vernahm nur die Stimme ihres Begleiters.
»Es tut mir leid. Es tut mir so leid.«
2
Ragusa. Dies war der Ort, den Stjepan für sie auserkoren hatte. Eine Handelsstadt, die zwar Tribut an das Osmanische Reich zahlte, dafür aber auch Schutz bieten konnte. Ein Ort, an dem die Eichenwälder bis ans Ufer der Adriatischen See reichten und der vor allem von den Einheimischen »Dubrovnik« genannt wurde, von Händlern dagegen auf Venezianisch »Ragusa«. Dort konnten Helena und ihre Gefolgschaft Zuflucht entlang des Stradun suchen, der Hauptstraße von Ragusa, die einst als Verbindung zwischen der Insel Lave und dem Festland errichtet worden war. Von hier aus konnten sie nach Ancona fliehen – jene Stadt, mit der Ragusa intensive Handelsbeziehungen pflegte. Und einmal in Ancona angekommen, würde ihnen Zeit bleiben, sich neu zu orientieren. Zeit zum Trauern. Zeit zum Nachdenken.
Doch wie sollten sie es jemals bis dorthin schaffen? Sie hatten immer noch die Mauern von Jajce im Rücken, die tiefen Wälder, durch die sich der Vrbas grub, Wälder, um die sich unzählige unheimliche Geschichten und Legenden rankten.
Helena schüttelte den Gedanken an diese Stadt, die sie zuletzt als kleines Kind gesehen hatte, ab und ließ die Pferde in wilden Galopp treiben. Doch der Pfad wurde zunehmend schmal und dornig, das Gestrüpp widerspenstig, und zuweilen wurde der Weg durch den Wald so dunkel, dass das Licht kaum ausreichte, um den Boden unter den Hufen auszumachen.
Es dauerte nicht lange, bis die Pferde nur noch müde schnaufend hintereinander durch das unendliche Grün trabten. Ob sie verfolgt wurden, und wenn ja, wie nah ihnen die Verfolger waren, konnte Helena nicht sagen. Ein flaues Gefühl in der Magengrube hielt sie davon ab, eine Rast zu befehlen.
Haris führte die Gruppe an. Er murmelte Gebete in einer fremden Sprache und blickte sich argwöhnisch um. So wie er sich benahm, rechnete er wohl damit, jeden Moment einen Pfeil aus seinen Rippen ziehen zu müssen. Deshalb trug er auch immer noch den visierlosen Helm, unter dem die Lederhaube seinen kahlen Schädel, der auf einem breiten Stiernacken ruhte, schützte. Sein Oberkörper war mit einem groben Leinenhemd bedeckt, über das er ein schweres Kettenhemd gezogen hatte. In seinem Hüftgurt steckte ein gekrümmter Säbel, und an seiner rechten Wade hatte er ein Messer befestigt. Aus einer Satteltasche ragte der Stiel eines furchterregenden Beils. Haris war ein Söldner, ein Mann, der das Kriegshandwerk zu seinem Beruf gemacht hatte und nun dem bosnischen Königshaus diente oder dem, was davon übrig war.
Blass und schweigsam folgte ihm Helenas Magd Anna, die allerdings in eine gänzlich andere Rolle gesteckt worden war und als vermeintliche Königin auf einem prächtigen Schimmel saß, der alle anderen Tiere überragte und sie nur allzu deutlich zur Zielscheibe machte. Sie schien tief in Gedanken versunken und krallte sich an die Zügel, als fürchte sie vom Pferd zu fallen, wenn sie losließe. Sommersprossen besprenkelten ihr Gesicht, und die stets rot geränderten Augen verliehen ihrem Antlitz eine andauernde Traurigkeit, so als stünde sie ständig kurz davor, zu weinen.
Mit etwas Abstand zu den beiden ritt Helena. Wie Anna hatte auch sie die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Es fiel ihr schwer, Haltung zu bewahren. Immer wieder musste sie sich dazu zwingen, sich im Sattel aufzurichten. Ihr Bauch wölbte sich unter dem weiten Mantel, und wenn sie aufblickte, war wohl nicht zu übersehen, dass ihre Stirn glänzte und die Wangen rötlich schimmerten. Trotz der Anstrengung, die es sie kostete, sich mit einem Kind im Bauch im Sattel zu halten, war sie darum bemüht, eine für ihre kaum achtzehn Lebensjahre seltsam wirkende Würde auszustrahlen, eine Ernsthaftigkeit, die sich auf ihren ganzen Körper übertrug, und doch wich ihr vom dunklen Haar umrahmtes Gesicht immer wieder in den Schatten ihrer Kapuze zurück, als wollte sie vor der Welt fliehen.
Hinter Helena verfiel die Stute eines gedrungenen Knaben unter einem breitkrempigen Hut, dessen Hals so kurz war, dass es den Anschein hatte, sein Kopf würde direkt aus den Schultern wachsen, stets in einen lustlosen Trott, weshalb ihr Reiter sie immer wieder antreiben musste. Er hieß Tomas, war der Stallbursche und Diener der Königin – und Annas Sohn. Er drehte seinen Oberkörper stets mit seinem Kopf, was ihn bedrohlich wirken ließ, so als sei er ständig auf der Hut und bereit zuzuschlagen. Ein mürrischer, aber wachsamer junger Mann, kaum mehr als zehn, zwölf Jahre alt.
Die vier Mitglieder der Stadtwache von Jajce, die den kleinen Tross auf Stjepans Befehl hin begleitetet hatten, bildeten das Schlusslicht der Gruppe. Sie waren allesamt kaum älter als der Stallbursche, blickten immer wieder unsicher hinter sich, und es hätte Helena nicht gewundert, wenn sie kurzerhand Reißaus genommen hätten – wäre da nicht auch Manderdinger gewesen, der unglaublich dicke Koch, der ihnen auf dem Einspänner folgte und mit seinen weit aus den Höhlen ragenden Augen glotzte wie ein misstrauischer, fratzenhafter Torwächter an der Pforte einer düsteren Kirche. An Manderdingers Seite klemmte eine Hellebarde von enormen Ausmaßen, und keiner der jungen Stadtwächter wagte es auszuprobieren, ob Manderdinger damit auch umzugehen wusste.
Sein Wagen war eine seltsame Konstruktion, die aus der Zeit der Hussitenkriege stammte. Haris nannte ihn einen fahrenden Sarg, der im Kampf zu einer Burg umfunktioniert werden konnte.
Der Hussitenwagen wurde von einem stämmigen, aber alten Pferd gezogen, einer Mähre, die den Schlachtrössern der anderen zwar im Galopp unterlegen war, mit jeder Stunde aber munterer wurde, während die stolzen Rösser immer mehr ermüdeten.
Obwohl Haris darauf gedrängt hatte, hatten sie erst gar nicht versucht, die Richtung nach Ragusa einzuschlagen. Anna, die vermeintliche Königin, hatte auf Helena gehört und – entgegen den ursprünglichen Plänen, sich Richtung Meer zu wenden oder dem Vrbas nach Norden zu folgen – das waghalsige Manöver befohlen, sich vor den Akindschi an Jajce vorbeizuschleichen, um dann linker Hand des Vrbas nach Nordwesten zu reiten.
Vorbei am großen Pliva-See quälten sie sich nun durch die schier unendlichen Wälder. Die Angst saß ihnen im Nacken wie das Schwert eines Henkers.
»Was glaubt Ihr, Haris«, raunte Helena, als sie ihr Pferd an die Seite des Kriegers gebracht hatte, »wie nah sind sie uns?«
Haris blinzelte die Schweißtropfen aus seinen Wimpern. »Ich glaube, dass wir keine Pause mehr einlegen sollten, bis uns meterdicke Wände schützen. Das waren Akindschi, Plünderer, die ausschließlich von ihrer Beute leben. Die massakrieren alle, die sie nicht zu Geld machen können, und die anderen versklaven sie. Sie brandschatzen, sind schnell wie Bora-Stürme und dienen dem osmanischen Heer als Vorhut. Wir hätten nach Ragusa reiten sollen.«
»Dazu ist es nun zu spät, und kein Gedanke daran bringt uns weiter. Ihr denkt also, dass diese Akindschi nur die Vorhut waren und die Truppen des Sultans uns ebenso auf den Fersen sind?«
»Nein, das glaube ich nicht. Akindschi sind zum Teil Übergelaufene. Manche von ihnen waren auch Untertanen …«, er machte eine Pause und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht, »… Untertanen des bosnischen Königs. Eines Königs, der sie ausgebeutet hat. Jetzt rächen sie sich, plündern für den Sultan und versklaven christliche Kinder, weswegen man sie mancherorts ›Sackmänner‹ nennt, und sie rauben und brennen alles nieder, was sie für die Menschen zu ›Rennern und Brennern‹ macht. Sie haben so viele Namen.«
Genervt blies Helena Luft aus ihrer Nase. »Glaubt Ihr, das wüsste ich nicht? Ich wollte keine Belehrung, ich wollte eine Einschätzung.«
Haris musterte sie von der Seite. Es war ungewöhnlich, dass ihm jemand in diesem Tonfall begegnete, und einen Moment lang überlegte er wohl, wie er darauf reagieren sollte. Dann hob er unwillig die Schultern und sagte: »Sie sind jedenfalls schneller als wir. Wenn sie sich nicht in Jajce aufhalten, um die Stadt zu plündern, sondern uns sofort gefolgt sind, brauchen wir ein Wunder. Sonst sind wir Männer bis Sonnenuntergang entweder aufgespießt oder geköpft, Tomas wird vielleicht versklavt, und ihr Frauen werdet zunächst geschlagen, dann vergewaltigt und schließlich – wenn ihr dann noch lebt – ebenso versklavt.«
Zornig richtete sich Helena auf und wandte sich dem Riesen zu. »Könnt Ihr die Wahrheit nicht in ein Kleid stecken? Müsst Ihr sie so ungeschönt hervorbringen und mir Angst machen?«
»Das wollte ich nicht.« Er spuckte einen dicken Schleimpatzen auf die von Helena abgewandte Seite. »Aber ich werde nicht fürs Schönreden bezahlt. Mein Leben ist der Kampf, und ich weiß, wann einer bevorsteht, so ist es nun einmal.« Sein vernarbtes linkes Augenlid zuckte.
3
Helena schaute sich um: Der Wald war im Lauf des Tages immer näher an den Pfad herangerückt, und es schien, als hätten sie die ganze Welt aufgeschreckt. Ohne auch nur eines von ihnen zu erblicken, hörte sie die Tiere der Wildnis aufgeregt die Flucht ergreifen oder sich zum Angriff bereit machend. Doch sie selbst machten mit den stampfenden Pferden und den scheppernden Waffen so viel Lärm, dass sie die meisten Geräusche wahrscheinlich gar nicht wahrnahm. Sie würden wohl kaum hören, wenn sich ihnen jemand näherte.
Ihr Vater hatte ihr viel von den bosnischen Wäldern erzählt, von den Legenden über Wölfe, die Menschen aufgezogen hatten, die dann fortwährend als Halbwesen durchs Gehölz gestreift waren. Oder von Bären, die jahrelang Winterruhe hielten, um dann als zornige Greise Bauernhöfe zu überfallen, Mensch und Tier töteten und dort bis ans Ende ihrer Tage lebten.
Ein Jagdvogel kreischte, das Schrecken eines Hirsches klang wie Hundegebell, Rehe sprangen wie von Sinnen durchs Blattwerk. Das alles registrierte Helena wachsam, aber es beunruhigte sie nicht weiter. Nur eines gefiel ihr nicht: das Kreischen der Krähen, die sie seit der Königsstadt begleiteten, als wollten sie ihren Fluchtweg markieren.
Als der Tross plötzlich zum Stehen kam, klang ihr das Schnaufen der Pferde und Reiter fast ohrenbetäubend laut.
Anna rief als Königin mit ängstlicher Stimme: »Haris, warum bleiben wir stehen?«
Doch statt zu antworten, hob der gewaltige Krieger nur die Hand. Er zog seinen Säbel und stieg vom Pferd. Von hinten sahen sie seinen massigen Rücken und den vor Schweiß glänzenden Nacken. Seine Schultern hoben und senkten sich unheilvoll. Was immer sich ihm in den Weg stellte, es würde sterben, wenn es sich nicht bald entfernte.
»Was ist denn los, Haris?«, wollte nun auch Helena wissen, doch im Näherkommen erkannte sie, weshalb der Hüne abgestiegen war. Der Weg führte durch das Rinnsal eines kleinen Bachs, hinter dem er sich gabelte. Beide Pfade waren mit Blicken nicht weiter als ein paar Armlängen zu durchdringen und verschwanden sogleich wieder in der Dunkelheit des dichten Laubwalds.
»Wohin sollen wir?«, fragte Haris und sah Anna an.
Die junge Frau hob ihr Haupt, wobei ihr die Kapuze in den Nacken fiel und ihr blasses Gesicht offenbarte. Sie starrte auf ihre Hände, scheu wie ein Reh, und ihre rissigen Lippen formten sich zu einer Entgegnung, doch ihre Stimme versagte, zu sehr nagte die Flucht wohl noch an ihrem Nervenkostüm. So war es einmal mehr Helena, die an ihrer Stelle das Wort ergriff.
»Wir nehmen den linken Pfad, er scheint nach Westen zu führen, der Richtungswechsel könnte unsere Verfolger abschütteln. Gott wird uns lenken. Vielleicht bringt er uns auch noch ans Meer und zu einem Schiff, das uns dann weit fort und in Sicherheit bringt. Wir haben keine Zeit, länger darüber nachzudenken. Also los, Haris, reite.«
Der Riese blickte zwischen Anna und Helena hin und her und nickte. Ein Zucken der Mundwinkel verriet, dass ihn die Aussicht, doch noch ans Meer zu gelangen, zufrieden stimmte. Sein Pferd trabte ein paar Schritte, drehte sich, und er wollte soeben in den Sattel steigen, wobei er der Weggabelung für einen kurzen Moment den Rücken zuwandte. Sein Ross füllte das Sichtfeld seiner Begleiter so weit aus, dass sie nicht bemerkt hatten, wie sich ihm auf dem dicht umwucherten Pfad etwas genähert hatte. Der Schatten baute sich nun an seinem Rücken auf, und als Haris sich umdrehte – vielleicht weil ihn ein sechster Sinn gewarnt oder weil er doch ein verräterisches Geräusch ausgemacht hatte –, konnte er gerade noch einen Schritt zur Seite machen. Er stolperte über einen Stein, verlor das Gleichgewicht und kam auf dem Hinterteil zum Liegen. Auch sein Schlachtross erschrak. Als er die Zügel im Fallen losgelassen hatte, bäumte es sich auf und wieherte.
Die Gestalt, die ihn so sehr erschreckt hatte, war aus einem der beiden Pfade aus dem Wald gekommen. Ein Mann mit langem Haar, gekleidet in einen schwarzen Umhang, darunter trug er helles Beinkleid und ein Hemd aus grobem, schmutzig erdfarbenem Stoff, über seiner Schulter trug er einen schweren Ledersack. Der Fremde trat auf das Pferd zu und strich dem Tier über den Kopf, um es zu beruhigen.
»Ich wollte Euch nicht erschrecken, mein Herr.« Die Stimme des Fremden war keinesfalls unterwürfig, sie klang im Gegenteil recht selbstbewusst für jemanden, der soeben einen Krieger im Kettenhemd, ohne ihn auch nur zu berühren, zu Boden gestreckt hatte.
»›Mein Herr‹?« Haris lachte zornig auf, tastete nach dem Säbel, den er fallen gelassen hatte, und grunzte: »Er sagt ›mein Herr‹. Glaubt, das würde ihn retten. Aber ich hacke ihm den Kopf ab. Ob höflich oder nicht.«
In einer flüssigen Bewegung stemmte Haris sich auf die Beine und schwang seinen Säbel, dessen gekrümmte Klinge im scheidenden Tageslicht aufblitzte. Die Waffe war jenen, mit der die Akindschi am Morgen ein halbes Dutzend Männer ermordet hatten, sehr ähnlich. Helena erschrak bei dem Anblick, erinnerte sie sich doch an die verstörende Szene auf der Lichtung. An die dem Tod entgegengurgelnden Männer, die hilflos gemeuchelt worden waren, bis schließlich auch Stjepans Kopf getrennt vom Körper über die Wiese gekullert war wie eine vom Baum gefallene Kastanie. Sie blinzelte die Erinnerung fort.
Haris’ Säbel surrte durch die Luft. Der Krieger knurrte dabei wie ein Hund, und Helena konnte aus ihrer Position heraus nicht sehen, was sein Gegenüber unternahm, um sich zu verteidigen. Doch Haris ließ mitten in der Bewegung seine Waffe fallen, kippte erneut um und landete furchtbar fluchend rücklings auf dem Boden.
Helena traute ihren Augen kaum. Haris war der mächtige Leibwächter der Königin, ein Mann, der sein Geschick in vielen, vielen Schlachten bewiesen hatte und dem diese Schlachten auch anzusehen waren. Eine hässliche, niemals gänzlich verheilende Wunde am Oberarm war ein Andenken an die furchtbare Niederlage gegen die Türken auf Kosovo Polje, dem Amselfeld, wo er vor fünfzehn Jahren gemeinsam mit dem ungarischen Heerführer Johann Hunyadi gekämpft hatte. Es war eine Schlacht gewesen, über die er nie gern gesprochen hatte, eine Schlacht, die vom König Ungarns provoziert worden war, die von dessen Vasallen, dem serbischen Despoten, hatte verhindert werden sollen und schließlich vom osmanischen Sultan Murad II. gewonnen worden war.
Manche sagten, Haris habe in den dreißiger Jahren als junger Mann, beinahe noch als Kind, auch in den Hussitenkriegen gekämpft, niemand wusste aber so genau, ob er aufseiten der Reformatoren, verschanzt hinter einer Wagenburg, auf heranpreschende Reiter eingestochen hatte oder ob er ganz im Gegenteil aufseiten der letztlich siegreichen königstreuen Truppen und Gegner von Jan Hus gekämpft hatte. Einerlei für welche Seite, er war dafür belohnt worden – und er hatte auch dafür bezahlt, denn irgendwann in all den Kriegswirren hatte er sein linkes Auge eingebüßt.
All diese Geschichten passten nicht dazu, dass dieser unerschrockene Krieger nun rücklings auf dem Boden lag, niedergestreckt von einem Wanderer ohne Harnisch, ohne geschützte Panzerung, von jemandem, der ganz offensichtlich von niederem Stand war, einem Bauern, Leibeigenen, womöglich sogar einem Vogelfreien, einem Geächteten.
Immerhin rückte der Fremde nun in Helenas Blickfeld. Seine Wangen waren rosig und glänzten, die Füße steckten in geschnürten Lederstiefeln, er trug schmutzige Beinlinge, am Rücken einen Ledersack, aus dem der Griff eines Schwerts ragte, wie Helena nun erkannte, und um seinen Hals baumelte ein mächtiges Kreuz aus Holz. Das wilde Haar des Mannes war zerzaust. Er konnte kaum älter sein als sie selbst. Und doch stand er da und drückte Haris seinen Wanderstab gegen die Brust, um ihn unten zu halten.
Alles war so rasch passiert, dass niemand reagieren konnte, und wieder war es Helena, die am schnellsten die Worte wiederfand und sich zu den Burschen der Stadtwache umdrehte. »Na los, worauf wartet ihr? Beschützt die Königin.«
Sofort war sie umkreist von den fahrigen Kriegern, die kaum imstande waren, unter den nervösen Bewegungen ihrer Pferde ihre Waffen zu ziehen. Einer hatte eine Armbrust, verlor aber das Gleichgewicht, fasste hastig nach den Zügeln, wobei ihm die Waffe beinahe aus der Hand glitt, sich entlud und den Pfeil in einen Ast trieb.
»Die Königin«, zischte Helena. »Ihr sollt die Königin beschützen, nicht mich, ihr tollpatschigen Kerle.«
Da erst verstanden die Männer und machten einen Kreis um die bemitleidenswert erscheinende Anna. Sie saß so verloren auf ihrem hohen Ross, so zerbrechlich und ängstlich, dass sie jeden Augenblick in Tränen auszubrechen schien.
Haris rollte mit den Augen und schnappte unter dem Druck des Wanderstabs nach Luft. »Lass mich. Das ist die Königin. Wenn du leben willst, hilf mir auf, und ich verspreche dir, die Prügel, die du dir einfängst, fallen milder aus, als es angemessen wäre.«
Jetzt näherte sich auch Manderdinger mit seinem klobigen Wagen, dessen klapprige Mähre mit breiten Nüstern schnaufte. Der fette Koch ließ seine Augen auf dem Fremden ruhen wie schwere Gewichte. Ganz offensichtlich hatte er vor, ihn einzuschüchtern. Seine Stimme klang wie grummelnde Gewitterwolken, als er knurrte: »Hilf ihm auf die Beine, Bengel, sonst mach ich aus deinen ein königliches Abendmahl.«
Der Mann, dessen Wanderstab immer noch auf Haris’ Brustkorb ruhte, war groß, fast so groß wie der Söldner, der vor ihm lag. Er wirkte auch mindestens so kräftig wie er.
Er sah unverwandt zu Helena auf. Da war immer noch keine Scheu in ihm auszumachen, keine Unsicherheit. Und das, obwohl doch vieles dagegensprach, dass er die nächsten zehn, zwölf Atemzüge überleben würde, waren sie doch deutlich in der Überzahl.
»Eine Königin? Hier? In diesen Wäldern? Das glaube ich nicht«, rief er keck.
Helena funkelte ihn an. »Was glaubt Ihr, wer Ihr seid, um hier Fragen zu stellen? Dies ist der Königin Land. Lasst den Leibwächter frei und weicht. Er hat Glück, dass wir keine Zeit haben, sonst würden wir seine Körperteile an die Bäume hängen.«
Der Fremde machte keine Anstalten, zu gehorchen, und drückte Haris stattdessen den Stab noch tiefer in die Rippen. Der Riese stöhnte auf, und sein Gesicht verfärbte sich ins Morgenrot.
»Bitte«, hauchte Helena nun deutlich sanfter. »Wir sind auf der Flucht.«
In diesem Moment kreischten die Krähen wieder auf, und der Fremde blickte sich argwöhnisch um. »Auf der Flucht«, wiederholte er wie zu sich selbst. »Verfolgt von Krähen.«
»Nein«, knurrte Haris jetzt. »Nicht nur von Krähen.«
Als bemerkte er ihn erst jetzt, reichte der Fremde Haris die Hand und half ihm auf. »Doch, es sind Krähen, die Euch folgen.« Er wies mit seinem Wanderstab den linken der beiden Wege entlang, jenen, den sie zuvor hatten einschlagen wollen. »Dieser Weg führt in Richtung Meer. Von dort bin ich gekommen. Der Weg wird bald breit und eben. Wer immer Euch folgt, Ihr werdet nicht schnell genug sein. Der andere führt nach Norden ins Land des ungarischen Königs Matthias Corvinus und später in jenes des Kaisers Friedrich. Ihr müsst diesen Weg nach Norden einschlagen. Weiter über die Berge und durch die Wälder bis zur Kupa. Wenn Ihr es über den Fluss schafft, seid Ihr im Heiligen Römischen Reich, dann müsstet Ihr sicher sein. So sicher jedenfalls, wie man dieser Tage sein kann, wenn man mit einer schwächlichen Eskorte reist.«
Haris hatte schnell wieder zur alten Würde gefunden, baute sich vor dem Fremden auf und umfasste das Krummschwert mit beiden Händen. »Du erteilst uns keine Ratschläge. Niemandem mehr. Denn jetzt stirbst du.«
Doch ehe Haris zum tödlichen Hieb ausholen konnte, rief Helena so deutlich, dass es alle hören konnten: »Haris, genug!« Und an den Fremden gewandt: »Bis zur Kupa sind es mindestens zwei, vielleicht drei Tagesreisen. Und was sollen wir im Habsburgerland?«
Der Fremde zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, was die Krähen von Euch wollen. Aber es scheint, als wolltet Ihr denjenigen nicht begegnen, die von den schwarzen Vögeln geleitet werden. Im Norden wärt Ihr weit von ihnen entfernt. Also würde ich sagen: Euch bleibt keine Wahl.«
»Es sind keine Krähen«, maulte Haris. »Das sind gottverdammte Türken, die uns folgen.«
Jetzt verlor der Fremde zum ersten Mal seinen ironischen Ausdruck und schaute einen Moment bestürzt in den Wald. »Wie weit sind sie hinter Euch?«
Helena wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Wir wissen es nicht. Wir reiten seit einem halben Tag. Wenn sie unsere Spur aufgenommen haben, können sie nicht mehr weit sein.«
»Wenn es Akindschi sind, sollten wir nicht mehr weitersprechen. Tut, was Ihr wollt. Ich reite nach Norden.« Der Fremde drehte sich um und pfiff, was ein Zittern im Unterholz bewirkte.
Nicht nur Haris schwang wieder seinen Säbel, auch die Wachmänner zückten ihre Waffen.
Der Fremde beruhigte sie. »Lasst die Waffen sinken«, und im selben Moment stapfte ein munterer Zelter aus dem Unterholz hervor. Der Fremde saß auf und nickte Helena zu. »Folgt mir oder bleibt. Aber entscheidet Euch schnell.«
Unschlüssig stand Haris da und wartete darauf, dass ihm jemand sagte, was er tun sollte. Man sah ihm an, dass er den Fremden am liebsten vom Pferd gezogen und verprügelt hätte.
»Wir haben keine Wahl«, störte Helena seine Mordlust. »Wir folgen dem Mann. Aber wenn er uns belogen hat, dürft Ihr ihm den Kopf abschlagen, Haris.«
Der Fremde drehte sich um, und sein Lächeln kehrte zurück. »Ihr droht einem Mann Gottes?«
Unsicher blickte Helena auf das Kreuz an seiner Brust, doch der Mann machte eine beschwichtigende Geste.
»Ich kann mit dieser Drohung leben. Wenngleich ich kaum annehme, dass mich dieser Koloss erwischen würde, selbst wenn er mich schlafend fände. Allerdings –«
»Allerdings was?«, unterbrach Haris ihn unwirsch. Er selbst saß mittlerweile ebenfalls im Sattel.
»Allerdings muss jemand den falschen Weg nehmen, um Eure Verfolger in die Irre zu führen. Wenn unsere List gelingen soll, muss es jemand sein, der genug Lärm macht, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und auch genug Spuren hinterlässt. Sie müssen ihm folgen. Mit etwas Glück gewinnen wir dadurch genug Zeit, um sie abzuschütteln.«
Helena blickte sich um und sah in die Gesichter ihrer Begleiter, die zu Boden blickten, als suchten sie dort Verstecke, in die sie kriechen konnten. Wer immer dazu auserkoren wurde, die Akindschi in die Irre zu führen, er würde das Manöver nicht überleben.
»Wenn sich allerdings niemand findet, muss es wohl die Magd der Königin sein, die sich opfert.«
Der Fremde sagte das so bestimmt, dass ihn alle verdutzt ansahen. Haris lenkte sein eigenes vor Helenas Pferd, hatte wieder seinen Säbel in der Hand, während sie sich im Sattel aufrichtete und den Fremden musterte. Anna schnappte nach Luft, wollte etwas sagen, doch ehe die Situation abermals entglitt, verbeugte sich der Fremde vor ihr.
»Verzeiht, Königin. Das ist natürlich allein Eure Entscheidung, aber entscheidet bitte schnell.« Der Mann sah sich um und betrachtete die Krähen, die sich auf die Äste einiger Bäume verteilt hatten und die debattierende Gruppe musterten wie Zuschauer auf einem Marktplatz. »Gottes Zeichen könnten nicht deutlicher sein.«
Auch Haris warf den Tieren nun einen unsicheren Blick zu und fuhr sich mit dem Handrücken über die schweißnasse Oberlippe. »Ich werde gehen.«
Doch da ertönte Manderdingers donnernde Stimme. »Nein, das wirst du natürlich nicht tun, du Narr!« Die Mähre setzte sich in Bewegung, und der Wagen rollte quietschend ein Stück näher. »Ich fahre. Ich mache sie auf mich aufmerksam, und ich kann mich verteidigen. Ich halte sie auf. Lange genug jedenfalls, um euch allen das Leben zu retten. Außerdem glaube ich nicht, dass sie mir etwas tun werden.« Er zog ein noch größeres Kreuz aus seinem Mantel, als es der Fremde um den Hals trug, und zwinkerte. »Dieses Kreuz wird selbst die wildesten Türken aufhalten.«
Helena lenkte ihr Pferd in seine Richtung. »Herr Manderdinger …«
»Keine Widerrede. Ich gehe.« Seine riesigen Augen schauten in alle möglichen Richtungen, sein Doppelkinn bebte, und die Schweißperlen rannen über seine rosa Wangen.
Helena glaubte auch die eine oder andere Träne auszumachen, doch sie wollte den Mann nicht darauf ansprechen und ihm seine Würde nehmen.
»Lebt wohl«, krächzte er. Als er bei Haris anlangte, streckte er ihm die Hand entgegen. »Gib auf dich acht.« Er wandte sich noch einmal den anderen zu. »Und auf die Königin.«
Haris schüttelte seine Hand. »Wir werden uns wiedersehen.«
»In dieser oder der nächsten Welt. Gewiss.« Und mit diesen Worten trieb Manderdinger seine Mähre an und schepperte mit seinem Wagen an der Gruppe vorbei auf den Fremden zu.
Haris rief ihm nach: »Wir sollten diesem Mann Gottes klimperndes Zeug um den Hals hängen und ihn in die Falle jagen, nicht einen der Unsrigen. Er soll gehen, nicht einer von uns.«
Der Fremde stand ungerührt da und zuckte mit den Schultern. »Glaubt mir, dann sterbt auch Ihr. Mit diesem Wagen seid Ihr zu langsam.«
Haris knurrte und konnte sichtlich kaum noch an sich halten. »Königin, ein Wort von Euch und ich zerteile diesen Kerl an Ort und Stelle. Er will uns nichts Gutes.«
Der Fremde starrte wieder auf die Krähen. »Ihr habt keine Wahl. Und mit Verlaub, auch nicht mehr viel Zeit.«
Helena lenkte ihr Pferd an seine Seite. »Nennt mir Euren Namen, ehe wir Euch folgen.«
Der Mann verbeugte sich. »Johannes, meine Dame. Ich bin Johannes, und wer seid Ihr?«
Einen Moment lang schien es, als würden alle den Atem anhalten. Als wäre etwas unzweifelhaft Unziemliches geschehen, weil er eine Dame des Königshofs ansprach.
Helenas Augenlider flatterten nervös, und Blut schoss ihr ins Gesicht. Sie wandte sich der schweigsamen Anna auf dem Pferd zu. »Das sind Königin Maria und ihre Gefolgschaft. Und ich bin Helena, der Königin Magd.«
Johannes musterte sie, und einen Moment lang war sie nicht sicher, ob er losprusten würde. Er tat nichts dergleichen, nickte nur und rief: »Also dann, Königin, wir sollten keine Zeit verlieren. Folgt mir.«
Wenige Augenblicke später war die Lichtung wieder leer. Die tiefen Räderspuren Manderdingers Gefährts waren nicht zu übersehen, während der finstere zweite Pfad sich unberührt in der undurchdringlichen Dunkelheit zu verlieren schien. Die Krähen hockten noch einige Zeit auf ihren Ästen, als schienen sie zufrieden mit der Darbietung und wollten die Tribünen noch nicht verlassen. Dann stiegen sie hoch, kreischten sich an und zogen ihre Kreise weit über den Baumwipfeln des Waldes.
4
Die Angst trieb sie an.
Wie sonst war es zu erklären, dass sie einem Fremden im blinden Vertrauen durch den Wald folgten?
Der Pfad war rasch so steil und unwegsam geworden, dass sie bald absteigen und die Pferde an den Zügeln führen mussten.
Anfangs hatte Helena noch auf jede Bewegung des Mannes geachtet, hatte argwöhnisch innegehalten, als sie den Sack und das Schwert an seinem Rücken bemerkt hatte, nun stellte sie zudem fest, dass er unter seinem Umhang auch einen Bogen und einen Köcher mit einem Dutzend Pfeilen mit sich trug. Er war offenbar gut bewaffnet, und sie ging davon aus, dass er mit diesen Waffen auch umgehen konnte.
Sie musste zugeben, dass sie den Fremden dafür bewunderte, wie energisch er sich den Weg freischlug, wo die Büsche zu dicht in den Pfad hineingewachsen waren. Der lange Holzstab, den er wie einen verlängerten Arm führte, diente ihm außerdem als Steighilfe über Wurzeln und Felsen, ebenso als Wegbereiter im Unterholz.
Der Fremde drehte sich mehrmals zu ihnen um, und einige Male streifte sie sein Blick, doch irgendwann gab Helena es auf, ihn so beharrlich zu mustern. Sie begann, nur noch auf sich selbst zu achten, denn es fiel ihr immer schwerer, mit den anderen Schritt zu halten.
Natürlich wusste sie, dass die Stadtwache sie nicht als Letzte in der Gruppe laufen lassen würde, doch sobald sie langsamer wurde, hatte sie ein Gefühl, als beobachte sie der Wald. Als griffen seine Äste nach ihr. Würde sie jetzt stehen bleiben oder gar zurückfallen, der Wald würde sie umschließen, ihre Spuren verwischen und sie einfach verschlucken.
Tief unten in einer Schlucht hörte Helena das Rauschen des Vrbas, dessen Verlauf sie nach Norden folgten. Fast kam ihr der Gedanke tröstlich vor, wie es wäre, auszurutschen, den Hang hinabzuschlittern und schließlich über die Felskante zu fallen, immer tiefer, bis sie aufschlagen und alles im großen schwarzen Nichts enden würde.
Sie richtete die Augen Richtung Baumwipfel und bekreuzigte sich hastig. Gedanken wie diese kamen Blasphemie gleich. Gedanken wie diese trieben ihr Angstwellen durch den Körper, denn der Heiland würde sie sehen können, würde sie anblicken und verabscheuen. Wie konnte sie nur so töricht sein und sich der Vorstellung hingeben, am Ende warte nichts als schwarzes Nichts auf sie? Natürlich würde etwas auf sie warten. Das Licht des Herren. Der Himmel. Und im Himmel würde sie auch Stjepan treffen. So war es ihr gelehrt worden, so hatten sie und alle anderen es zu glauben. Allerdings nur unter einer Bedingung – sie durfte nicht einmal daran denken, ihrem Leben selbst ein Ende zu bereiten.
Stjepan …
Bei dem Gedanken an ihn und wie er vor wenigen Stunden in ihre Richtung gezeigt und sie verraten hatte, wurde ihr beinahe übel. Er hatte sie auf ihrer Flucht in zwei Gruppen getrennt, doch nicht etwa in der Hoffnung, auf diese Weise wenigstens seine Frau zu retten. Nein, wie sie jetzt wusste, hatte er gehofft, dass die Türken sie zuerst finden und dadurch von ihm ablassen würden. Wie einfältig sie doch gewesen war. Am Ende hatte er den Feinden sogar die Königsstadt Jajce angeboten in der Hoffnung, sie dann milder zu stimmen. Helena hatte es einfach nicht glauben können und war geblieben, anstatt sofort die Flucht zu ergreifen. So war sie Zeugin seiner Niedertracht geworden. Und seines Todes.
Sie würde ihn am Himmelstor im Angesicht des Herrn ohrfeigen. Noch einmal bekreuzigte sie sich, doch diesmal huschte ein gehässiges Lächeln über ihr Gesicht.
Sie rannten eine Ewigkeit durch den dichten Wald, die Pferde eng an den Zügeln haltend. Irgendwann konnte Helena die Übelkeit nicht mehr zurückhalten. Sie blieb stehen, lehnte sich an einen Baum und übergab sich. Tomas, der Stallbursche, drehte sich besorgt zu ihr um, doch sie bedeutete ihm energisch, weiterzugehen.
Die Wächter standen unschlüssig um sie herum und blickten in alle Richtungen. Ihnen war die Angst anzusehen. Sie wollten weiter. Nur weg. Also glaubten auch sie offenbar nicht daran, dass sie der Wald beschützen würde.
Helena wischte sich die Mundwinkel trocken und nickte ihnen zu, ihr zu folgen, um so rasch wie möglich zu Tomas, Haris und der vermeintlichen Königin aufzuschließen. Und zu dem fremden Kriegermönch Johannes, der wie ein Geist aufgetaucht war.
Als sie aus dem Hohlweg kamen, tauchten die ersten windschiefen Gebäude eines düsteren Weilers auf.
Auf ein Zeichen von Haris blieb der Tross stehen.
»Grenzer«, raunte er und spuckte auf den Boden. »Verdammte Häretiker, man weiß nie, ob sie für uns oder gegen uns sind. Heute schenken sie dir Wein ein, morgen könnten sie schon mit den Akindschi ziehen.«
Mit schmalen Augen achtete er darauf, wie Johannes auf seine Worte reagierte, doch der junge Mann verzog keine Miene.
5
Auf den ersten Blick war nicht zu erkennen, wo die Tiere hausten und wo die Menschen. Hinter einem morschen Gatter wälzte sich eine magere Sau im Dreck. Ein zerrupftes Huhn rannte auf sie zu, ehe es einen Haken schlug und hinter einem schlampig geschlichteten Scheitholzhaufen verschwand. Auf dem Feld, das sich vor dem Wald ausbreitete, mühte sich ein greisenhaftes Bauernpaar ab. Die beiden warfen schwere Heuladungen mit Heugabeln auf einen Karren. Nach jedem Schwung stützte sich der Mann auf das Werkzeug und atmete durch. Seinen kahlen Kopf hatte er mit einem schmutzigen Lederlappen bedeckt, dessen Laschen über die Ohren hingen. Die Frau arbeitete ohne Unterlass in einem Rhythmus, den sie allem Anschein nach schon ihr ganzes Leben innehatte, so träge, aber auch sicher war der Fluss ihrer Bewegungen. Ihr Körper war nicht mehr der jüngste, doch er war kräftig und sehnig und die immerwährende Anstrengung offenbar gewohnt.
Die Sonne hatte ihren Zenit zwar längst überschritten, und der Tag neigte sich dem Abend zu, dennoch brannte sie immer noch erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel, der die blasse Farbe des Vrbas hatte. Das Kopftuch der Frau wies Schweißflecken auf.
Ein Mädchen, vielleicht zehn, elf Jahre alt, trug zwei volle Eimer Wasser mit einem Joch über den Schultern vom Brunnen zum Haus. Bei jedem Schritt plätscherte etwas Wasser aus den Behältern und ließ sie innehalten, bis sich die glitzernde Oberfläche in den Kübeln wieder beruhigt hatte. Dann ging es so lange weiter, bis abermals Tropfen herausspritzten.
Der Wind stand still, als eine Krähe sich am Strohdach des Hauses niederließ und einen Schrei ausstieß, der so laut war, dass das Mädchen aufblickte. Auch der Greis auf dem Feld sah nun zu dem gefiederten Tier hinüber und neigte den Kopf, als versuchte er, den Vogelschrei zu deuten. Die Krähe war groß wie ein Kolkrabe, nur grauer und ausgezehrter, auch ihr Schnabel war etwas kleiner, und das Gefieder sah matt und struppig aus. Ihre schwarzen Augen musterten die Menschen rund um den Hof, und sie schien dabei zu grinsen – so hämisch, wie es nur hinterlistige Krähen vermochten. Aus einem Stallgebäude war das nervöse Wiehern eines Pferds zu vernehmen. Und mit einem Mal kam Bewegung in den Weiler.
Der Alte deutete den Vogel aus einer Ahnung heraus wohl als Warnung, denn er rief der Frau etwas zu, wodurch beide sogleich, so schnell sie eben konnten, übers Feld humpelten. Den Esel trieben sie vor sich her und achteten nicht darauf, dass der Karren Heuballen verlor. Die Frau ließ die Heugabel nicht aus den Händen, und der Alte schlug dem Esel immerfort mit einem Stock auf den Hintern.
Das Mädchen stieß einen spitzen Schrei aus, ließ die Eimer fallen und lief ins Haus, aus dem ihr jetzt ein untersetzter Mann mit nacktem Oberkörper und wildem Bartwuchs entgegenlief. Sein Kopf war bedeckt von gekräuseltem Haar, das seltsame Ähnlichkeit mit dem Haar auf seiner Brust hatte. Er griff nach dem erstbesten Werkzeug, das ihm unterkam – einer Holzaxt, die er mit beiden Händen hielt –, und winkte den Alten zu, sich zu beeilen. Er drehte die Axt in seinen Händen, schien fieberhaft zu überlegen, was zu tun sei, und scheuchte das Mädchen dann mit heftigen Gesten an sich vorbei hinein ins Haus.
Als sich der Tross, den der Schrei der Krähe angekündigt hatte, näherte, hatte sich die kleine Familie vor dem Tor zur windschiefen Hütte, die als Behausung diente, aufgestellt. Der Mann mit der Axt, die Frau mit der Heugabel und der Alte, der nun eine Sense in der ausgemergelten Hand hielt. Auch das Mädchen stolperte wieder aus dem Haus und schleppte mit zitternden Händen einen Rossschinder mit sich, den ihr der Mann, der vermutlich ihr Vater war, sogleich tadelnd aus der Hand nahm. Er schlug die Axt in den Türrahmen, schob das Kind neuerlich zurück ins Innere und streckte die gefährliche Stangenwaffe von sich, die Spitze auf die ungebetenen Gäste gerichtet. Mit ihrem kurzen Haken konnte sie sich in Rüstungen verkeilen und Angreifer vom Pferd zerren, der Dorn auf der einen Seite durchschlug Panzerungen, die zweischneidige armlange Klinge konnte furchtbare Verletzungen zufügen. Wenn man diese Waffe zu nutzen wusste, war sie mörderisch, sowohl für Pferd als auch für Reiter. Wenn nicht, hielt sie einen immerhin davon ab davonzurennen.