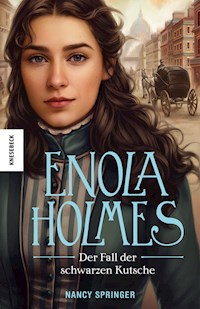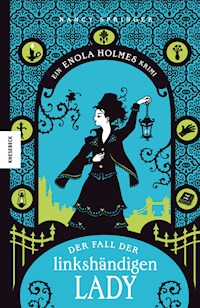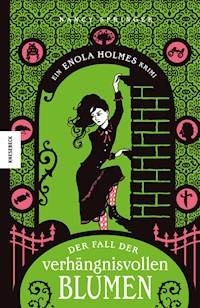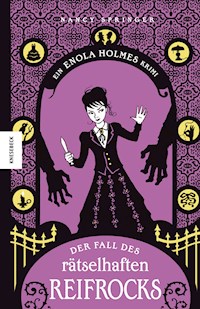6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Enola Holmes
- Sprache: Deutsch
Das Buch zum Netflix-Film mit Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Helena Bonham Carter Anders als ihre berühmten älteren Brüder Sherlock und Mycroft führt Enola Holmes ein freies aber abgeschiedenes Leben auf dem Land – bis eines Tages ihre Mutter verschwindet und ihr neben versteckten Banknoten auch einige verschlüsselte Hinweise hinterlässt. Heimlich macht sich Enola auf den Weg ins düstere viktorianische London, um ihre Mutter zu suchen. Doch dort wird sie in die Entführung eines jungen Lords verwickelt und muss in zwielichtigen Gegenden vor mörderischen Gaunern fliehen – immer auf der Hut vor ihren scharfsinnigen Brüdern, die sie zur Erziehung in ein Internat stecken wollen. Wird sie es zwischen all dem Chaos schaffen, die Hinweise zu entschlüsseln und gleichzeitig dem Internat zu entkommen? Der erste Band einer rasant spannenden Buch-Serie über die sympathische kleine Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für meine Mutter – N.S.
Inhalt
»Ich verharrte einen Moment zu lang.«
Londoner East End nach Einbruch der Dunkelheit, August 1888
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
London, November 1888
Geheimcodeanflösung
»Ich verharrte einen Moment zu lang.«
Schwere Schritte erklangen hinter mir. Ich machte einen Satz, wollte fliehen, doch es war zu spät. Hastig eilten die Schritte näher. Mit eisernem Griff legten sich Finger um meinen Arm. Ich wollte schreien, doch eine Hand wie aus Stahl presste sich auf meinen Mund. Dicht an meinem Ohr knurrte eine Stimme: »Wenn du dich wehrst oder schreist, dann werde ich dich töten.«
Vor Grauen war ich wie gelähmt. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ich in die Dunkelheit, unfähig, mich zu rühren. Selbst das Atmen fiel mir schwer. Während ich keuchend dastand, lockerte sich der Griff um meinen Arm, aber nur um sich sogleich ganz um mich zu schlingen, meine Arme an die Seiten zu zwingen und meinen Rücken gegen eine Oberfläche zu drücken, die eine Wand aus Stein hätte sein können – hätte ich nicht gewusst, dass es der Brustkorb meines Angreifers war. Seine Hand löste sich von meinem Mund, doch bevor meine zitternden Lippen auch nur einen Laut zustande brachten, blitzte im Zwielicht der Nacht etwas Metallenes vor mir auf. Etwas Langes. Am Ende spitz wie eine Scherbe aus Eis. Ein Messer.
Londoner East End nach Einbruch der Dunkelheit, August 1888
Das einzige Licht, das gegen die Nacht andrängt, sickert aus den wenigen noch funktionierenden Gaslaternen und den über dem Kopfsteinpflaster hängenden Feuerschalen, an denen alte Männer vor den Wirtshäusern gekochte Meeresschnecken verkaufen. Die Fremde, die vom Hut bis zu den Stiefeln in Schwarz gekleidet ist, stiehlt sich unbemerkt von einem Schatten zum nächsten, als wäre sie selbst einer. Wo sie herkommt, ist es undenkbar für ein weibliches Wesen, sich nachts ohne die Begleitung eines Ehemanns, Vaters oder Bruders auf die Straße zu wagen. Doch sie ist zu allem entschlossen, um nach der zu suchen, die sie verloren hat.
Aus weit aufgerissenen Augen späht sie unter ihrem schwarzen Schleier hervor und beobachtet. Sie sieht die Glasscherben auf den rissigen Gehsteigen. Sie sieht die Ratten, die frech umherjagen und ihre widerlichen nackten Schwänze hinter sich herziehen. Sieht Kinder in Lumpen, die barfuß zwischen den Ratten und den Scherben Fangen spielen. Sieht Pärchen, Männer in roten Flanellhemden und Frauen mit billigen Strohhütchen, die Arm in Arm vorübertorkeln. Sie sieht jemanden inmitten der Ratten an einer Wand liegen, betrunken oder eingeschlafen – oder vielleicht sogar tot.
Und nicht nur die Augen, auch die Ohren sperrt die Suchende weit auf. Irgendwo spuckt ein Leierkasten eine Melodie in die rußige Luft. Die schwarz Verschleierte lauscht der schnurrenden Musik. Auch ein kleines Mädchen hört sie, das vor der Tür eines Wirtshauses »Daddy? Dad?« ruft. Sie hört Schreie, Gelächter, betrunkenes Lallen und die Rufe von Straßenhändlern: »Austern! Schmeißt sie in Essig und fresst sie im Ganzen! Schöne Fette – vier für ’nen Penny!«
Sie riecht Essig. Sie riecht Gin, gekochten Kohl und heiße Würste, die salzige Brise vom nahen Hafen und den Gestank der Themse. Sie riecht vergammelten Fisch. Riecht ungefilterte Abwässer.
Sie beschleunigt ihren Schritt. Sie muss in Bewegung bleiben, denn nicht nur sie ist eine Suchende – man sucht auch nach ihr. Die schwarz verschleierte Jägerin wird gejagt. Sie muss weit laufen, damit die Männer, die sie verfolgen, sie nicht finden können.
An der nächsten Straßenlaterne sieht sie eine Frau mit angemalten Lippen und schwarz verschmierten Augen wartend in einer Tür stehen. Eine offene Kutsche fährt vor und ein Mann in einem Gehrock und mit einem glänzenden Seidenzylinder steigt aus. Selbst die Frau auf der Schwelle trägt eine tief ausgeschnittene Abendrobe, die einmal einer Lady aus der sozialen Schicht des feinen Herren gehört haben könnte. Die Beobachterin in Schwarz glaubt nicht, dass der Gentlemen gekommen ist, um die Frau zum Tanzen auszuführen. Sie sieht, dass die verhärmten Augen der Prostituierten voller Furcht sind, egal, wie breit ihre roten Lippen auch lächeln. Eine wie sie wurde erst vor Kurzem ein paar Straßen weiter tot aufgefunden, brutal aufgeschlitzt. Die Suchende in Schwarz wendet den Blick ab und läuft weiter.
Ein unrasierter Mann, der an einer Mauer lehnt, zwinkert ihr zu. »Miss, so ganz allein unterwegs? Wie wär’s mit ’n bisschen Gesellschaft?« Wäre er ein Gentleman, hätte er sie niemals angesprochen, ohne ihr zuvor vorgestellt worden zu sein. Sie ignoriert ihn und eilt vorbei. Sie darf mit niemandem sprechen. Sie gehört nicht hierher – was ihr jedoch nichts ausmacht. Sie hat noch nie irgendwohin gehört. Und gewissermaßen war sie sogar schon immer allein. Trotzdem ist ihr Herz nicht ohne Gram, während sie die Schatten durchkämmt, denn nun hat sie kein Zuhause mehr, ist eine Fremde in der größten Stadt der Welt und weiß nicht, wo sie heute Nacht schlafen soll.
Und falls, so Gott will, sie den nächsten Morgen erlebt, kann sie nur hoffen, dass sie den geliebten Menschen findet, nach dem sie sucht.
Tiefer und tiefer dringt sie in die Schatten des Elendsviertels im Osten Londons vor. Allein.
1. Kapitel
Zu gerne wüsste ich, warum meine Mutter mich »Enola« getauft hat, was rückwärts gelesen »alone« bedeutet – das englische Wort für »allein«. Mum war, oder ist vielleicht immer noch, begeistert von Rätseln und Geheimcodes, daher muss sie sich etwas dabei gedacht haben – ob als böses Omen, ungeschickter Segensspruch oder Zeugnis lange geschmiedeter Pläne. Obwohl mein Vater damals noch nicht von uns gegangen war.
Jedenfalls hat sie mir während meiner Kindheit beinahe jeden Tag gesagt: »Du kommst bestens allein zurecht, Enola.« Tatsächlich war das ihre übliche, gedankenverlorene Art, sich von mir zu verabschieden, bevor sie sich mit Zeichenblock, Pinseln und Wasserfarben aufmachte, die Landschaft zu durchstreifen. Und tatsächlich ließ sie mich durchaus allein, als sie im Juli am Abend meines vierzehnten Geburtstags nicht nach Ferndell Hall, unserem Zuhause, zurückkehrte.
Da meine Feier auch ohne sie stattfand – mit Lane, dem Butler, und seiner Frau, der Köchin –, bereitete mir ihre Abwesenheit zunächst kein Kopfzerbrechen. Obwohl wir herzlich genug miteinander umgingen, sofern wir uns über den Weg liefen, mischten Mum und ich uns selten in die Angelegenheiten der jeweils anderen ein. Ich nahm an, dass irgendetwas Dringendes sie anderweitig in Beschlag nahm, vor allem, da sie Mrs Lane im Vorfeld angewiesen hatte, mir zur Teestunde gewisse Päckchen zu überreichen.
Mums Geschenke an mich waren:
– ein Zeichenkasten: Papier, Bleistifte, ein Taschenmesser, um sie zu spitzen, und Radiergummis – alles fein angeordnet in einer flachen Holzkiste, die sich zu einer Staffelei ausklappen ließ;
– ein dickes Buch mit dem Titel Die Sprache der Blumen: mit Erklärungen zu den Botschaften von Fächern, Taschentüchern, Siegelwachs und Briefmarken;
– ein weit kleineres Büchlein mit verschiedenen Geheimcodes.
Obwohl es um meine Zeichenkünste nicht besonders gut bestellt war, wollte Mutter das bisschen Talent, das ich hatte, fördern. Sie wusste, dass ich gerne skizzierte und beinahe jedes Buch zu jedem Thema mit Freuden verschlang – doch sie wusste ebenso, dass Geheimcodes nicht zu meinen Favoriten gehörten. Dennoch hatte sie dieses kleine Buch für mich gemacht, mit ihren eigenen Händen, wie ich deutlich sehen konnte: Die Seiten, die sie mit zierlichen Aquarellblumen verziert hatte, waren gefaltet und anschließend zusammengenäht.
Ganz offensichtlich hatte dieses Geschenk geraume Zeit in Anspruch genommen – ich war ihr also durchaus wichtig, redete ich mir ein. Mit Nachdruck. Und zwar gleich mehrmals an diesem Abend.
Ich hatte zwar keine Ahnung, wo Mum sein könnte, rechnete aber damit, dass sie im Laufe der Nacht entweder nach Hause kommen oder aber eine Nachricht schicken würde. Ich verlor nicht viel Schlaf darüber.
Doch am nächsten Morgen schüttelte Lane den Kopf. Nein, die Dame des Hauses sei noch nicht zurückgekehrt. Nein, man habe auch nichts von ihr gehört.
Draußen fiel grauer Regen, der gut zu meiner Stimmung passte, die immer unruhiger wurde.
Nach dem Frühstück trottete ich zurück auf mein Zimmer – ein hübsches Refugium, wo Kleiderschrank, Waschstand, Kommode und dergleichen weiß bemalt waren, verziert mit rosa-blauen Blumensträußchen in den Ecken. »Landhausmöbel« nannten die Leute es – billiger Kram, der nur für Kinder taugte. Aber ich mochte es. Meistens.
Heute nicht.
Ich hielt es im Haus nicht länger aus. Nicht einmal stillsitzen konnte ich, außer, um rasch Galoschen über meine Stiefel zu ziehen. Ich trug Hemd und Knickerbocker, bequeme Kleidung, die zuvor meinen älteren Brüdern gehört hatte. Darüber warf ich einen Regenmantel. Von oben bis unten eingehüllt polterte ich die Treppe hinunter und schnappte mir aus dem Ständer im Flur noch einen Regenschirm. Während ich durch die Küche nach draußen eilte, rief ich Mrs Lane knapp zu: »Ich gehe mich ein wenig umsehen.«
Seltsam: Dieselben Worte sagte ich fast jeden Tag, wenn ich das Haus verließ – um nach Dingen zu suchen, von denen ich in der Regel noch nicht wusste, welche genau es sein würden. Hauptsache, etwas. Oft kletterte ich auf Bäume, um zu sehen, was es in ihnen zu finden gab: rotbraun und gelb gestreifte Schneckenhäuser, Nüsse, Vogelnester. Und wenn ich auf das Nest einer Elster stieß, stöberte ich darin herum und fand so einiges: Schuhknöpfe, glänzende Bänder, verlorene Ohrringe. Zu gern tat ich dabei so, als wäre etwas besonders Wertvolles verschwunden, das es aufzuspüren galt …
Heute war es kein Spiel.
Auch Mrs Lane war sich dessen bewusst. Üblicherweise hätte sie gerufen: »Wo ist Ihr Hut, Miss Enola?«, weil ich nie einen trug. Doch als sie mir heute nachsah, wie ich loszog, um meine Mutter zu suchen, schwieg sie.
Ich dachte wirklich, ich könnte sie finden.
Sobald die Küche außer Sichtweite war, begann ich, wie ein Beagle herumzurennen und nach Mums Fährte zu suchen. Am Morgen zuvor hatte man mir erlaubt – quasi als Geburtstagsgeschenk –, im Bett liegen zu bleiben. Daher hatte ich nicht gesehen, wie meine Mutter das Haus verlassen hatte. Trotzdem ging ich davon aus, dass sie wie gewohnt einige Stunden damit verbracht hatte, Blumen und andere Pflanzen abzuzeichnen, weshalb ich zuerst auf Ferndells Ländereien nach ihr Ausschau halten wollte.
Mum, die ihr Anwesen selbst verwaltete, ließ die Dinge gern ungestört wachsen. Ich wanderte daher durch wild wuchernde Blumengärten, Rasen voller Ginster und Brombeeren, Wälder, die mit Wein und Efeu zugewachsen waren. Und alles, während der graue Himmel seine Tränen über mir vergoss.
Der alte Collie, Reginald, trottete neben mir her, bis er es leid war, nass zu werden, und davonschlich, um sich einen Unterschlupf zu suchen. Vernünftiges Tier! Durchgeweicht bis zu den Knien, war mir klar, dass ich es ihm gleichtun sollte, aber ich konnte nicht. Nicht nur meine Schritte wurden immer schneller, auch meine Sorge wuchs, bis mich schließlich Entsetzen antrieb. Die Angst, meine Mutter könnte irgendwo dort draußen liegen, verletzt oder krank sein oder – eine Befürchtung, die ich nicht völlig verdrängen konnte, da Mum bei Weitem nicht mehr die Jüngste war – niedergestreckt von einem Herzversagen daliegen. Am Ende war sie … doch das wollte ich nicht einmal denken. Dafür gab es andere Worte: von uns gegangen. Den Jordan überschritten. Entschlafen. Sich zu meinem Vater gesellt.
Nein. Bitte nicht.
Man könnte meinen, da Mutter und ich uns nicht sonderlich nahestanden, wäre mir ihr Verschwinden ebenso wenig nahegegangen. Doch ganz im Gegenteil. Ich fühlte mich schrecklich und war davon überzeugt, dieses Unglück wäre allein meine Schuld. Immerhin gab ich mir grundsätzlich die Schuld – an allem, selbst am Luftholen –, weil ich nämlich unverschämt spät in Mutters Leben getreten war. Ein Skandal. Eine Last. Bisher war ich davon ausgegangen, dass ich das irgendwie wiedergutmachen würde, wenn ich erst erwachsen war. Eines Tages, so hoffte ich, würde ich aus meinem Leben ein leuchtendes Beispiel machen, das mich aus dem Dunkel der Schande ans Licht ziehen würde.
Und dann, versteht ihr, würde meine Mutter mich endlich lieben.
Nur dafür musste sie natürlich am Leben sein.
Und ich musste sie finden.
Suchend durchstreifte ich Wälder, in denen Generationen von Gutsherren Hasen und Hühner gejagt hatten. Ich kletterte über den zerfurchten, farnbewachsenen Fels der Grotte, dem das Anwesen seinen Namen verdankte – ein Ort, den ich liebte. Doch heute hielt ich mich hier nicht auf. Ich lief weiter zum Rand des Parks, wo der Wald endete und das Farmland begann.
Meine Suche führte mich hinaus auf die Felder, denn es war gut möglich, dass Mum der Blumen wegen hierhergekommen war. Da Ferndell nicht allzu weit von der Stadt entfernt lag, waren unsere Pächter dazu übergegangen, statt Gemüse Glockenblumen, Stiefmütterchen und Lilien anzubauen, da sie besser daran verdienten, täglich frische Blüten nach Covent Garden zu liefern. Hier wuchsen reihenweise Rosen, Schönaugen, flammende Büschel von Zinnien und Mohn, alle für London. Normalerweise, wenn ich dieses Blumenmeer betrachtete, träumte ich von einer hellen Stadt, in der lächelnde Hausmädchen in jeden Raum der Villen Tag für Tag frische Blumensträuße stellten. Einer Stadt, in der alle feinen und adeligen Damen sich selbst, ihre Haare und ihre Kleider mit Windröschen und Veilchen ausstaffierten und bedufteten. Ach, London…
Doch heute ließen die Blumen auf den Äckern nass die Köpfe hängen und meine Träumereien von London dauerten lediglich einen, höchstens zwei Atemzüge an, bevor sie sich auflösten wie der Dunst, der von den Feldern aufstieg. Ausladende Felder. Kilometerweite Felder.
Wo war Mutter?
In meinen Träumen – meinen Mum-Träumen, nicht in denen von London – fand ich sie auf eigene Faust, als strahlende Heldin, zu der meine Mutter voller Dankbarkeit und Bewunderung aufblickte, als ich sie rettete.
Doch es waren nichts als Träume und ich war eine Närrin.
Bisher hatte ich lediglich ein Viertel des Anwesens und einen noch viel kleineren Teil der Ländereien durchkämmt. Sollte Mum irgendwo verletzt liegen, würde sie ihren Geist aushauchen, lange bevor ich sie ganz allein finden könnte.
Ich kehrte um und eilte zurück zum Haus.
Kaum angekommen, stürzten sich Lane und Mrs Lane auf mich wie zwei Turteltauben auf ihr Nest. Er nahm mir den triefenden Umhang, den Schirm und die Stiefel ab, sie scheuchte mich in die Küche, damit ich mich aufwärmte. Obwohl es sich für sie natürlich nicht ziemte, mich zu tadeln, machte sie ihrer Meinung Luft. »Man muss schon geistesschwach sein, um sich bei diesem Regen stundenlang im Freien aufzuhalten«, sagte sie zu dem großen Kohleherd, während sie eine der Kochplatten hochstemmte. »Aristokratin hin oder her, in diesem Wetter kann man sich den Tod holen«, schalt sie den Teekessel, während sie ihn auf den Herd stellte. »Schwindsucht unterscheidet nicht zwischen Bettlern und Adeligen«, schimpfte sie mit der Teedose. Da sie ja nicht zu mir redete, bestand für mich keine Notwendigkeit zu reagieren. Mit mir hätte sie niemals so sprechen dürfen. »Man kann auch sehr gut einen freien Geist besitzen, ohne nach einer Mandelentzündung, Rippenfellentzündung, Lungenentzündung oder Schlimmerem zu suchen.« Diesmal bekamen die Teetassen ihren Teil ab. Als sie sich anschließend zu mir umwandte, wandelte sich ihr Ton schlagartig. »Verzeihen Sie bitte, Miss Enola. Möchten Sie Ihr Mittagessen zu sich nehmen? Wollen Sie sich nicht etwas dichter an den Herd setzen?«
»Noch dichter und ich werde gegrillt. Nein, ich brauche kein Mittagessen. Gibt es irgendetwas Neues von Mutter?« Obwohl ich die Antwort bereits kannte – denn Lane oder Mrs Lane hätten mir sofort Bescheid gegeben, hätten sie etwas erfahren –, konnte ich mir die Frage nicht verkneifen.
»Nichts, Miss.« Sie wickelte die Schürze um ihre Hände, als würde sie ein Baby einwickeln.
Ich stand auf. »Dann muss ich einige Nachrichten schreiben.«
»Miss Enola, in der Bibliothek brennt kein Feuer. Lassen Sie mich alles hierher an den Tisch bringen, Miss.«
Nicht in dem großen Ledersessel und dem düsteren Zimmer sitzen zu müssen war mir nur recht. Vom Schreibtisch in der Bibliothek brachte Mrs Lane einige Blatt Papier mit unserem Familienwappen darauf, das Tintenfass mit dem Füllfederhalter und etwas Löschpapier in die Küche.
Ich tunkte den Füller in die Tinte und verfasste auf dem cremeweißen Briefpapier einige Zeilen an die zuständige Polizei, um sie wissen zu lassen, dass meine Mutter sich offenbar verirrt hatte, und bat höflichst darum, eine Suche einzuleiten.
Dann hielt ich inne und dachte nach: Musste ich das wirklich tun?
Leider ja. Ich konnte es nicht länger hinauszögern.
Zögerlich schrieb ich eine zweite Nachricht, eine die schon bald als Telegramm durch die Leitungen wandern würde, um viele Kilometer weit entfernt von einem Fernschreiber aufgefangen und niedergeschrieben zu werden:
LADY EUDORIA VERNET HOLMES SEIT
GESTERN VERMISST STOPP BITTE UM RAT
STOPP ENOLA HOLMES
Ich adressierte das Telegramm an Mycroft Holmes in Pall Mall, London.
Dieselbe Botschaft schickte ich an Sherlock Holmes in der Baker Street, ebenfalls in London.
Meine Brüder.
2. Kapitel
Nachdem ich den Tee geschlürft hatte, den Mrs Lane mir aufdrängte, zog ich trockene Kniebundhosen an und verließ das Haus, um meine Nachrichten ins Dorf zu bringen.
»Aber der Regen … die Nässe! Dick kann das übernehmen«, bot Mrs Lane an.
Sie meinte ihren erwachsenen Sohn, der auf dem Anwesen alles erledigte, was so anfiel, während Reginald, der etwas intelligentere Collie, ihn dabei beaufsichtigte. Anstatt Mrs Lane zu gestehen, dass ich Dick diese wichtige Aufgabe nicht zutraute, sagte ich: »Bei der Gelegenheit kann ich gleich etwas herumfragen. Ich nehme das Rad.«
Die Rede war nicht etwa von einem alten Drahtesel mit riesigem Vorderrad, der einen bis auf die Knochen durchrüttelte, sondern einem modernen »Zwerg«-Fahrrad mit Luftreifen, völlig sicher.
Während ich durch den Nieselregen strampelte, machte ich kurz am Pförtnerhäuschen halt – für ein Gutshaus ist Ferndell klein, eigentlich nicht mehr als ein normales Steingebäude, das sich wichtigtut, um es mal so auszudrücken. Einem Gut entsprechend benötigte es allerdings eine Auffahrt, ein Tor und daher auch ein Pförtnerhaus.
»Cooper«, wandte ich mich an den Pförtner, »würden Sie das Tor für mich öffnen? Und erinnern Sie sich zufällig, ob Sie es gestern für meine Mutter geöffnet haben?«
Ohne seine Verblüffung über eine solche Frage allzu gut zu verbergen, verneinte er. Lady Eudoria Holmes war zu keiner Zeit hier vorbeigekommen.
Nachdem er mich nach draußen gelassen hatte, radelte ich die kurze Strecke nach Kineford.
Bei der Post gab ich meine Telegramme auf. Dann lieferte ich in der Polizeistation meine Nachricht ab und redete mit dem Beamten, bevor ich meine Runden drehte. Ich klapperte das Pfarramt, den Lebensmittelhändler, die Bäckerei, die Konditorei, den Metzger, den Fischhändler und Ähnliches ab. Überall erkundigte ich mich so diskret wie möglich nach meiner Mutter, doch keiner hatte sie gesehen. Und nicht nur die Frau des Pfarrers musterte mich dabei mit hochgezogener Augenbraue. Ich vermutete, dass diese Missbilligung an den Kniebundhosen lag. Radfahren in der Öffentlichkeit ziemte sich für weibliche Wesen nämlich nur in einem »Bloomerkostüm« (knielange Pluderhosen und darüber ein wasserabweisender Rock) oder überhaupt irgendeinem Rock, der lang genug war, um meine Knöchel zu verbergen. Mir war bewusst, dass man meine Mutter dafür kritisierte, geschmacklose Dinge nicht angemessen zu verstecken – wie etwa Kohleschütten, die Rückseite ihres Pianos und mich.
Ich unerhörtes Kind!
Nie habe ich meine Schande hinterfragt, denn das hätte bedeutet, Themen anzuschneiden, die ein »braves« Mädchen nichts angingen. Trotzdem hatte ich beobachtet, dass die meisten verheirateten Frauen sich alle ein bis zwei Jahre in ihr Haus zurückzogen und mehrere Monate später mit einem neuen Kind auf der Bildfläche erschienen, insgesamt mit etwa einem Dutzend, bis entweder Ruhe einkehrte oder sie verstarben. Im Vergleich hatte meine Mutter lediglich meine beiden viel älteren Brüder zustande gebracht. Irgendwie machte diese frühere Zurückhaltung meine späte Ankunft für einen Rationalisten, Logiker und Gentleman und seine künstlerisch begabte Ehefrau aus gutem Hause umso skandalöser.
Jedenfalls steckten die Menschen mit den hochgezogenen Augenbrauen die Köpfe zusammen und tuschelten, als ich abermals durch Kineford fuhr, diesmal um im Gasthaus, in der Schmiede, beim Tabakhändler und im Pub nachzuforschen, alles Orte, an die »brave« Frauen selten einen Fuß setzen.
Ich erfuhr nichts.
Und trotz meines freundlichsten Lächelns und der Achübrigens-Manier konnte ich praktisch hören, wie hinter mir ein wahres Crescendo an aufgeregtem Tratsch, Spekulationen und Gerüchten laut wurde, als ich auf dem Rückweg nach Ferndell Hall unglücklich in die Pedale trat.
»Keiner hat sie gesehen«, antwortete ich Mrs Lanes stumm fragendem Blick, »oder hat eine Ahnung, wo sie sein könnte.«
Wieder lehnte ich das Angebot zum Mittagessen ab – obwohl es inzwischen fast schon Zeit für den Nachmittagstee war. Ich schlurfte hinauf zu den Zimmern meiner Mutter und blieb im Flur nachdenklich vor der Tür stehen. Mum schloss ihre Räumlichkeiten grundsätzlich ab. Vermutlich um Mrs Lane die Mühe zu ersparen – Lane und Mrs Lane waren nämlich unsere einzigen Hausangestellten und Mum räumte ihre Zimmer selbst auf. So gut wie nie erlaubte sie jemandem, sie zu betreten, aber unter den gegebenen Umständen …
Ich beschloss hineinzugehen.
Als ich die Hand auf den Türknauf legte, war ich überzeugt, Lane aufspüren zu müssen, damit er mir den Schlüssel gab.
Doch auf leichten Druck hin drehte sich der Knauf doch.
Die Tür öffnete sich.
Und spätestens in diesem Moment begriff ich, dass nichts mehr so war wie bisher.
Als ich mich in der Stille des Wohnzimmers meiner Mutter umsah, verspürte ich mehr Ehrfurcht als in einer Kirche. Ich hatte die Logikbücher meines Vaters gelesen, ebenso Malthus und Darwin – wie meine Eltern hatte ich also durchaus rationale und wissenschaftliche Ansichten. Doch in Mums Zimmer zu sein, gab mir das Gefühl, glauben zu wollen. An irgendetwas. Vielleicht an die Seele oder den Geist.
Mum hatte aus ihrem Zimmer ein Heiligtum der Kunst gemacht. An den Fenstern hingen Stoffbahnen aus Japanseide mit Lotusmuster, die zurückgezogen waren, damit das Licht auf die eleganten Ahornmöbel fallen konnte, die so gedrechselt waren, dass sie an Bambus erinnerten – ganz anders als das wuchtige dunkle Mahagoni im Salon. Unten im Erdgeschoss war sämtliches Holz lackiert, schwere Stoffe verdeckten die Fenster und von den Wänden blickten die grimmigen Ölgemälde von Vorfahren. Doch hier im Reich meiner Mutter war das Holz weiß gestrichen und an den Pastellwänden hingen Hunderte eleganter Aquarelle: Mums luftige, detailverliebte Zeichnungen von Blumen, keines größer als ein Blatt Papier und dünn gerahmt.
Einen flüchtigen Moment lang kam es mir so vor, als wäre Mum hier in diesem Raum, als wäre sie die ganze Zeit hier gewesen.
Wäre es doch tatsächlich so!
Behutsam, wie um sie nicht zu stören, betrat ich auf Zehenspitzen den nächsten Raum, ihr Atelier: ein schlichtes Zimmer mit blanken Fenstern, die viel Licht einließen, und ebenso blanken Eichendielen, die man ausgewählt hatte, da sie so pflegeleicht waren. Als ich den Blick schweifen ließ über die Staffelei, den Tisch mit der schräg gestellten Arbeitsplatte, die Regale voller Papier und Materialien, entdeckte ich eine Holzkiste und runzelte die Stirn.
Wohin Mum auch gegangen war, ihren Farbkasten hatte sie also nicht mitgenommen.
Ich hatte doch angenommen …
Wie dumm von mir! Ich hätte zuallererst hier nachsehen sollen. Sie war gar nicht losgezogen, um Blumen zu zeichnen. Sie war … irgendwohin, aus irgendeinem Grund, der mir völlig unbekannt war. Wie hatte ich je glauben können, ich könnte sie auf eigene Faust finden? Ich war dumm, dumm, dumm.
Mit nun schweren Schritten trat ich durch die nächste Tür in Mums Schlafzimmer.
Und blieb gleich aus mehreren Gründen verblüfft stehen. Zunächst einmal war da der Zustand von Mums glänzendem, modernem Messingbett: ungemacht! Mein ganzes Leben lang hatte Mum ohne Unterlass dafür Sorge getragen, dass ich mein Bett machte und mein Zimmer sofort nach dem Frühstück aufräumte – da würde sie doch nicht ihr eigenes Bett mit zurückgeworfenen Laken, verstreuten Kissen und der halb auf dem Perserteppich liegenden Daunendecke hinterlassen?!
Obendrein war ihre Kleidung nicht ordentlich zusammengelegt. Ihr brauner Gehrock aus Tweed war achtlos über den Standspiegel geworfen.