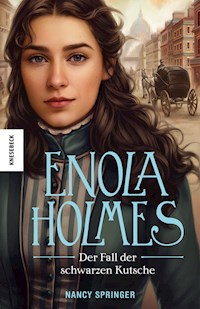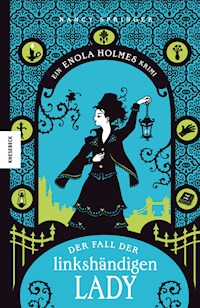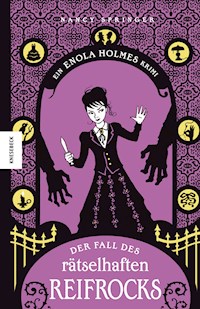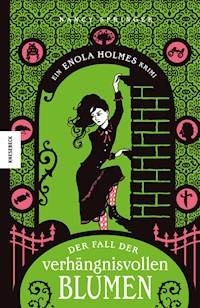
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Enola Holmes
- Sprache: Deutsch
Dr. Watson, Sherlock Holmes' Rechte Hand, ist verschwunden. Der Meisterdetektiv ist ratlos. Enola, die den freundlichen Dr. Watson mag, möchte der trauernden Ehefrau helfen. Doch sie zögert – Ermittlungen im unmittelbaren Umfeld ihres Bruders könnten ihre Freiheit gefährden, denn wenn sie entdeckt wird, werden ihre Brüder Mycroft und Sherlock sie sicher ins Internat schicken. Als sie aber einen geheimnisvollen Blumenstrauß in Dr. Watsons Haus bemerkt, dessen Blüten allesamt den Tod symbolisieren, muss sie schnell handeln. Denn offenbar steht Dr. Watsons Leben auf dem Spiel. Sie schlüpft in ihre bisher anspruchsvollste Verkleidung und macht sich auf die Suche. Kann sie Dr. Watson rechtzeitig aufspüren? Und was haben die beiden seltsamen Schwestern mit dem Verschwinden des Doktors zu tun? Der Film Enola Holmes mit Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Helena Bonham Carter war 2020 einer der erfolgreichsten Filme auf Netflix!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für meine Mutter.
Inhalt
März 1889
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
April 1889
März 1889
Irre haben keinen gesunden Menschenverstand, denkt die Oberin. Doch was, wenn nicht das Fehlen des gesunden Menschenverstandes würde wohl sonst die Verirrung des Geistes auslösen? Man nehme nur diesen neuen Insassen: Hätte er einen Funken Verstand, würde er an diesem herrlich sonnigen Tag, dem ersten schönen in diesem Frühling, mit den anderen im Hof Leibesübungen machen. Er würde den Anweisungen folgen (»Aufrecht stehen! Tief einatmen! Die Augen zum Himmel, bestaunt seine Pracht! Und nun Abmarsch! Linker Fuß voraus, EINS-zwei-drei-vier!«) und sich selbst etwas Gutes tun, doch stattdessen …
»Lassen Sie mich frei!«, verlangt er zum vielleicht hundertsten Mal. »Ich bin Engländer! Einen britischen Bürger derart zu behandeln ist schlicht nicht hinnehmbar!« Er klingt wütend, trotzdem flucht er nicht, das muss sie ihm zugutehalten. Selbst als er sich am schlimmsten benahm, als er mit den Wärtern rang und dem Direktor ein blaues Auge schlug, selbst da hat er nicht geflucht. Genauso wenig wie jetzt. Dafür beklagt er sich heftig. »Lassen Sie mich frei! Ich bestehe auf meinen Rechten als treuer Untergebener der Königin. Lassen Sie mich aus diesem vermaledeiten Sarg heraus, sage ich!«
»Es ist kein Sarg, Mr Kippersalt.« Die Oberin sitzt auf einem unbequemen Holzstuhl, allein von ihrer Leibesfülle gepolstert, strickt im Schoß einen Strumpf und spricht mit gelangweilter, aber beruhigender Stimme. »Obere und untere Hälfte mögen einem Sarg ähneln, aber Sie wissen selbst, dass die Seitenwände eines Sargs keine Öffnungen zum Atmen hätten. Zudem sehe ich genau, dass Sie in keinerlei Nöten sind …«
»Keinerlei Nöte?« Der Mann in der engen Verwahrungskiste fängt an zu lachen. Aufgeschreckt von dem unerwarteten Laut, lässt die Oberin eine Masche fallen. Stirnrunzelnd legt sie ihre Strickarbeit zur Seite und greift zu Papier und Stift.
»In keinerlei Nöten in dieser teuflischen Vorrichtung?«, ruft der Mann, der noch immer unnatürlich schrill lacht.
»Sie scheinen in keiner Weise körperlich beeinträchtigt«, antwortet die Oberin mit sanfter Würde. »Sie liegen auf einer sauberen Pritsche und Sie können Ihre Position ändern, Ihre Hände bewegen. Gewiss doch ist das Gitterbett einer Zwangsjacke vorzuziehen.«
»Ein Gitterbett! So nennen Sie das?!« Der Mann lacht noch immer völlig ohne Grund. Die Oberin mustert ihn aufmerksam. Sie weiß, dass sie bei ihm auf der Hut sein muss. Für einen so untersetzten Burschen hat er sich als unerwartet flink erwiesen, noch dazu als einfallsreich. Beinahe hat er es bis zum Zaun geschafft.
Sie notiert Zeit und Datum in Mr Kippersalts frisch begonnener Patientenakte, dahinter: Patient hat offenbar einen hysterischen Anfall und lacht. Frühere Notizen halten fest, dass Mr Kippersalt sich mit höchstem Widerstand dagegen wehrte, seine graue Wolluniform anzuziehen, während man seine eigenen Sachen in die Verwahrung brachte. Dass er die Mahlzeiten ablehnt. Dass sein Urin hell und klar ist, seine Verdauung angemessen funktioniert und er reinlich zu sein scheint. Dass er keinerlei Verformungen des Kopfes, Rumpfes oder der Glieder aufweist. Dass er eine gewisse Intelligenz an den Tag legt und ein Taschentuch benutzt.
»Ein Gitterbett! Hinter Gitter hat man mich gewiss gesteckt.« Das besorgniserregende Gelächter des Mannes verstummt.
Kein schlecht aussehender Mensch mittleren Alters, vom Typ her ein Soldat. Er streicht sich mit den Fingern über den Schnurrbart wie um sich zu beruhigen oder nachzudenken. »Wann werden Sie mich herauslassen?«
»Nachdem der Doktor Sie untersucht hat.« Und nachdem Chloralhydrat – eine Substanz mit schlaffördernden Eigenschaften – zum Einsatz gekommen ist, daran hat die Oberin keinen Zweifel. Der Anstaltsarzt, selbst ein von Laudanum Abhängiger – eine Tinktur aus Opium –, kümmert sich wenig um die Insassen, abgesehen davon, ihnen Medikamente zu verabreichen.
»Doktor? Ich bin selbst Arzt!« Der frisch eingelieferte Geisteskranke bricht erneut in jaulendes Gelächter aus.
Die Oberin schreibt: Keine Verbesserung der Symptome von Größenwahn. Nachdem sie seine Akte beiseitegelegt hat, greift sie wieder zu ihrem Strickzeug. Eine Ferse zu stricken kann eine kniffelige Angelegenheit sein, doch so ist es nun einmal, wenn man mit dem Direktor einer Irrenanstalt verheiratet ist: Immer gibt es sieben Sachen gleichzeitig zu erledigen, nie einen ruhigen Moment, um die Seele baumeln zu lassen, spazieren zu gehen oder eine Zeitung zu lesen. Nicht nur die Patienten müssen beaufsichtig werden, sondern auch die Krankenschwestern. Bis hierher ist der Einfluss von Florence Nightingale noch nicht vorgedrungen und die Hilfskräfte sind bestenfalls Analphabeten, wenn nicht gar irgendeinem Laster verfallen – für gewöhnlich dem Alkohol.
Die Oberin seufzt. Während sie versucht, die fallen gelassene Masche wieder aufzunehmen, schleicht sich eine gewisse Schärfe in ihren Tonfall, als sie erwidert: »Ein Arzt? Das stimmt nicht, Mr Kippersalt. In Ihren Einweisungspapieren steht eindeutig, dass Sie einen Laden führen.«
»Mein Name ist nicht Kippersalt! Ich bin nicht derjenige, für den Sie mich halten! Warum will keiner an diesem diabolischen Ort begreifen, dass ich wegen eines absurden Missverständnisses hier gelandet bin?«
Sie merkt deutlich, dass der Mann in der sargähnlichen Kiste sie beobachtet, und lächelt, wenn auch müde. »Ich habe dreißig Jahre Erfahrung, Mr Kippersalt, und die haben mich gelehrt, dass die Patienten meistens glauben, es würde ein Missverständnis vorliegen. Aber das war noch nie der Fall.« Wie könnte es auch eines sein, wenn solch beträchtliche Summen von Geld den Besitzer gewechselt haben, damit dieser Herr zu ihnen kommt? »Feine Herren wie Sie zum Beispiel – wie viele hatten wir schon hier, die steif und fest behauptet haben, Napoleon persönlich zu sein. Das kommt am häufigsten vor. Wir hatten aber auch schon einen Prinz Albert, einen Sir Walter Drake und sogar William Shakespeare …«
»Ich sage die Wahrheit!«
»… und einige dieser armen verwirrten Geister werden letztlich geheilt«, fährt die Oberin fort, ohne auf die Unterbrechung einzugehen. »Andere wiederum bleiben bei uns. Ist es das, was Sie wollen, Mr Kippersalt? Den Rest Ihres Lebens hier zu verbringen?«
»Mein Name ist nicht Kippersalt! Mein Name ist Watson!« Durch die Luftöffnungen hindurch kann sie sehen, wie sein Bart sich sträubt.
Freundlich erwidert sie: »In einem der anderen Flügel haben wir einen Sherlock Holmes. Ich frage mich, ob er für Sie bürgen würde.«
»Sie sind ja wahnsinnig! Ich sage Ihnen, ich bin John Watson, Mediziner und Schriftsteller! Sie müssen lediglich mit Scotland Yard telefonieren und …«
Telefonieren? Als hätte man so weit nördlich der Innenstadt Londons je solch ein neumodisches Gerät gesehen, geschweige denn benutzt! Lediglich Scotland Yard anrufen … Schon wieder dieser Größenwahn.
»… nach Inspektor Lestrade fragen. Er wird meine Identität bestätigen.«
»Unfug«, murmelt die Oberin. »Unfug.« Glaubt er ernsthaft, der Direktor würde nachforschen, diese beträchtliche Summe im Ernstfall zurückgeben und ihn auf freien Fuß setzen? Der Mann ist verrückt. »Ruhig jetzt. Ruhig.« Als wolle sie ein kleines Kind besänftigen, raunt sie ihm besorgt zu. Eine solche Heftigkeit könnte zu Hirnfieber führen, sollte sie nicht bald abklingen. Bereits zwei Tage sind vergangen und Mr Kippersalt zetert noch immer so unvernünftig wie zu dem Zeitpunkt, als man ihn einlieferte. Ein trauriger Fall, wenn man es sich genau überlegt. Die Oberin hat es schon mit vielen Geisteskranken zu tun gehabt, doch dieser tut ihr besonders leid, denn sie hat den Eindruck, er wäre ein wirklich herzensguter Mensch, wäre er bei rechtem Verstand.
Kapitel 1
Sich einen neuen Namen zu überlegen ist schwierig. Noch schwieriger, kann ich mir denken, als einen Namen für ein neugeborenes Kind auszuwählen, da man sich selbst so verwirrend gut kennt, während man mit einem Baby bei seiner Ankunft noch kaum vertraut ist. Gewiss war es irgendeine Künstlerflause, die meine Mutter dazu veranlasst hatte, mich »Enola« zu taufen, was rückwärts »alone«, also »allein« bedeutet.
Nicht an Mum denken.
Obwohl die große Prellung in meinem Gesicht verheilt war, traf das auf die viel größere Verletzung meiner Gefühle nicht zu. Daher blieb ich am ersten schönen, sonnigen Tag im März 1889 in meiner Unterkunft. Papier und Stift in den Händen saß ich am offenen Fenster (Wie willkommen nach einem langen Winter frische Luft doch ist – selbst jene Londons!) und schaute hinaus auf die brodelnden Straßen des East End. Das Geschehen unten hatte meine Aufmerksamkeit erregt: Aufgrund mehrerer Hammel, die zu Huf unterwegs waren, standen alle möglichen Arten von Fahrzeugen – darunter Kohlewagen, Eselkarren und Schubkarren von Straßenhändlern – dicht an dicht und steckten fest. Ich hörte, wie die Fahrer sich gegenseitig die schlimmsten Flüche an den Kopf warfen. Anwerber fürs Militär in roten Uniformen und andere Faulenzer sahen grinsend zu, während ein blinder Bettler, geführt von einem Kind in Lumpen, versuchte, an diesem Stau vorbeizukommen. Straßenkinder kletterten auf Laternenpfähle, um johlend zu gaffen, und Frauen in rußigen Schals gingen eilig ihren Besorgungen nach.
Sie – die schlimm überarbeiteten Frauen der Elendsviertel – hatten ein Ziel, anders als ich.
Als ich auf den Zettel in meinem Schoß blickte, stellte ich fest, dass ich geschrieben hatte:
Enola Holmes
Hastig und heftig strich ich ihn durch, meinen eigenen Namen, den einen, den ich definitiv nicht nutzen konnte. Meine Brüder Mycroft und Sherlock durften mich nämlich nicht finden, da sie sich in den Kopf gesetzt hatten, sich meiner anzunehmen und mich zu verwandeln – durch Gesangsstunden und ähnliche Hirngespinste –, und zwar in eine Zierde für die feine Gesellschaft. Was ihnen per Gesetz durchaus zustand – mich gegen meinen Willen in ein Internat zu stecken, meine ich. Oder in ein Kloster, ein Waisenhaus, eine Akademie für Porzellanmalerei für junge Damen, wonach auch immer ihnen der Sinn stehen mochte. Dem Gesetz nach könnte Mycroft, der Ältere der beiden, mich sogar lebenslang in ein Irrenhaus einsperren lassen. Eine solche Haft benötigte lediglich die Unterschriften zweier Ärzte, von dem einer der »Irrenarzt« wäre, der es allein auf Geld abgesehen hatte, um seine Anstalt führen zu können. Und dann noch die Unterschrift von Mycroft selbst – ich würde ihm jede Intrige zutrauen, um mir meine Freiheit zu rauben.
Ich schrieb:
Ivy Meshle
Der Name, den ich während der sechs Monate benutzt hatte, in denen ich auf der Flucht gewesen war, auf mich allein gestellt. »Ivy«, weil Efeu für Treue stand, »Meshle« als Wortspiel, ausgehend von »Holmes«: Hol mes, mes Hol, Meshle – und dieser Name hatte mir gefallen. Zu gern hätte ich ihn behalten. Doch ich hatte Angst. Wie sich herausgestellt hatte, wusste Sherlock, dass ich Ivy als Codenamen nutzte, wenn ich mit Mum durch die Kleinanzeigen der Zeitungen kommunizierte.
Was wusste mein ach so schlauer Bruder Sherlock – der im Gegensatz zu dem tatenlosen, dicken Mycroft tatsächlich Jagd auf mich machte –, was wusste Sherlock über mich? Was hatte er im Lauf unserer höchst unregelmäßigen Aufeinandertreffen erfahren?
Ich notierte:
Er weiß, ich sehe aus wie er.
Er weiß, ich klettere auf Bäume.
Er weiß, ich fahre Fahrrad.
Er weiß, ich habe mich als Witwe verkleidet.
Er weiß, ich habe mich als arme Frau verkleidet, die Wischlappen für Tinte verkauft.
Er weiß, ich habe mich als Nonne verkleidet.
Er weiß, ich habe Essen und Decken an die Armen verteilt.
Er weiß, ich trage einen Dolch in meinem Korsett.
Er weiß, ich habe zwei vermisste Personen gefunden.
Er weiß, ich habe die Polizei auf zwei Bösewichte angesetzt.
Er weiß, ich bin zweimal in seine Wohnung in der Baker Street eingedrungen.
Er weiß, ich nutze den Vornamen Ivy.
Es ist anzunehmen, dass er inzwischen durch Dr. Watson von einer jungen Frau namens Ivy Meshle erfahren hat, die für den ersten und einzigen wissenschaftlichen Perditor der Welt arbeitete.
Beim letzten Satz seufzte ich, denn Dr. Watson bewunderte ich durchaus, obwohl ich dem guten Arzt erst dreimal begegnet war: das erste Mal, als er den Perditor (einen professionellen Sucher vermisster Personen) aufsuchte und zum Wohle seines Freundes Sherlock Holmes um Hilfe bat; das zweite Mal, als ich in seine Praxis kam, um ihm eine Frage zu stellen, und er mir Bromid gegen meine Kopfschmerzen verabreichte; das dritte Mal, als ich überraschend eine verwundete Lady in seine Obhut übergab. Dr. Watson war der Inbegriff eines galanten, robusten englischen Gentleman, der jedem gern behilflich war. Ich mochte ihn sehr, fast so sehr wie meinen Bruder – denn trotz allem himmelte ich Sherlock an, auch wenn ich ihn überwiegend aus den beliebten Geschichten kannte, die sein Freunds Watson über ihn verfasste und die ich ebenso begeistert las wie jeder andere in England.
Warum nur schienen ausgerechnet die, die mir lieb und teuer waren, mich regelmäßig ins Unglück zu stürzen?
Seufzend presste ich die Lippen aufeinander und kreuzte Ivy Meshle mit mehreren dicken Strichen aus.
Was also dann?
Nicht nur das Finden eines neuen Namens stellte mich vor ein Rätsel, sondern auch das allumfassende Problem, was ich tun und wer ich sein sollte. In welche Art von Frau sollte ich mich als Nächstes verwandeln? In eine gewöhnliche wie Mary oder Susan? Wie öde. Doch die Blumennamen, die ich so sehr liebte (wie etwa Rosemary, Symbol für das Gedenken, oder Violet, Symbol für versteckte Schönheit und Tugend), standen außer Frage, da Sherlock von der Geheimsprache wusste, die Mutter und ich verwendeten.
Genauso wenig konnte ich einen meiner Mittelnamen nutzen. Selbstverständlich hatte ich das übliche adelige Kontingent davon – getauft war ich auf: Enola Eudoria Hadassah Holmes. Enola E.H. Holmes: E. E. H. H. Eehh. Genau so fühlte ich mich gerade. Hadassah war der Name der verstorbenen Schwester meines Vaters, den Sherlock auf der Stelle erkennen würde. Und Eudoria – noch schlimmer – war der Name meiner Mutter.
Nicht, dass es mir in irgendeiner Weise wichtig gewesen wäre, meiner Mutter nachzueifern.
Oder doch?
»Verflixt und zugenäht! Himmel Herrgott!«, murmelte ich ungezogen und schrieb:
Violet Vernet
Der Mädchennamen meiner Mutter – Vernet – würde Sherlock aber natürlich auch sofort auffallen. Vielleicht rückwärts?
Tenrev
Nein, eher nicht. Aber wenn ich ein wenig mit den Buchstaben spielte?
Netver
Never
Every
Ever
Ever wie für immer. Für immer was?
Für immer allein?
Für immer verloren?
Für immer trotzig, sagte ich mir feierlich. Für immer das sein, was ich nun einmal bin. Eine Rebellin, eine Träumerin und eine Perditorin, Finderin des Verlorenen. Mir kam der Gedanke, dass ich als Schritt in diese Richtung, um nämlich an Neuigkeiten zu gelangen, die letztlich nicht gedruckt wurden und die mir als Perditorin nützlich sein konnten, versuchen sollte, eine Anstellung bei einem der Verlage in der Fleet Street zu bekommen …
Rein zufällig hörte ich just in diesem Moment die Schildkrötenschritte meiner Vermieterin auf der Treppe. »Die Zeitungen, Miss Meshle!«, brüllte sie, noch bevor sie den Absatz erreicht hatte. Taub wie eine Runkelrübe, hielt Mrs Tupper es offenbar für nötig, eine Menge Lärm zu verursachen.
Während ich aufstand, durchs Zimmer lief und alles, was ich geschrieben hatte, ins Feuer warf, klopfte sie so kräftig an, als wollte sie Walnüsse knacken. »Zeitungen, Miss Meshle!«, schrie sie mir ins Gesicht, als ich die Tür öffnete.
»Danke, Mrs Tupper.« Natürlich konnte sie mich nicht hören, dafür konnte sie meine Lippen sehen, die – wie ich hoffte – ein Lächeln bildeten, als ich ihr die Zeitungen abnahm.
Allerdings ging sie nicht. Stattdessen richtete sie ihren kurzgewachsenen, gebeugten Körper so weit auf, wie sie konnte, und fixierte mich mit ihrem wässrigen Blick. »Miss Meshle«, verkündete sie mit all der Tapferkeit von jemandem, der beschlossen hat, eine moralische Pflicht zu erfüllen. »Es tut Ihnen nich gut, sich so einzuigeln. Also, was auch gescheh’n sein mag – und es geht mich nichts an –, aber egal, was war, es bringt nichts, deswegen blass zu werden. Heut is ein schöner Tag, die Sonne spitzt raus und langsam fühlt sich’s an wie Frühling. Warum schnappen Sie sich nich Ihre Haube und gehn spazieren? Wenigstens –«
Zumindest glaube ich, sie sagte so etwas in der Art. Ich habe ihr kaum zugehört und ich bedaure, zugeben zu müssen, dass ich ihr in diesem Moment die Tür vor der Nase zuschlug. Denn mein Blick war auf die Schlagzeile des Daily Telegraph gefallen und wurde gebannt davon festgehalten.
Da stand:
KOLLEGE VON SHERLOCK HOLMES AUFMYSTERIÖSE WEISE VERSCHWUNDEN:DR. WATSON VERMISST
Kapitel 2
Ich nahm mir nicht einmal die Zeit, mich zu setzen, sondern las an Ort und Stelle – mit dem Rock meines billigen Baumwolltageskleids gefährlich nah am Feuer:
Ereignisse, die jedem Zartbesaiteten eiskalte Schauer über die Haut jagen, haben sich in Bloomsbury zugetragen. Ganz London dürfte sich betroffen zeigen, sollte ein gewisser vermisster britischer Gentleman nicht bald gefunden werden. Dr. John Watson, ein angesehener Arzt, der vielleicht am besten dafür bekannt ist, Gefährte des berühmten Detektivs Mr Sherlock Holmes und Chronist von dessen Abenteuern zu sein, ist auf höchst geheimnisvolle Weise spurlos verschwunden. Natürlich befürchten Familie und Freunde des Verschollenen vor allem, er könnte in die Hände eines kriminellen Widersachers von Mr Sherlock Holmes gefallen sein, um in einem teuflischen Plan als Pfand zu dienen, als Geisel herzuhalten oder aus Rache ermordet zu werden. Andererseits wurden auch Bedenken laut, aufgrund seiner schwarzen Tasche, die ihn eindeutig als Arzt kennzeichnet, könnte er einem Mob der Impfgegner aus dem East End zum Opfer gefallen sein. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man keinerlei Verbrechen ausschließen. Derzeit bemüht man sich herauszufinden, was genau Dr. Watson am vergangenen Mittwoch getan hat, dem Tag, an dem er zu seiner gewohnten Visite und anderen Erledigungen aufbrach, jedoch weder nach Hause noch in seine Praxis zurückkehrte. Eine Befragung von Kutschern …
Und so weiter. Viele Worte, die im Endeffekt rein gar nichts aussagten. Ein Verschwinden, das den Zeitungen unter anderen Umständen keine Zeile wert wäre, könnte man nicht den Namen meines Bruders groß in der Schlagzeile abdrucken. Dr. Watson hatte seiner Frau am Mittwochmorgen einen Abschiedskuss gegeben. Heute war Freitagnachmittag – der gute Doktor war bereits seit zwei Tagen verschwunden. Ich konnte mir vorstellen, dass die Polizei mit gewisser Berechtigung sagte, eine ganze Reihe völlig harmloser Ereignisse könnten die Abwesenheit des Doktors erklären. Dass jeden Moment ein Telegramm oder Brief eintreffen und erklären könnte, wo er sich aufhielt und warum er aufgehalten worden war. »Man bemüht sich herauszufinden«, bedeutete, dass die Polizei noch nicht ermittelte. Sonst hätte die Zeitung den verantwortlichen Inspektor namentlich genannt. Nein, zu diesem Zeitpunkt waren die Einzigen, die Dr. Watson wirklich aufspüren wollten, nur zwei: seine Frau und sein Freund, mein Bruder Sherlock Holmes.
Und ab sofort eine mehr: ich.
Doch Moment. Was, wenn Watsons Abwesenheit von meinem Bruder angezettelt worden war, um mich in eine Falle zu locken?
Sherlock wusste, dass ich mich mit Fällen vermisster Personen befasste. Und während er womöglich nicht ahnte, dass ich Dr. Leslie Ragostin, wissenschaftlicher Perditor, frei erfunden hatte, war ihm sehr wahrscheinlich bekannt, dass ich für ihn gearbeitet hatte. Wusste er es zu schätzen, dass dies meine Berufung war, Verlorenes wiederzufinden?
Konnte er sich denken, wie teuer mir der väterliche Dr. Watson war?
Sollte ich diese neuesten Ereignisse dann nicht mit höchstem Misstrauen überdenken?
Ich hatte diese absolut vernünftigen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da warf ich die Zeitung schon ins Feuer, wühlte in meinem Schrank und überlegte mögliche Verkleidungen, mögliche Strategien, um Einzelheiten über Dr. Watsons Verschwinden in Erfahrung zu bringen – wie ich die Angelegenheit am besten angehen könnte. Nein, nicht einmal eine Zwangsjacke hätte mich davon abhalten können.
Obwohl mir durchaus bewusst war, dass ich sehr vorsichtig vorgehen musste.
Was mich vor gewisse Schwierigkeiten stellte. Nachdem ich den Großteil des vergangenen Monats abgeschottet in meiner Unterkunft verbracht hatte, verbittert darüber, dass meine Mutter mir in meiner Zeit der Not nicht geholfen hatte (also mit anderen Worten faul und beleidigt gewesen war), musste ich nun einsehen, dass ich kläglich schlecht vorbereitet war für jegliche Unternehmungen. Ein Dutzend Dinge brauchte ich, die ich aber nicht hatte.
Ich wickelte mir einen unauffälligen Schal um Kopf und Schultern und machte mich auf, sie zu besorgen. Mrs Tupper würde sich freuen: Ich ging spazieren.
Ich spazierte tatsächlich, den ganzen Weg, denn meine Gefühle kamen mir ebenso verschlungen vor wie die labyrinthischen Gassen der Elendsviertel, meine Gedanken so gedrängt und verwirrt wie die schmutzigen Wohnhäuser mit ihren spitzen Giebeln, die über mir aufragten. Ein langer Spaziergang würde vielleicht helfen, mich zu beruhigen und eine Art Ordnung in meinen Geist zu bringen.