
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Enola Holmes
- Sprache: Deutsch
Lady Cecily wendet sich mit einer verzweifelten verschlüsselten Botschaft an Enola. Sherlock Holmes' kleine Schwester begreift sofort, dass sie ihrer Freundin helfen muss, bevor es zu spät ist – aber wie? In ihrem bisher kompliziertester Fall geht Enola in ganz London auf Spurensuche, bis sie die abscheuliche Wahrheit entdeckt: Lady Cecily wird gefangen gehalten und soll gegen ihren Willen verheiratet werden! Enola muss ihre eigene Freiheit riskieren und sich mit ihrem Bruder Sherlock zusammentun, um ihre Freundin zu retten. Kann Enola ihrem Bruder vertrauen? Und können sie Cecily rechtzeitig befreien? Der Film Enola Holmes mit Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Helena Bonham Carter war 2020 einer der erfolgreichsten Filme auf Netflix!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für meine Mutter.
Inhalt
Mai 1889
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Mai 1889
Mai 1889
»Über acht Monate sind inzwischen vergangen, seit das Mädchen verschwunden ist –«
»Das Mädchen hat einen Namen, mein lieber Mycroft«, unterbricht Sherlock, lediglich mit einem dezenten Anflug von Schärfe in der Stimme, ist er sich doch dessen bewusst, bei seinem Bruder zum Abendessen zu Gast zu sein. Mycroft, der trotz seiner zurückgezogenen Lebensweise ein hervorragender Gastgeber ist, hat gewartet, bis die Ringeltaubenpastete mit Korinthensoße abgeräumt war, bevor er das unbequeme Problem mit ihrer jüngeren Schwester angesprochen hat.
»Enola. Zudem ist sie leider nicht im üblichen Sinn des Wortes verschwunden«, fügt Sherlock leiser, fast schon launisch hinzu. »Sie hat rebelliert, ist ausgebüxt und hat alles darangesetzt, uns immer wieder durch die Lappen zu gehen.«
»Und das ist noch lange nicht alles, was sie getan hat.« Grunzend, da seine ausladende Front ihm im Weg ist, beugt Mycroft sich vor und greift nach der geschliffenen Glaskaraffe.
Sherlock, der durchaus merkt, dass Mycroft offenbar etwas Gewichtiges zu berichten hat, wartet schweigend ab, während sein älterer Bruder ihre Gläser mit dem köstlichen Getränk füllt, das dieses Gespräch erträglich macht. Beide Männer haben ihre hohen gestärkten Kragen und die schwarzen Krawatten gelockert.
Mycroft nippt an seinem Getränk, bevor er in seiner üblichen behäbigen und mürrischen Art fortfährt. »Während dieser acht Monate war sie maßgeblich an der Rettung dreier vermisster Personen beteiligt – und daran, drei gefährliche Verbrecher ihrer gerechten Strafe zuzuführen.«
»Das ist mir nicht entgangen«, räumt Sherlock ein. »Und?«
»Fällt dir an ihrem Tun kein höchst alarmierendes Muster auf?«
»Durchaus nicht. Purer Zufall. Über den Fall des Lord Basilwether ist sie nur gestolpert. Lady Cecily Alistair lief ihr gewissermaßen in die Arme, als sie sich in ihrer Verkleidung als Nonne um die Notleidenden auf der Straße kümmerte. Und –«
»Und rein zufällig konnte sie den Entführer identifizieren?«
Sherlock begegnet Mycrofts bissigem Kommentar mit einem harten Blick. »Und, wie ich gerade sagen wollte, was Watsons Verschwinden betrifft – hätte sie sich wohl kaum daran beteiligt, wäre seine Verbindung zu mir nicht allgemein bekannt.«
»Du weißt nicht, wie oder warum sie sich eingemischt hat. Du weißt nicht einmal, wie sie ihn gefunden hat.«
»Nein«, gibt Sherlock Holmes zu. »Das tue ich nicht.« Dank dem besänftigenden Einfluss des gut gealterten Portweins seines Bruders, aber auch aufgrund der verstrichenen Zeit und gewisser Vorfälle verursachen ihm Gedanken an seine ausgerissene Schwester nicht länger bitteren Ärger oder gar heftige Sorge. »Und es ist nicht das erste Mal, dass sie mich übertölpelt hat«, sagt er beinahe stolz.
»Pah. Was sollen ihr ihre Tricks und ihre Kühnheit schon bringen, wenn sie erst eine Frau ist?«
»Wenig, vermute ich. Sie ist wahrhaft die Tochter unserer frauenrechtlerischen Mutter. Doch zumindest fürchte ich im Augenblick nicht länger um ihre Sicherheit. Offensichtlich ist sie durchaus in der Lage, für sich selbst zu sorgen.«
Mycroft fuchtelt mit den Händen, als könne er das Gesagte wie ein lästiges Insekt vertreiben. »Darum geht es nicht. Nicht weniger als die Zukunft des Mädchens steht auf dem Spiel, nicht ihr unmittelbares Überleben. Was soll in ein paar Jahren aus ihr werden? Kein Gentleman, der etwas auf sich hält, wird eine solch unabhängige junge Frau heiraten, die sich für kriminelle Machenschaften interessiert!«
»Sie ist gerade erst vierzehn, Mycroft«, erinnert Sherlock seinen Bruder geduldig. »Ich bezweifle doch stark, dass sie immer noch einen Dolch an der Brust trägt, wenn sie alt genug ist, als Braut umworben zu werden.«
Mycroft hebt seine dornbuschigen Augenbrauen. »Du glaubst, sie wird sich am Ende den Erwartungen der Gesellschaft beugen? Du, der sich geweigert hat, auf irgendeinem anerkannten Gebiet einen akademischen Grad zu erwerben, und stattdessen seinen eigenen Beruf und seine eigene Lebensgrundlage erfunden hat?«
Der erste und einzige privat beratende Detektiv macht eine wegwerfende Geste. »Sie ist weiblich, mein lieber Mycroft. Die biologischen Notwendigkeiten ihres Geschlechts drängen sie dazu, sich ein Nest zu bauen und fortzupflanzen. Sobald sie beginnt, zu einer Frau zu reifen, wird sie zwangsweise –«
»Pah! Mumpitz!« Mycroft kann seine Schroffheit nicht länger zügeln. »Glaubst du im Ernst, unsere widerspenstige Schwester wird sich dazu herablassen, einen Ehemann zu finden –«
»Himmel, was soll sie denn sonst tun?«, erwidert Sherlock, ein wenig verletzt. Der große Detektiv ist ein Wort wie Mumpitz in Bezug auf seine Meinung nicht gewohnt. »Womöglich eine lebenslange Karriere anstreben, vermisste Personen zu finden und Bösewichte aufzuspüren?«
»Nicht ausgeschlossen.«
»Was denn, du glaubst, sie könnte sich selbstständig machen wollen? Als meine Konkurrentin?« Sherlocks Ärger wandelt sich zu Amüsiertheit. Er fängt an zu kichern.
Mycroft sagt leise: »Ich würde es ihr zutrauen.«
»Als Nächstes siehst du sie noch Zigarre rauchen!« Nun lacht Sherlock Holmes herzlich. »Hast du vergessen, dass unsere Schwester lediglich ein störrisches Kind ist? Sie kann unmöglich solch weitgreifende Absichten haben. Absurd, mein lieber Mycroft, völlig absurd!«
Kapitel 1
Bisher waren meine einzigen Klienten als »Dr. Ragostin, wissenschaftlicher Perditor« eine untersetzte, ältliche Witwe, die ihren verschollenen Schoßhund dringend wiederhaben wollte; eine verängstigte Lady, die ein Geschenk ihres Gatten, nämlich einen wertvollen herzförmigen Rubin verlegt hatte; und ein Armeegeneral, dessen wichtigstes Souvenir aus dem Krimkrieg verschwunden war, nämlich sein von Kugeln durchlöcherter Beinknochen mit der Unterschrift des Feldarztes, der das zugehörige Bein amputiert hatte.
Alles Bagatellen. Meine Kräfte hätten sich auf weit Wichtigeres konzentrieren sollen: Mum zu finden. Ich wusste, meine Mutter streifte mit den Nomaden durchs Land, und ich hatte mir geschworen, dass ich sie im Frühling ausfindig machen würde – nicht um ihr Vorwürfe zu machen oder sie zu etwas zu zwingen, nein, nur um mit meinem … meinem amputierten Familienmitglied wieder vereint zu sein, um es einmal so auszudrücken.
Und doch war es inzwischen Mai und ich hatte kaum bis keinerlei Anstalten gemacht, Mutter überhaupt zu suchen. Warum, konnte ich nicht sagen, nur, dass meine Arbeit mich in London festhielt.
Arbeit? Ein Schoßhund, ein Stein und ein Knochen?
Doch Klienten waren Klienten, sagte ich mir. Selbstverständlich hatte keiner von ihnen den glorreichen (und erfundenen) Dr. Ragostin persönlich kennenlernen müssen (oder können). Stattdessen hatte »Miss Ivy Meshle«, seine geschätzte Sekretärin, dem dankbaren Frauchen sein Haustier, einen putzigen, gelockten Spaniel, zurückgebracht, nachdem sie ihn aus den Fängen eines berüchtigten Händlers aus Whitechapel gerettet hatte, der mit entwendeten Rassehunden Geschäfte machte. Ebenso war es »Miss Meshle« gewesen, die das Rätsel um den vermissten Edelstein aufs Einfachste gelöst hatte, indem sie einen Jungen in den Lindenbaum vor dem Fenster der Lady geschickt hatte, um dort in einem Elsternest nachzusehen. (Wie leicht ich selbst auf diesen Baum hätte klettern können, und wie gern ich es getan hätte! Doch der Anstand ließ es nicht zu.) Und was die Beinschachtel des Generals betraf, war die Spur, die ich noch immer verfolgte, eher lau, als ich zufällig auf einen weit interessanteren, und wie sich herausstellte, dringlicheren Fall stieß.
Errötend gebe ich zu, dass sich die ausschlaggebende Begegnung dazu in einem kürzlich eröffneten Etablissement in der Oxford Street ereignete, das zwar dankbar und gut besucht wurde von den feinen Damen, die in diesem teuren Viertel einkauften, doch in Anwesenheit von Männern nicht erwähnt wurde: dem ersten Damenklosett Londons.
Diese vortreffliche Neuheit, die stillschweigend anerkannte, dass Damen aus gutem Hause ihre Tage nicht länger ausschließlich in eben jenem Hause verbrachten, nur wenige Schritte entfernt von ihrer eigenen Wassertoilette, kostete beim Betreten einen Penny. Und das war sie wert, wenn die Not einen überkam, obwohl dieselbe Summe einem Kind aus dem East End einen ganzen Tag Brot, Milch und den Besuch einer Schule ermöglicht hätte. Dieser Eintrittspreis stellte sicher, dass die Einrichtung hauptsächlich von Damen der Oberschicht benutzt wurde, wenngleich hin und wieder ein Arbeitermädchen hereinschneite, so wie Ivy Meshle mit ihren falschen Locken und der billigen modischen Kleidung von der Stange.
An jenem Tag war ich allerdings nicht als die leicht ordinäre Ivy Meshle verkleidet. Meine Nachforschungen hatten mich in die Nachbarschaft des British Museum verschlagen – das zu meinem Unmut häufig von meinen beiden Brüdern besucht wurde, weshalb ich als weibliche Gelehrte getarnt war und mein unschönes Haar in einem schlichten Knoten trug, während mein schmales, farbloses Gesicht von einer Brille mit einem Rahmen aus Ebenholz verdeckt wurde. Diese verkleinerte nicht nur meine markante Nase, sondern machte aus mir jemanden, den man keines zweiten Blickes würdigte, da keine modebewusste Dame jemals eine Brille tragen würde. In einem Kleid aus hochwertiger, doch eng gewebter, dunkler grober Wolle und mit einem ebenso schlichten dunklen Hut saß ich im bequemen Salon des Damenklosetts, der mit braunem Leder und falschem Marmor ausgestattet war, um einige Augenblicke zu entspannen, in dankbarer Gewissheit, dass mir weder Sherlock noch Mycroft hierher folgen würden.
Bisher war der Tag für mich sehr angespannt verlaufen – weibliche Gelehrte finden bei der männlichen Bevölkerung Londons wenig Anerkennung –, doch hier fiel ich nicht auf. Es war durchaus üblich, dass vom Einkauf erschöpfte Besucher der Toilette sich im kühlen und schattigen, mit Gips verputzten Salon ausruhten, bevor sie sich erneut in den Staub und die Hitze der Straßen stürzten.
Eine Glocke schellte, das Dienstmädchen lief durch den Salon des Klosetts, um die Tür zu öffnen, und drei Damen traten ein. Sie gingen dicht an mir vorüber, da ich auf einem rostroten Plüschsofa neben der Tür Platz genommen hatte. Selbstverständlich blickte ich nicht von meiner Zeitung auf, ebenso wenig hätte ich an eine von ihnen auch nur einen Gedanken verschwendet, hätte ich nicht vom ersten Moment an gespürt, dass bei ihnen etwas nicht stimmte. Ganz und gar nicht stimmte. Eine gewisse Anspannung lag in der Luft.
Als sie vorbeiliefen, hörte ich das Rascheln seidener Unterröcke, doch sonst nichts. Sie redeten nicht miteinander.
Ich fragte mich, was wohl los war, und hob die Augen, ohne den Kopf zu bewegen (sie offen zu mustern hätte als schlechtes Benehmen gegolten), obwohl mir der Anblick ihrer Rücken wenig verriet.
Zwei reich gekleidete würdige alte Damen in ausladenden Röcken flankierten eine jüngere, schlankere Frau, gekleidet in die jüngste Mode aus Paris – tatsächlich war es das erste Mal, dass ich einen Glockenrock an einem echten Menschen und nicht nur an einer Schaufensterpuppe sah. Auf einer Schleppe oder einem Reifrock bauschten sich große zitronengelbe Schleifen, doch der Rock selbst, der ein tieferes Gelbgrün hatte, wurde von versteckten Bändern zugezogen, wie um in der Nähe der Knie eine zweite Taille zu simulieren. Darunter breitete er sich wieder aus, um eine mit Rüschen besetzte »Glocke« zu formen, unter der die Füße des Mädchens kein einziges Mal hervorlugten. Tatsächlich wühlte sie die Rüschen beim Gehen kaum auf, da der Rock ihren Schritt auf geschätzt fünfundzwanzig Zentimeter verkürzte. Ich verzog das Gesicht, während ich zusah, wie sie dahinstrauchelte, denn obwohl ihre schlanke Figur nicht dem Ideal einer »Wespentaille« entsprach, war sie in meinen Augen ein herrliches Geschöpf. Es war, als hätte man einem Reh Fußfesseln angelegt. Natürlich hatte gesunder Menschenverstand vor der Mode schon immer die Segel gestrichen (Reifröcke, Tournüren …), doch man musste schon eine vollkommene Modenärrin sein, um sich in ein solches Kleid zu zwängen, in dem man kaum einen Fuß vor den anderen setzen konnte!
Als sich das Trio dem Durchgang zum Allerheiligsten des Klosetts näherte, blieb das Mädchen stehen.
»Kommt mit, Kind«, befahl eine der älteren Frauen.
Stattdessen setzte sich das Mädchen im Glockenrock wenig elegant hin. Genau genommen warf sie sich, fiel fast, in einen der dunklen ledernen Armsessel auf der anderen Seite des Raums.
Als ihr Gesicht sich in meine Richtung drehte, hätte ich vor Schreck und Überraschung beinahe laut nach Luft geschnappt, denn ich kannte sie! Unmöglich konnte ich mich irren, denn unser gemeinsam bestandenes Abenteuer, die schwesterliche Zuneigung, die ich für sie empfunden hatte, mein Schrecken, als der Würger sie angegriffen hatte, das alles war mir unauslöschlich ins Gedächtnis gebrannt. Es war die Tochter des Baronet, die Linkshänderin, die ich damals gefunden und gerettet hatte: die Ehrenwerte Cecily Alistair.
Doch die Frauen in ihrer Begleitung kannte ich nicht. Wo war Cecilys Mutter, die liebliche Lady Theodora?
Was Lady Cecily anging: Im vergangenen Winter hatte ich sie frierend, hungernd und in Lumpen gesehen, all der Glanz ihrer leuchtenden Augen verloschen. Trotzdem hätte mich nichts auf die Bestürzung vorbereiten können, die ich nun bei ihrem Anblick verspürte. Ihr Gesicht kam mir noch eingefallener vor als bei unserer letzten Begegnung und der Ausdruck darin gequälter. Verbissen, mit trotzig verkniffenen Lippen und einem wilden, verzweifelten Aufbegehren funkelte sie die beiden älteren Damen an, die über sie hinausragten.
»Oh nein, junge Dame«, sagte eine der beiden in gebieterischem Ton, der deutlich machte, dass sie weit mehr sein musste als etwa eine Gouvernante – Großmama vielleicht oder Tante? »Und ob Ihr mit uns kommt!« Sie packte das sitzende Mädchen an einem Ellbogen, während die andere Frau den zweiten nahm.
Inzwischen hatte ich den Kopf gehoben und gaffte die drei unverhohlen an. Zum Glück standen die beiden Glucken mit dem Rücken zu mir und waren ganz auf die Sechzehnjährige im Lehnsessel konzentriert.
Leise erwiderte Lady Cecily: »Ihr könnt mich nicht zwingen«, und ließ sich tief in den Stuhl sinken, wobei sie ihre zitronengelben Zierden ordentlich zerdrückte. Sie machte sich klein und zog den Kopf ein, sodass die beiden Frauen sie schon mit Gewalt auf die Füße hätten ziehen müssen. Zweifelsohne wäre das keine kleine Herausforderung gewesen, dennoch glaube ich, sie hätten es darauf ankommen lassen, wäre ich nicht gewesen. Hastig schauten sich die beiden Drachen um, um zu sehen, wer sie beobachten könnte. Zwar blickte ich schnell wieder auf meine Zeitung, doch sie waren nicht dumm.
»Tja«, hörte ich eine von beiden mit spröder Stimme sagen, »dann müssen wir uns wohl abwechseln.«
»Geht«, entgegnete die andere. »Ich bleibe bei ihr.«
Eine von ihnen drang ins eigentliche Klosett vor, und als ich die Tür zuschwingen hörte, blickte ich wieder auf. Die zweite Matrone setzte sich gerade in einen anderen Lehnsessel und war einen Augenblick mit dem Arrangement ihrer seidenen Rockfalten beschäftigt. In diesem Moment hob Lady Cecily den Kopf, wie eine Gefangene, die nach jeder denkbaren Fluchtmöglichkeit Ausschau hielt, und sah mich an.
Und sie erkannte mich. Obwohl wir uns erst ein einziges Mal begegnet waren, in jener Nacht, als ihr Entführer sie beinahe umbrachte, erkannte sie mich. Peng, es war, als hätte jemand mit der Peitsche geknallt, so wuchtig trafen sich unsere Blicke – und so schnell wandte sie den Blick wieder ab, zweifellos, damit ihre Begleiterin nicht den verblüfften Ausdruck in ihren Augen bemerkte.
Ich folgte ihrem Beispiel und überlegte, ob sie sich wohl an meinen Namen erinnerte, den ich ihr damals so impulsiv und unüberlegt genannt hatte: Enola Holmes. Ich hatte mich diesem unglücklichen Genie, der Tochter eines Baronets von geteilter Persönlichkeit, schwesterlich verbunden gefühlt: der Linkshänderin und Künstlerin, die das schwere Los der Armen erlebt und in höchst außergewöhnlichen Kohlezeichnungen festgehalten hatte und dennoch dazu gezwungen war, der Gesellschaft die wohlerzogene, rechtshändige Lady Cecily vorzuspielen.
Jedoch wusste ich weit mehr über sie als sie über mich. Ich konnte nur raten, wie ich in jener gefahrvollen Nacht auf sie gewirkt haben musste – wie ein Traum, ein mysteriöses Mädchen in einem schwarzen Mantel. Ihr Erstaunen darüber, mich jetzt, bei Tageslicht, wiederzusehen, war deutlich. Womöglich ebenso deutlich wie ihre Hoffnung darauf, dass ich ihr noch einmal behilflich sein könnte, in welcher Notlage sie sich auch diesmal befinden mochte.
Was war nur geschehen? Ich legte meine Zeitung beiseite, als sei ich ihrer überdrüssig, und ließ mir die Verzweiflung durch den Kopf gehen, die ich in Lady Cecilys dunklen Augen erkannt hatte; wie bleich ihr mageres Gesicht war, wie stumpf ihre goldbraunen Haare, die man ihr straff aus der Stirn gekämmt und unter einer schlichten Kopfbedeckung, einem flachen Strohhut, zusammengesteckt hatte.
Als ich einen Augenblick später einen erneuten Blick wagte, hielt sie einen Fächer in den Händen.
Ein höchst eigenartiges Exemplar, denn er war einfarbig, bonbonrosa – schrecklich ordinär – und passte so gar nicht zu ihren zitronenfarbenen Bändern, dem limonengelben Rock und den cremefarbenen Lederhandschuhen und Stiefeln. Zudem bestand dieser Fächer aus schlichtem gefaltetem Papier, angeklebt an zwei einfache Stäbchen und besetzt mit gewöhnlichen rosa Federn, während ihr teurer neuer Rock aus feinster butterweicher grüngelber Seide hergestellt war.
Die ältere Dame in ihrer Begleitung, die sich so gesetzt hatte, dass sie Lady Cecily gut im Auge hatte, sagte mürrisch: »Es ist mir ein Rätsel, warum Ihr darauf besteht, dieses grässliche Ding mit Euch herumzuschleppen, wo ich Euch doch einen so hübschen Fächer geschenkt habe. Cremeweiße Seide mit verzierten Elfenbeinhölzern und überzogen mit feinster Spitze – schon vergessen?«
Cecily beachtete sie nicht, sondern öffnete ihren rosa Fächer, schwenkte ihn, wie um ihr Gesicht zu kühlen. Mir fiel auf, dass sie dabei die linke Hand verwendete – eine entscheidende Beobachtung! Sie entschied, ihr wahres Ich zu zeigen, anstatt sich den Regeln des Anstands zu unterwerfen. Mir fiel auch auf, dass sie den Fächer wie eine Art zerbrechliche Barriere zwischen sich und ihre Aufpasserin hielt. Hinter dieser zarten Deckung suchte sie meinen Blick und im selben Moment berührte der Fächer wie zufällig kurz ihre Stirn.
Ich verstand das Signal sofort: Vorsicht. Wir werden beobachtet. Die Sprache der Fächer war von jungen Liebenden erfunden worden, um im Beisein von Anstandsdamen den anderen dennoch umwerben zu können. Und wenngleich ich sicherlich nie in den Genuss eines Liebhabers gekommen war – und auch nicht damit rechnete, dass sich dies je ändern sollte –, war ich während meiner unschuldigen Kindheitstage auf Ferndell Hall und der verschrobenen Erziehung meiner Mutter oft abgelenkt worden, indem ich andere beobachtete.
Wie beiläufig seufzte ich, als wäre mir heiß und langweilig, griff in eine große Tasche, die sich unter der Drapierung vorn auf meinem Kleid befand, und zog meinen eigenen Fächer heraus, den ich weder aus Gründen der Eleganz noch des Flirtens bei mir trug, sondern schlicht um mein Gesicht zu kühlen. Meine Variante war aus braunem Lackleinen, einfach, aber geschmackvoll. Ich öffnete ihn gebührend weit (mehr als zur Hälfte), um Freundschaft zu signalisieren.
Derweilen erschien die ältliche Dame, die zuvor aufs Klosett verschwunden war, woraufhin die andere sich erhob und ihrerseits verschwand. Lady Cecily nutzte diesen Moment, in dem beide abgelenkt waren, um mit ihrem Fächer hektisch zu wedeln, ein deutliches Zeichen für Angst und Kummer.
Ich ließ meinen Fächer kurz an meiner rechten Wange ruhen: Ja. Womit ich ihr zu verstehen gab, dass ich begriffen hatte – etwas stimmte nicht.
»Nehmt gefälligst die rechte Hand!«, keifte die alte Dame, die sich nun setzte, »und legt das dämliche Spielzeug weg.«
Cecily erstarrte, gehorchte jedoch nicht.
»Legt es weg, sage ich«, befahl ihre – Wärterin? Das und nichts anderes schien diese alte Vettel zu sein.
Lady Cecily entgegnete: »Nein. Es amüsiert mich.«
»Nein?« Der Tonfall der größeren, älteren Frau wurde bedrohlich – bevor er sich änderte. »Na schön, von mir aus sollt Ihr Euren Willen haben – aber nur was das angeht.« Als sie grimmig weiterredete, wurde ihre Stimme so leise, dass ich nichts verstehen konnte. Steif dasitzend (ihre stämmige Taille war in ihrer prächtigen Robe bis zum Äußersten geschnürt), wandte mir der alte Drache sein Profil zu. Und während ich äußerlich unbewegt dasaß und mir Luft zufächerte, waren alle meine Sinne innerlich in höchster Alarmbereitschaft wie bei einem perfekt ausgebildeten Jagdhund. Als ich mir die Frau vor mir einprägte, um sie bei einem eventuellen Wiedersehen erkennen zu können, fiel mir auf, dass sie nur schwer von der anderen zu unterscheiden war. Die breiten, fleischigen Gesichter der beiden waren von seltsam zarten Zügen geprägt: geschwungene spröde Brauen, kleine Nase, schmale Lippen. Tatsächlich sahen beide sich so ähnlich, dass es sich sehr wahrscheinlich um Schwestern handelte, vielleicht sogar um Zwillinge. Das Haar von dieser mochte ein wenig grauer sein als das der anderen, zumindest soweit ich es unter dem übertriebenen Hut erkennen konnte, der schräg saß und so vollgepackt mit Zahnlilien war, dass sie sogar bis unter den Rand reichten.
»… und wenn es den ganzen Tag dauert«, hob sich ihre Stimme ein wenig, als das Temperament die Oberhand gewann. »Eine Brautausstattung braucht Ihr und eine Brautausstattung werdet Ihr bekommen.«
Lady Cecily sagte: »Ihr könnt mich nicht zwingen, etwas anzuprobieren.«
»Wir werden sehen. Kommt jetzt«, sagte sie, als die andere Matrone aus der Toilette trat, ihren Sonnenschirm hob und damit deutlich machte, dass sie abmarschbereit war.
Ohne ein Wort erhob sich Lady Cecily und hielt sich dabei den Fächer offen vors Gesicht, was für gewöhnlich einen scheuen Liebhaber ermutigen soll: Kommt zu mir. Doch unter diesen Umständen, während ihre großen dunklen Augen mich über den rosa gefiederten Rand flehend anblickten, signalisierte es … Ja, was nur?
Lasst mich nicht im Stich?
Helft mir?
Gern, dachte ich, während ich mir an die Wange tippte. Ja – nur wie?
Rettet mich.
Wovor?
»Steckt endlich dieses vermaledeite Ding in die Tasche!«
Cecily nahm den rosa Fächer lediglich herunter, während die beiden Matronen sie in die Mitte nahmen und zur Tür führten, neben der ich saß und träge mit dem Fächer wedelte, während meine Gedanken sich überschlugen. Inzwischen hielt Cecily ihren Fächer an der Schnur und zwirbelte ihn – ein weiteres Zeichen für Gefahr. Vorsicht. Man beobachtet uns.
Sie wünschte Diskretion. Also tat ich abgelenkt, als sie an mir vorbeiliefen, und betrachtete ein hässliches in Gold gerahmtes Stillleben an der gegenüberliegenden Wand, während ich insgeheim plante, ihnen zu folgen und herauszufinden, wohin –
Wumms, ein plötzlicher Ruck brachte mein Sofa zum Schaukeln. Aus den Augenwinkeln nahm ich verschwommenes Zitronengelb war – Lady Cecily, die über ihren lächerlichen Glockenrock gestolpert und um ein Haar auf mich gefallen wäre. Sofort hatten ihre beiden Begleiterinnen sie aufgehoben und ins Freie gescheucht, ohne ein Wort der Entschuldigung an mich.
Hätten sie mir auch nur einen Blick zugeworfen, hätten sie womöglich bemerkt, was mir nun auffiel: der rosa Papierfächer neben mir auf dem Sofa.



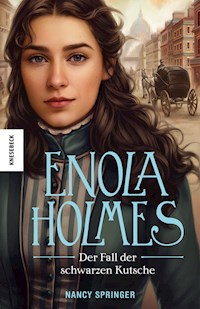

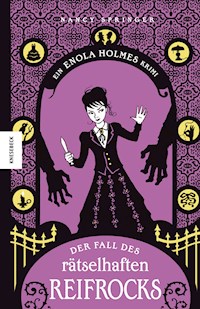













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









