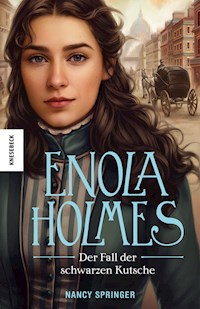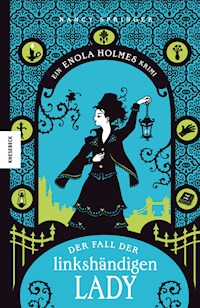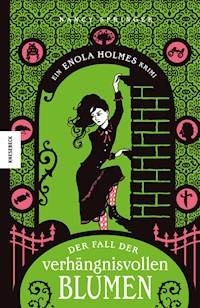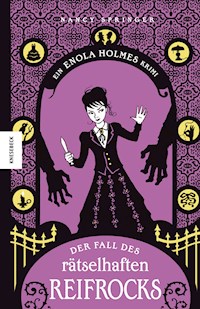11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Enola Holmes
- Sprache: Deutsch
Nachdem Enola Holmes bereits in ihrem zweiten Fall die linkshändige Lady Cecily aus den Fängen ihres Entführers befreit hatte, hätte es eigentlich ein glückliches Ende für ihre Freundin geben können – wäre da nicht Cecilys strenger Vater! Durch den Skandal um seine Tochter sieht er den Ruf seiner ganzen Familie beschädigt. Um weitere Gerüchte und Dramen zu vermeiden, sieht er nur einen Ausweg und hält seine eigene Tochter im Haus gefangen. Höchste Zeit für Enola, selbst zur Entführerin zu werden und um die Freiheit ihrer Freundin zu kämpfen! Dabei stößt sie auf ein dunkles Familiengeheimnis, das schon lange im Verborgenen schlummert. Wird sie Lady Cecily aus den Fängen und den hinterhältigen Plänen ihres Vaters befreien können? Der Film Enola Holmes mit Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Helena Bonham Carter war 2020 einer der erfolgreichsten Filme auf Netflix!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ENOLA HOLMES
Der Fall der eleganten Eskapade
NANCY SPRINGER
Aus dem Amerikanischen vonNadine Mannchen
Für Jaime Fernando Pinto, in Liebe
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Epilog
Prolog
Die siebzehnjährige Lady Cecily Alistair nahm eine Stricknadel in die linke Hand und ritzte mit der Spitze kraftvoll eine grobe, lebensgroße Karikatur ihres Vaters in die Innenseite ihrer verriegelten Zimmertür. Barfuß trat sie in ihrem Nachthemd einen Schritt zurück, um sich die pummelige Figur mit dem dicken Kopf anzusehen, die sie in splittrigen braunen Linien gerade ins weiß gestrichene Holz gekratzt hatte. Mit Farbe oder Kohlestiften hätte sie es weit besser gekonnt, doch ihr Vater hatte ihr beides abgenommen, als er sie vor einer Woche hier eingesperrt hatte. Er gestattete ihr auch kein Tagebuch, keine Bleistifte, keinen Füllfederhalter, keine Bücher oder irgendeine andere Beschäftigung außer stricken. Und er wusste wohl, dass sie das noch nie gemocht hatte, nicht einmal, bevor ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde.
Bevor sich all das vor nur einem Jahr zugetragen hatte, war sie eine gehorsame, wenn auch nicht besonders glückliche Tochter gewesen. Die größten Sorgen hatten ihr damals die Vorbereitungen darauf gemacht, der Queen vorgestellt zu werden, sich elegant fast bis zum Boden zu verneigen, ohne dass dabei die drei großen weißen Federn verrutschten, die absurderweise aus der Haube auf ihrem Kopf sprossen – und nach ihrem »gesellschaftlichen Debüt« einen angemessen reichen Ehemann mit vorzeigbarem Titel zu finden.
Als Lady Cecily nun an diese Zeit zurückdachte, zielte sie mit ihrer Stricknadel wie mit einem Wurfpfeil auf das gedachte Herz ihres aufgemalten Vaters – in Wirklichkeit hatte er keins.
Nicht, dass es ihr Traum gewesen wäre, Debütantin oder Ehefrau zu werden, trotzdem hätte sie den Plänen ihrer Eltern zugestimmt; nicht sie war es gewesen, die sie durchkreuzt hatte. Gewiss war es nicht ihre Schuld gewesen, dass man ausgerechnet sie hypnotisiert und entführt hatte.
Lady Cecilys Geschoss prallte gegen die versperrte Tür, verfehlte jedoch sein Ziel.
Stirnrunzelnd hob sie es auf, um es noch einmal zu versuchen, und überlegte nicht zum ersten Mal, warum sie so widerstandslos, so fügsam, so voll und ganz besessen gewesen war von … von den Erwartungen ihrer Familie, ja, aber was noch verstörender war: von der Macht des Bösewichts. Er, der charismatische Entführer, hatte sie »mesmerisiert«, sodass sie niemals seiner Kontrolle entkommen wäre – nicht ohne dieses seltsame, schlaksige, furchtlose Mädchen namens Enola, das aus dem Nichts aufgetaucht und wie ein Phantom auch wieder im Nichts verschwunden war, nachdem es Cecily befreit und ihr das Leben gerettet hatte.
Enola: ein Rätsel. Enolas Name bedeutete rückwärts gelesen »alone« – allein. Aschenputtel hatte eine gute Fee zur Patentante, während Cecily eine gänzlich sonderbare Patenschwester zu haben schien.
Wäre ihr Leben ein Märchen, wäre sie nach Hause zurückgekehrt, um glücklich bis an ihr Ende zu leben, aber nichts da. Daddy hatte getobt, obwohl zwischen seiner Tochter und dem Entführer rein gar nichts geschehen war, abgesehen davon, dass er sie ausgehungert, ausgebeutet und, ach ja – übrigens auch noch versucht hatte, sie zu ermorden. Aber für Daddy, wie für den Großteil der Gesellschaft, war das alles ein Skandal und sie, Cecily, das Opfer, war nun beschmutzt, befleckt, ruiniert – kein Material zum Verheiraten mehr. Niemals würde sie am Hofe eingeführt, zur Debütantin werden oder einen aristokratischen Ehemann anlocken.
Daddy hatte ihr nicht einmal die Zeit gewährt, sich von der Tortur zu erholen, bevor er sie seinen beiden abscheulichen Schwestern überlassen hatte, mit denen er den perfiden Plan geschmiedet hatte, sie mit ihrer Kröte von Cousin zwangszuverheiraten. Fast hätte ihr reizender Vater sie wie eine Sklavin in den Ehebund verkauft. Jedoch war es ihr dank eines glücklichen Zufalls gelungen, Enola in einer öffentlichen Toilette eine verschlüsselte Nachricht zukommen zu lassen, wenn auch mit äußerst geringer Hoffnung auf Rettung. Am Morgen ihrer Trauung hätte Cecily, geschwächt durch Unterernährung und Misshandlung, sich wie eine Puppe durch die Zeremonie schleifen lassen. Per Gesetz wäre sie an einen verachtenswerten Ehemann gefesselt gewesen, wäre Enola nicht gewesen.
Enola, die im allerletzten Moment auftauchte wie die Heldin aus einer Sage – oder zumindest wie eine sagenhaft Hochgewachsene. An diesem Tag hatte Cecily mehr über Enola erfahren, denn die hatte sie zu ihrem Bruder gebracht, der sich als niemand Geringerer als der große Detektiv Sherlock Holmes entpuppt hatte! Enola war also Enola Holmes, doch Cecily kam es so vor, als ob … Enola eigentlich irgendwie ihre allerbeste Freundin war, obwohl sie sich erst zweimal im Leben begegnet waren, vergangenen Januar und vergangenen Mai … nun ja, dreimal, wenn man die sehr kurze und stumme Begegnung in Londons erster Damentoilette dazurechnete.
Sherlock Holmes hatte Cecily sicher in die Arme ihrer Mutter übergeben und dann hatte es – zumindest für eine Weile – den Anschein gehabt, als wäre alles gut. Doch viel zu früh war Daddy erschienen und hatte sie zurück nach London gebracht, wo er seine Tochter in ihrem Zimmer gefangen hielt und damit drohte, sie bei erstbester Gelegenheit mit irgendjemandem irgendwie zu verheiraten. Nicht genug damit, dass er Cecily zur Strafe ihre Bücher und ihre Kunst genommen hatte, nein, er hatte auch noch all ihre Kleidung fortgesperrt, um ihr selbst die geringste Chance zur Flucht zu nehmen.
So kam es, dass sie mitten an einem sonnigen Oktobernachmittag nichts außer einem Nachthemd trug und nichts Besseres zu tun hatte, als eine kleine fette Karikatur ihres Vaters auf die Innenseite ihrer Zimmertür zu ritzen.
Cecilys Hand mit der Stricknadel darin ballte sich zu einer Faust. Und anstatt ihre Waffe erneut auf ihr Ziel zu werfen, marschierte sie darauf zu und bohrte die Spitze ins Holz. Trotzig, mit ihrer verbotenen linken Hand, erdolchte sie das Abbild von Sir Eustace Alistair, Baronet.
1. Kapitel
Oktober 1889
Als ich an diesem sonnigen Oktobertag aus meiner Kutsche stieg, fühlte ich mich ausgesprochen wohl. Endlich hatte die Druckerei meine neuen Visitenkarten geliefert und sie trugen meinen höchst eigenen Namen: Enola Holmes. In meinem brandneuen kirschroten »polnischen« Mantel würde ich heute meine beste Freundin aufsuchen und es gab wirklich viel zu bereden. Seit wir uns vor mehreren Monaten das letzte Mal gesehen hatten, war ungeheuer viel geschehen:
Zunächst und vor allem war ich nicht länger auf der Flucht vor meinen beiden älteren Brüdern, Sherlock und Mycroft Holmes. Seit jenem schicksalhaften Tag im Juli vor über einem Jahr, als meine Mutter verschwunden war, hatten sie versucht, mich zu bändigen, mich auf ein Internat für höhere Töchter zu schicken und dergleichen – und ich war vor ihnen fortgerannt. Doch dank meiner Abenteuer – besser gesagt, meiner Geniestreiche – während dieser Zeit hatten sie ihren Frieden mit mir gemacht und mir zugestimmt, dass ich, Enola Eudoria Hadassah Holmes!, durchaus in der Lage war, auf eigenen Füßen zu stehen, selbst wenn ich dem Gesetz nach noch nicht volljährig war.
Außerdem hatten wir zu dritt herausgefunden, was aus unserer Mutter geworden war. Sie hatte uns einen höchst erhellenden Brief zukommen lassen, in dem stand, dass sie inzwischen verstorben sei. Und da sie gewusst hatte, dass ihr nicht mehr lange blieb, war sie fortgegangen, um ihre letzten Tage in Frieden zu verbringen, abseits der unerbittlichen Zwänge der Gesellschaft. Sie lag in einem namenlosen Grab und hatte es uns untersagt, für sie lächerliche, ritualhafte schwarze Trauerkleidung zu tragen.
Infolge all dessen – der Versöhnung mit meinen Brüdern und dem gleichzeitigen Verlust meiner Mutter – hatte ich in meinem jugendlichen, aber ereignisreichen Leben sozusagen eine Pause eingelegt, um erst einmal wieder zu mir zu kommen. Derzeit bewohnte ich ein Zimmer im Club für Arbeitende Frauen, wo ich, was selbst mein Bruder Mycroft zugeben musste, absolut sicher war, da nirgends im ganzen Haus Männer Zutritt hatten. Und bis auf Weiteres hatte ich meine Tätigkeit als »Wissenschaftliche Perditorin«, als Finderin verlorener Dinge, eingestellt. Solange ich meine Tage nicht in »Dr. Ragostins« Büro verbrachte, besuchte ich stattdessen Seminare der Londoner Frauenakademie, wo ich vor allem die Herausforderungen von Algebra, Geometrie und Naturphilosophie genoss. Mehr noch, ich genoss die Gesellschaft, oder sollte ich sagen die Verbrüderung mit meinen Brüdern, vor allem mit Sherlock. Ihn besser kennenzulernen, war ein besonders faszinierendes Unterfangen.
Und schlussendlich hatte ich die Zeit genutzt, um ausgiebig einkaufen zu gehen. Wie erfreulich es doch war, dass die »Wespentaille« endlich aus der Mode gekommen war! Gerade im rechten Moment, da ich keine Hüftregulatoren und Büstenformer mehr nötig hatte, um mich vor meinen Brüdern zu verkleiden, brauchte man sie ohnehin nicht länger! An diesem speziellen Tag hatte ich die Bekleidungsläden Londons mit meinen neuen Freundinnen Tish und Flossie abgeklappert. Ich hatte ein sehr modernes Kostüm gekauft, das mich als nichts als mein eigenes schlankes Selbst zeigte, und nun wünschte ich mir nur noch ein Wiedersehen mit meiner allerbesten Freundin Lady Cecily Alistair, um mein Glück vollkommen zu machen.
Ja, in der Tat, auf irgendeine Weise war sie eine allerbeste Freundin, obwohl sich unsere Wege erst zweimal gekreuzt hatten, vergangenen Januar und vergangenen Mai … nun, dreimal, bestand man darauf, das Treffen in der Toilette mitzuzählen.
Nachdem ich den noblen Pflasterweg der Alistairs entlanggetänzelt war, betätigte ich fröhlich den Türklopfer des Haupteingangs.
Nach einer Weile, die mir ungewöhnlich lang vorkam, öffnete der obligatorisch stoische Butler. Ich reichte ihm meine Karte und wies ihn mehr an, als dass ich fragte: »Ist Lady Cecily zu sprechen?«
»Lady Cecily empfängt niemanden.« Er schickte sich an, die Tür wieder zu schließen.
»Moment!« Ich trat vor und schob einen Fuß in die Tür, um ihn aufzuhalten. Selbst wenn sie ein Schläfchen halten sollte, würde Cecily meinen Besuch doch gewiss nicht versäumen wollen. Zum Butler sagte ich: »Überbringen Sie ihr meine Karte, dann werden wir sehen.«
Doch ohne überhaupt nach seinem Tablett zu greifen, wiederholte er hartnäckig: »Lady Cecily empfängt niemanden.«
Die Sonne schien weiter – was in London selten genug vorkam, vor allem im Herbst –, doch ich fröstelte, als wäre ein Schatten über mich gefallen, vor Sorge um Cecily. Was konnte nur los sein? Als Linkshänderin geboren, was für Angehörige der Oberschicht ein Unglück war, hatte Lady Cecily als Kind eine sogar noch drakonischere Erziehung als die meisten anderen erdulden müssen, nur um aus ihr ein gesittetes und unterwürfiges, rechtshändiges Schmuckstück der Gesellschaft zu machen. Doch insgeheim hatte sie rebelliert, indem sie mutige Kohlezeichnungen mit ihrer linken Hand anfertigte, außerdem hatte sie zwei vollkommen unterschiedliche Handschriften entwickelt. Und zwei Persönlichkeiten: Die eine zeigte sich als brave, vollendete Dame, die andere wollte die Gesellschaft revolutionieren. Hatte sie ihre Ansichten mit ihren Eltern geteilt und war dadurch in Schwierigkeiten geraten? Oder ging hier etwas Unheilvolleres vor sich? Als mir zu Ohren kam, dass Cecilys Mutter nach London zurückgekehrt war, um sich mit ihrem Gatten auszusöhnen, war ich unangenehm überrascht gewesen. War »aussöhnen« vielleicht nicht der richtige Ausdruck?
Zu dem Butler mit der steinernen Miene sagte ich: »In diesem Fall würde ich gern ein Wort mit Lady Theodora wechseln.« Noch einmal reichte ich ihm meine Karte.
Noch einmal ignorierte er sie. »Ihre Ladyschaft empfängt niemanden.«
Was zum Kuckuck? Lady Theodora empfing keinen Besuch? Etwas stimmte nicht.
»Herrjemine!«, stieß ich gereizt aus. »Sie wissen sehr wohl, dass sie mich empfangen würde. Erinnern Sie sich nicht an mich?« Ich zog die Schultern zusammen, krümmte den Rücken, zog den Kopf ein, richtete den Blick zu Boden, sprach wie ein wohlerzogenes Mäuschen und verwandelte mich so in »Mrs Ragostin«, die Lady Theodora als Freundin in einer schweren Krise beigestanden hatte. »Erinnern Sie sich nicht an mich?«, wiederholte ich, diesmal mit Piepsstimmchen, bevor ich mich wieder aufrichtete und den Butler unter meiner Strohhutkrempe hervor finster anblickte. »Nun?«, blaffte ich.
Vermutlich hatte ihn mein Auftritt aus der Fassung gebracht, denn seine in Marmor gehauene Fassade bekam Risse und seine Haltung bröckelte. »Miss, äh, Ragostin, Mrs, meine ich. Ich bitte vielmals um Verzeihung, doch ich habe die Anweisung erhalten, niemanden einzulassen. Strikter Befehl von Sir Eustace.« Seine geschliffene Aussprache hatte ihn verlassen. »Ich wag’s ja nicht mal, Ihre Karte zu berühren, Misses, aus Angst, ich könnte meine Anstellung verlieren.«
»Anweisung von Sir Eustace!«, wiederholte ich entsetzt und schlug die Ziegenlederhandschuhe vor den Mund, denn über Lady Cecilys Vater hatte ich nichts Lobenswertes gehört, dafür aber vieles, was sich beklagen ließe.
Der arme Butler verzog tatsächlich das Gesicht. »Oh nein, Miss, ich wollte damit nicht sagen –«
Doch ich blieb nicht, um mir anzuhören, was er nicht hatte sagen wollen. Verstört und in Sorge machte ich kehrt und ging die Stufen hinab zum Gehsteig, wo am Randstein ein Hansom, eine halb offene Kutsche, auf mich wartete.
Von seinem hohen Kutschbock über dem Dach aus erlaubte sich der Fahrer die unübliche Freiheit, seine Sorge auszudrücken. »Schiefgelaufen, Miss Enola?« Als einer meiner liebsten Bekannten, weil er mir einmal seine Kutsche und sein überaus fähiges Pferd, Brownie, geliehen hatte, war er mein Stammkutscher geworden.
»Und wie schief, Harold«, antwortete ich. Er selbst nannte sich »’arry«, aber ich sprach ihn mit »Harold« an. »Bitte bringen Sie mich nach Hause.«
Hätte der Butler der Alistairs mitgehört, wäre er vermutlich davon ausgegangen, mich abgewimmelt zu haben. Doch weit gefehlt. Ich hatte durchaus vor, Lady Cecily zu sehen und mit ihr zu sprechen, koste es, was es wolle, und zwar noch am selben Tag.
Auf meinem Sitzplatz in der Kutsche strich in meinen modisch engen Rock glatt und seufzte. Das Ensemble, das ich trug, hatte keine Taschen und nur ein zuknöpfbares leichtes Korsett, in dem sich wenige Dinge für Eventualitäten verstauen ließen. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich jemals Überröcke, Reifröcke, Tournüren und all den darin verborgenen Stauraum vermissen würde. Ich würde mir zum Zweck meiner Detektivarbeit neue Sicherheitsvorkehrungen einfallen lassen müssen.
Im Club für Arbeitende Frauen angekommen, zog ich mich nicht sofort nach oben in mein Zimmer zurück, in dem ich wohnte. Stattdessen knöpfte ich meinen polnischen Mantel auf, nahm den Hut ab und ließ ihn an den Bändern baumeln, um einen Anschein von Müßiggang zu erzeugen. So spazierte ich durch den Lesesaal und die Bibliothek und lächelte die Frauen an, die zu mir hochblickten. Die geneigte Leserschaft muss wissen, dass dies Londons – und vielleicht der ganzen Welt – erster Club war, der ausschließlich Frauen offenstand. Sobald wir uns in der Sicherheit seiner heiligen Hallen befanden, konnten wir entspannen, ohne Angst vor rücksichtslosen Männern oder den Benimmregeln der Gesellschaft haben zu müssen – die anderen Mitglieder lächelten zurück, selbst wenn wir uns noch nicht vorgestellt worden waren.
Da ich diejenige, die ich suchte, noch nicht gefunden hatte, schlenderte ich weiter und nickte grüßend Frauen zu, die ich kannte. So durchquerte ich den Teesalon mit seinen zierlichen Möbeln im japanischen Stil, anschließend das Kartenspielzimmer und schließlich einen fröhlichen Salon mit Baumwollüberwürfen, wo ich sie an einem Fenster stehen sah: eine hochgewachsene, ältere Dame, die vom ersten Augenblick an mein reges Interesse geweckt hatte.
Ihr Erscheinungsbild wäre in jeder Umgebung aufgefallen: Sie trug ein zartes sonnenblumengelbes »Reformkleid«, das sie, in einem Stück von den Schultern bis zu den Halbschuhen fließend, einhüllte, und ihr langes graues Haar fiel lose über ihren Rücken. Ihren Namen kannte ich nicht, doch ich wollte sie wirklich gern näher kennenlernen. Ich hatte nämlich zufällig belauscht, wie sie sich mit überaus kultivierten Freundinnen über meine Mutter unterhalten hatte.
Sie hatte Mum gekannt.
Ich wollte mit ihr ins Gespräch kommen, allerdings würde ich mich ihr noch nicht zu erkennen geben – denn sobald ich ihr meinen Nachnamen verraten hätte, würde ich ihr mitteilen müssen, dass Mum nicht mehr unter uns weilte. Und was konnte es schaden, die Menschen in dem Glauben zu lassen, dass Lady Eudoria Vernet Holmes ihr Leben irgendwo frei, gesund und munter in vollen Zügen genoss?
Dies war das erste Mal, dass ich die große Frau in dem locker wallenden Gewand allein antraf, was es leichter machte, an sie heranzutreten, obwohl ich mich so schüchtern fühlte wie ein kleines Kind. »Bitte verzeihen Sie die Störung«, wagte ich einen Vorstoß.
Sie drehte sich um, recht geschmeidig für jemanden ihres Alters, um mich aus ihren absolut außergewöhnlichen großen und grau-grünen Augen zu mustern – aber nein!, begriff ich erschrocken und amüsiert zugleich: Ihre Augen wirkten groß und jadefarben, weil sie so etwas wie »Spanisches Papier« verwendet hatte. Wie gewagt! Doch die verbotenen Gesichtspflegeutensilien erfüllten ihren Zweck, denn trotz ihrer pergamentartigen Haut, die über den Gesichtsknochen Falten bildete, war sie hinreißend schön.
»Oh, hallo, Liebes.« Sie lächelte. »Ich habe Sie hier schon hin und wieder bemerkt.« Nun wirkte ihr Lächeln verdutzt. »Doch Sie sehen jünger aus als beim letzten Mal.«
»Stimmt«, gab ich ihr recht, »als ich vergangenen Mai hierherkam, war ich gerade eine verheiratete Frau Mitte zwanzig.«
»Sie ›waren gerade‹? Das müssen Sie mir näher erklären!« Sie nahm auf einem zweisitzigen Sofa mit geschwungener hoher Lehne Platz und klopfte einladend auf den freien Platz neben sich. »Meine Güte, die Heirat von Mrs John Jacobson hat für eine Menge Mutmaßungen gesorgt, und nun wollen Sie alles zum Einsturz bringen und mir erzählen, dass Sie gar nicht sie sind?«
»Ganz recht. Ich bin nicht verheiratet.« Sobald ich neben ihr saß, blickte ich zu ihr auf. »Dürfte ich Sie wohl nach Ihrem Namen fragen?«
»Oh, wie töricht von mir, mich nicht gleich vorzustellen! Ich bin Lady Vienna Steadwell, meine Liebe.«
Ich überlegte, ob ich richtig gehört hatte, und runzelte wohl die Stirn.
»Ja, Vienna«, wiederholte sie und lächelte umso breiter, wobei ihr dünnes Gesicht sich immer weiter kräuselte. »Ich wurde nach der Stadt Wien benannt, in der ich geboren wurde, genau wie Florence Nightingale, wissen Sie? Es war wohl eine Mode kreativer Eltern der damaligen Zeit.«
»Nach einem ganz ähnlichen Einfall hat meine kreative Mutter mich Enola getauft.« So gelang es mir, ihr ganz nebenbei die Hälfte meines Namens zu verraten. Ich reichte ihr die Hand. »Es freut mich, Euch kennenzulernen, Lady Vienna Steadwell.«
Nachdem sie meine Hand herzlich geschüttelt hatte, wollte Lady Vienna mich weiter über mich selbst ausfragen, doch just in diesem Moment kam das Hausmädchen herein. Meiner Erfahrung nach besitzen Angestellte einen unheimlichen Sinn dafür, immer zur falschen Zeit zu erscheinen, doch diesmal nicht. Dankbar sah ich das Mädchen mit Kressesandwiches, Makronen und einem Krug Limonade hereinkommen. Während sie uns bediente, machte ich ihr mit einigen Umständen ein Kompliment zu ihrem schlichten Kleid mit dem Blumenmuster darauf.
Die Dienstmädchen im Frauenclub mussten glücklicherweise nicht die übliche schwarze Uniform mit der weißen, rüschenbesetzten Schürze und dieser absurd gestärkten Haube tragen, die abstand wie der Schwanz eines Zaunkönigs. Hier konnten sie frei entscheiden, was sie anziehen wollten.
Wie ich gehofft hatte, begann Lady Steadwell daraufhin, von der Kleiderreform zu reden, während ich Sandwiches und Makronen verschlang, und ich nutzte die Gelegenheit, ihr zu sagen, wie sehr mir ihr unkonventioneller Reformstil gefiel. Doch sie war keine Närrin. Schließlich beäugte sie mich und sagte: »Miss Enola, wie um alles in der Welt kommt es, dass Sie in Ihrem Alter ganz allein hier in London leben?«
»Meine Familie wohnt nicht weit von hier.« Wahr, wenn auch ausweichend – Mycroft und Sherlock waren meine Familie.
»Tatsächlich? Und was fangen Sie mit Ihrer Zeit an, abgesehen von einkaufen?«
Es machte mir nichts aus, ein wenig geneckt zu werden, also lächelte ich. »Ich habe einige Seminare an der Akademie für Frauen belegt.«
»Aha!« Das fand durchaus ihren Zuspruch. »Und auf welchem Studiengebiet?«
»Eine Mischung aus verschiedenen. Mein Lebensziel ist es, als Wissenschaftliche Perditorin zu arbeiten: als Finderin vermisster Personen und verlorener Dinge.«
»Wie überaus ungewöhnlich!«
Ihr Lächeln und ihre Augenbrauen drückten Verwirrtheit aus, doch ich machte tapfer weiter. »Tatsächlich habe ich es gerade wieder mit einem ärgerlichen Problem zu tun und ich hoffe, Ihr haltet mich nicht für aufdringlich …« Endlich war ich an den Punkt gekommen, an dem ich meine Frage an sie stellen konnte. »Lady Steadwell, seid Ihr rein zufällig mit den Alistairs bekannt?«
Nachdem sie wenige Male geblinzelt hatte, antwortete sie: »Das war ich, als sie noch lebten. Aber … Ach, Sie meinen die Alistair-Kinder? Otelia, Aquilla und Eustace?«
Kinder? Sie waren weit älter als ich. »Sir Eustace Alistair und seine Familie.«
»Ich bin mit keinem von ihnen vertraut, aber natürlich weiß ich von ihnen. Über sie hört man die bedauerlichsten Dinge.« Sie klang etwas steif – offenbar hatte sie für Klatsch und Tratsch nicht viel übrig.
Ich dagegen hätte diese bedauerlichen Dinge zu gern erfahren. »Zum Beispiel?«
»Oh, zum Beispiel hat Lady Theodora Sir Eustace angeblich in einem Anfall von Selbstaufopferung geheiratet, nachdem ein anderer ihr das Herz gebrochen hatte, und bereut es seitdem.«
Ich tat so, als wüsste ich von nichts. »Dann ist Sir Eustace kein guter Ehemann?«
»Er ist der üblichen Ausgabe von Ehemann weit unterlegen«, sagte Lady Vienna mit trockenem Humor. Doch dann setzte sie ihre Teetasse ab und sprach in wesentlich ernsterem Tonfall weiter. »Abgesehen von den gängigen männlichen Fehlern ist Eustace klein, dick, hält sich für etwas Besseres und hat überhaupt einen ausgewachsenen Napoleon-Komplex.«
Nun war ich es, die verwirrt war. »Napoleon-Komplex?«
»So nennen es die Nervenärzte, wenn ein Mann aussieht und sich aufführt wie ein aufgeblasener Zwerggockel.«
»Verstehe. Die Nervenärzte«, wiederholte ich.
»Ja, die Gründer einer neuen Wissenschaft vom menschlichen Verhalten. Sie haben von ihrer bemerkenswerten Forschung gehört?«
»Ja.« Und Lady Cecily wäre mit ihrer doppelten Persönlichkeit ein interessantes Thema.
»Der Napoleon-Komplex«, fuhr Lady Vienna fort, »ist eine charakteristische Ausprägung des Minderwertigkeitskomplexes, den kleine Männer entwickeln. Sir Eustace zeigt die klassischen Symptome: Umherstolzieren, Sich-in-Pose-Werfen, Herumbrüllen, Selbstherrlichkeit, die sich zum Größenwahn auswächst, und die absolute Zwangsherrschaft über seine Familie.«
»Lady Steadwell.« Ich schob das Teegedeck beiseite, beugte mich dicht zu ihr und sah sie fest an. »Ist es Sir Eustace Eurer Meinung nach zuzutrauen, dass er seine Frau und seine Tochter in ihrem eigenen Heim gefangen hält?«
Gefasst erwiderte sie meinen Blick durchdringend, als sie mit gesegneter Schlichtheit antwortete: »Oh ja.«
2. Kapitel
Ja, sehr wahrscheinlich war Cecily in ihrem Zimmer gefangen. Auch wenn der Gedanke mir Übelkeit verursachte, kam ich zu genau diesem Schluss. Doch mehrere unruhige Stunden lang konnte ich nichts daran ändern, bis die Sonne unterging.
Während des Abendessens allerdings führte ich meine Ermittlungen fort.
Abendessen im Club für Arbeitende Frauen war weniger eine formelle Angelegenheit, sondern vielmehr ein symbolisches Aufbegehren gegen die feierlichen Fesseln der Gesellschaft. Zwar gab es das übliche schneeweiße Tischtuch, doch auf seiner mit Flecken übersäten Oberfläche ähnelte kein Kerzenständer dem anderen, und auch die Gedecke waren ein rigoroses Durcheinander aus verschiedenstem (wenngleich niemals beschädigtem) Porzellan. Im selben Sinn glich auch kein Silberbesteck mit seinem Muster dem eines anderen. Selbst die Servietten erfreuten sich der Abwechslung. Und – der revolutionärste Denkmalsturz von allen – wir Frauen, die wir dinierten, mussten uns nicht »verkleiden«, uns also nicht aus keinem erkennbaren Grund herausputzen. Stattdessen trugen wir, was immer uns gefiel, solange wir dabei nicht nackt waren.
Auch die Gespräche waren alles andere als förmlich, und sobald an diesem Abend die Suppe serviert wurde, zögerte ich nicht, den anderen stimmungs- und auch etwas humorvoll zu erzählen, wie ich an Sir Eustace Alistairs Tür so mir nichts, dir nichts abgewiesen worden war.
»Himmel, ich bin schockiert, aber nicht überrascht«, kommentierte eine ältere und würdevolle Dame, die für eine Wochenzeitung einen Kummerkasten schrieb. »Der gute Baronet war schon immer ein richtiggehender Rüpel.«
»Ein Popanz durch und durch«, stimmte ihr eine Frau zu, die als Abteilungsleiterin in einem Kaufhaus arbeitete. »Ein aufgeblasener Schaumschläger, dem seine verkommene Schwülstigkeit zu Kopf gestiegen ist, umso mehr, weil er nur ein ›Sir‹ ist.«
»Während seine Schwestern Otelia und Aquilla ›Ihre Lordschaften‹ geheiratet haben und es dem kleinen Bruder Eustace zu gern aufs Brot schmieren«, ergänzte eine jüngere Frau, die rein zufällig eine Spezialistin für Eiswasserhydrotherapie war.
Die Kummerkasten-Dame fasste zusammen: »Sir Eustace Alistair ist ein schrecklicher Haustyrann. Lady Theodora hätte ihn schon lange verlassen sollen, noch bevor sie ihm so viele Kinder geboren hätte.«
»Eine von uns hätte ihr ein Diaphragma zustecken sollen«, meldete Lady Vienna sich zu Wort.
Ich hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte, doch andere Frauen warfen sich derart schockierte Blicke zu, dass ich nicht nachhakte. Kurz trat verlegene Stille ein.
Ohne die geringste Veränderung in ihrem sanft lächelnden Gesicht fügte Lady Vienna hinzu: »Sie hat mein tiefstes Mitgefühl. Wie schrecklich, dass sie dazu gezwungen war, zu ihm zurückzukehren.«
Alle am Tisch stimmten herzlich, wenn auch leise zu, während wir uns dem Wachtelfrikassee zuwandten.
Eine beratende Phrenologin äußerte mit Vorsicht und fragendem Tonfall: »Lady Theodora wurde aber nicht im herkömmlichen Sinn Unrecht zuteil …?«
»Das vielleicht nicht«, sagte die Hydrologin eisig, »aber jede Frau hat die moralische Verpflichtung, gegen Tyrannei aufzubegehren! Meine Güte, Sir Eustace hat sich sogar erdreistet, seine eigene Tochter an seine gehässigen Schwestern zu verschachern, die sie gefangen hielten und aushungerten, um sie dazu zu zwingen, ihre Kröte von einem Cousin zu heiraten!«