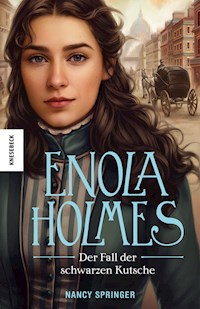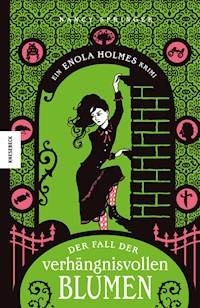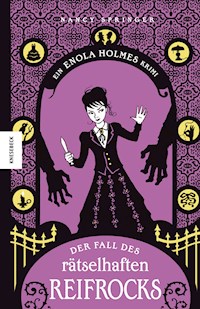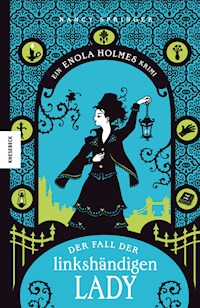
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Enola Holmes
- Sprache: Deutsch
Enola versteckt sich in London noch immer vor dem genialsten Detektiv der Welt, ihrem eigenen Bruder Sherlock Holmes, und wartet auf weitere verschlüsselte Nachrichten ihrer Mutter. Als sie zufällig von der verschwundenen Lady Cecily erfährt und in den faszinierenden Kohlzeichnungen der offenbar sehr begabten Künstlerin eine Seelenverwandte erkennt, übernimmt Enola die Ermittlungen. In verschiedenen Verkleidungen auf den dunklen Londoner Straßen unterwegs und immer auf der Hut vor Mördern und Verbrechern, muss Enola die Hinweise entschlüsseln: eine angelehnte Leiter, ein gerissener Verkäufer, politische Flugblätter… Um Lady Cecily zu retten, riskiert Enola mehr als sie sollte – und kommt dabei auch ihrem Bruder unerwartet nahe.In diesem spannenden Nachfolger des ersten Bands Der Fall des verschwundenen Lords führt Nancy Springer die Leser zurück in das düstere und gefährliche Viktorianische London und setzt die Abenteuer der schlauen Detektivin Enola Holmes fort.Der Film Enola Holmes mit Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Helena Bonham Carter war 2020 einer der erfolgreichsten Filme auf Netflix!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für meine Mutter.
Inhalt
Ich wusste, nun würde ich sterben …
London, Januar 1889
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Noch immer in der Kälte des Winters, Februar 1889
Ich wusste, nun würde ich sterben …
Als ich mich wieder auf den Weg machte, schlotterte ich vor Kälte. Und vor Angst. Die Ohren hatte ich gespitzt.
Aus der nächsten Straße drangen leiser, beschwingter Gesang und betrunkenes Gebrüll. Eine Wirtschaft, die um diese Zeit noch geöffnet hatte? Wie konnte das denn erlaubt sein? Sicherlich hätten die Ordnungshüter …
Versunken in meine Gedanken, bemerkte ich zu spät, dass jemand hinter mir lief.
Ein unscheinbares Geräusch. Vielleicht das Schlurfen von Schuhleder über den gefrorenen Matsch und die bröckelnden Pflastersteine. Vielleicht das Zischen eines bösen Atems. Noch während ich verblüfft den Mund öffnete, noch während ich herumfahren wollte, packte mich etwas am Hals.
Etwas Unsichtbares hinter mir.
Grauenhaft kräftig.
Fest und fester packte es zu.
Nicht der Griff eines Menschen. Etwas … ein schlankes Verhängnis, windend, zuschnürend, schnitt mir in die Kehle. Unfähig zu jedem klaren Gedanken, griff ich nicht einmal nach meinem Dolch. Ich reagierte rein instinktiv, ließ die Laterne fallen und riss beide Hände hoch, um an dem … Ding zu zerren, das meinen Hals quälte. Schon drückte es mir die Luft ab, während mein Körper unter Schmerzen zappelte. Mein Mund weitete sich zu einem stummen Schrei, meine Sicht verschwamm in Dunkelheit und ich wusste, nun würde ich sterben.
London, Januar 1889
»Wir wären gar nicht erst in dieser beklagenswerten Lage«, erklärt der jüngere und größere der beiden Männer in dem kleinen Clubzimmer, »hättest du sie nicht zwingen wollen, aufs Internat zu gehen!« Seine Gesichtszüge sind kantig und er selbst so dünn, dass man ihn schon mager nennen könnte. Einem schwarzen Reiher gleich schreitet er in seinen polierten schwarzen Schuhen, der schwarzen Hose und dem schwarzen Frack unruhig auf und ab.
»Mein lieber Bruder.« Der ältere, üppigere Mann, der es sich in einem tiefen, mit Saffianleder gepolsterten Lehnsessel bequem gemacht hat, zieht beide Augenbrauen hoch, die verschneiten Hecken gleichen. »Dich so in etwas hineinzusteigern, sieht dir gar nicht ähnlich.« Er ist gelassen, denn immerhin befinden sie sich hier in seinem Club, noch dazu im besonders geschützten Raum für private Unterredungen, und er kann schon jetzt nur noch an den Rinderbraten denken, auf den er sich zum Abendessen freut. Freundlich sagt er zu seinem jüngeren Bruder: »Man muss wohl davon ausgehen, dass sich dieses törichte Kind vollkommen allein in dieser sündigen Stadt befindet und womöglich bereits bestohlen und mittellos dasteht – oder, schlimmer noch, ihrer Unschuld beraubt wurde. Dennoch darfst du dich in dieses Dilemma nicht emotional verstricken lassen.«
»Wie bitte sollte das möglich sein?« Der unruhige Mann fährt herum und wirft dem anderen einen scharfen Blick zu. »Sie ist unsere Schwester!«
»Und die zweite vermisste weibliche Person ist unsere Mutter – ja und? Finden wir sie schneller, wenn wir uns nervös machen wie ein Jagdhund im Zwinger? Wenn du unbedingt jemandem die Schuld zuschieben musst«, fügt der Sitzende hinzu und faltet die Hände über der gut gepolsterten, breiten Seidenweste, »solltest du deinen Zorn auf Mutter konzentrieren.« Ein Logiker durch und durch, führt er sofort die Gründe auf: »Unsere Mutter hat das Mädchen völlig verwahrlost – in Kniebundhosen und auf einem Fahrrad! – herumlaufen lassen, anstatt dass man es salonfähig machte. Mutter war es, die den lieben langen Tag Blumensträußchen gemalt hat, während unsere Schwester auf Bäume kletterte. Es war unsere Mutter, die sämtliche Gelder unterschlagen hat, die eine Gouvernante, einen Tanzlehrer, schmückende feminine Kleider für das Kind et cetera finanzieren sollten. Und es war unsere Mutter, die das Mädchen letztendlich im Stich gelassen hat.«
»An ihrem vierzehnten Geburtstag!«, murmelt der Unstete.
»Geburtstag oder nicht, wo liegt der Unterschied?«, murrt der ältere Bruder, der das Thema allmählich leid ist. »Mutter ist diejenige, die ihrer Verantwortung nicht nachgekommen ist, sich sogar aus dem Staub gemacht hat und –«
»Und dann zwingst du einem jungen Mädchen mit gebrochenem Herzen deinen Willen auf, indem du ihm befiehlst, die einzige Welt zu verlassen, die es je gekannt hat und die gefährlich aus den Fugen geraten war!«
»Der einzig logische Weg, um aus ihr zumindest annähernd so etwas wie eine angesehene junge Dame zu machen!«, unterbricht ihn der Ältere schroff. »Vor allem du solltest einsehen, wie logisch d-«
»Logik ist nicht alles.«
»Und das aus deinem Mund!« Bequemlichkeit und Ruhe sind nun wie weggeblasen. Der untersetzte Mann lehnt sich in seinem Sessel vor und stellt die Stiefel (geziert von makellosen Gamaschen) fest aufs Parkett. »Warum bist du so … so von Emotionen überwältigt, so betroffen? Warum unterscheidet sich die Suche nach unserer Schwester, dieser rebellischen Ausreißerin, so sehr von all den anderen kleinen Problemchen, d-?«
»Weil sie unsere Schwester ist!«
»Eine so viel jüngere, dass du sie in deinem ganzen Leben genau zwei Mal getroffen hast.«
Der große, rastlose Mann, dessen Gesicht an einen Habicht erinnert, bleibt stehen. »Ein einziges Mal hätte genügt.« Anders als zuvor redet er nun nicht mehr schnell und schneidend, sondern langsamer und sanfter. Allerdings sieht er dabei nicht seinen Bruder an. Stattdessen scheint er durch die mit Eiche vertäfelten Wände des Clubzimmers zu einem weit entfernten Ort zu blicken – oder einem weit entfernten Zeitpunkt. Er sagt: »Sie erinnert mich an mich selbst, als ich in ihrem Alter war. Fast nur Nase und Kinn, schlaksig, unbeholfen, eine Einzelgängerin …«
»Unfug!« Der ältere Bruder unterbricht diesen Mumpitz umgehend. »Wie absurd! Sie ist ein Mädchen. Ihr Intellekt ist unterlegen, allein ist sie schutzlos … ein Vergleich ist völlig undenkbar.« Stirnrunzelnd und doch ganz der Staatsmann, senkt er die Stimme wieder und beherrscht sich. »Sich den Kopf über Vergangenes zu zerbrechen erfüllt keinen Nutzen – die einzig vernünftige Frage, die wir uns nun stellen sollten, ist die folgende: Wie sollen wir sie deiner Meinung nach finden?«
Mit offensichtlicher Mühe reißt sich der hochgewachsene Mann von seinen Überlegungen los und mustert seinen Bruder mit wachen grauen Augen. Nach einer Weile sagt er lediglich: »Ich habe einen Plan.«
»Etwas anderes habe ich nicht erwartet. Und ist der Herr geneigt, mich in seinen Plan einzuweihen?«
Stille.
Nachdem er sich wieder in seinen Sessel gelehnt hat, setzt der Ältere ein dünnes Lächeln auf. »Auf deine Geheimniskrämerei kannst du nicht verzichten, was, Sherlock?«
Ebenso kühl wie der ältere zuckt der jüngere Bruder, auch bekannt als der große Meisterdetektiv, nun mit den Schultern. »Es erfüllt keinen logischen Nutzen, dir zu diesem Zeitpunkt auch nur das Geringste zu verraten, mein lieber Mycroft. Sollte ich deine Hilfe benötigen, werde ich mich sicherlich an dich wenden.«
»Und warum bist du dann heute überhaupt hergekommen?«
»Um dir ausnahmsweise einmal die Meinung zu sagen.«
»Sollte dies tatsächlich deine Meinung sein, mein lieber Sherlock? Mir scheint, deinen geistigen Ergüssen mangelt es an Disziplin. Du hast zugelassen, dass die Nerven mit dir durchgehen. Du wirkst überarbeitet, übermäßig erregt.«
»Ein Zustand, der meiner Ansicht nach immer noch besser ist, als keinerlei Regung zu zeigen.« Für ihn war das Thema offensichtlich erledigt. Sherlock Holmes nahm seinen Hut, seine Handschuhe und seinen Spazierstock und wandte sich der Tür zu. »Auf Wiedersehen, Mycroft.«
»Deinem Plan das beste Gelingen, mein lieber Sherlock. Auf Wiedersehen.«
1. Kapitel
Absolut verblüfft und schockiert betrachtete ich die Karte, die mir der Page soeben auf einem Silbertablett gebracht hatte.
»Dr. med. John Watson.« Ich sprach den Namen laut aus, um mir zu versichern, dass ich mich nicht verlesen hatte. Denn ich konnte nicht fassen, dass ausgerechnet er der allererste Klient sein sollte, der das (im Januar 1889) neu eröffnete Büro des einzigen Wissenschaftlichen Perditors – also eines professionellen Finders von vermissten Dingen und Menschen – in ganz London – und sogar der ganzen Welt – aufsuchte.
Dr. John Watson? John war ein gängiger Name, aber Watson? Noch dazu Doktor der Medizin? Es konnte kein Irrtum sein, trotzdem wollte ich es nicht glauben. »Etwa der Dr. Watson, Joddy?«
»Woher soll ich das denn wissen, gnädige Frau?«
»Joddy, ich habe es doch nun oft genug gesagt, Sie sollen mich mit Miss Meshle ansprechen. Einfach Miss Meshle.« Ich rollte mit den Augen, doch was konnte man schon von einem Jungen erwarten, den seine Mutter Jodhpur genannt hatte (was im Kirchenregister fälschlich »Jodper« geschrieben worden war), weil diese Bezeichnung für Reithosen in ihren Ohren vornehm klang? Schuld war Joddys Ehrfurcht vor meinen Rüschen und Puffärmeln, weshalb er mich »gnädige Frau« nannte. Doch das durfte er nicht, sonst würden die Leute anfangen, Fragen zu stellen. Seine Ehrfurcht wollte ich dem Pagen durchaus nicht austreiben. Immerhin bemerkte er so nicht, dass ich nur ein Mädchen war, kaum älter als er selbst. Nur das »gnädige Frau« sollte er sich endlich verkneifen.
Gefasster und darauf bedacht, ja nicht zu aristokratisch zu klingen, fragte ich ihn: »Sie haben dem Gentleman ausgerichtet, dass Dr. Ragostin nicht im Haus ist?«
»Ja, gnädige Fr… Ich meine, ja, Miss Meshle.«
Das Büro des Wissenschaftlichen Perditors trug den Namen eines gewissen Dr. Leslie T. Ragostin zur Schau. Schließlich können nur Männer Wissenschaftler sein. Allerdings würde »Dr. Ragostin« nie mit seiner Anwesenheit glänzen, da er – als Doktor mit einem Universitätsabschluss – nur in meiner Vorstellung sowie auf den Plaketten und Visitenkarten existierte, die ich bei jeder Gelegenheit in Geschäften, Kiosken, Hörsälen und an Obstständen auslegte.
»Würden Sie Dr. Watson in mein Büro bringen? Ich werde sehen, ob ich ihm weiterhelfen kann.«
Joddy eilte hinaus. Anders als sein Verstand machte zumindest seine äußere Erscheinung Eindruck: mit Borten an Ärmeln und Hosenbeinen, weißen Handschuhen und einem gestreiften Hütchen auf dem Kopf, das verdächtig an eine Miniaturtorte erinnerte. Aber warum auch nicht? Die meisten Uniformen sind absurd.
Sobald er verschwunden war, ließ ich mich auf den Holzstuhl hinter meinem Schreibtisch sinken, weil meine Knie so stark zitterten, dass meine seidenen Unterröcke raschelten. So ging das nicht. Nachdem ich tief durchgeatmet hatte, schloss ich kurz die Augen und rief mir das Gesicht meiner Mutter in Erinnerung. Sobald ich sie vor mir hatte, konnte ich praktisch ihre Stimme hören: »Enola, du kommst sehr gut allein zurecht.«
Diese geistige Übung zeigte die erwünschte Wirkung. Gefasst öffnete ich die Augen, als Joddy Dr. Watson aus dem Wohnzimmer, das als Warteraum diente, auch schon hereingeleitete.
»Dr. Watson. Ich bin Dr. Ragostins Sekretärin, Miss Ivy Meshle.« Ich erhob mich, um meinem Besucher die Hand zu reichen, und stellte fest, dass er genau so war, wie ich anhand seiner Berichte und Aufsätze erwartet hatte: ein stämmiger englischer Gentleman, der zwar nicht reich war, aber eindeutig der gebildeten Schicht angehörte und mit einer gesunden Gesichtsfarbe, freundlichen Augen und einem winzigen Hang zum Übergewicht ausgestattet war.
Ich hoffte, andersherum sah er in mir, was ich zu sein vorgab: eine absolut gewöhnliche, junge arbeitende Frau mit einer übertrieben großen Brosche auf der Front ihres Kleides und ebenso hässlichen, dazu passenden Ringen in den Ohren – überhaupt reich geschmückt mit billigem Tand, welcher die jüngste Mode imitierte (auch nicht weniger absurd als eine Uniform). Ein Mädchen, dessen hübsche Locken nicht gänzlich die eigenen waren, sondern höchst wahrscheinlich von einem bayerischen Bauernmädchen stammten. Eine junge Frau, zwar ehrenwert, jedoch nicht kultiviert. Eine, deren Vater vielleicht ein Sattler oder ein Gastwirt war. Ein Mädchen, das vor allem damit beschäftigt war, sich einen Ehemann zu angeln. Sollte meine Verkleidung mithilfe der bereits erwähnten »Brosche«, außerdem einer eng anliegenden Halskette, übertrieben vielen Schleifen und den allzu offensichtlichen Haarteilen diesen Eindruck erwecken, dann erfüllte sie genau ihren Zweck.
»Erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Meshle.« Dr. Watson hatte selbstverständlich längst den Hut abgenommen. Und ganz wie es sich gehörte, hatte er zunächst seine Handschuhe ausgezogen und sie gemeinsam mit dem Gehstock dem Pagen anvertraut, bevor er meine Hand ergriff und schüttelte.
»Bitte, nehmen Sie Platz.« Ich deutete auf den Sessel. »Rücken Sie ihn gerne nah an den Kamin. Schrecklich kalt draußen, nicht wahr?«
»Grässlich. Noch nie habe ich erlebt, dass die Themse so dick zugefroren ist, dass man darauf Schlittschuh laufen kann.« Beim Reden rieb er die Hände aneinander und hielt sie nah ans Feuer. Trotz aller Bemühungen war der Raum nicht allzu warm und ich beneidete meinen Gast um den bequemen gepolsterten Sessel. Aus irgendeinem Grund hatten mir Kälte und Feuchtigkeit nicht viel ausgemacht, bevor ich nach London gekommen war, wo ich bereits einen Bettler – zumindest seine körperlichen Überreste – gesehen hatte, der am Gehsteig festgefroren war.
Ich setzte mich auf den unbequemen Holzstuhl hinter meinem Schreibtisch, zog den Schal fester um die Schultern, rieb meine eigenen Hände (steif, trotz der gestrickten Handschuhe, aus denen meine Finger herausspitzten) und griff nach Stift und Notizbuch. »Es tut mir so leid, Mr Watson, dass Dr. Ragostin außer Haus ist. Sicherlich wäre er hocherfreut, Sie kennenzulernen. Sie sind doch der Dr. Watson, der mit Mr Sherlock Holmes bekannt ist, oder irre ich mich?«
»Das bin ich.« Höflich, ja sogar bescheiden, blickte er mich dabei an. »Tatsächlich geht es bei meinem Besuch um ihn.«
Mein Herz klopfte auf einmal so heftig, dass ich beinahe Angst bekam, mein Gast könnte es hören. Ich konnte mir nicht länger einreden, ein glücklicher – oder unglücklicher – Zufall hätte diesen Mann zu mir geführt.
In dieses Büro, um den weltweit einzigen professionellen Finder von vermissten Dingen und Menschen aufzusuchen.
Dennoch gab ich mir Mühe, lediglich höflich und wie eine Frau aus der Mittelschicht zu klingen, mit der angebracht dienstbeflissenen Mischung aus Fleiß und Unterwürfigkeit. »Ach ja?« Mit gezücktem Stift fragte ich: »Und um welche Art von Schwierigkeit handelt es sich bei Mr Holmes?«
»Sicherlich werden Sie verstehen, Miss Meshle, dass ich diese Angelegenheit lieber mit Dr. Ragostin persönlich besprechen würde.«
Ich lächelte. »Und Sie, Dr. Watson, werden gewiss verstehen, dass man mich damit betraut hat, alle einleitenden Maßnahmen zu ergreifen, um Dr. Ragostins kostbare Zeit weitestgehend zu schonen. Dr. Leslie Ragostin hat mir seine ausdrückliche Vollmacht erteilt – natürlich nicht, um selbst in Aktion zu treten«, fügte ich hinzu, um das angeborene Misstrauen Frauen gegenüber zu dämpfen. »Doch häufig bin ich für ihn Augen und Ohren. Genau wie Sie für Mr Sherlock Holmes«, ergänzte ich schmeichelnd, ohne es allzu offensichtlich erscheinen zu lassen.
Ohne ihm zu zeigen, wie sehr ich innerlich flehte: Bitte. Bitte, ich muss wissen, ob ich richtig geraten habe, warum Sie hier sind.
»Ähm, ja«, sagte Dr. Watson unsicher. »Gewiss.« Er hatte wirklich freundliche Augen, umso mehr wenn er sich Sorgen machte. »Nur bin ich nicht sicher – die Angelegenheit ist etwas delikat … Holmes weiß nämlich nichts von meinem Besuch hier.«
Dann … hatte mein Bruder ihn gar nicht geschickt?
Schlagartig beruhigte sich mein Herz, dafür tat es nun weh.
Scheinbar gelangweilt sagte ich zu Dr. Watson: »Sie können sich auf meine absolute Verschwiegenheit verlassen.«
»Gewiss. Natürlich.« Und als hätte mein schwindendes Interesse ihn, eine gequälte Seele, dazu verleitet, sich mir anzuvertrauen, umklammerte er die Lehnen seines Sessels und begann zu erzählen.
»Zweifellos wissen Sie, dass ich zu Beginn seiner erstaunlichen Karriere mehrere Jahre lang der Mitbewohner von Mr Sherlock Holmes war. Da ich nun verheiratet bin und mich als Arzt niedergelassen habe, sehe ich ihn weit seltener als früher. Dennoch ist es mir nicht entgangen, dass er seit dem vergangenen Sommer bedrückt wirkt, die vergangenen paar Monate über regelrecht verstört – bis zu dem Ausmaß, dass er weder vernünftig isst noch schläft. Inzwischen mache ich mir nicht länger nur als Freund, sondern auch als Arzt Sorgen um ihn. Er hat an Gewicht verloren, hat eine überaus ungesunde Gesichtsfarbe und er ist auffallend melancholisch und jähzornig geworden.«
Während ich all das für »Dr. Ragostin« mitschrieb, konnte ich den Kopf dicht über dem Schreibtisch halten, sodass Dr. Watson mein Gesicht nicht sehen konnte. Zum Glück, denn ich bin sicher, meine Bestürzung wäre deutlich sichtbar gewesen: In meinen Augen bildeten sich Tränen. Mein Bruder, Musterbeispiel für einen kühlen, logischen Verstand, sollte verstört sein? Unfähig zu essen oder zu schlafen? Ich hatte ja keine Ahnung, dass er zu solch großen Gefühlen überhaupt in der Lage war. Noch dazu für mich.
Dr. Watson fuhr fort. »Obwohl ich ihn wiederholt gefragt habe, was ihn so belastet, streitet er ab, irgendwelche Probleme zu haben. Als ich gestern nicht lockerließ, brauste er dermaßen auf … ganz und gar nicht eisern kontrolliert wie sonst, sondern so irrational, dass ich den Eindruck bekam, sofort handeln zu müssen, ob es ihm gefällt oder nicht – zu seinem eigenen Besten. Daher stattete ich seinem Bruder Mr Mycroft Holmes einen Besuch ab …«
Ivy Meshle, begriff ich, durfte von Sherlock Holmes’ Bruder nichts wissen. Daher unterbrach ich ihn: »Wie buchstabiert man seinen Namen, bitte?«
»Ein seltsamer Name, nicht?« Watson buchstabierte ihn für mich, gab mir Mycrofts Adresse in London und erzählte weiter. »Nach einigem Zögern erklärte mir Mycroft Holmes, dass er und Sherlock Holmes sich in der äußerst unglücklichen Lage befinden, ihre Mutter nicht ausfindig machen zu können. Und nicht nur ihre Mutter ist spurlos verschwunden, sondern auch ihre jüngere Schwester. Zwei Familienmitglieder – noch dazu ihre einzigen Angehörigen – sind wie vom Erdboden verschluckt.«
»Wie grässlich!«, murmelte ich, den Blick starr aufs Blatt gerichtet. Inzwischen war mir nicht mehr nach Weinen zumute. Nein, viel lieber hätte ich gelächelt – am liebsten hätte ich meinem ach-so-ältesten Bruder Mycroft, der aus mir eine affektierte junge Dame hatte machen wollen, eine lange Nase gedreht. Es fiel mir schwer, eine angemessen mitfühlende Miene aufzusetzen, während ich die Rolle von jemandem spielte, der von all dem keine Ahnung hatte. »Entführt?«
Dr. Watson schüttelte den Kopf. »Lösegeldforderungen gab es keine. Nein, beide sind aus freien Stücken gegangen.«
»Wie schockierend.« Mir fiel ein, dass ich ja von nichts wissen konnte. »Sie sind gemeinsam ausgerissen?«
»Nein! Getrennt voneinander. Die Mutter verschwand vergangenen Sommer und das Mädchen lief sechs Wochen später weg, als man sie ins Internat bringen wollte. Sie ging völlig allein. Ich vermute, deswegen nimmt Holmes sich die Sache auch so zu Herzen. Wäre das Mädchen bei seiner Mutter, fände er die Angelegenheit vielleicht nicht in Ordnung, doch immerhin wüsste er, dass seine Schwester in Sicherheit ist. Jedenfalls hat es ganz den Anschein, dass das Mädchen – eigentlich noch ein Kind! – auf eigene Faust nach London reiste!«
»Ein Kind, sagen Sie?«
»Erst vierzehn Jahre alt. Nach Mycroft Holmes’ Angaben haben er und sein Bruder Grund zu der Annahme, dass ihre Schwester Zugang zu beträchtlichen Finanzmitteln hat …«
Ich verspannte mich und spürte einen sorgenvollen Stich – wie konnten sie das nur erraten haben?
»… und sie befürchten, dass sie sich als junger, leichtsinniger Gentleman ausgibt …«
Ich entspannte mich wieder, denn nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein. Ich hoffte, niemals zu dem theatralischen Klischee herabzusinken, mich als Mann zu verkleiden. Obwohl ich mich gewiss nicht allein darauf beschränkte, Ivy Meshle zu sein.
»… und als solcher könnte sie dekadenten Einflüssen ausgesetzt sein«, sagte Dr. Watson, »und womöglich ein Leben in Schimpf und Schande führen müssen.«
Ein Leben in Schimpf und Schande? Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was das sein sollte, notierte es aber gewissenhaft. »Mr Mycroft Holmes und Mr Sherlock Holmes haben Grund zu dieser Befürchtung?«, hakte ich nach.
»Ja. Die Mutter war – oder ist – eine fest entschlossene Kämpferin für die Frauenrechte und das Mädchen selbst ist bedauerlicherweise sehr undamenhaft geraten, wie es scheint.«
»Durchaus. Wie bedauerlich.« Ich linste unter meinem Schopf falscher Stirnfransen hervor, klimperte mit meinen falschen Wimpern und verzog die bemalten Lippen zu einem Lächeln. Ich hatte sogar im ganzen Gesicht ein klein wenig einer unerhörten Substanz namens Rouge aufgetragen, um meiner aristokratischen Blässe zu einem herzlicheren, gewöhnlicheren Rosa zu verhelfen. »Könnten Sie Dr. Ragostin wohl eine Fotografie von dem Mädchen zur Verfügung stellen?«
»Nein. Auch nicht von der Frau. Offenbar haben beide Fotografen gemieden.«
»Wie das?«
Er seufzte und zum ersten Mal wurde sein Ausdruck weniger freundlich. »Das war Teil ihrer Entscheidung, entgegen der weiblichen Natur zu handeln, wie ich vermute.«
»Könnten Sie mir bitte ihre Namen nennen und beide beschreiben?«
Er buchstabierte für mich: Lady Eudoria Vernet Holmes, Miss Enola Holmes. (Mum hatte Voraussicht bewiesen, als sie mich Enola nannte, das rückwärts »alone«, also »allein« bedeutet.)
Dr. Watson sagte: »Soweit man mir berichtet hat, ist das Mädchen die Auffälligere von beiden. Recht groß und dünn …«
Ich hatte mir Mühe gegeben, an Gewicht zuzulegen, was dank der Fischkopfsuppen und Schafskopfeintöpfe, die meine geizige Hauswirtin auf den Tisch brachte, allerdings ohne Erfolg geblieben war.
»… mit einem lang gezogenen Gesicht, einer betonten … nun … man muss wohl eher sagen, mit einer Nase und einem Kinn, die einem Cicero alle Ehre machen würden …«
Welch taktvolle Art zu sagen, dass ich meinem Bruder Sherlock viel zu ähnlich sehe. Da es mir noch nicht gelungen war, pummelig zu werden, trug ich in jeder Wange ein Gummipolster, das eigentlich dazu gedacht war, einen ganz anderen, unaussprechlichen Körperteil aufzufüllen. Kombiniert mit Einlagen für die Nasenlöcher, veränderten sie meine Gesichtszüge vollkommen.
»… und von kantiger Statur, die femininen Charme vermissen lässt«, fuhr Dr. Watson fort. »Sie hat eine Vorliebe für maskuline Kleidung und burschikose Aktivitäten bewiesen, hat einen weit ausholenden, maskulinen Schritt und könnte für die gute Gesellschaft völlig verloren sein, wird sie nicht bald gefunden.«
»Und die Mutter?«, fragte ich, um das Thema zu wechseln und einen Lachanfall zu vermeiden.
»Vierundsechzig Jahre alt, erscheint jedoch beträchtlich jünger. Physisch unauffällig, hat aber ein störrisches Temperament und ist sehr eigensinnig. Eine talentierte Künstlerin, wie ich höre, die ihre Energie leider darauf verschwendet, für diese sogenannten Frauenrechte zu kämpfen.«
»Oh. Sie möchte Hosen tragen?«
Er lächelte über meine scheinbare Abneigung für derartige Reformanstrengungen. »Sehr wahrscheinlich. Sie bevorzugt sogenannte vernünftige Kleidung.«
»Und gibt es irgendwelche Hinweise, wo man sie finden könnte?«
»Keine. Doch wie gesagt, das Mädchen hält sich vermutlich in London auf.«
Ich legte meinen Stift ab und sah ihn an. »Nun gut, Dr. Watson, ich werde Dr. Ragostin mit allen Details versorgen. Aber ich muss Sie vorwarnen, dass er den Fall vermutlich nicht übernehmen wird.« Mein allererster Fall, eine Zwickmühle: mich selbst finden? Ich konnte ihn unmöglich annehmen.
»Aber warum in aller Welt?«
Die Antwort hatte ich mir bereits überlegt. »Weil er sich nicht mit Vermittlern abgibt. Er wird fragen, warum Mr Sherlock Holmes nicht selbst gekommen ist –«
Dr. Watson unterbrach mich einigermaßen erhitzt, obwohl sein Unmut nicht mir galt. »Weil Holmes viel zu zurückhaltend ist, zu stolz. Wenn er nicht einmal mir den Grund für seinen Kummer verrät, glauben Sie, er würde sich einem Fremden anvertrauen?«
»Aber es wäre ja ein Kollege, ebenfalls ein Ermittler«, warf ich sanft ein.
»Noch schlimmer. Holmes würde sich erniedrigt fühlen in Gegenwart von –« Recht abrupt hielt Dr. Watson inne und fragte dann: »Wo wir dabei sind – man muss sich durchaus fragen: Wer ist Dr. Ragostin eigentlich? Ich bitte Sie vielmals um Verzeihung, Miss, ähm …«
»Meshle.« Man nehme den Namen Holmes, vertausche die Silben – Mes hol – und buchstabiere ihn, wie man ihn spricht: Meshle. Lächerlich einfach. Dennoch würde er nie darauf kommen. Keiner würde das.
»Miss Meshle. Ich will wirklich niemanden beleidigen, doch ich habe Nachforschungen angestellt, und niemand hat je von Dr. Ragostin gehört. Ich bin nur hergekommen, weil er behauptet, sich darauf spezialisiert zu haben, vermisste Personen zu finden.«
»Alles, was verloren gegangen ist«, warf ich ein.
»Doch ich habe niemanden gefunden, der für ihn bürgen könnte.«
»Weil er am Beginn seiner Karriere steht, ebenso wie einst Ihr Freund Holmes. Dr. Ragostin muss sich erst noch einen Namen machen. Doch es dürfte Sie interessieren, dass er die Methoden von Mr Sherlock Holmes mit großem Interesse studiert.«
»Tatsächlich?« Dr. Watson wirkte beschwichtigt.
»Oh ja. Mr Holmes ist für ihn ein Idol und es wird ihn überaus überraschen, dass sein Held seine verschollene Mutter und Schwester bisher nicht hat aufspüren können.«
Als wäre ihm sein Sessel mit einem Mal unbequem geworden, rutschte Dr. Watson an den vorderen Rand und räusperte sich. »Vermutlich«, sagte er langsam, »liegt es daran, dass Holmes sich für derartige Fälle normalerweise nicht interessiert. Er findet sie gewöhnlich und langweilig, sodass er sich im Allgemeinen nicht darum kümmert. Himmel, erst gestern«, ergänzte Watson, »als ich Holmes aufsuchte, kamen mir Sir Eustace Alistair und Lady Alistair entgegen, die ihn angefleht hatten, sich auf die Suche nach ihrer Tochter zu machen. Doch er hat ihnen eine Abfuhr erteilt.«
Ich wurde hellhörig. »Sir Eustace Alistair? Seine Tochter ist verschwunden? Davon habe ich noch gar nichts in den Zeitungen gelesen …«
Watson legte einen Finger auf die Lippen und hustete. »Man hat es unter den Teppich gekehrt, um einen Skandal zu vermeiden.«
Dann fürchteten sie also, das Mädchen könnte mit einem Mann durchgebrannt sein.
Ich musste mir diese Angelegenheit vornehmen. Dr. Watson würde mir nicht mehr darüber erzählen, das sah ich ihm an – er überlegte bereits, ob er nicht schon zu viel preisgegeben hatte. Dennoch hatte er mir somit doch meinen ersten Fall direkt vor die Nase serviert. Ich würde die verlorene Tochter des Baronet finden.
Nicht sonderlich erfreut stand Watson auf. Die Unterredung war zu Ende. Ich griff nach der Glockenstrippe und läutete nach Joddy, damit er unseren Gast nach draußen begleitete.
»Ich würde Dr. Ragostin gern noch einmal persönlich sehen«, sagte Dr. Watson noch, »bevor er etwas unternimmt.«
»Selbstverständlich. Geben Sie mir noch Ihre Adresse? Dr. Ragostin wird sich bei Ihnen melden, sobald er meine Notizen durchgegangen ist«, schwindelte ich.
Nachdem ich die Adresse aufgeschrieben hatte, erhob ich mich, um Dr. Watson zur Tür zu bringen.
Als er fort war, setzte ich mich in den nun freien Sessel ans Feuer und fing paradoxerweise an zu frösteln.
2. Kapitel
Ich fröstelte vor Angst.
Angst vor meinem Bruder Sherlock, den ich anhimmelte.
Er war mein Held. Und er war mein Verderben. Es fehlte nicht viel zu behaupten, dass ich ihn vergötterte. Doch sollte er mich finden, würde ich meine Freiheit für immer verlieren.
Trotzdem … er war meinetwegen verzweifelt?
Ich konnte mir nicht länger einreden, ich hätte einzig und allein seinen Stolz verletzt.