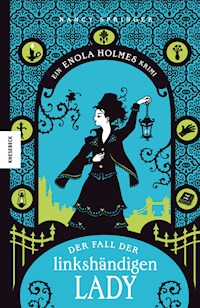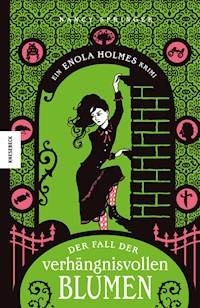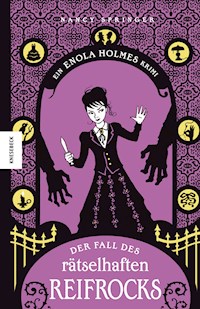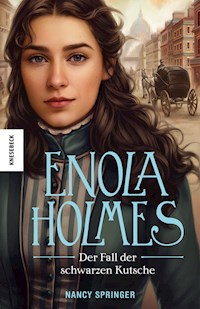
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Enola Holmes
- Sprache: Deutsch
Als die junge, Letitia Glover auf Sherlock Holmes Türschwelle auftaucht, um mehr über das Schicksal ihrer verschollenen Zwillingsschwester zu erfahren, nimmt sich Enola dieses Falls an. Es scheint, dass Letitias Schwester, Felicity Glover, den Earl of Dunhench geheiratet hat und laut einer knappen Notiz desselbigen verstorben sei. Aber Letitia ist überzeugt, dass das nicht die Wahrheit sein kann. Enola lässt das Schicksal der jungen Frau nicht kalt und sie begibt sich undercover auf die Spuren der vermeintlich Toten, denn die Notiz des Earls ist verdächtig vage und die Sterbeurkunde wirft noch mehr Fragen auf. Sie findet bald heraus, dass dies nicht die erste Frau des Earls ist, die plötzlich und aufgrund mysteriöser Umstände verstirbt. Enola steht vor ihrem bisher vielleicht düstersten Fall. Wird sie ihn mithilfe von Sherlock aufklären können? Der Film Enola Holmes mit Millie Bobby Brown, Henry Cavill und Helena Bonham Carter war 2020 einer der erfolgreichsten Filme auf Netflix!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für Teanna Byerts, langjährige Freundin
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Prolog
von Sherlock Holmes, 1889
Denjenigen von Ihnen, die meine bedeutende Karriere als welterster privater beratender Detektiv verfolgen, kann kaum entgangen sein, auf welch sensationelle Art und Weise eine andere Holmes von ähnlichem Schlag vor Kurzem auf der Bildfläche Londons erschienen ist: meine wesentlich jüngere Schwester Enola. Viele finden ihr unverschämt unverhohlenes Auftreten in der Öffentlichkeit sowohl skandalös als auch beklagenswert. Nicht wenige mutmaßen über ein Versagen meinerseits, sie unter Kontrolle zu halten. Daher ergreife ich gern die Gelegenheit, meinen eigenen, ganz logischen und rationalen Bericht über meine Beziehung zu Enola Eudoria Hadassah Holmes zu Papier zu bringen.
Um mich gleich zu Beginn von jeglichem Verdacht auf Gefühlsduselei freizusprechen, will ich anmerken, dass ich keinerlei Kindheitserinnerungen an meine Schwester Enola habe. Tatsächlich habe ich sie bis zum Juli 1888 kaum gekannt. Als sie 1874 geboren wurde, war ich gerade im Begriff, mein Geburtshaus zu verlassen, um ein eigenständiges Leben zu beginnen und meinen Studien nachzugehen. Die höchst unangenehme Wirrnis, die gemeinsam mit ihr als Säugling in unserem Haushalt Einzug hielt, veranlasste mich dazu, das Haus umso eiliger zu verlassen. In den folgenden Jahren begegnete ich ihr nur gelegentlich und ausschließlich mit der natürlichen Abneigung eines Gentlemans gegenüber einem unordentlichen und unausgereiften menschlichen Exemplar. Als unser Vater begraben wurde, war sie vier Jahre alt und noch immer unfähig, für die Sauberkeit ihrer Nase Sorge zu tragen. Ich kann mich nicht daran erinnern, mit ihr zu jener Zeit ein einziges vernünftiges Gespräch geführt zu haben.
Zehn Jahre sollten vergehen, bis ich sie das nächste Mal sah, im Juli 1888.
Und es war kein gewöhnlicher Anlass. Das unerwartete und unerklärte Verschwinden ihrer Mutter – unserer Mutter – veranlasste die junge Enola dazu, meinen Bruder Mycroft und mich selbst aus London zu sich zu rufen. Als unser Zug in unser ländliches Ziel einfuhr, erwartete Enola uns am Bahnsteig und erinnerte an einen jungen Storch. Bemerkenswert hochgewachsen für ein vierzehnjähriges Mädchen, trug sie ein Kleid, das ihre knochigen Waden nicht hinreichend verdeckte, zudem weder Handschuhe noch einen Hut. Vielmehr hatte der Wind ihre Haare in ein Krähennest verwandelt. Mycroft und ich hielten sie für ein Straßenkind und erkannten sie erst, als sie uns ansprach: »Mr Holmes und, ähm, Mr Holmes?« Wie ein Grünschnabel ohne jegliche Manieren benahm sie sich und reagierte auf Mycrofts Fragen reichlich verwirrt. In der Tat, als wir nach einer gemeinsamen Fahrt Ferndell Hall, unser Familienanwesen, erreichten, hielt ich meine Schwester für womöglich noch hirnloser als die üblichen Vertreterinnen ihres Geschlechts.
Sobald wir vor Ort waren, schlussfolgerten Mycroft und ich, dass unsere Mutter nicht entführt, sondern, ganz die Frauenrechtlerin, die sie nun einmal war, fortgelaufen war. Allzu sehr bekümmerte uns dies nicht, da Mutter ihren reproduktiven Zweck bereits erfüllt hatte und in ihrem Alter sowohl nutzlos als auch unverbesserlich war. Anders als womöglich Enola. Etwas musste geschehen, daher beschlossen wir zu versuchen, sie zu retten. Wir ignorierten ihren unsinnigen Protest und trafen Absprachen, um sie in ein hervorragendes Internat zu geben, in der Hoffnung, sie schließlich verheiraten zu können.
Als Mycroft und ich später dann nach London zurückkehrten, waren wir davon überzeugt, unsere Pflicht erfüllt zu haben.
Allerdings traf unsere Schwester nie im besagten Internat ein. Während der Reise bewerkstelligte sie es, sich in Luft aufzulösen.
Wie konnte sie es wagen? Welch Undankbarkeit!
Die folgenden Tage über setzte ich, Sherlock Holmes, größter Detektiv der Welt, alles daran, ein dummes Mädchen aufzuspüren, das von zu Hause fortgelaufen war, vermutlich als Junge verkleidet. Doch nicht die geringste Spur konnte ich ausfindig machen. Sehr zu meinem Missfallen war es ausgerechnet Inspektor Lestrade von Scotland Yard, der mir schließlich Neuigkeiten von Enola brachte.
Sie verkleidete sich als Witwe.
Eine Witwe! Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass ich sie unterschätzt hatte. Zumindest ein Mindestmaß an Verstand hatte sie: Als trauernde Witwe konnte sie ihr Gesicht vollkommen verbergen, mindestens ein Jahrzehnt älter erscheinen und zudem gänzlich vermeiden, angesprochen zu werden.
Allerdings war sie im Trauergewand einer Witwe auch auffällig. Ich verfolgte ihre Spur bis nach London, wenngleich ich es kaum glauben konnte, dass sie die Dreistigkeit besaß, sich dorthin zu wagen – und bei Scotland Yard machte ich die Bekanntschaft eines jungen Aristokraten, der von einem Mädchen in Verkleidung einer Witwe aus den Händen von Entführern gerettet worden war! Jedoch informierte mich der Junge darüber, dass sie inzwischen als alte Jungfer mit einer Zwickelbrille verkleidet war.
Ich verdoppelte meine Anstrengungen, sie zu finden und vor den Gefahren Londons zu bewahren. Leider verfügte ich nicht über ein Porträt, das ich hätte herumzeigen können. Nie hatte man sie fotografiert. Dafür besaß ich ein höchst interessantes und aufschlussreiches Büchlein über Chiffren, das unsere Mutter ihr geschenkt hatte. Nachdem ich auf diesem Weg herausgefunden hatte, dass die beiden eine geheime Korrespondenz mittels der Kleinanzeigen in der Pall Mall Gazette pflegten, gab ich darin selbst eine Annonce auf, in der ich mich als Mutter ausgab und Enola um ein Treffen bat. Doch irgendwie hatte sie meine List durchschaut. Während ich am Britischen Museum auf sie wartete, um mich auf sie zu stürzen, drang sie in meine Wohnung ein und holte sich das Büchlein zurück! Als meine Vermieterin mir mitteilte, dass sie ihr wie eine arme Hausiererin erschienen war, die in der herbstlichen Kühle nur so zitterte, begriff ich, dass ich unterwegs sogar an ihr vorbeigelaufen war!
Nun machte ich mir umso mehr Sorgen um Enola, da ich fürchtete, sie könnte in der Tat mittellos sein. Also konzentrierte ich mich bei meiner Suche auf die Armenviertel, wo ich eines Nachts im Winter auf die »Schwester der Straße« traf – eine stumme Nonne in einem schwarzen Habit, die sich um die Ärmsten der Armen kümmerte. Sie schenkte mir einen Keks! Kurz darauf drückte mir dieselbe Nonne eine halb ohnmächtige Dame in die Arme und teilte mir kurz angebunden die Identität des Schurken mit, der dieser Lady Leid angetan hatte. Als ich die Stimme der »stummen« Nonne erkannte, musste ich mir entsetzt eingestehen, dass diese Schwester meine Schwester war! Ich versuchte, sie festzuhalten, doch sie wehrte mich mit einem Dolch ab und verschwand in die Nacht. Sämtliche Polizisten Londons konnten sie nicht aufspüren. Als ich mich am Morgen geschlagen gab und in meine Wohnung zurückkehrte, fand ich dort den Habit! Diese Frechheit, diese Unverschämtheit, wie sie es nur hatte wagen können, sich in meinen eigenen vier Wänden zu verbergen, während ich die Stadt nach ihr absuchte!
Übrigens hatte sie einen mörderischen Bösewicht recht übel zugerichtet mit ihrem Dolch, um die Lady zu retten. Offensichtlich war meine Schwester Enola durchaus in der Lage, auf sich achtzugeben. Doch vermaledeites Gör! Man konnte doch nicht zulassen, dass sie auf den Straßen Londons verwilderte. Ich musste sie einfach retten. Und dennoch, trotz meiner besten Bemühungen wurde der Winter vom Frühling abgelöst, ohne dass ich meinem Ziel auch nur einen Schritt näher gekommen wäre.
Dann erforderte das unerklärliche Verschwinden meines lieben Freundes, Dr. Watson, all meine Aufmerksamkeit. Eine ganze Woche verging, in der ich weder schlief noch aß – ebenso wenig wie mein Bruder Mycroft. Dennoch konnten wir Watson nicht finden. Tatsächlich waren es am Ende nicht wir, die ihn retteten, sondern unsere Schwester! Eine Botschaft in den Zeitungen führte uns geradewegs zu ihm, der in einem Irrenhaus gefangen gehalten wurde, und diese Botschaft war unterzeichnet mit E. H. – Enola Holmes.
Ich war überaus beschämt und konnte mir nicht erklären, wie sie diese Leistung vollbracht hatte.
Genauso wenig hatte ich eine Ahnung davon, wo in London sie wohnte oder wie sie über die Runden kam. Doch, verehrter Leser, verehrte Leserin, ich darf Sie an die Lady erinnern, die sie in meinen Armen zurückgelassen hatte. Kurz nach Watsons Rückkehr sollte ebendiese Lady Opfer einer Zwangsheirat werden und ich wurde beauftragt, den perfiden Plan zu vereiteln. Zu diesem Zweck stattete ich der Villa, in der man sie meinen Ermittlungen nach gefangen hielt, einen heimlichen, nächtlichen Besuch ab. Ganz in Schwarz gekleidet und mit dunkel bemaltem Gesicht schlich ich mich in den Garten – wo ich geradewegs in einen Abgrund zu stürzen schien! Er entpuppte sich als ein recht tiefer Graben, auf dessen Boden ich mir beim Aufprall den Knöchel schwer verletzte.
Und meinen Stolz. Man rechnet nicht damit, mitten im Herzen der Großstadt auf einen »abgesenkten Zaun« zu stoßen. Und doch war ich in einem gefangen – unfähig, auch nur den Versuch zu wagen, wieder herauszuklettern. Mein Knöchel war bereits so dick angeschwollen, dass ich auf meinem unbequemen steinernen Sitzplatz mein Taschenmesser zu Hilfe nehmen musste, um meine Schnürsenkel aufzuschneiden und den Stiefel auszuziehen. Da sich dies in der vollkommenen Dunkelheit als Herausforderung erwies, fluchte ich leise vor mich hin.
Prompt schalt mich eine unverwechselbare Mädchenstimme spöttisch: »Schäm dich!«
Mir blieb der Mund offen stehen, ich gebe es zu. So groß war mein Schrecken, dass es mir für einen Augenblick sogar die Sprache verschlug, bevor ich hervorpressen konnte: »Enola?«
Ja, sie war es, die mir nun Brandy und einen Verband herabwarf, bevor sie auf einen unmöglich steilen Baum kletterte – mit einem Seil zwischen den Zähnen. Nachdem sie es befestigt hatte, schwang sie sich wie ein zu groß geratener Affe auf die andere Seite des Grabens, in dem ich noch immer festsaß, und kam dort sicher auf. Ich rechnete damit, sie würde mir das Seil reichen, damit ich mich aus meiner misslichen Lage befreien konnte, aber nein. Tolldreist machte sie sich auf, die gefangene Lady auf eigene Faust zu retten. Vielleicht würde ich heute noch in dieser Grube hocken, wäre nicht der Herr des Hauses aufgetaucht und hätte mit einem Gewehr auf uns geschossen! Im folgenden Verlauf half Enola mir aus dem Graben, den Zaun hinauf, auf der anderen Seite wieder hinab und stützte mich während unserer Flucht, da mein verletzter Fuß mich derart hilflos machte, dass ich mich an ihre Schulter klammern musste, um überhaupt humpeln zu können. Ich bin sicher, mein Bruder Mycroft wird mir nie vergeben oder verstehen, dass ich mich dazu verpflichtet fühlte, sie ziehen zu lassen, sobald wir in Sicherheit waren. Doch Dankbarkeit und auch meine Ehre ließen nichts anderes zu. Wir gaben uns die Hand, meine Schwester und ich, bevor sie wie ein wildes Pony mit wehenden Haaren scheute und floh. Erleichtert stellte ich fest, dass sie immerhin einen Rock trug und keine Hose.
Nur zwei Tage später vertraute sie mir die bemitleidenswerte Lady an, die sie vor der Zwangsverheiratung bewahrt hatte. Anschließend hat meine Schwester sich nicht mehr blicken lassen, bis ich einen Monat später zufällig im Hause von Florence Nightingale auf sie traf. Enola trug eine Brille, einen burschikosen Hut, Handschuhe voller Tintenflecke und ein dunkles, schmal geschnittenes Kleid, um sich als Studierende auszugeben, doch endlich wurde ich meinem Ruf gerecht und erkannte sie auf der Stelle. Sie ergriff die Flucht. Ich jagte sie tatsächlich bis ins oberste Geschoss des Hauses, wo sie prompt durchs Fenster und eine mächtige Eiche hinab entkam, bevor sie wie ein Hase davonwetzte.
Zu gleichen Teilen von Wut und Bewunderung ergriffen, machte ich mich daran, den Auftrag auszuführen, den ich von Miss Nightingale erhalten hatte: eine vermisste Frau namens Tupper zu finden. Ich stellte Nachforschungen an und verkleidete mich in der folgenden Nacht als armer, gebrechlicher alter Graubart, als der ich mich in der Nähe eines gewissen prächtigen Hauses herumtrieb – dem Anschein nach in der Gosse nach Kleingeld fischend. Durchaus verblüfft war ich, als eine schlicht gekleidete, doch offenbar aristokratische Lady vor mir die Straße überquerte, den Weg zum Haus beschritt und energisch an die Tür klopfte. Es war Enola! Ich konnte sie nicht davon abhalten, diesen gefährlichen Ort zu betreten, daher schickte ich mich an, sie durch die Fenster zu beobachten. So groß war meine Sorge um ihre Sicherheit, dass ich sogar an der Hauswand hinaufkletterte, als man sie ins Obergeschoss brachte. Während ich mich an Weinranken klammerte und die Nase gegen die Scheibe des Fensters drückte, sah sie mich geradezu frech an und zwinkerte mir zu! Ich war so perplex, dass ich um ein Haar den Halt verloren hätte. Danach, wie es mittlerweile zur beklagenswerten Gewohnheit geworden war, überlistete sie mich. Während ich an der Haustür damit beschäftigt war, einen Bösewicht mit Jiu-Jitsu zu bekämpfen, verschwand Enola durch die Hintertür – selbstverständlich in Begleitung der Dame Tupper, die sie im Hause Nightingale in Sicherheit brachte.
Am folgenden Tag entnahm ich den Bruchstücken einer lautstarken Unterhaltung durch ein Hörrohr, dass die bemitleidenswerte, taube und uralte Mrs Tupper Enolas Vermieterin war. Dies erregte meine Geister einigermaßen, rechnete ich doch damit, dass Enola sie in der Nightingale-Residenz aufsuchen könnte. Von da an lauerte ich ihr verstohlen auf, begleitet von einem Gefährten namens Reginald. Dutzende von Menschen verkehrten täglich in dem Nightingale-Anwesen, und während ich nach meiner schlichten Schwester Ausschau hielt, schenkte ich einer überaus hübschen Dame in einem ausgefallen aufwendigen himmelblauen Kleid aus dreierlei Stoffen keinerlei Aufmerksamkeit – nur Reginald, der Collie, der jahrelang das Haustier meiner Schwester gewesen war, begann zu winseln und an seiner Leine zu zerren! Ich ließ ihn laufen, woraufhin er zu ihr sprang. Kaum wagte ich es zu glauben, als die »Lady« den Hund unter Tränen und Gelächter begrüßte und sich höchst unstatthaft auf den Boden setzte, um die Arme um ihn zu schlingen! Als sie bemerkte, dass ich auf sie herabblickte, lächelte sie mich an und griff freiwillig nach meiner Hand, um sich zu erheben. Ich glaube, sie spürte, dass ich im übertragenen Sinn der Redewendung eben nicht länger »auf sie herabblickte«.
So also waren wir wieder vereint. Wenn auch nicht ohne Komplikationen – noch am selben Tag entwischte sie mir erneut. Doch wir blieben in Kontakt und nur einige Tage später arrangierte ich es, sie in ihrer elegantesten Verkleidung in dieselbe Kutsche wie meinen Bruder Mycroft zu setzen. Nachdem er einen Abend mit seiner verblüffenden Schwester verbracht und ihr dabei geholfen hatte, im Labyrinth von Londons Hafenanlagen eine vermisste Herzogin aufzuspüren, kam Mycroft in etwa zum selben Schluss wie ich:
Enola hatte keinen Schutz nötig.
Enola hatte kein Internat nötig.
Ebenso wenig hatte Enola es nötig, verheiratet zu werden. In der Tat, der Himmel stehe dem Mann bei, der so leichtsinnig sein möge, sie zur Frau zu nehmen!
An nächsten Tag, Enolas fünfzehntem Geburtstag, nahmen wir zu dritt in meiner Wohnung Tee und Kuchen ein. Aus einem Brief, den wir kürzlich erhalten hatten, erfuhren wir, warum unsere Mutter fortgelaufen war: Ihre Tage waren gezählt gewesen. Was ihr davon geblieben war, hatte sie befreit von den Zwängen der Gesellschaft verbracht, inzwischen war sie jedoch verstorben. Enola vergoss einige Tränen, lachte aber auch viel – ihre Mutter war tot, dafür hatte sie ihre Brüder für sich gewonnen. Mycroft hatte seinen Frieden mit ihr geschlossen und mir war sie ans Herz gewachsen. Alles war gut.
Zumindest dachte ich dies in meiner Genugtuung, vollkommen blind und unfähig vorherzusehen, dass sie ihre auffällige Nase in einen meiner Fälle stecken würde …
Kapitel 1
Nachdem ich mich mit meinen Brüdern im Sommer des Jahres 1889 ausgesöhnt hatte, verbrachte ich den August glückselig mit Collie Reginald bei einem Besuch auf Ferndell, dem Heim meiner Kindheit auf dem Lande. Noch dazu kaufte ich mir nach meiner Rückkehr nach London in mein sicheres, wenn auch etwas spartanisches Zimmer im Club für Arbeitende Frauen ein entzückendes neues Kleid: aprikotfarbene Seide mit dezent gepufften Schultern und einem schmalen Bahnenrock, worin ich wie nichts anderes erschien als mein schlankes Selbst! Denn endlich, und zum großen Glück, geriet die »Wespentaille« aus der Mode – genau zu dem Zeitpunkt, als ich keine Büstenschmeichler und Hüftregulatoren mehr nötig hatte, um mich vor Sherlock und Mycroft zu maskieren! Ungeduldig freute ich mich schon darauf, sie als die wirklich wahre Enola Holmes wiederzusehen.
Doch aus Tagen wurde eine ganze Woche, schließlich ein ganzer Monat. Der August wich dem September, und noch immer hörte ich nichts von ihnen.
Ich blies Trübsal. Wieder einmal war ich viel zu einsam, wie es mein Schicksal zu sein scheint – selbst mein Name, Enola, bedeutet rückwärts gelesen nämlich »alone«: das englische Wort für »allein«. Ich wollte einen neuen Hut kaufen, der zu der aprikotfarbenen Seide passte, doch selbst die Aussicht auf eine so freudige Erledigung konnte mich nicht aus meiner Lethargie reißen. So kam es, dass ich eines sonnigen Nachmittags, als ich einen Bummel durch die Läden hätte machen können, schmollend im Salon meines Clubs saß, als ein Dienstmädchen mir auf einem Messingtablett eine Botschaft überbrachte.
»Der Gentleman lässt ausrichten, dass er auf Ihre Antwort wartet, Miss.«
Männern, verehrter Leser, war es nämlich nicht gestattet, die Tür zum Club für Arbeitende Frauen zu passieren.
Noch nie hatte ich Besuch von einem Gentleman erhalten, daher musste die Nachricht von einem meiner Brüder stammen, nahezu mit Sicherheit von Sherlock, da Mycroft kaum dazu angeregt werden konnte, seinen gewohnten Orbit zu verlassen, der seine Wohnung im Pall-Mall-Gebäude, sein Regierungsbüro in Whitehall und den Diogenes Club einschloss. Daher machte mein Herz einen erfreuten Sprung, als ich nach der Nachricht griff, die auf ein Blatt feinen Papiers geschrieben war, und sie auffaltete, um sie zu lesen. Mein erster Blick jedoch galt der Unterschrift.
Mist.
Sie war nur von Dr. Watson.
Er schrieb:
Liebe Miss Enola,
Ihr Bruder Sherlock würde lautstark protestieren, wüsste er, dass ich auf diese Art an Sie herantrete, da bin ich gewiss. Doch sowohl als sein Freund als auch als sein medizinischer Berater fühle ich mich dazu verpflichtet, Sie von seinem alarmierenden Zustand zu unterrichten. Womöglich wissen Sie nichts von seinem Hang zu Anfällen von Melancholie. Und zweifellos wird er mich heftig dafür tadeln, mich einzumischen. Dennoch muss ich Sie bitten, mit mir zu kommen und ihn aufzusuchen, in der Hoffnung, dass Ihre Anwesenheit einen guten Einfluss auf ihn haben wird. Ich erwarte Ihre Antwort.
Ihr ergebener
Diener Dr. John Watson
Aufs Neue führte mein Herz seine Turnübungen durch. Sherlock in alarmierendem Zustand? Was um alles in der Welt konnte Watson damit nur meinen?
Ich musste sofort zu ihm.
Noch während ich aufsprang, wies ich das Dienstmädchen an: »Richten Sie dem Gentleman aus, dass ich sofort bei ihm bin!« Schon rannte ich in mein Zimmer, um meine neuesten Stiefel anzuziehen. Ich trug Seidenpantoffel, die lediglich für drinnen geeignet waren, auf der Straße wären sie im Nu zerfetzt. Außerdem brauchte ich ein passendes Paar ordentlicher Handschuhe, musste mein unmögliches Haar bändigen, bevor ich einen Hut darauf setzen konnte, und mir einen Sonnenschirm schnappen. Eine modische Dame verlässt das Haus nie ohne Sonnenschirm, Fächer oder zumindest ein Taschentuch – eben etwas Hübsches, das sich in der Hand tragen lässt. Und gewiss hat der geneigte Leser bereits bemerkt, dass ich inzwischen Gefallen daran gefunden hatte, als modische junge Dame der Gesellschaft aufzutreten.
So sehr, dass es mir in den Sinn kam, noch in ein anderes Kleid zu schlüpfen, doch ich unterdrückte diese Idee. Anstatt Dr. Watson länger als unbedingt nötig auf dem sonnigen Gehweg warten zu lassen, versicherte ich mir, dass mein Kleid aus Taft und gepunkteter Baumwolle mehr als schick genug war.
Als ich aus dem Haupteingang des Clubs für Arbeitende Frauen eilte, wartete der gute Doktor mit einer halb offenen Kutsche auf mich. Begleitet von einigen Grußfloskeln half er mir beim Einsteigen, bevor er sich selbst neben mich setzte und den Kutscher bat, uns in die Baker Street zu fahren.
Selbstverständlich musste ich ihm die üblichen Fragen stellen: War Dr. Watson wohlauf? Und seine Gattin? Ich mochte Dr. Watson wirklich sehr und hoffte, er würde meine Zuneigung in meinem liebevollen Tonfall wahrnehmen. Hätte ich ihn weniger gern gemocht, hätte ich dieses höfliche Geplänkel höchst unhöflich übergangen, denn ich wollte wirklich dringend mehr darüber erfahren, was meinem Bruder fehlte.
»Und Sherlock? Etwas veranlasst Sie zur Sorge, Doktor?«
Der gute Doktor seufzte, während in seine ehrlichen braunen Augen ein Ausdruck von Unbehagen trat. »Die vergangenen zehn Tage hat Holmes ohne Unterbrechung damit zugebracht, seine bemerkenswerten Fähigkeiten einem Fall zu widmen, in dem es um geheime, der Royal Navy entwendete Dokumente, das Schiffsunglück der Prinzessin Alice und eine seltene malaysische Spinnenart ging. Rund um die Uhr hat er ohne jede Pause gearbeitet und sich das Äußerste abverlangt. Und nun, da er die Angelegenheit aufgeklärt hat, ist er in eine überaus tiefe Depression verfallen. Zur Stunde des Triumphs, während der die Führer unserer Nation ihn im Parlament loben, weigert er sich, seine Wohnung zu verlassen oder auch nur etwas zu essen. Heute Vormittag kostete es mich all meine Überredungskünste, ihn überhaupt aus dem Bett zu bewegen.« Dr. Watson, der bisher mit dem Boden unserer Kutsche geredet hatte, hob seinen festen Blick und machte keine Anstalten, seine Besorgnis zu verbergen. »Ich hielt ihn dazu an, sich zu rasieren und anzukleiden, als leidlichen ersten Schritt, ihn in Richtung Genesung anzutreiben, doch ohne Erfolg. Ohne ein Wort wies er mich ab. Er drehte den Kopf zur Seite und ignorierte mich.«
In der Baker Street 221 hielt die Kutsche an. Doch nachdem wir ausgestiegen waren und unser Gefährt von dannen gerattert war, verharrte ich auf dem Gehsteig und sagte zu Dr. Watson: »Ich gehe erst, wenn ich verstanden habe, was ich eigentlich tun soll.«
»Melancholie ist Ihnen nicht vertraut?«
»So würde ich das nicht sagen.« Ich bemühte mich um ein Lächeln, schnitt stattdessen jedoch eine Grimasse. »Ich habe selbst hin und wieder solch dunkle Anfälle. Vermutlich liegt es in der Familie. Mir scheint diese Stimmung in Trübsinn verwurzelt zu sein, und ich finde, ein netter Wutausbruch, ein Anflug klärender Wut, könnte vielleicht das beste Mittel sein, sie zu kurieren. Geben Sie mir recht?«
Watson schien von meinen Ansichten etwas überrascht zu sein, doch er antwortete überzeugt: »Jede Art von Veränderung und Gemütsregung würde ich als Verbesserung ansehen.«
»Dann, mein lieber Doktor, glaube ich, Sie sollten sich wieder Ihrem Alltag widmen. Ich bin überzeugt, allein habe ich bei Sherlock bessere Karten.«
Mrs Hudson, Sherlocks liebenswerte, leidgeprüfte Vermieterin, zwinkerte und lächelte mir zu, als sie mir seine Tür aufschloss.
Einmal in der Wohnung, fand ich mich konfrontiert mit Melancholie in Form von Dunkelheit. Die Vorhänge der Fenster waren zugezogen und die Lampen nicht entzündet, sodass Sherlocks Wohnzimmer wie der trübe Fluss in die Unterwelt wirkte. Alles war düster, daher konnte ich nur mit Mühe erkennen, dass er auf seinem Sofa lungerte – zumindest bemerkte ich dort den Umriss einer langen, reglosen Gestalt.
»Du meine Güte, wie düster wir heute aufgelegt sind!«, schimpfte ich, während ich durchs Zimmer lief, um schwungvoll die Vorhänge zu öffnen. Tageslicht strömte herein und ich drehte mich um, um meinen Bruder erneut zu betrachten. In einem mausgrauen Morgenmantel lag Sherlock ausgestreckt auf dem Sofa, die Beine übereinandergeschlagen – wobei mir seine nackten, knochigen Knöchel seltsam verletzlich erschienen, obwohl er Pantoffel an den Füßen trug. Auf dem Boden neben ihm lag ein Stapel Zeitungen, die ihm gewiss der treue Watson zur Zerstreuung bereitgelegt hatte. Jedoch sah ich gleich, dass Sherlock keine einzige davon angerührt hatte. Er lehnte in den Kissen der Armlehne seines Sofas, während seine langen Hände untätig in seinem Schoß ruhten. Obwohl er mir den Kopf zugedreht hatte, schien er mich kaum anzusehen, sondern ins Leere zu starren. Es versetzte mir einen Stich ins Herz, so sehr vermisste ich in diesem Moment den sonst so scharfen Blick in seinen Augen. Seine Haut wirkte blass, sein Gesicht war unrasiert und eingefallen.
»Mein lieber Bruder, was sitzt du hier im Dunkeln herum?«, sagte ich bevormundend und gab mir größte Mühe, ihm auf die Nerven zu fallen. »Wir haben es mit einem kritischen Fall von Schmollen zu tun, der dringend kuriert werden muss, habe ich recht? Nun, lass mich nachdenken.« Nachdem ich Handschuhe und Sonnenschirm beiseitegelegt hatte, griff ich mir von seinem Schreibtisch einen Stift und einen Block mit recht teurem Papier. Anschließend nahm ich einen Stuhl in Beschlag, stellte ihn neben das Sofa, direkt vor ihn, und nahm darauf Platz. Ich spähte in Sherlocks stoppeliges Gesicht und nickte ernst. »Wärst du im Irrenhaus, würden sie dir Chloralhydrat und Schwarze Nieswurz verabreichen, um dir den Spleen auszutreiben«, sagte ich. »Doch ich schätze, wir könnten es zunächst mit einer Entschlackungskur versuchen.« Ich begann, den Block in meinem Schoß zu bearbeiten, während ich leise vor mich hinmurmelte: »Laudanum, Belladonna, Antimon, allesamt hochwirksam, sofern sie nicht zu deinem sofortigen Ableben führen … Bestimmt könnte Dr. Watson dir etwas empfehlen. Wir könnten auch versuchen, die schwarze Galle einfach auszuschwitzen, Sherlock!« Ich warf einen raschen Blick zu ihm, weniger auf der Suche nach einer Reaktion als vielmehr, um ihm das fanatische Funkeln in meinen Augen zu zeigen. Inzwischen hatte ich mich nämlich von meiner Vorliebe fürs Melodramatische mitreißen lassen und spielte die Rolle einer Frau, die leidenschaftlich dazu entschlossen war, dem Leidenden um jeden Preis zu helfen, perfekt. Erneut widmete ich mich meiner boshaften Liste, die stetig länger wurde. Schweiß. Schwitzbad. Nein, komplettes Eintauchen in kaltes Wasser! »Stärkungsmittel, Schwitzkur, Eiswasser«, brabbelte ich, »oder …« Als hätte ich einen Geistesblitz gehabt, setzte ich mich kerzengerade auf. »Oder eins dieser neuen galvanisierenden Bäder! Hast du gehört, Sherlock, dabei wird man ins Wasser gesetzt und dann leiten sie Strom durch –«
Oh Freude! Er fiel mir ins Wort. »Lass mich in Ruhe, sonst galvanisiere ich dich.«
Ich strahlte seine stürmisch dreinblickenden Augen an, die sich endlich auf mich konzentrierten. »Man kann sogar schon galvanisierende Gürtel kaufen, weißt du – in einigen der moderneren Läden. Ich könnte dir einen besorgen und dann könntest du ihn tragen, bis du dich besser fühlst.«
»Verschwinde und lass mich in Ruhe, Enola!«
»Und dich wie einen Wurm fressenden Maulwurf im Dunkeln zurücklassen? Ganz gewiss nicht, lieber Bruder. Es ist meine Mission und meine Pflicht, mich um dich zu kümmern.«
»Verflucht sei deine Mission!« Er setzte sich auf, umklammerte das Sofa und – gepriesen sei der Herr – erhob die Stimme! »Musst du dich überall einmischen, Weib?!«, schrie er. »Was muss ich denn tun, um –«
»Galvanisieren!« Ich grinste ihn an. »Galvanisieren ist genau das Richtige – das musst du tun, um wieder zu genesen. Zusätzlich zu dem galvanisierenden Gürtel könnte ich dir sicherlich noch ein paar Senfpflaster organisieren. Ich habe gehört, dass bei Melancholie ein Gegenreiz manchmal –«
»Du reizt mich schon genug! Würdest du nun bitte gehen?«
Ich schlug einen sanfteren Ton an. »Erst, wenn du angezogen bist und etwas gegessen hast, mein lieber Bruder.«
Er wandte sich von mir ab. »Nein.«
»Sherlock –«
»Nein.« Er ließ sich erneut auf das Sofa sinken und redete monoton weiter. »Nein. Von mir aus kannst du deinen Kopf mitsamt dem schicken Hut in die Themse stecken. Lass mich allein.«
»Sherlock«, beschwerte ich mich, eher schmeichelnd als gereizt.
Er reagierte nicht. Als ich zu ihm linste, waren seine Augen geschlossen, damit er mich besser ignorieren konnte.
Seufzend lehnte ich mich zurück. Obwohl ich fest entschlossen war, nicht aufzugeben, hatte ich keine Ahnung, was ich nun tun sollte. Ich hatte mein Pulver verschossen und nichts zum Nachladen – abgesehen natürlich von meiner sturen Anwesenheit.
Also blieb ich einfach sitzen.
Die Zeit verstrich, während ich der Stille lauschte und vergeblich überlegte, was ich als Nächstes tun oder sagen sollte. Sherlock lag angespannt und schweigsam da, schlief aber nicht. Er schien kaum zu atmen – die Uhr, die auf seinem Kaminsims vor sich hin tickte, verursachte mehr Lärm als er. Sie und der Verkehr, der über das Kopfsteinpflaster der Baker Street rumpelte. Nach einer Weile hörte ich die Glocke der Haustür schellen und Mrs Hudsons matronenhafte Schritte, als sie sich beeilte, sie zu öffnen. Allerdings verschwendete ich keinen weiteren Gedanken daran – bis ich Mrs Hudson wenig später erneut hörte. Diesmal kam sie die Treppe herauf! Auf ihre übliche forsche Art klopfte sie an, ließ sich selbst ein und sagte zu der reglosen Gestalt auf dem Sofa: »Eine junge Dame will Sie sehen, Mr Holmes, ganz blass und zitternd. Irgendetwas bedrückt sie so sehr, dass sie vollkommen neben sich steht und kein Nein akzeptiert. Ich weiß, was Sie mir gesagt haben, Mr Holmes, aber –«
Sie verstummte, wie erstickt vom finsteren Blick, den er ihr zuwarf, als er nun doch die Augen öffnete. Dieser einzelne erdolchende Ausdruck war eine so deutliche Antwort wie jedes Wort.
»Aber ich kann sie doch nicht einfach so vor die Tür setzen«, flehte Mrs Hudson voller Kummer, der zweifelsfrei echt war.