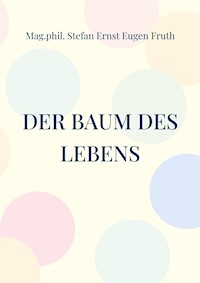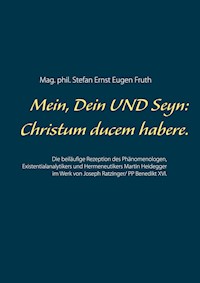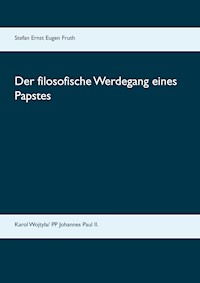
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Papst Johannes Paul II. verfasste in den 80er Jahren die "Theologie des Leibes" als Fortführung seiner zwei philosophischen Bücher "Liebe und Verantwortung" und dem Hauptwerk "Person und Tat": In ebendiesem revolutionierte er die gesamte Literatur der Filosofie unter besonderer Aufnahme des Werkes der karmelitanischen Ordensfrau Theresa Benedicta a Cruce, Edith Stein aus Breslau, ehemals Preußen (welche auch nie Ihre Vorliebe für das Humboldtsche Bildungsideal verleugnet hat). In "Person und Tat" entwickelt er eine sehr strenge Ontologie der Metaphysik, die sich aus den Strömungen der Freiburger Phänomenologie und der verloren gegangen geglaubten alten Meta-Physik speist. Die Theologie des Leibes, diese General-Audienzen also, bilden quasi den engeren Höhepunkt seines filosofischen Schaffens, dem es ja immer um die "Würde der Person" geht und das sich aus den genuinen theologischen und biblischen - besonders gruppiert um drei Jesuanische Zitate - Quellen speist. Diese Thema habe ich, Mag. phil Stefan Ernst Eugen Fruth, nach dem Abschluss meiner geisteswissenschaftlichen Studien in Innsbruck und Freiburg im Breisgau, sowie meiner Diplomarbeit "Die Zeitlichkeit des umsichtigen Besorgens und die Konzeption der Weltzeit nach M. Heidegger" im Jahre 1999 und dann nach ablaufenden Jahren als Finanz-Buchhaltungsangestellter in der Transportwirtschaft, der Erwachsenenbildung und nunmehr als diözesaner Mitarbeiter, aufgegriffen und versucht, auf 200 Seiten in ein vernünftiges Schema zu bringen; wobei zuerst der phänomenologische Zugang zentral schien, später die biblische Kernaussage sich immer mehr als die wahrhaft wesentliche und damit nicht mehr als rein filosofische, sondern eben fundamental-theologische, herausstellte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Mensch als Person in Leiblichkeit. Karol Wojtylas philosophischer Beitrag zu einer fundamentaltheologischen Anthropologie.
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort: Gnthi seautón. Mensch, Erkenne dich selbst!
Thematische Einführung.
Erster Teil: Die philosophisch-phänomenologische Anthropologie von Karol Wojtyla in besonderer Berücksichtigung seiner Rezeption der phänomenologischen Methode
0. EINLEITUNG. Eine fundamentale Diskussion der phänomenologischen Methode und die Metaphysik im philosophischen Werk von Karol Wojtyla.
1. Wojtylas theoretischer ANSATZ in seinen philosophischen Schriften, Vorträgen und Vorlesungen
1.a. “Liebe und Verantwortung”
1.a.1. Die Substanz als Voraussetzung und der Begriff “suppositum”
1.a.2. Das Vermögen der Wahrnehmung und der Begriff “intentio”
1.a.3. Die Methodik des Papstes
1.a.3.a. Zitate aus den populären Interviews Papst Johannes Paul II. Zur menschlichen Historie
1.a.3.b. Zitate aus den Generalaudienzen Papst Johannes Paul II. Die Frage des Glaubens und der Religion
1.b. Was ist praktische Ethik?
1.c. “Das Geheimnis und der Mensch”
1.d. “Der Mensch als Person”
1.e. “Die menschliche Person und das Naturrecht”
1.f. “Die Wahrheit wird euch frei machen”
1.g. “Die Perspektiven des Menschen”
1.h. “Lubliner Vorlesungen” und akademische Schriften. Zur Frage nach der wissenschaftlichen Objektivität und ihrer objektiven NORM
2. ARGUMENTATION. Das philosophische Hauptwerk “Person und Tat”
2.1. Der actus humanus
2.2. Akt und Dynamismus
2.3. Person: Erfahrung und Bewusstsein als ethische Elemente
2.4. Zur Frage der methodischen Richtung: Kann eine Erfahrungswissenschaft der personalen Ethik eine “realistische Phänomenologie“ sein? Das Problem der Theorie.
3. ERLÄUTERUNG. Die philosophischen Vorträge als Kardinal
4. ZUSAMMENFASSUNG. Thema und Methode bei Karol Wojtyla
4.1. Exkurs über das Phänomen der “Weltzeit” bei Heidegger
Zweiter Teil: Theologie des Leibes bei PP Johannes Paul II. Die anthropologische Konzentration von Karol Wojtyla findet ihren Abschluss in jenen Ausführungen, die heute als „Theologie des Leibes“ ediert worden sind.
0. Einleitung
1. Das Gesetz der Analogie
2. Leiblicher Eros und christlicher Ethos
3. Sakramente der Ehe und der Weihe
4. Tot sacramenta quot verba. Gotteskindschaft als Gabe und Auftrag.
5. Der göttliche Heilsplan der Liebe als personale Norm der Menschlichkeit. Die Sünde führt zu Leid und Tod, die Gerechtigkeit zur Auferstehung.
6. Der Ruf des menschlichen Herzens: Reinheit durch Hingabe und Verdunkelung durch Begehrlichkeit.
7. Das göttliche Geheimnis der Schöpfung und die Erlösung des Leibes durch das Heilswirken Christi
8. Der Bund Gottes mit den Menschen: Geheimnis und Sakrament - die göttliche Ökonomie
9. “Die Wahrheit wird euch frei machen.” (Joh 8,32). Die Liebe als menschliche “Bewährungsprobe”
10. Das Gesetz des Lebens zum Erbe haben
Dritter Teil: Das Verhältnis von Theologie und Philosophie/ Phänomenologie im Denken von Karol Wojtyla/ PP Johannes Paul II.
1. Die ganzheitlich religiöse, metaphysische und anthropologische Dimension der Enzyklika “fides et ratio”
2. Exkurs: Die speziell soziale und praktische Dimension und ihr methodischer Ansatz in den Sozialenzykliken des Papstes und am Beispiel der naturrechtlichen Konzeption des Sozialethikers Johannes Messner
2.a. Exkurs: Die fundamentaltheologische und anthropologische Bedeutung des Phänomens “Arbeit” als Ordnungsfaktor der menschlichen Gesellschaft in den Sozialenzykliken Johannes Paul II.
2.b. Exkurs: Der methodische Ansatz in der naturrechtlichen Konzeption des Sozialethikers Johannes Messner
3. Abschließende Überlegungen. Ecce homo.
LITERATURVERZEICHNIS
Literatur von Karol Wojtyla/ Johannes Paul II.
Sekundärliteratur von Dritten (Auswahl)
Bibelausgabe
Vorwort: Gnthi seautón. Mensch, Erkenne dich selbst!
“Auf dem Boden der ganzheitlichen Erfahrung des Menschen taucht die Person durch die Tat gerade deshalb vor uns auf, weil in dieser Erfahrung der Mensch nicht nur von außen gegeben ist, sondern auch von innen.” (Karol Wojtyla/ Johannes Paul II., Person und Tat,
Herder 1981, Seite →.)
Dieses Zitat aus dem methodischen Einleitungs-Kapitel von Karol Wojtylas Buch “Person und Tat” illustriert in besonderer Weise seine Erklärung des Begriffs “Person”: Was eine Person ausmacht, ist die ganzheitliche Erfahrung des Menschseins, also der Begriff vom Menschen in seiner Allgemeinheit, vom Menschen an sich.
Dieser allgemeine Begriff vom Menschsein zeigt sich nicht nur äußerlich (bspw. sichtbar, durch das Sehen), sondern vor allem in ausgezeichneter Weise durch innere Erfahrung, Intuition. Dies bedeutet, dass der Mensch an sich und damit irgendwie auch JEDER Mensch der erste Gegenstand menschlicher Erfahrung ist!
Gleichzeitig konkret und individuell wird dieser Begriff des Menschlichen dann durch das Handeln, durch die Tat. Hier spezifiziert sich dieses allgemeine Vermögen der inneren und äußeren Erfahrung vom Menschen, und man kann somit von einem individuellen Lebenslauf sprechen, etwa von der Biographie eines Individuums, welches für bestimmte Aktionen und Verhaltensweisen verantwortlich zeichnet.
-- Karol Wojtyla wurde im Jahr 1920 in einer sehr katholischen polnischen Familie geboren. Früh zeigte sich seine religiöse und auch seine poetische Veranlagung. Durch den zweiten Weltkrieg musste er sein Studium der Polnischen Philologie frühzeitig abbrechen und wurde zur Zwangsarbeit in einem Steinbruch und einer Chemiefabrik verpflichtet. Er blieb aber im Untergrund Mitglied einer Experimentaltheatergruppe und verfasste weiter Gedichte und Theaterstücke, die seine ausgesprochen religiöse Neigung zeigen. Zudem trat er ins geheime Priesterseminar der Erzdiözese Krakau ein und empfing so nach den Greueln der Kriegsjahre 1946 unter kommunistischer Herrschaft die Priesterweihe. Zwei Jahre später promovierte er in Rom am Angelicum über den heiligen Johannes vom Kreuz. Zurück in Polen wurde er Kaplan und ab 1953/54 Professor für Moraltheologie sowie Philosophie und Sozialethik und habilitierte sich mit einer Arbeit über Ethik und Christentum des Phänomenologen Max Scheler. 1958 wurde er zum Weihbischof geweiht, 1964 zum Erzbischof von Krakau. Er nahm 1962 bis 1965 am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. 1969 erschien “Person und Tat”, sein zweites philosophisches Werk nach der ethischen Studie “Liebe und Verantwortung” von 1960. Im Jahr 1978 zum Papst gewählt, starb Johannes Paul “der Große” im Jahr 2005. Er, dem die pastorale Sorge für den Menschen in jeder Phase seines Lebens ein Anliegen war, hinterläßt 14 Enzykliken und zahlreiche wegweisende Äußerungen seines Lehramts. Dies entsprach der marianischen Frömmigkeit seines Denkens.
Thematische Einführung.
“Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt, und dass eure Frucht bleibt” (Joh 15,16).
Im Apostolischen Schreiben “Ecclesia in Europa” aus dem Jahr 2003 spricht der Papst in unserer Zeit von einer symptomatischen Seinsvergessenheit, einem allgemeinem Leben etsi deus non daretur und dem Fehlen von Metaphysik: “Der Verlust der Hoffnung hat seinen Grund in dem Versuch, eine Anthropologie ohne Gott und ohne Christus durchzusetzen. Diese Denkart hat dazu geführt, den Menschen <als absoluten Mittelpunkt allen Seins zu betrachten, indem man ihn fälschlicherweise den Platz Gottes einnehmen ließ und dabei vergaß, daß nicht der Mensch Gott erschafft, sondern Gott den Menschen erschafft. Das Vergessen Gottes hat zum Niedergang des Menschen geführt. Es wundert daher nicht, daß in diesem Kontext ein großer Freiraum für die Entwicklung des Nihilismus im philosophischen Bereich, des Relativismus im erkenntnistheoretischen und moralischen Bereich, des Pragmatismus und sogar des zynischen Hedonismus in der Gestaltung des Alltagslebens entstanden ist.> Die europäische Kultur erweckt den Eindruck einer <schweigenden Apostasie> seitens des satten Menschen, der lebt als ob es Gott nicht gäbe.”1
Seine eigene Anthropologie hat Wojtyla, schon bevor er Papst wurde, in seinem philosophischen Werk ausgeführt und dann in den Generalaudienzen zur “Theologie des Leibes” 1979-1984 expliziert.
Auch angesichts der wissenschaftlichen Richtung der akademischen Phänomenologie Husserls oder Schelers, wie diese den Philosophen Wojtyla, und vor ihm schon Edith Stein, geprägt und beeinflusst haben mögen, handelt es sich im Werk Karol Wojtylas/ PP Johannes Paul II. um die Einlösung einer Forderung der Wahrheit selbst, “den ebenso notwendigen wie dringenden Übergang vom Phänomen zum Fundament zu vollziehen”2, wie es in der Enzyklika “fides et ratio” heißt. Diese zitiert dabei das II. Vatikanische Konzil: “Die Vernunft ist nämlich nicht auf die bloßen Phänomene eingeengt, sondern vermag geistig tiefere Strukturen der Wirklichkeit mit wahrer Sicherheit zu erreichen, wenn sie auch infolge der Sünde zum Teil verdunkelt und geschwächt ist.”3
Es ist dies die altbekannte scholastische adaequatio rei et intellectus, wie sie schon Thomas von Aquin und Bonaventura vor Augen stand, also Metaphysik im strengsten Sinne. Es geht hier um das menschliche Erkennen einer objektiven Wirklichkeit, “wenngleich auf unvollkommene und analoge Weise”4, nämlich um “eine Forderung an die Erkenntnis des sittlichen Guten, dessen letzter Grund das höchste Gut, Gott selber, ist.”5
Der Papst bekräftigt an dieser Stelle, was er auch vorher in seinem philosophischen Werk vertreten hat, “daß die Wirklichkeit und die Wahrheit das Tatsächliche und Empirische übersteigen”. Er nennt mit der kirchlichen Tradition die menschliche Fähigkeit, dies zu erkennen, den “intellectus fidei”.
Man sieht hier also die inhaltliche Nähe Wojtylas zur Scholastik des Mittelalters, aber auch zur philosophischen Fähigkeit der Vernunft überhaupt, “sich über das Zufällige zu erheben”6 und den kosmos zu erklären, wie sie sich in der modernen Zeit zB in der philosophischen Denkrichtung der Phänomenologie Husserls, Schelers und Edith Steins geäußert hat.
Dem Papst und Philosophen steht dabei eine Art und Weise des Philosophierens vor Augen, welche “von sich aus imstande ist, die unablässige Selbsttranszendierung des Menschen auf die Wahrheit hin zu erkennen” und die “sich mit Hilfe des Glaubens öffnen [kann], um in der <Torheit> des Kreuzes die echte Kritik an denen aufzugreifen, die sich der Täuschung hingeben, die Wahrheit zu besitzen, während sie sie in den Untiefen ihres Systems gefangenhalten.”7
In diesem Sinn ist auch sein Verhältnis zur Schul- und Denkrichtung der Phänomenologie zu sehen, die er ebenso freigeistig und kreativ anwandte wie es auch Edith Stein schon vor ihm getan hat: Beiden ist eine starke Zuwendung zur scholastischen Tradition eigen, die sie ins Heute zu übersetzen versuchten. Deshalb fällt es auch schwer, sie einer bestimmten philosophischen Richtung ein- und unterzuordnen, weshalb sie auch noch in keiner Philosophie-Geschichte zu finden sind. Wojtyla und Stein werden vor allem als Vertreter der katholischen Kirche gewürdigt. Ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten philosophischen Schule ist daher äußerst fragwürdig; beide sind eher der “philosophia perennis” zuzurechnen, waren aber sehr eigenständig in ihrer Anwendung der philosophischen Strömungen ihrer Zeit; sind also als “konservativ” zu bezeichnen.
Mit dieser knappen Einführung ist die Thematik dieser Dissertation umrissen, wie sie im Weiteren näher entfaltet wird: Karol Wojtylas/ PP Papst Johannes Paul II. Anthropologie ist aus dieser Sicht ein fundamentaltheologisches Projekt mit einer wesentlich philosophischen Komponente. Im Zentrum der Betrachtungen steht der Mensch als Person gerade in seiner Leiblichkeit, d.i. in seinem ihm eigenen Wesen und damit auch in seiner Kontingenz bzw. Begrenztheit, welche eo ipso ergänzungsbedürftig bleibt, aber auch fähig zu Ergänzung und Entwicklung ist.
Es bleibt mir als Verfasser, mich bei denen zu bedanken, die meine Arbeit mit Wohlwollen unterstützt haben, meinen Eltern, Lehrern, Kollegen und Freunden und an dieser Stelle besonders bei Herrn Prof. Roman Siebenrock für sein Entgegenkommen.
1 JOHANNES PAUL II., Ecclesia in Europa. Apostolisches Schreiben, Christiana 2003, Seite 16/17 mit einem Zitat der Zweiten Sonderversammlung der Bischofssynode für Europa, Relatio ante disceptationem, I, 1,2: LOsservatore Romano, 3.10.1999, S. 6.
Diese Meinung vertritt Karol Wojtyla auch schon im "Zeichen des Widerspruchs. Besinnung auf Christus", Beninger/ Herder aus dem Jahr 1979. Er schließt dabei an Gedanken Augustins aus "De civitate Dei" und an die biblische Sündenfall-Erzählung von Adam und Eva im Paradies, d.i. die menschliche Selbstliebe bis hin zur Verachtung Gottes, an.
Vgl. aus der Einführung von D.J. Hilla zu JOHANNES PAUL II., Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Katechesen 1985 - 1986. EOS 1993, Seite 11: "Einen Schwerpunkt im Denken des Heiligen Vaters bildet die Frage nach der Wahrheit. Die Wahrheit ist in Gott verankert. Wahr ist etwas dann, wenn es genau jenes Wesen verwirklicht, das Gott ihm zugedacht hat. Wahrheit bedeutet die Übereinstimmung eines Seienden mit dem Plane Gottes." Hilla zitiert hier auch wieder Karol Wojtyla, Zeichen des Widerspruchs. Besinnung auf Christus, Beninger/ Herder 1979, S. 21: "Der Mensch muß Wurzel schlagen in der Erkenntnis des Schöpfers." Mit anderen Worten formuliert: Gottes idealtypisches Wort ist Jesus Christus. Natur ist dabei göttliche oder menschliche: etwas, das wird und wirkt.
2 JOHANNES PAUL II., Enzyklika Fides et Ratio. Über das Verhältnis von Glaube und Vernunft. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Deutsche Bischofskonferenz 1998, Seite 86.
3 Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes, 15; zitiert in JOHANNES PAUL II., Enzyklika Fides et Ratio. Über das Verhältnis von Glaube und Vernunft. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Deutsche Bischofskonferenz 1998, Seite 84.
4 JOHANNES PAUL II., Enzyklika Fides et Ratio. Über das Verhältnis von Glaube und Vernunft. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Deutsche Bischofskonferenz 1998, Seite 85
5 Ebd. S. 85
6 Ebd. S. 29.
7 Ebd. S. 28
Erster Teil: Die philosophisch-phänomenologische Anthropologie von Karol Wojtyla in besonderer Berücksichtigung seiner Rezeption der phänomenologischen Methode
0. EINLEITUNG. Eine fundamentale Diskussion der phänomenologischen Methode und die Metaphysik im philosophischen Werk von Karol Wojtyla.
“in omne comprehensione includitur ens." (Thomas von Aquin, De veritate)8
Persönliche Lebensentwürfe von Menschen gestalten sich im Graubereich zwischen diffusem Alltag und herrschendem Positivismus. Ein Versuch, sich wissenschaftlich mit “der Welt” auseinanderzusetzen, ist die phänomenologische Methode, mit ihren verschiedenen Ausprägungen und Repräsentanten. Dementsprechend ist die Intention dieses Ersten Teils Arbeit nicht schon die praktische Konsequenz etwa einer “Theologie des Leibes” (unter der Thematik von Ehe, Familie und religiöser Praxis des Glaubenslebens), sondern vielmehr erst ihre begriffliche Grundlegung (Hermeneutik), also die Philosophie oder Anthropologie von Begriffen wie “Bewusstsein”, “Erfahrung”, “Transzendenz” und “Vergegenständlichung” etc. .
Der akademische Professor Karol Wojtyla hat seinen Beitrag zur phänomenologischen Methode vor allem durch seine Beschäftigung mit dem Werk von Max Scheler aufgebaut. Als Rüstzeug dazu brachte er seine christliche Ethik und seine akademische Ausbildung in Theologie, Scholastik und Metaphysik mit. Sein philosophisches Werk (siehe Primärliteratur-Verzeichnis) ist sehr überschaubar, da er nur wenige Jahre (in den 1950er-Jahren) als akademischer Professor für Moraltheologie bzw. Philosophie und Sozialethik wirkte und dann schnell mit der Aufgabe eines katholischen Bischofs betraut wurde. Dabei scheint ihn aber das Thema nicht losgelassen zu haben, da sein Hauptwerk erst 1969, zur Zeit seiner Teilnahme am Zweiten Vatikanischen Konzil erschien.
Seine Äußerungen zu den anderen Meistern der phänomenologischen Schule, zu Franz Brentano, Edmund Husserl und Martin Heidegger oder Edith Stein, um nur einige zu nennen, sind sehr spärlich9 gesät. Sein Hauptaugenmerk, so scheint es bei Betrachtung der Werke des Philosophen Wojtyla, galt immer dem Kern der Sache, dem “Wesentlichen”, das er als guter Priester vor allem in der klassischen Metaphysik sah. Als deren hauptsächlicher Vertreter ist demnach wohl Thomas von Aquin zu nennen, den Wojtyla auch als Papst - in der Enzyklika “fides et ratio” im Gefolge der Päpste vor ihm - als die große Autorität der einen ewigen “Seinsphilosophie” und ihrer “ständigen Neuheit” (sic!) kennzeichnet.
Weiter wichtige Namen der Philosophiegeschichte sind für Wojtyla Platon und Aristoteles, Kant und wie gesagt Scheler. - Wojtylas Beschäftigung mit der Dichtkunst ist nicht Thema dieser Arbeit. Auch nicht eine Analyse der zeitgenössischen Philosophie, Theologie und Analytik. Es scheint, dass die zwei Blickrichtungen10: klassische Metaphysik, vor allem repräsentiert durch den Philosophen-Theologen Thomas von Aquin, und die phänomenologische Methode Max Schelers als Brückenpfeiler zu Wojtylas Beitrag zur Philosophie genügen. Max Scheler wird von Wojtyla ausdrücklich als bedeutender Kritiker Immanuel Kants gewürdigt.
Der Verfasser möchte dem ductus Wojtylas folgen, sich nicht in Detailfragen zu verlieren, sondern das “Wesentliche” und Ganze, sozusagen “die Sachen selbst” in den Blick zu bekommen. Dabei ist, wie auch Edith Stein in ihrem Hauptwerk zeigte, der spezielle menschliche Blick, der persönliche Standpunkt eines jeden Menschen das Kennzeichen einer “modernen” Methode, die sich auch phänomenologisch nennen möchte - also ist das nicht der rationalistische Blickwinkel “sub specie aeternitatis” einer “causa sui” wie bei Spinoza oder die idealistische Form des Denkens wie etwa bei Hegel11 im Gefolge der Ideenlehre Platons.
Wojtyla legt aber, um es vorwegzunehmen, großen Wert auf die “Objektivität’ dieses Blicks, dieser Theorie, die sich an den (durchaus weltlichen und empirischen) Phänomenen, so wie sie wahrhaft (selbst) sind, ausweisen soll. Philosophie soll also nicht reine Subjektivität oder menschliches Produkt der psychischen Einbildungskraft sein. So nennt er Scheler in seiner Habilitation12 einen Emotionalisten, der rein auf das Erleben eines persönlichen Wert-Gefühls fokussiert und Kant einen Rationalisten bzw. Phänomenalisten, der in den “Dingen” außerhalb der menschlichen Vernunft nur ein reines Chaos sieht, das erst noch durch einen menschlichen Verstand schematisiert werden muss.
Thomas von Aquin ist dabei in den Schriften und Vorlesungen Wojtylas immer die große unanfechtbare Autorität, die, sozusagen biblisch geerdet, den Vorzug vor allen anderen Denkanstrengungen hat, in ihrem unübertroffenen Realismus. Sein Name repräsentiert damit natürlich die ganze philosophische Tradition der Kirche und ihrer Denker, die sie durchaus von Anfang an hatte, bis hin zu den Definitionen der Konzilien, die sehr wohl auch einen philosophischen Anspruch stellen.
Nichtsdestotrotz sieht es Wojtyla als Verdienst der neuzeitlichen Denker nach Thomas, dass eben die persönliche individuelle Anschauung in einer Anstrengung, genannt das Erleben, das spezifisch und alltäglich menschliche13 Element also, theoretisch mehr Gewichtung findet als bei den antiken und mittelalterlichen Denkern und Systematikern. Mit Nachdruck hält der Philosoph Wojtyla hier aber an klassisch gewordenen Formulierungen in der lateinischen Sprache der scholastischen Überlieferung fest, um die Phänomene im Allgemeinen zu diskutieren. Ich meine, man kann Wojtyla daher mit Recht als thomistischen Realisten oder leicht auch als Vertreter eines ethischen Personalismus moderner Prägung bezeichnen.
So möchte auch der Verfasser dieser Arbeit ihm dabei ein Stück nachfolgen und den reichen Schatz der katholischen Philosophie-Theologie heben, wie sie sich über die Jahrhunderte einen Namen gemacht hat. Es ist nämlich gar nicht einfach, zB Thomas von Aquin im Original zu studieren, aufgrund der Fülle seiner Schriften, der überkommenen Sprache, der komplizierten Gedankengänge und der veralteten Fragestellungen. Die Problematik der Übersetzung anderer Sprachen ist eine ganz eigene, Kritik an deren Tradition ist oft anzutreffen. Wojtyla bietet aber in seinen akademischen und auch in seinen populären Schriften eine übersichtliche, kurze und bündige Darstellung von “ Metaphysik" bzw. “Seinslehre" bzw. dessen, was er immerhin als einer, der zum Papst gewählt wurde, darunter versteht. Das hat einen sehr großen heuristischen Wert für jeden Lernenden und Studierenden, der wissen will, was und wie man Philosophie verstehen soll. (Sehr freimütig hat er sich auch als Papst nicht gescheut, die philosophische Terminologie in populären Interviews, Katechesen und Publikationen zu verwenden.)
So soll diese Arbeit sozusagen monographisch speziell am wissenschaftlichen philosophischen Werk Wojtylas orientiert sein, ohne aber eine breite Auseinandersetzung mit allen möglichen Denk- und Schul-Richtungen, Problemen und Religionen bieten zu können. Durch diese methodische Reduktion, so meint der Verfasser, soll am Besten zum Vorschein kommen, was Wojtylas durchaus von ihm selbst “phänomenologisch” genannter Ansatz, was seine theoretische Methode und was seine Sicht einer “klassischen” , d.i. bleibenden Metaphysik (philosophia perennis) und Anthropologie ist.
Dazu stehen uns in diesem Ersten Teil der Arbeit vor allem Wojtylas Hauptwerk “Person und Tat”14 und seine akademischen Aufsätze und Vorlesungen sowie die Interviews (und später die apostolischen Lehrschreiben) zur Verfügung, soweit ich sie mit Hilfe meines akademischen Vorwissens und des Internets ab dem Jahr 2000 (in deutscher Sprache)15 recherchieren konnte.
Ob es einen ähnlich gearteten wissenschaftlichen Forschungsansatz16 zu Wojtylas Werk gibt, ist mir momentan nicht bekannt; in der akademischen Welt der sogenannten Geisteswissenschaftler, wie ich die universitäre Fakultät und vorher schon das “neusprachliche” Gymnasium, unter Gleichaltrigen erlebte, wurde der polnische Papst nicht erwähnt oder als nicht besonders ernst zu nehmende Gestalt irgendeines amts-versessenen obskur religiösen Machtapparats gesehen, mit dem man sich als gebildeter Mensch von Welt besser nicht zu sehr beschäftigte....
Ich verfasste meine Diplomarbeit mit dem Titel “Die Zeitlichkeit des umsichtigen Besorgens und die Konzeption der Weltzeit nach M. Heidegger” nach Studien mit Schwerpunkt auf die hermeneutisch-phänomenologische Daseinsanalytik in Innsbruck und Freiburg im Breisgau, bei Professor Rainer Thurnher am philosophischen Institut der GEIWI in Innsbruck im Jahr 1999. Dieser Titel war sehr bewusst gewählt, denn, so schien es mir - und es sollte sich später im praktischen Berufsleben als kaufmännischer Buchhaltungs-Angestellter bestätigen -, hier war die crux des Alltags-Lebens, an der keiner vorbeikommt. Muss doch jeder “sein Geschäft verrichten”, und auch “jeder Krämer lobt seine Ware” - wie der Volksmund sagt.
Sehr verbissen hatte ich mich bei der Daseinsanalyse in einer Art von Weltschmerz in das Heideggersche Phänomen der “Weltzeit , welche bekanntlich per definitionem ganz einfach “der Zeitlichkeit entspringt’, die “ausgesprochene” und “öffentliche Zeit” genannt wird und die gegliedert-gespannt datierbare und so bedeutsame Ausgelegtheit einer alltäglichen Seinsvorstellung darstellt. (Könnte man dieses Phänomen-Wort vielleicht mit “saeculum17” ins Lateinische übersetzen?), kam aber zu keinem befriedigenden Ergebnis bzw. Doktorat, obwohl ich hinter dem Wort ein großes Geheimnis18 ahnte. Just zur gleichen Zeit kam die Erfindung des Internets und mit ihm ungeahnte Möglichkeiten der Recherche auf allen Ebenen der Philosophie. So entdeckte ich auch den polnischen Dichter und Ethiker Karol Wojtyla für mich und war mehr als erstaunt, ja begeistert zu sehen - um es zu sagen mit einem Wort Edith Steins über Max Scheler - dass man katholisch sein kann und intelligent. (Zwar wurde man hierzulande in der Kindheit schon katholisch getauft und gefirmt, gelebte Identität mit der Kirche ist aber gesellschaftlich selten.)
- Und das in einem wirklich hervorragendem Maße, das ich gerne “päpstlich” nennen darf; denn er war ein Mann, der die “personalistische Norm” aufrichtig gelebt und mit benevolentia praktiziert hat.
8 bei Edith Stein so formuliert: “Zur Gesamtheit des Seienden fügt die Zuordnung zum Geist (..) nichts hinzu, weil sie schon darin eingeschlossen ist.” (Stein Edith, Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. GA Bd. II/I2, Herder 2006, Seite 267.)
9 vgl. Karol Wojtyla, Person und Tat, Anmerkungen. (Ab hier zitiert mit: PT.)
10 Aus JOHANNES PAUL II., Auf, lasst uns gehen! Erinnerungen und Gedanken, Weltbild 2004, Seite 98, Kapitel "Der Bischof und die Welt der Kultur": “Mein persönlicher philosophischer Standort bewegt sich sozusagen zwischen zwei Polen: zwischen dem aristotelischen Thomismus und der Phänomenologie. In besonderer Weise interessierte mich das Gedankengut Edith Steins, einer außergewöhnlichen Persönlichkeit, auch wegen ihres Lebensweges".
11 als idealistischen Denker bezeichnet Wojtyla auch Husserl, vgl. PT 57 und 352 Anmerkung 20 dazu.
12 in: Karol Wojtyla/ Johannes Paul II., Primat des Geistes. Philosophische Schriften, Seewald 1979, ab hier zitiert mit: PG, zB S. 43 und 44. Vgl. PT Seite 269 und S. 50.
13 Man kann es in diesem Zusammenhang das "demokratische" Element nennen und an den modernen Rechtsstaat mit öko-sozialer Marktwirtschaft denken. Vgl. dazu Johannes Messner, Das Naturrecht 1950 und Kulturethik 1954. Vgl. JOHANNES PAUL II., Erinnerung und Identität. Gespräch an der Schwelle zwischen den Jahrtausenden, Weltbild 2005, Seite 72, Kapitel "Das Geheimnis der Barmherzigkeit": "das letzte Wort der göttlichen <Ökonomie> in der Geschichte der Welt und in der Geschichte der Menschheit. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können (vgl. Tim 2,4): Gott ist die Liebe. (vgl 1 Joh 4,8)." Vgl. Sartre Jean-Paul, Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, erster Satz: "Das moderne Denken hat einen beachtlichen Fortschritt gemacht, indem es das Existierende auf die Reihe der Erscheinungen, die es manifestieren, reduzierte." Es ist dies ein rein funktionelles Denken, im Gegensatz zu einem mehr traditionellen, das an ein "Wesen" hinter den Dingen glaubte.
14 Karol Wojtyla/ Johannes Paul II., Person und Tat, Herder 1981, zitiert ab hier mit: PT
15 Im Vorwort zu: Wer ist der Mensch? Skizzen zur Anthropologie. Hsgb. Hanns-Gregor Nissing, Pneuma 2011, bietet Nissing einen Überblick über das philosophische Werk Wojtylas.
16 Ich selbst, als Verfasser, würde diese Arbeit am ehesten eine semiotische Analyse nennen, mit einem von der Sache her philologisch-strukturalistisch orientierten Forschungsansatz.
18 vgl. Joseph Ratzinger/ Benedikt XVI in: “Jesus von Nazareth. Zweiter Teil”, Herder 2011, Seite 119 im 4. Kapitel “Das hohepriesterliche Gebet Jesu”, Punkt “Dass sie alle eins seien”. Das Zitat lautet:
“Die Kirche entspringt dem Gebet Jesu. Dieses Gebet ist aber nicht nur Wort, es ist der Akt, in dem er sich selbst “heiligt”, das heißt sich “opfert" für das Leben der Welt. Wir können umgekehrt auch sagen: Im Gebet wird das grausame Geschehen des Kreuzes zu “Wort”, zum Versöhnungsfest zwischen Gott und Welt. Daraus entspringt die Kirche als die Gemeinschaft derer, die auf das Wort der Apostel hin an Christus glauben” [Johannesevangelium 17,20]. Anm. Verf.: Hier zeigt sich in einem ausdrücklich religiösen Sinn die Struktur des “Entspringens” von “Welt” aus der Zeit.
Der Verfasser dieser Arbeit stellt die These e.h. auf: Die Weltzeit ist das temporal interpretierte Sein; - oder anders formuliert: Die Weltzeit ist ein Pro-jekt, welches man auch als <ein Stück Arbeit> bezeichnen kann. - Das Sein selbst hingegen ist ein Wert an sich. Wir wissen nicht, was es schlussendlich besagt, wir können uns nur einen Begriff davon erarbeiten bzw. ein Ge-Wissen davon haben. Das Sein ist scholastisch gesprochen: actus.
Vgl. Karol Wojtyla, Liebe und Verantwortung. Eine ethische Studie, Kösel 1979, (Anmerkung) Seite 260 : “Die erfahrbare Verbindung der Liebe mit der Bejahung des Lebens, des Seins drängt als Folge der metaphysischen Deutung den Gedanken auf, dass der Tod personaler Wesen in der Perspektive der schöpferischen Liebe Gottes nur ein Übergang zu einer höheren Form des Lebens sein kann (morte fortius caritas).
1. Wojtylas theoretischer ANSATZ in seinen philosophischen Schriften, Vorträgen und Vorlesungen
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. (Psalm 8,5-6)
Wojtyla selbst bietet einen optimalen Einstieg in die soeben aufgerissene Thematik: “Was ist Philosophie?” oder: “Wie verstehen wir das <Sein>?” oder: “Wie zeigen sich Phänomene?”, “Was sind sie?” besonders in seinem philosophischen Hauptwerk “Person und Tat”, wo er gleich zu Beginn seinen theoretische Ansatz als Methode (=Gang der Untersuchung) vorstellt und eine engere sachliche “Studie” ankündigt, die wesentliche Einsichten und einen festen theoretischen Standpunkt erarbeiten soll. Dazu sollen uns aber die etwas breiter angelegten Überlegungen Wojtylas aus seinen frühen akademischen Schriften und Vorlesungen den Weg bereiten, bevor wir dann in eine direkte Auseinandersetzung gehen, was “die phänomenologische Methode” für Wojtyla in seinem selbstständigen Entwurf, dem Hauptwerk “Person und Tat” ist.
1a.. “Liebe und Verantwortung
“Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Ein deutliches Zeichen dafür ist die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen. Denn abgesehen vom Nutzen werden diese um ihrer selbst willen geliebt, und von allen besonders die Sinneswahrnehmung, die durch die Augen zustande kommt. “ (Aristoteles, Metaphysik 1. Buch [A] 21-24)
Seine ethische Studie “Liebe und Verantwortung”19 beginnt Wojtyla mit der interessanten Darlegung der sozusagen ontischen, ersten Voraussetzungen der menschlichen Existenz und ihres Da- und Soseins. Da es sich meines Erachtens um einen grundlegenden Text20 sehr hohen Anspruchs handelt, möchte ich ihn in ausreichender Länge zitieren:
“Die Welt, in der wir leben, setzt sich aus einer großen Zahl von Objekten zusammen. <Objekt> ist hier gleichbedeutend mit <Wesen>. Das ist aber nicht der genaue Sinn Wortes, denn eigentlich bezeichnet <Objekt> das, was zu einem Subjekt in Beziehung steht. Nun aber ist das Subjekt ebenfalls ein Wesen, ein Wesen, das existiert und auf die eine oder andere Weise handelt. Man kann somit auch sagen, die Welt, in der wir leben, setze sich aus einer großen Zahl von Subjekten zusammen. Eigentlich sollte man von Subjekten sprechen, bevor man von Objekten spricht.
Wenn wir diese Ordnung umgestellt haben, so in der Absicht, in diesem Buch von Anfang an den Objektivismus, mithin Realismus zu unterstreichen. Wenn man nämlich mit dem Subjekt begänne, zumal wenn man beim Subjekt Mensch ansetzte, liefe man Gefahr, alles, was sich außerhalb seiner befindet, also die Welt der Objekte, rein subjektiv zu betrachten, also so, wie es in das Bewußtsein des Subjekts eindringt und sich in ihm festsetzt. Man muss sich deshalb von Anfang an klar sein, daß jedes Subjekt gleichzeitig etwas Objektives ist, daß es objektiv etwas oder jemand ist.
Der Mensch ist objektiv jemand, und dies unterscheidet ihn von den anderen Wesen der sichtbaren Welt, die objektiv immer nur etwas sind. Diese simple, elementare Unterscheidung zeigt, welch ein Abgrund die Welt der Personen von der der Dinge trennt.
Die objektive Welt, zu der wir gehören, setzt sich aus Personen und aus Dingen zusammen. Als <Ding> bezeichnen wir für gewöhnlich ein Wesen, das nicht nur keine Vernunft, sondern auch kein Leben hat; ein Ding ist ein unbelebtes Objekt. (...) Mit dem Ausdruck Person will man betonen, daß sich der Mensch nicht restlos in den Begriff <Individuum einer Spezies> fassen läßt, sondern daß es in ihm etwas mehr gibt, eine besondere Daseinsfülle und -vollkomenheit. Um diese hervorzuheben, muss unbedingt das Wort <Person> verwendet werden.
Die einfachste und einsichtigste Begründung dafür ist die, daß der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist, daß er die Vernunft besitzt, die sich bei keinem anderen sichtbaren Wesen feststellen läßt, weil wir bei ihnen keine Spur begrifflichen Denkens finden. Davon geht die bekannte Definition des Boethius aus, wonach die Person ein Individuum von vernunftbegabter Natur (individua substantia rationalis naturae) ist. Dies ist es, was innerhalb der Welt der objektiven Wesen die <Person> unterscheidet und ihre Besonderheit ausmacht (...) durch ihre Innerlichkeit und ein Leben eigener Art, das in ihr konzentriert ist, d.h. durch das innere Leben. (...) Beim Menschen nehmen das Erkennen und Verlangen einen geistigen Charakter an und tragen so zur Bildung eines eigentlichen inneren Lebens bei - ein Phänomen, das bei den Tieren nicht vorkommt. Das innere Leben ist das geistige Leben. Es sammelt sich um das Wahre und Gute. Zahlreiche Probleme gehören ebenfalls dazu, wovon die beiden folgenden wohl die wichtigsten sind: <Welches ist die erste Ursache von allen?> und <Wie kann man gut sein und die Fülle des Guten erreichen?> .
Das erste dieser zentralen Probleme des inneren Lebens des Menschen betrifft vor allem das Erkennen, das zweite dagegen das Verlangen, oder genauer gesprochen, das Streben. Übrigens scheinen diese beiden Funktionen mehr zu sein als lediglich Funktionen. Sie sind eher naturgegebene Ausrichtungen des ganzen Menschen.(...) Die Person ist eben ein objektives Wesen, das als bestimmtes Subjekt mit der ganzen (äußeren) Welt eng in Verbindung steht und dank seiner Innerlichkeit und seinem Innenleben darin von Grund auf wurzelt. (...) Zwar beginnt die Verbindung der menschlichen Person mit der Welt auf der physischen, sinnenhaften Ebene, doch nimmt sie erst in der Sphäre des inneren Lebens die dem Menschen arteigene Form an. Hier zeichnet sich ein für die Person spezifischer Zug ab: Der Mensch nimmt nicht nur die Elemente der äußeren Welt wahr und reagiert darauf spontan oder geradezu mechanisch, sondern er sucht in seiner ganzen Haltung zur Welt, zur Wirklichkeit sich selbst zu behaupten, sein eigenes Ich zum Ausdruck zu bringen - und er muß so handeln, denn die Natur seines Wesens verlangt dies. Der Mensch hat eine von Grund auf andere Natur als die der Tiere. Zu seiner Natur gehört die auf der Reflexion gründende Fähigkeit zur Selbstbestimmung, was darin zum Ausdruck kommt, daß der Mensch in seinem Handeln das, was er tun will, wählt. Man nennt diese Fähigkeit den freien Willen.
Weil der Mensch als Person freien Willen besitzt, ist er auch Herr seiner selbst, was die lateinische Formel besagt, nach der die Person sui iuris ist. In einer engen Beziehung mit diesem charakteristischen Zug der Person steht eine andere markante Eigenschaft: Die Person ist - nach der Formulierung der mittelalterlichen Philosophie - alteri incommunicabilis; sie ist unmitteilbar, unweggebbar. (...) Niemand anders kann meinen Willensakt durch den seinigen ersetzen. (...) Ich kann das, was ich nach dem Wunsch eines anderen wollen soll, nicht wollen, und darin bin ich incommunicabilis. Ich bin in meinen Taten selbstständig und soll dies sein. Auf diesem Prinzip beruht die ganze menschliche Koexistenz; die Erziehung und die Kultur gehen auf dieses Prinzip zurück.
Der Mensch ist nämlich nicht allein Subjekt des Handelns; manchmal wird er auch zu dessen Objekt. In jedem Moment finden Handlungen statt, die einen anderen Menschen zum Objekt haben.”
Diese lange Textpassage ist für den Verfasser dieser Arbeit wie die Antwort auf die Frage: Was ist die klassische Philosophie? Was ist Metaphysik? Es lohnt sich, die einzelnen Wörter genau zu betrachten, ihre Verwendung und ihren Zusammenhang. Es handelt sich nämlich um die Errichtung eines Gedanken- Gebäudes, das Wojtyla auch in seinem Hauptwerk benutzen wird. Es geht darum, von welchen ersten Voraussetzungen ( Prinzipien) Wojtyla ausgeht, was seine Grund- Vokabeln sind. Es sind dies philosophische Vokabeln mit einer reichen Tradition, die auch in allen möglichen anderen Zusammenhängen verwendet wurden. Besonders sticht dabei der Begriff der Person hervor, auf den Wojtyla stark baut. Leider wird er dem Leser an dieser Stelle nicht eigens in seiner genetischen Herkunft erklärt - dass dieser aus dem altgriechischen Theater (Maske) stammt oder auch aus den Definitionen der Konzilien über die Göttliche Dreifaltigkeit der Personen.
Wojtyla wählt vielmehr die Methode, den Begriff “Person” von den “Dingen” abzuheben, aber nicht weiter auf einen anderen zurückzuführen - etwa auf Gott als den Schöpfer der geschaffenen Geschöpfe oder auf das Seiende “Mensch” selbst -, sondern er setzt den Wortsinn, seine Bedeutung vielmehr schon als bekannt voraus, ähnlich das urphilosophischen Wort “Wesen” ( ousia, Substanz)21 oder “Natur” (physis)22 oder die grammatikalischen Wörtern “Subjekt” und “Objekt” und implizit auch die “Freiheit”23(libertas), der “Geist” ( mens) und die Wahrheit ( veritas). Was Wojtyla neben seinem sicheren Gebrauch dieser Termini, die er wohl seiner aristotelisch-thomistischen Ausbildung verdankt, bietet, ist, dass er lateinische Definitionen bringt, etwa die des Boethius oder scheinbar geläufige Ausdrücke der mittelalterlichen Scholastik, die ohne eine weitere Urheber-Angabe 24 sind. Mir fällt auf, dass aber der Begriff “Liebe”25, der ja auch in allen Facetten schillert und viele Übersetzungsmöglichkeiten und Kontexte26 hat, hier in dieser Einleitung zu einer ethischen Studie (über das Thema Sexualität27) ebensowenig wie der phänomenologisch grundlegende Begriff “Bewusstsein” noch nicht vorkommt.
Diese Terminologie zieht sich wie ein Leitfaden durch das philosophische Werk Wojtylas und wird noch weiter verfeinert und ergänzt durch den Begriff “suppositum”, der anscheinend auch zum guten Handwerkszeug eines Scholastikers gehört und für den methodischen Ansatz von Wojtylas späterem Hauptwerk eine große systematische Bedeutung hat.
19 Karol Wojtyla, Liebe und Verantwortung. Eine ethische Studie, Kösel 1979; ab hier zitiert mit: LuV. Dieses Werk erschien erstmals 1960.
20 LuV Seite 19 bis 22, Kapitel I. Die Person und der Trieb. Unterkapitel: 1. Analyse der Wörter <gebrauchen< und <genießen>, Unterkapitel: Die Person als Subjekt und Objekt des Handelns.
21 Vgl. die langen Analysen des Wortes “Wesen” in Edith Stein: “Endliches und Ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn von Sein.” 1938/1950, in dem auch ein über 50-seitiger Anhang dem Denken und Werk Martin Heideggers gewidmet ist. Hier sind genaueste Begriffsklärungen zB von ousia, substantia, essentia, esse, ens, existentia, dynamis, potentia, actus, hypostasis, hypokeimenon, res, species, eidos, idea, Form und Stoff, hyle und morphe, zu finden, die von der akademischen Wissenschaft noch lange nicht rezipiert sind, wahrscheinlich, weil es sich bei der Autorin um eine christliche Märtyrerin, Ordensfrau und Heilige handelt, die immerhin von PP Johannes Paul II und im Jahr 1998 zur “Patronin Europas” erklärt wurde! Sie war auch Assistentin von Edmund Husserl und persönlich zB mit Martin Heidegger oder Max Scheler und Roman Ingarden (“Der Streit um die Existenz der Welt” 1947/48) bekannt. Erwähnenswert ist auch ihre Beschäftigung mit dem Werk des Jesuiten Erich Przywara, namentlich mit der “Analogia entis” von 1932.
22 Beim Wort “Natur”, besonders aber bei “Welt” kann man an “Sein und Zeit” 1927 oder an die ’’Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)” 1936-1938 von Martin Heidegger denken.
23 Vgl. zB Schelling, “Über das Wesen der menschlichen Freiheit” 1809