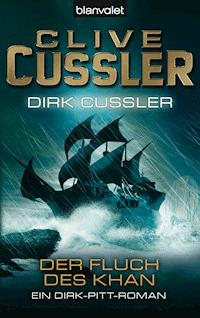
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Ein skrupelloser Mogul setzt alles daran, die Welt entweder im Sturm zu erobern oder aber völlig zu vernichten – genau wie einst sein berüchtigter Vorfahr Dschingis Khan! Mithilfe einer neuen Technologie will er den weltweiten Petroleummarkt ins Chaos stürzen, um diesen anschließend zu beherrschen. Nur Dirk Pitt kann seinen mörderischen Plan jetzt noch vereiteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Dirk Cussler
Der Fluch des Kahn
Roman
Aus dem Englischen von Oswald Olms
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Treasure of Khan« bei Putnam, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2006 by Sandecker, RLLLP
All rights reserved by the Proprietor throughout the world
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2007 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Jörn Rauser
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15188-1
www.blanvalet.de
Für Kerry, in Liebe
D.E.C.
Der Sturm des Kaisers
10. August 1281
Hakata-Bai, Japan
Arik Temur spähte in die Dunkelheit und lauschte auf den lauter werdenden Schlag der Ruder, die ins Wasser eintauchten. Als das Geräusch nur noch wenige Meter entfernt war, drückte er sich in den Schatten und zog den Kopf ein. Diesmal werden wir den Angreifern hier an Bord einen heißen Empfang bereiten, dachte er mit grimmiger Vorfreude.
Das Klatschen der Ruder brach ab, doch ein dumpfer Laut verriet ihm, dass das kleine Boot am Heck des großen Schiffes längsseits haltgemacht hatte. Nur eine schmale Mondsichel stand am mitternächtlichen Himmel, die kristallklar funkelnden Sterne tauchten das Schiff aber in ein wattig weißes Licht. Temur kniete sich lautlos hin, als er eine dunkle Gestalt über die Achterreling klettern sah, gefolgt von einer weiteren und dann noch einer, bis fast ein Dutzend Männer an Deck standen. Die Angreifer trugen leuchtend bunte Seidengewänder unter ihren ledernen Panzerhemden, die bei jeder Bewegung leise knarrten. Vor allem war es aber das Schimmern der rasiermesserscharfen Katanas, der einschneidigen Duellschwerter, das ihm ins Auge fiel, während sie sich sammelten.
Sobald der Köder angenommen und die Falle zugeschnappt war, wandte sich der mongolische Befehlshaber an einen neben ihm kauernden Jungen und nickte ihm zu. Unverzüglich schlug der Junge einen schweren Bronzegong an, den er unter den Arm geklemmt hatte, worauf ein metallisch dröhnender Ton durch die stille Nachtluft hallte. Die Angreifer erstarrten, vom jähen Alarm erschreckt. Dann sprangen dreißig bewaffnete Soldaten lautlos aus dem Schatten. Mit spitzen Eisenspeeren bewehrt stürzten sie sich auf die Gegner und stachen mit mörderischer Wut auf sie ein. Die Hälfte der Angreifer wurde auf der Stelle getötet, getroffen von zahllosen Speerspitzen, die ihren Harnisch durchdrangen. Die verbliebenen Gegner schwangen ihre Schwerter und versuchten sich zu wehren, wurden aber von der Masse der Verteidiger rasch überwältigt. Binnen Sekunden lagen sämtliche Angreifer tot oder tödlich verwundet auf dem Schiffsdeck. Mit Ausnahme eines Mannes, der wie ein einsamer Derwisch dastand.
Bekleidet mit einem reich bestickten roten Gewand und einer Pluderhose, die in Bärenfellstiefeln steckte, war er offenkundig kein einfacher Bauer, den man zum Söldnerdienst gepresst haben musste. Blitzschnell und mit verheerender Treffsicherheit überraschte er die vorrückenden Verteidiger, als er kurzerhand herumfuhr, genau auf sie zustürmte und mit flinken Schwertschlägen die Speerstöße ablenkte. Im Nu hatte er zu einer dreiköpfigen Verteidigergruppe aufgeschlossen, fällte sie allesamt mit funkelnder Klinge und hieb einen Mann mit einem einzigen Streich fast entzwei.
Als er sah, wie dieser Wirbelwind seine Soldaten dahinmetzelte, sprang Temur auf, zückte sein Schwert und stürmte voran. Der Schwertkämpfer bemerkte Temur, parierte geschickt einen Speerstoß von der Seite, drehte sich herum und hieb nach dem anrückenden Krieger. Der mongolische Kommandeur, der im Laufe seines Lebens schon mehr als zwanzig Männer getötet hatte, wich der sausenden Klinge seelenruhig aus. Die Schwertspitze zischte an seiner Brust vorbei und verfehlte die Haut nur um Millimeter. Sobald sein Gegner ins Leere schlug, hob Temur seine Klinge und stieß ihm die Spitze in die Seite. Der Angreifer erstarrte, als der kalte Stahl in seinen Brustkorb drang und das Herz durchbohrte. Mit letzter Kraft verbeugte sich der Angreifer vor dem Mongolen, verdrehte dann die Augen und kippte tot um.
Die Verteidiger stießen einen Jubelruf aus, der über das Hafenbecken hallte und den übrigen Schiffen der hier versammelten mongolischen Eroberungsflotte verriet, dass der Angriff in dieser Nacht fehlgeschlagen war.
»Ihr habt tapfer gekämpft«, lobte Temur seine Soldaten, hauptsächlich Chinesen, die sich um ihn scharten. »Werft die Leichen der Japaner ins Meer, danach waschen wir ihr Blut von unserem Deck. Heute Nacht werden wir gut und voller Stolz schlafen.« Inmitten weiterer Jubelrufe kniete sich Temur neben den Samurai und löste das blutbefleckte Schwert aus der Hand des Toten. Im schummrigen Lichtschein der Schiffslaternen musterte er die japanische Waffe, bewunderte die feine Schmiedekunst und die rasiermesserscharfe Schneide und schob sie dann mit einem zufriedenen Nicken in die Scheide an seiner Taille.
Während die Toten kurzerhand über die Bordwand geworfen wurden, wandte sich der Kapitän des Schiffes, ein ernster Koreaner namens Yon, an Temur.
»Ein wackerer Kampf«, sagte er ohne große Begeisterung. »Aber wie viele Angriffe auf mein Schiff muss ich noch ertragen?«
»Sobald die Südgruppe der Yangtse-Flotte eintrifft, wird der Angriff an Land eröffnet werden. Dann wird der Feind bald zermalmt sein, und diese Überfälle werden aufhören. Vielleicht wirkt auch die Falle abschreckend, die wir dem Feind heute Nacht gestellt haben.«
Yon schnaubte zweifelnd. »Mein Schiff und die Besatzung sollten mittlerweile wieder in Pusan sein. Der ganze Eroberungsfeldzug gerät zu einem Debakel.«
»Die Ankunft der beiden Flotten hätte zwar besser aufeinander abgestimmt werden müssen, doch der Ausgang steht außer Frage. Der Sieg wird unser sein«, erwiderte Temur gereizt.
Als der Kapitän kopfschüttelnd wegging, fluchte Temur leise vor sich hin. Auf koreanische Schiffe und ihre Besatzung sowie auf ein Heer chinesischer Fußkämpfer angewiesen zu sein, war so, als kämpfte man mit gebundenen Händen. Wenn man eine Zehntausendschaft mongolischer Reiterei an Land schaffte, das wusste er, wäre das Inselvolk binnen einer Woche unterworfen.
Mit bloßem Wünschen aber war es nicht getan, und so dachte er unwirsch über die Worte des Kapitäns nach. Der Feldzug hatte in der Tat von Anfang an unter einem schlechten Stern gestanden, und wenn er abergläubisch wäre, hätte er sogar auf den Gedanken kommen können, dass ein Fluch auf ihnen lastete. Als Khubilai, der Kaiser von China und Großkhan des mongolischen Reiches, Tribut von den Japanern verlangt hatte und abgewiesen worden war, hatte es sich von selbst verstanden, dass er eine Flotte losschickte, um sie für ihre Unverschämtheit zu bestrafen. Doch die im Jahr 1274 ausgesandte Flotte war viel zu klein. Noch ehe man einen sicheren Brückenkopf errichten konnte, zerschlug ein schwerer Sturm die mongolische Armada und schmälerte die Anzahl der vor der Küste liegenden Kriegsschiffe.
Jetzt, sieben Jahre später, wollte man den gleichen Fehler nicht noch einmal begehen. Khubilai Khan hatte eine gewaltige Flotte aufgeboten, die aus Einheiten der koreanischen Ostflotte und der aus China kommenden Hauptmacht, der Südgruppe der Yangtse-Flotte bestand. Mehr als hundertfünfzigtausend chinesische und mongolische Soldaten sollten über die japanische Insel Kyuschu herfallen und die lumpigen Aufgebote der Kriegsherren überrennen, die das Land verteidigten. Doch die Streitmacht musste sich erst noch vereinigen. Die Ostflotte, die von Korea aus ansegelte, war zuerst eingetroffen. Ihre nach Ruhm gierenden Befehlshaber hatten versucht, nördlich der Hakata-Bai Truppen anzulanden, die aber rasch zum Stehen gebracht wurden. Angesichts der beherzten japanischen Gegenwehr waren sie gezwungen, sich zurückzuziehen und auf die Ankunft der zweiten Flotte zu warten.
Die zusehends selbstbewusster werdenden japanischen Krieger gingen daraufhin zum Kampf gegen die mongolische Flotte über. Freche Stoßtrupps stahlen sich bei Nacht mit kleinen Booten in den Hafen und griffen die vor Anker liegenden mongolischen Schiffe an. Ein ums andere Mal wurden grausam enthauptete Leichen gefunden, die von einem weiteren Überfall der Samuraikrieger kündeten, welche die Köpfe ihrer erschlagenen Feinde als Kriegsbeute mit nach Hause nahmen. Nach etlichen dieser Angriffe wurden die Schiffe der Erobererflotte miteinander vertäut, damit sie sich gegenseitig Schutz gewähren konnten. Lediglich Temurs Plan, mit seinem Schiff abseits der anderen am Rande der Bucht vor Anker zu gehen, um dem Feind eine Falle zu stellen und einen japanischen Stoßtrupp in den Tod zu locken, war geglückt.
Rein taktisch richteten die nächtlichen Angriffe nur wenig Schaden an, aber sie untergruben die ohnehin schon schwindende Moral der Truppe. Die Soldaten mussten fast drei Monate nach dem Auslaufen aus Pusan noch immer an Bord der engen Schiffe ausharren. Die Verpflegung wurde knapp, die Schiffe verrotteten, und in der Flotte brach die Ruhr aus. Doch Temur wusste, dass sich das Blatt mit der Ankunft der Yangtse-Flotte wenden würde. Die kampferprobten und disziplinierten Truppen aus China würden die nur schlecht geordneten Samuraikrieger mühelos besiegen, sobald sie in großer Zahl gelandet waren. Wenn sie nur endlich einträfen.
Sonnig und klar brach der nächste Morgen an, mit einer steifen Brise aus südlicher Richtung. Kapitän Yon stand am Achterdeck seiner Mugun, eines Versorgungsschiffes, und ließ den Blick über die dicht an dicht liegenden Schiffe in der Hakata-Bai schweifen. Die koreanische Flotte bot einen eindrucksvollen Anblick. Fast neunhundert Schiffe jedweder Größe und Form erstreckten sich quer über die Bucht. Die meisten waren ausladende, robuste Dschunken, manche nur drei Meter, andere, wie Yons Schiff, nahezu fünfundzwanzig Meter lang. Fast alle waren eigens für diesen Feldzug gebaut worden. Doch die Ostflotte, wie sie genannt wurde, würde von der erwarteten Streitmacht um ein Vielfaches übertroffen werden.
Um halb drei Uhr nachmittags erklang ein Ruf aus dem Ausguck, und bald darauf hallten aufgeregte Schreie und dröhnende Trommelschläge über das Hafenbecken. Draußen auf See tauchten die ersten winzigen Punkte der südlichen Flotte am Horizont auf und näherten sich langsam der japanischen Küste. Von Stunde zu Stunde waren immer mehr Punkte zu erkennen, die allmählich größer wurden, bis die ganze See mit einer Unmasse dunkler Holzschiffe mit blutroten Segeln übersät war. Mehr als dreitausend Schiffe mit hunderttausend weiteren Soldaten rückten aus der Korea-Straße an – eine Invasionsflotte, wie sie die Welt bis zur Landung der alliierten Truppen in der Normandie fast siebenhundert Jahre später nicht mehr erleben sollte.
Die Seidensegel der Kriegsflotte erstreckten sich wie eine karmesinrote Regenwand über den Horizont. Die ganze Nacht über und bis weit in den darauffolgenden Tag hinein näherte sich ein Geschwader chinesischer Dschunken nach dem anderen der Küste und sammelte sich in und um die Hakata-Bai, während die Oberbefehlshaber über ein Landungsunternehmen nachdachten. Signalflaggen stiegen am Flaggschiff empor, wo die mongolischen und chinesischen Generäle neue Pläne schmiedeten.
Die Japaner, die sich hinter steinernen Deichmauern verschanzt hatten, blickten voller Entsetzen auf die mächtige Flotte. Die gewaltige Übermacht schien jedoch manch einen Verteidiger in seiner Entschlossenheit eher noch zu bestärken. Andere hingegen wirkten verzweifelt, beteten zu ihren Göttern und flehten um himmlischen Beistand. Selbst die furchtlosesten Samuraikrieger erkannten, dass sie den Angriff höchstwahrscheinlich nicht überleben würden.
Doch tausend Meilen weiter südlich war eine andere Macht am Werk, und zwar eine noch gewaltigere als die Invasionsflotte des Khubilai Khan. Eine brodelnde Gemengelage aus Wind, See und Regen braute sich zusammen und ballte eine ungeheure Kraft in sich. Der Sturm war wie die meisten Taifune in den warmen Gewässern des westlichen Pazifik nahe den Philippinen entstanden. Ein einziges Gewitter in einer Hochdruckfront hatte ihn ausgelöst, denn dadurch trafen warme Luftschichten auf kalte. Die wirbelnden Winde, mit denen die warme Luft vom Meeresspiegel emporgesogen wurde, wuchsen sich allmählich zum Sturm aus. Mit unverminderter Kraft zog er über die See, wurde immer stärker und verheerender und erreichte Windgeschwindigkeiten von über zweihundert Stundenkilometern. Der »Supertaifun«, wie man ihn heute bezeichnen würde, zog zunächst geradewegs nach Norden und drehte dann unverhofft in Richtung Nordost ab. Auf seiner Bahn lagen die südlichen Inseln von Japan und die mongolische Flotte.
Die vor Kyuschu liegende vereinigte Flotte konzentrierte sich unterdessen nur auf den bevorstehenden Kampf. Ohne den aufziehenden Sturm wahrzunehmen, sammelten sich die Schiffe zu einem gemeinsamen Angriff.
»Wir werden zu den Landungsmanövern im Süden beordert«, meldete Kapitän Yong Temur, als in seinem Geschwader die Signalflaggen emporstiegen. »Die ersten Stoßtrupps sind gelandet und haben einen Hafen zum Entladen der Truppen gesichert. Wir sollen Teilen der Yangtse-Flotte aus der Hakata-Bai folgen und unsere Soldaten zur Verstärkung an Land bringen.«
»Für meine Soldaten wird es die reinste Erlösung sein, wenn sie wieder festen Boden unter den Füßen bekommen«, erwiderte Temur. Wie alle Mongolen war er den Krieg zu Lande gewohnt, vor allem den Reiterkampf. Angriffe von See aus waren für die Mongolen etwas Neues, das der Kaiser erst vor wenigen Jahren eingeführt hatte, weil er nur auf diese Weise Korea und Südchina unterwerfen konnte.
»Sie werden noch früh genug an Land kommen«, erwiderte Yon, der das Einholen des Steinankers beaufsichtigte.
Während er mit seinem Schiff der Hauptmacht der Flotte aus der Hakata-Bai und entlang der Küste gen Süden folgte, blickte Yon ein ums andere Mal beklommen zum Himmel, der am Horizont immer schwärzer wurde. Eine einzelne Wolke war dort aufgezogen, die augenscheinlich immer größer wurde, bis sie den ganzen Himmel bedeckte. Als die Dunkelheit anbrach, peitschte der Wind die See auf, und schwere Regentropfen pladderten auf das Schiff. Viele koreanische Kapitäne erkannten die ersten Anzeichen des aufkommenden Sturms und steuerten ihre Schiffe weiter von der Küste weg. Die chinesischen Seeleute indessen, die weniger Erfahrung mit der offenen See hatten, hielten törichterweise ihre Position nahe der Landestelle.
Temur, der in seiner schaukelnden Koje keinen Schlaf fand, stieg an Deck, wo sich acht seiner Männer, seekrank vom Toben der Elemente, an die Reling klammerten. Dutzende Lichter tanzten in der stockdunklen Nacht auf den Wogen, kleine, mit Kerzen bestückte Laternen, die die anderen Schiffe der Flotte kennzeichneten. Viele waren noch immer miteinander vertäut, und Temur sah das ständige Auf und Ab des Kerzenscheins in der rollenden Dünung.
»Ich kann Eure Truppen nicht an Land bringen«, schrie Yon Temur über den heulenden Wind hinweg zu. »Der Sturm nimmt noch zu. Wir müssen auf See hinaus, um nicht an den Felsen zermalmt zu werden.«
Temur nickte lediglich, ohne einen Einwand zu erheben. Obwohl er sich nichts lieber wünschte, als mit seinen Soldaten das stampfende Schiff zu verlassen, wusste er doch, dass jeder derartige Versuch an Tollkühnheit grenzte. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als den Sturm abzuwarten, so sehr ihm beim bloßen Gedanken daran auch graute.
Yon ließ das Luggersegel am Vormast setzen und ging auf Westkurs. Mühsam kämpfte sich das stampfende Schiff durch die immer höher werdenden Wogen und entfernte sich allmählich von der Küste.
Auf den übrigen Schiffen der Flotte herrschte heillose Verwirrung. Zahlreiche chinesische Dschunken versuchten in der kochenden See Truppen an Land abzusetzen, doch die meisten blieben nahe der Küste vor Anker liegen. Nur vereinzelte Schiffe der Ostflotte folgten Yon und nahmen Kurs aufs offene Meer. Offenbar glaubten nur wenige, dass erneut ein Taifun über die Flotte hereinbrechen und sie ein weiteres Mal zerschlagen würde, so wie im Jahr 1274. Doch die Zweifler sollten bald eines Besseren belehrt werden.
Heftiger Wind und sintflutartige Regenfälle kündigten den näher ziehenden Supertaifun an. Kurz nach Anbruch der Morgendämmerung wurde der Himmel pechschwarz, dann brach der Sturm mit aller Macht los, peitschte Gischt und Regen waagerecht vor sich her und zerfetzte die Segel der rollenden und stampfenden Flotte, als wären sie von Hagelkörnern getroffen worden. Unter Donnerschlägen, die man kilometerweit hören konnte, brachen sich gewaltige Wogen an der Küste. Mit gellendem Wind, stärker als bei einem Hurrikan der Kategorie 4, traf der Wirbelsturm schließlich auf Kyushu.
Die japanischen Verteidiger an Land waren einer drei Meter hohen Sturmflut ausgesetzt, die über die Küste hinwegbrandete, Häuser, Ortschaften und Verteidigungsanlagen überschwemmte und Hunderte von Menschen ertränkte. Verheerende Winde entwurzelten Bäume und fegten Trümmer durch die Luft, die wie Geschosse einschlugen. Dazu fiel unentwegt sintflutartiger Regen, in manchen Gegenden bis zu dreißig Zentimeter binnen einer Stunde, der Täler überschwemmte und Flüsse über die Ufer treten ließ. Springfluten und Schlammlawinen, die innerhalb von Sekunden ganze Städte und Ortschaften unter sich begruben, forderten zahllose weitere Opfer.
Doch das Unheil, das die Küste heimsuchte, verblasste im Vergleich mit den wütenden Urgewalten, die über die mongolische Flotte auf See herfielen. Zu den mörderischen Winden und dem peitschenden Regen gesellten sich Mammutwellen, die der tobende Sturm auftürmte. Wogende Wasserberge brandeten gegen die Invasionsflotte an, brachten zahlreiche Schiffe zum Kentern und zertrümmerten andere. Schiffe, die zu nah an der Küste ankerten, trieben binnen kürzester Zeit machtlos in die felsigen Untiefen, wo sie zu Kleinholz zerschlagen wurden. Spanten gaben nach und Balken brachen unter der Wucht der Wogen, sodass Dutzende von Dschunken einfach in der brodelnden See verschwanden. Die in der Hakata-Bai liegenden Schiffe, die noch immer miteinander vertäut waren, waren dem Sturm gnadenlos ausgeliefert. Und wenn eines unterging, zog es die anderen mit in die Tiefe. Die in den rasch sinkenden Schiffen gefangenen Besatzungsmitglieder und Soldaten starben eines schnellen Todes. Aber auch diejenigen, die sich ins tobende Wasser retteten, ertranken kurz darauf, da nur wenige schwimmen konnten.
An Bord der koreanischen Mugun hielten sich Temur und seine Männer verzweifelt fest, während das Schiff wie ein Korken herumgeschleudert wurde. Zwar steuerte Yon gekonnt durch den wütenden Sturm und achtete darauf, dass der Bug stets auf die anrollenden Wogen ausgerichtet war. Doch oft krängte das Schiff so stark, dass Temur dachte, es würde kentern. Yon aber stand unverwandt am Ruder, wenn sich das Schiff wieder aufrichtete, den Mund zu einem entschlossenen Grinsen verzogen, während er mit den tobenden Elementen kämpfte. Erst als ein gewaltiger, gut zwölf Meter hoher Brecher unverhofft im Dämmerlicht auftauchte, wurde selbst der alte Kapitän bleich.
Mit Donnergrollen brach die mächtige Wasserwand über sie herein, fegte wie eine Lawine über das Schiff hinweg und begrub es unter kochendem Wasser und brodelndem Schaum. Mehrere Sekunden lang verschwand das koreanische Schiff in der tobenden See. Den Männern unter Deck wurde kurz flau im Magen, als sie jählings absackten, dann wurde alles schwarz, und selbst das Heulen des Windes verstummte. Eigentlich hätte das hölzerne Schiffe unter der Wucht der Woge bersten müssen, doch die zähe kleine Mugun hielt durch. Als die Riesenwelle vorübergebrandet war, tauchte das Schiff wie eine Erscheinung aus der Tiefe auf und trotzte weiter Wind und Wellen.
Temur war quer über das Deck geschleudert worden, als das Schiff überflutet wurde, und konnte sich nur mit knapper Not an einer Leiter festhalten. Er schnappte nach Luft, als sie wieder auftauchten, dann sah er zu seinem Entsetzen, dass die Masten weggerissen worden waren. Achteraus ertönte ein schriller Schrei im Wasser. Er warf einen kurzen Blick über das Deck und stellte erschrocken fest, dass Yon und fünf koreanische Seeleute sowie eine Handvoll seiner Männer über Bord gespült worden waren. Dann gellte ein Chor banger Hilferufe auf, der jedoch im nächsten Augenblick im heulenden Wind unterging, und Temur sah den Kapitän und seine Männer unmittelbar neben dem Schiff um ihr Leben kämpfen. Doch er konnte nur ohnmächtig zusehen, wie sie von einer großen Woge davongetragen wurden.
Ohne Masten und Besatzung war das Schiff dem Sturm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Tausend Mal hätte es untergehen können, als es hilflos durch die Sturzseen stampfte und rollte und immer wieder von hoch anbrandenden Wogen überflutet wurde. Doch dank seiner simplen, aber stabilen Bauweise hielt sich gerade dieses koreanische Schiff über Wasser, während rundum zahllose chinesische Dschunken in der Tiefe versanken.
Nachdem er sich mehrere Stunden ausgetobt hatte, wurde der Wind schwächer, und auch der trommelnde Regen ließ allmählich nach. Einen Moment lang brach sogar die Sonne durch, und Temur dachte bereits, der Sturm sei vorüber. Doch es war nur das vorüberziehende Auge des Taifuns, das ihnen eine kurze Gnadenfrist gewährte, bevor der Orkan von Neuem losbrach. Unter Deck stieß Temur auf zwei koreanische Seeleute, die noch an Bord waren, und zwang sie, seinen Männern beim Führen des Schiffes zu helfen. Als der Wind wieder auffrischte und der Regen erneut einsetzte, ließen sich Temur und die Seeleute abwechselnd am Ruder festbinden und kämpften gegen die mörderischen Wogen.
Sie hatten keine Ahnung, wo sie sich befanden und in welche Richtung sie segelten, wandten aber ihren ganzen Mut auf, um das Schiff über Wasser zu halten. Dabei war ihnen nicht bewusst, dass der Wind mittlerweile gedreht hatte, aus Norden blies und sie über das offene Meer rasch gen Süden trieb. Der Taifun hatte einen Großteil seiner Kraft verloren, als er auf Kyushu traf, daher setzte er ihnen nicht mehr ganz so heftig zu wie zuvor. Aber noch immer wurde das Schiff von Böen mit einer Windgeschwindigkeit von mehr als hundertfünfzig Stundenkilometern erfasst, die es erbarmungslos durch die Sturzseen peitschten. Temur, vom trommelnden Regen geblendet, wusste nicht mehr, auf welchem Kurs sie unterwegs waren. Mehrmals kam das Schiff dem Land gefährlich nahe und trieb nur knapp an Inseln, tückischen Riffs und Untiefen vorüber, ohne dass sie im Zwielicht des Sturm zu sehen waren. Wie durch ein Wunder lief es nicht auf, und den Männern an Bord wurde überhaupt nicht klar, wie nahe sie dem Tod waren.
Tag und Nacht tobte der Taifun, bevor er allmählich abflaute und Wind und Regen nachließen. Die koreanische Mugun war zwar leck und beschädigt, verbissen und stolz hielt sie sich aber über Wasser. Obwohl Kapitän und Besatzung über Bord gegangen waren und das Schiff kaum mehr als ein Wrack war, hatten Temur und seine Männer die ganze Wucht des mörderischen Sturms überlebt. Umso glücklicher wähnten sie sich, als sich die See endlich beruhigte, so als wären sie vom Schicksal zu etwas Besonderem auserkoren.
Die übrige mongolische Armada, die weniger Glück hatte, wurde von dem mörderischen Taifun fürchterlich geschlagen. Fast die gesamte Yangtse-Flotte wurde vernichtet, entweder an der Felsenküste zertrümmert oder von tobenden Sturzseen versenkt. Eine Unmasse geborstener Spanten und Planken der mächtigen chinesischen Dschunken, koreanischen Kriegsschiffe und Ruderbarken übersäte die Küste. Die Schreie der im Wasser Sterbenden waren längst vom heulenden Wind verweht worden. Viele der Soldaten, die schwere Lederpanzer trugen, sanken sofort zum Meeresgrund, nachdem sie in die Wogen geschleudert worden waren. Andere kämpften trotz aller Panik und hielten sich über Wasser, um der Gewalt der mächtigen, endlos anbrandenden Wellen letztlich doch zum Opfer zu fallen. Und die wenigen Glücklichen, die lebend an Land krochen, wurden binnen kurzer Zeit von plündernden Samuraihorden niedergemacht, die den Strand absuchten. Wie Holzstapel säumten die Toten nach dem Sturm die Küste, und vor Kyushu ragten so viele nur halb versunkene Wracks am Horizont auf, dass es schon hieß, man könne trockenen Fußes über den Golf von Imari laufen.
Die Überreste der Invasionsflotte schleppten sich nach Korea und China zurück und brachten die unvorstellbare Kunde mit, dass es ein weiteres Mal die Natur gewesen war, die die mongolischen Eroberungspläne durchkreuzt hatte. Für Khubilai Khan bedeutete es eine vernichtende Niederlage, die schwerste, die die Mongolen seit den Tagen eines Dschingis Khan erlebt hatten, und sie zeigte aller Welt, dass die Streitkräfte des großen Reiches alles andere als unbesiegbar waren.
Für die Japaner war der aufziehende Taifun nicht weniger als ein Wunder. Trotz der Zerstörungen, die er auf Kyushu anrichtete, hatte er die Insel vor der Eroberung bewahrt und die feindliche Streitmacht vernichtet. Die meisten Menschen glaubten, das sei nur den Gebeten zu verdanken, die zur elften Stunde an die Sonnengöttin im Schrein von Ise gerichtet worden waren. Göttlicher Beistand habe ihnen den Sieg beschert, ein klares Zeichen dafür, dass Japan auf den Beistand der Himmelsmächte zählen könne, um sich fremder Eroberer zu erwehren. Der Glaube an den Kami-Kaze oder »Götterwind«, wie er genannt wurde, war so stark, dass er die ganze japanische Geschichte durchdrang und als Bezeichnung für die Selbstmordpiloten im Zweiten Weltkrieg wieder auftauchte.
Temur und die Überlebenden an Bord des koreanischen Truppentransporters hatten keine Ahnung von der Vernichtung der Invasionsflotte. Da sie aufs offene Meer getrieben worden waren, konnten sie nur vermuten, dass sich die Streitmacht neu formiert hatte, nachdem der Sturm abgezogen war, und den Angriff fortsetzte.
»Wir müssen wieder zur Flotte stoßen«, erklärte Temur seinen Männern. »Der Kaiser erwartet einen Sieg, und wir haben unsere Pflicht zu erfüllen.«
Doch das war leichter gesagt als getan. Nachdem sie drei Tage und Nächte lang ohne Mast und Segel umhergetrieben waren, wusste keiner mehr, wo sie sich befanden. Als das Wetter aufklarte, waren nirgendwo andere Schiffe in Sicht. Noch schlimmer aber war für Temur, dass niemand an Bord wusste, wie man sich auf hoher See orientierte. Die beiden koreanischen Seeleute, die den Sturm überlebt hatten, waren ein Koch und ein betagter Schiffszimmermann, die nichts von Navigation verstanden.
»Japan muss östlich von uns liegen«, erklärte Temur dem koreanischen Zimmermann. »Stell einen neuen Mast und Segel her, dann werden wir anhand der Sonne und der Sterne gen Osten segeln, bis wir Land sichten und feststellen können, wo wir die Flotte finden können.«
Der alte Zimmermann wandte ein, dass das Schiff nicht mehr seetüchtig sei. »Es ist leck und angeschlagen. Wir müssen nach Nordwesten segeln, nach Korea, wenn wir uns retten wollen.«
Doch davon wollte Temur nichts wissen. In aller Eile wurde ein Behelfsmast gezimmert und ein Notsegel gesetzt. Mit neuer Entschlossenheit steuerte der zum Seemann gewordene mongolische Soldat das Schiff in Richtung Osten, konnte es kaum erwarten, die japanische Küste anzulaufen und sich wieder in die Schlacht zu stürzen.
Zwei Tage verstrichen, doch Temur und seine Männer sahen nichts als blaues Wasser. Das japanische Festland kam nicht in Sicht. Überlegungen, den Kurs zu ändern, wurden verworfen, als von Südwesten ein weiterer Orkan aufzog, zwar nicht so heftig wie der Taifun, aber dennoch ein ausgedehntes tropisches Sturmtief, das sich nur langsam weiterbewegte. Fünf Tage lang kämpfte das Schiff gegen schwere Regenfälle und starken Wind, der es hilflos herumwarf. Das angeschlagene Schiff schien die Grenzen seiner Belastbarkeit erreicht zu haben. Der Behelfsmast samt der Segel wurde erneut von Böen über Bord gefegt, und unter der Wasserlinie waren so viele Lecks, dass der Zimmermann rund um die Uhr arbeiten musste. Noch beunruhigender aber war, dass die gesamte Ruderanlage abgebrochen war und zwei von Temurs Männern, die sich daran festklammerten, mit in den Tod gerissen hatte.
Als es so aussah, als könnte das Schiff nicht länger durchhalten, zog der zweite Sturm ab. Doch sobald sich das Wetter beruhigte, wurden die Männer an Bord besorgter denn je. Seit über einer Woche hatten sie kein Land mehr gesichtet, und allmählich schwanden die Vorräte. Die Männer flehten Temur an, das Schiff nach China zu steuern, doch das war wegen der vorherrschenden Winde und Strömungen gar nicht möglich, zumal die Mugun über kein Ruder mehr verfügte. Einsam trieb das Schiff im Ozean, orientierungslos, ohne Navigationshilfen und kaum einer Möglichkeit, es zu steuern.
Temur verlor jedes Zeitgefühl, während die Stunden zu Tagen gerannen und die Tage zu Wochen. Als der Proviant zur Neige ging, ernährte sich die Besatzung von gefangenen Fischen und sammelte Regenwasser zum Trinken. Dann verzogen sich die grauen Sturmwolken allmählich, der Himmel klarte auf, und sonniges Wetter brach an. Mit dem Abflauen des Windes stieg die Temperatur. Das Schiff samt seiner Besatzung schien sich nicht von der Stelle zu rühren, trieb noch immer ziellos über eine glatte See. Bald darauf hielt der Tod Einkehr auf der Mugun. Bei jedem Sonnenaufgang fand man einen neuen Leichnam, war wieder ein verhungernder Seemann über Nacht gestorben. Temur kam sich geradezu entehrt vor, wenn er seine ausgezehrten Soldaten betrachtete. Statt des ruhmreichen Schlachtentods hatte ihnen das Schicksal ein elendes Verderben auf einem menschenleeren Ozean fern von der Heimat beschieden.
Als die Männer rundum in der Mittagssonne vor sich hin dösten, brach an Backbord plötzlich lautes Geschrei aus.
»Ein Vogel!«, schrie jemand. »Mach ihn tot.«
Temur sprang auf und sah, wie drei Männer einen großen Meeresvogel mit schwarzem Schnabel zu umringen versuchten. Der Vogel hüpfte aufgeregt umher und beäugte die Männer mit wachsamem Blick. Einer der Männer ergriff mit knorriger, sonnenverbrannter Hand einen Holzhammer und warf ihn blitzschnell nach dem Vogel, in der Hoffnung, ihn zu betäuben oder zu töten. Der Vogel wich dem wirbelnden Hammer geschickt aus, stieß einen entrüsteten Schrei aus und schwang sich mit einem trägen Flügelschlag zum Himmel auf. Während die Männer lauthals fluchten, musterte Temur schweigend den Vogel und folgte ihm mit seinem Blick, als er gen Süden flog und allmählich am Horizont verschwand. Blinzelnd betrachtete er die blaue Linie in weiter Ferne, wo Wasser und Himmel ineinander übergingen, dann aber zog er eine Augenbraue hoch. Er zwinkerte ein paar Mal, sah wieder hin und straffte sich leicht, als er einen kleinen, grünen Punkt am Horizont bemerkte. Dann bestätigte ihm seine Nase, dass er nicht fantasierte. Die feuchte Salzluft, an die sich Temur mittlerweile gewöhnt hatte, roch mit einem Mal anders. Ein schwacher Blütenduft wehte zu ihm. Er atmete tief durch, räusperte sich und wandte sich an die Männer an Deck.
»Da vorn ist Land«, sagte er mit ausgedörrter Stimme und deutete an die Stelle, wo die Möwe verschwunden war. »Jeder Mann, der noch bei Kräften ist, muss mithelfen, damit wir es ansteuern können.«
Bei seinen Worten rappelte sich die erschöpfte und ausgezehrte Besatzung auf. Nachdem sie eine ganze Weile auf den fernen Fleck am Horizont gestarrt hatten, besannen sich die Männer und machten sich ans Werk. Ein großer Decksbalken wurde zersägt, an Tauen befestigt und über das Heck abgelassen, wo er als notdürftiges Ruder dienen sollte. Während drei Mann mit dem Balken kämpften, um das Schiff zu steuern, schnappten sich die restlichen alles, was sich als behelfsmäßiges Ruder verwenden ließ, Besen, Planken und sogar Säbel, und mühten sich mit dem Mut der Verzweiflung, das angeschlagene Schiff an Land zu bringen.
Langsam wurde der Punkt in der Ferne größer, bis eine smaragdgrün schimmernde Insel mit einer breiten, hoch aufragenden Bergspitze vor ihnen auftauchte. Als sie näher kamen, sahen sie schwere Brecher, die an eine senkrecht aufragende Felsküste brandeten. Einen bangen Augenblick lang geriet das Schiff in eine Gegenströmung, die es auf eine von schroffen Klippen umgebene Bucht zutrieb.
»Riff voraus!«, schrie der alte Schiffszimmermann, der die aufragenden Felsen vom Bug aus im Auge behielt.
»Alle Mann zur linken Seite«, brüllte Temur, als sie auf eine dunkle Felswand zuhielten. Das halbe Dutzend Männer an Steuerbord rannte, humpelte oder kroch nach Backbord und schlug mit den Ersatzrudern wie besessen aufs Wasser ein. Erst in letzter Sekunde konnten sie den Bug von den Felsen wegdrehen, und selbst dann hielten sie noch die Luft an, als die Backbordwand an eine Reihe unter Wasser liegender Felsen schrammte. Dann endete das mahlende Scharren, und den Männern wurde klar, dass die Rumpfplanken des Schiffes einmal mehr standgehalten hatten.
»Hier können wir nirgendwo an Land gehen«, schrie der Zimmermann. »Wir müssen wenden und zurück auf See.«
Temur spähte auf die blanken Felsklippen, die über der Küste aufragten. Eine hohe, schroffe Wand aus porösem schwarzem und grauem Gestein erstreckte sich vor ihnen, nur vom kleinen, schwarzen Oval einer Bucht unterbrochen, die an Steuerbord unmittelbar voraus lag.
»Bringt den Bug herum. Rudert, Männer, immer weiter rudern.«
Mit aller Kraft pullten die ausgepumpten Männer das Boot von den Felsen weg und in die ablandige Strömung. Sie trieben an der Insel entlang, bis sie sahen, dass die hoch aufragende Küste allmählich flacher wurde. Endlich stieß der Zimmermann die Worte aus, auf die die Besatzung wartete.
»Hier können wir landen«, sagte er und deutete auf eine große, halbmondförmige Bucht.
Temur nickte, worauf die erschöpften Männer das Schiff mit letzter Kraft zur Küste steuerten und in die Bucht hineinruderten, auf einen Sandstrand zu, bis der verkrustete Rumpf ein paar Schritte vor dem Festland auf Grund lief.
Die Männer waren so geschwächt, dass sie kaum vom Schiff klettern konnten. Temur nahm sein Schwert und schleppte sich mit fünf Mann an Land, um Nahrung und Trinkwasser zu suchen. Als sie in der Ferne Wasser rauschen hörten, schlugen sie sich einen Pfad durch dichte Farngewächse und stießen auf eine Süßwasserlagune, gespeist von einem Wasserfall, der über einen Felssims herabstürzte. Jubelnd stürzten sich Temur und seine Männer in die Lagune und tranken das kühle Wasser in großen Zügen.
Doch ihre Ausgelassenheit endete jählings, als ein dumpfes Dröhnen durch die Luft drang. Es war der Schlag der Signaltrommel an Bord des koreanischen Schiffes, der zur Schlacht rief. Temur sprang sofort auf und rief seine Männer zusammen.
»Zurück zum Schiff. Sofort.«
Ohne darauf zu warten, dass sich seine Männer gesammelt hatten, stürmte er in Richtung Schiff los. Sämtliche Schmerzen und auch die Schwäche in seinen Beinen, die ihm gerade noch zu schaffen gemacht hatten, waren durch das erfrischende Wasser und die jähe Aufregung verflogen. Er hörte, wie der Trommelschlag lauter wurde, als er durch den Dschungel rannte und allmählich näher kam, bis er einen Palmenhain passierte und den Sandstrand erreichte.
Mit dem geübten Blick eines altgedienten Soldaten suchte er das umliegende Gewässer ab und entdeckte sofort den Grund für den Alarm. Auf halber Breite der Bucht hielt ein schmales Kanu auf das gestrandete Schiff zu. Darin saßen ein halbes Dutzend Männer mit nacktem Oberkörper, die in stetem Rhythmus spatenförmige Paddel ins Wasser tauchten und das Boot rasch in Richtung Küste trieben. Temur bemerkte die dunkle, bronzefarbene Haut der Männer, die größtenteils lockige schwarze Haare hatten, und zwar kürzere als seine. Mehrere Männer trugen Halsketten mit einem hakenförmigen Knochen, der ihnen über der Brust hing.
»Eure Befehle?«, fragte der abgemagerte Soldat, der die Trommel geschlagen hatte.
Temur zögerte einen Augenblick, bevor er antwortete, wusste er doch, dass selbst eine Schar alter Jungfern mit seiner Besatzung in ihrem derzeitigen Zustand fertig werden würde.
»Bewaffnet euch mit Speeren«, befahl er in aller Ruhe. »Bildet hinter mir eine Verteidigungslinie am Strand.«
Die Überlebenden seines Trupps schleppten sich vom Schiff und aus dem Dschungel und bezogen mit den wenigen verbliebenen Speeren hinter Temur Stellung. Die abgerissenen Soldaten hatten kaum noch Kraft, aber Temur wusste, dass sie notfalls bis auf den Tod für ihn kämpfen würden. Er tastete nach dem Griff des japanischen Samuraischwertes und fragte sich, ob er wohl mit der Klinge in der Hand sterben würde.
Das Kanu, dessen Ruderer das Boot lautlos zur Küste paddelten, hielt gezielt auf die Männer am Strand zu. Als der Bug über den Sand scharrte, sprangen die Insassen heraus, zogen das Kanur rasch an Land und stellten sich dann neben dem Boot auf. Mehrere Sekunden lang musterten sich die beiden Parteien argwöhnisch. Schließlich schritt einer der Männer aus dem Kanu über den Strand und blieb vor Temur stehen. Er war klein, kaum einen Meter fünfzig groß, älter als die anderen und hatte lange weiße Haare, die er mit einem Baststreifen zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Er trug eine Kette aus Haifischzähnen um den Hals und hielt einen Stock aus knorrigem Treibholz in der Hand. Seine braunen Augen funkelten, als er den Mongolen anlächelte und eine Reihe schiefer, aber strahlend weißer Zähne zeigte. Er stieß ein paar rasche Worte in einem melodischen Singsang aus, offenbar einen Gruß. Temur nickte nur leicht, ohne die anderen Männer am Kanu aus dem Auge zu lassen. Der Alte plapperte ein paar Minuten lang, kehrte dann jählings zum Kanu zurück und griff hinein.
Temur schloss die Hand fester um das japanische Schwert und warf seinen Männern einen warnenden Blick zu. Doch seine Anspannung legte sich, als der Alte sich aufrichtete und einen fetten, gut dreißig Pfund schweren Gelbflossenthunfisch hoch hielt. Die anderen Eingeborenen beugten sich ebenfalls in das Kanu, holten weitere Fische und Binsenkörbe mit Schalentieren heraus, die sie vor Temurs Männern ablegten. Die ausgehungerten Soldaten warteten bangen Blickes auf die Erlaubnis des mongolischen Anführers, dann machten sie sich gierig über die Nahrung her und lächelten ihren Gastgebern zu. Unterdessen ging der Alte zu Temur und bot ihm einen mit Wasser gefüllten Trinkschlauch aus Schweinsleder an.
Als beide Seiten Vertrauen zueinander gefasst hatten, deuteten die Eingeborenen in den Dschungel und winkten den Schiffbrüchigen zu, dass sie ihnen folgen sollten. Zögernd verließen Temur und seine Männer ihr Schiff und trotteten hinter den Eingeborenen durch den Urwald, bis sie nach einem zwei, drei Kilometer langen Marsch auf eine Lichtung traten. Mehrere Dutzend kleiner, mit Stroh gedeckter Hütten standen rund um ein eingezäuntes Gehege, in dem etliche Kinder mit einer Schar Schweine spielten. Auf der anderen Seite der Lichtung befand sich eine größere Hütte mit hohem Dach, das Haus des Dorfvorstehers, der, wie Temur zu seiner Überraschung feststellte, niemand anders war als der weißhaarige Alte.
Die Bewohner des Dorfes glotzten die Fremdlinge an, während in aller Eile ein Fest vorbereitet wurde, mit dem man die asiatischen Krieger als Ehrengäste in der Gemeinschaft willkommen hieß. Das Schiff, die Kleidung und die Waffen der Fremdlinge deuteten auf großes Wissen hin, und insgeheim schätzte man die Männer als neue Verbündete im Kampf gegen mögliche Feinde. Die chinesischen und koreanischen Krieger aber waren einfach froh, noch am Leben zu sein, und nahmen dankbar die großzügigen Speisen, die Unterkünfte und die Gefährtinnen an, die man ihnen bot. Nur Temur reagierte zurückhaltend auf die Gastfreundschaft. Während er mit dem Dorfvorsteher eine gegrillte Abalone verzehrte und seine Männer betrachtete, die zum ersten Mal seit Wochen wieder ihr Dasein genossen, fragte er sich, ob er die Mongolei jemals wiedersehen würde.
Im Lauf der nächsten Wochen ließen sich die Männer der mongolischen Invasionsflotte in der Ortschaft nieder und lebten sich allmählich in der Dorfgemeinschaft ein. Temur hingegen weigerte sich anfangs noch und schlief jede Nacht in dem faulenden Schiff. Erst als der vom Sturm zerschlagene Rumpf endgültig auseinanderbrach und die Überreste der Mugun auf den Grund der Bucht sanken, zog auch er widerwillig in das Dorf um.
Wieder und wieder gingen ihm Gedanken an seine Frau und die vier Kinder durch den Kopf, aber jetzt, da das Schiff verloren war, gab Temur jegliche Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat auf. Seine Besatzung hingegen fand sich nur zu gern mit dem neuen Leben auf dem tropischen Eiland ab, das sie viel reizvoller fanden als das freudlose Dasein als Soldaten des mongolischen Kaisers in China. Ihr kampflustiger Befehlshaber jedoch war ein treuer Gefolgsmann des Khans und wusste, dass er die Pflicht hatte, bei der erstbesten Gelegenheit zurückzukehren und wieder in dessen Dienst zu treten. Aber da sein Schiff zertrümmert am Grund der Bucht lag, bot sich ihm keinerlei Möglichkeit zur Heimkehr. Verbittert und widerwillig fand sich Temur mit seinem Dasein als Gestrandeter auf der großen Insel ab.
Die Jahre verstrichen, und allmählich ließ die Entschlossenheit des alten Kriegers nach. Im Lauf der Zeit hatten Temur und seine Männer die melodische Sprache der Inselbewohner gelernt. Und der mongolische Kommandeur genoss es, wenn er und der weißhaarige Häuptling einander Abenteuergeschichten erzählten. Mahu, wie er genannt wurde, prahlte damit, dass seine Vorfahren vor ein paar Generationen mit riesigen Segelschiffen auf große Fahrt über die endlose See gegangen seien. Die Insel, so sagte er, habe sie mit einem Grollen und einer Rauchwolke aus der Bergspitze empfangen, ein Willkommenszeichen der Götter, dass sie sich hier niederlassen und es sich wohlergehen lassen sollten. Seither wären ihnen die Götter gnädig gewesen und hätten sie mit einem Stück Land beschenkt, in dem mildes Klima herrschte und Nahrung im Überfluss vorhanden war.
Temur verkniff sich ein Lachen, fragte er sich doch, wie die primitiven Eingeborenen, die mit ihren kleinen Kanus kaum zu den Nachbarinseln übersetzen konnten, den Ozean überquert haben wollten.
»Ich möchte gern eins dieser riesigen Segelschiffe sehen«, entgegnete er dem alten Mann also ungläubig.
»Ich werde dich zu einem bringen«, erwiderte Mahu unwirsch. »Dann kannst du dich selbst davon überzeugen.«
Belustigt stellte Temur fest, dass es der alte Häuptling ernst meinte, und ging auf sein Angebot ein. Nach einem zweitägigen Marsch quer über die Insel, auf dem er seine Neugier bereits zu bereuen begann, führte der überwucherte Dschungelpfad, dem sie folgten, überraschend auf einen schmalen Sandstrand. Temur blieb stehen, als er den Sand unter den Füßen spürte, worauf der Alte schweigend ans andere Ende des Strandes deutete.
Temur erkannte es nicht gleich. Er ließ den Blick über den Sand schweifen, sah aber nur zwei große Baumstämme, die im rechten Winkel zum Wasser lagen. Ansonsten wirkte der Strand einsam und verlassen. Als er erneut zu den gefällten Bäumen schaute, wurde ihm mit einem Mal klar, dass er mehr als nur totes Holz vor sich hatte – die Stämme bildeten den Stützrahmen eines mächtigen Floßes, das halb im Sand vergraben lag.
Der mongolische Krieger, der seinen Augen kaum traute, rannte hin. Und mit jedem Schritt stieg seine Erregung. Obwohl der uralte Segler offensichtlich seit Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten am Strand lag, war er noch immer intakt. Temur erkannte, dass es sich um ein Boot mit Doppelrumpf und einem flachen Deck handelte, das von den beiden Stämmen getragen wurde. Es war rund achtzehn Meter lang und hatte einst einen großen Mast besessen, der mittlerweise verfault war. Das mit Planken belegte Deck hatte sich zwar aufgelöst, aber die mächtigen Stützbalken wirkten noch genauso fest wie zu der Zeit, da sie gefällt worden waren. Temur hatte nicht den geringsten Zweifel, dass er es mit einem hochseetüchtigen Boot zu tun hatte. Mahus fantastische Geschichte stimmte also. Aufgeregt betrachtete Temur die Überreste des Gefährts, meinte er doch in ihnen eine Möglichkeit zu sehen, von der Insel wegzukommen.
»Du wirst mich nach Hause und zu meinem Kaiser zurückbringen«, flüsterte er der mächtigen Holzkonstruktion zu.
Mit Hilfe eines eingeborenen Arbeitstrupps und unter Anleitung des koreanischen Schiffszimmermannes machte sich Temur nun daran, das alte Segelboot zu überholen. In der Nähe wachsende Hartholzbäume wurden gefällt und zu Decksplanken zurechtgehauen. Kokosfasern wurden zu Tauwerk geflochten und an Rumpfplanken und Stützen festgemacht. Ein großes Binsensegel wurde gewebt und am Ersatzmast angebracht, den sie aus einem jungen Baum nahe dem Strand hergestellt hatten. Innerhalb weniger Wochen war der fast vergessene Hochseesegler dem Sand entrissen und bereit, die Wogen zu durchpflügen.
Zum Segeln des Bootes hätte Temur seine alten Kampfgefährten an Bord beordern können, doch er wusste, dass die Mehrzahl gar nicht bereit war, ihr Leben erneut für eine wagemutige Seefahrt aufs Spiel zu setzen. Viele Männer hatten mittlerweile Frauen und Kinder auf der Insel. Als er sich nach Freiwilligen erkundigte, traten nur drei Mann sowie der alte Mahu vor. Mehr konnte Temur nicht verlangen. Es waren zwar kaum genügend Männer, um das alte Boot zu segeln, aber der mongolische Kommandeur fand sich mit der Entscheidung der anderen ab, die lieber bleiben wollten.
Proviant wurde eingelagert, dann warteten die Männer so lange, bis Mahu erklärte, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei.
»Die Göttin Hina wird uns jetzt eine sichere Fahrt nach Westen gewähren«, sagte er eine Woche später zu Temur, als der Wind drehte. »Lass uns aufbrechen.«
»Ich werde dem Kaiser von seiner neuen Kolonie in diesem fernen Land berichten«, rief er den am Strand versammelten Männern zu, als der Doppelrumpf durch die Brandung stieß und von einem ablandigen Wind rasch aufs Meer hinausgetrieben wurde. Das Schiff hatte reichlich Wasser, getrocknete Fische und Früchte an Bord, sodass sie wochenlang auf See überleben konnten.
Als die üppige grüne Insel hinter ihnen in den Wogen verschwand, wurden die Männer an Bord des Katamarans einen Augenblick lang unsicher und kamen sich töricht vor. Der mörderische Kampf gegen die See, den sie vor mehr als einem Jahrzehnt hatten bestehen müssen, kam ihnen wieder in den Sinn, und alle fragten sich, ob die Urgewalten der Natur sie wohl auch diesmal am Leben ließen.
Doch Temur war zuversichtlich. Er vertraute Mahu. Zwar hatte der alte Häuptling wenig Erfahrung im Segeln, dagegen hatte er mühelos den Stand der Sterne bestimmt, tagsüber den Lauf der Sonne verfolgt und Wolken und Dünung gemustert. Mahu wusste, dass die auf der Insel herrschenden Südwinde im Herbst auf Ost drehten, sodass sie von einer steten Brise in Richtung Heimat getrieben werden würden. Mahu war es auch, der wusste, wie man mit einer Leine, einem knöchernen Haken und einem Fliegenden Fisch als Köder Thunfische fangen und damit die Verpflegung während der langen Fahrt aufstocken konnte.
Nachdem die Insel endgültig verschwunden war, stellte die unerfahrene Besatzung fest, dass sich ihr Boot überraschend leicht segeln ließ. Vierzehn Tage lang wurden sie jeden Tag aufs Neue von klarem Himmel und ruhiger See empfangen, während der Wind sie stetig vorantrug. Nur ein gelegentlicher Sturm stellte die Stabilität des Bootes auf die Probe, gab der Besatzung zugleich aber auch die Gelegenheit, frisches Regenwasser zu sammeln. Und die ganz Zeit über erteilte Mahu in aller Ruhe seine Befehle und orientierte sich ständig am Stand der Sonne und der Sterne. Als er etliche Tage später den Horizont betrachtete, bemerkte er einen ungewöhnlichen Wolkenhaufen im Südwesten.
»Land im Süden, zwei Tage entfernt«, rief er aus.
Die Besatzung reagierte erleichtert und aufgeregt auf die Nachricht, dass sie bald wieder auf festes Land stoßen würden. Aber wo waren sie, und welchem Land näherten sie sich?
Am nächsten Morgen tauchte ein Punkt am Horizont auf, der von Stunde zu Stunde größer wurde. Es war aber kein Land, sondern ein anderes Segelschiff, das ihren Kurs kreuzte. Als es näher kam, sah Temur, dass es ein niedriges Achterdeck hatte und den Wind mit einem Dreieckssegel einfing. Es war also keine chinesische Dschunke, wie er wusste, sondern allem Anschein nach ein arabisches Handelsschiff. Der Kauffahrer drehte längsseits neben dem Katamaran bei, worauf ihnen ein schlanker, dunkelhaariger Mann in einem leuchtend bunten Gewand von der Reling aus einen Gruß zurief. Temur musterte den Mann einen Augenblick lang, bis er davon überzeugt war, dass von ihm keine Gefahr drohte, und kletterte dann an Bord des kleinen Seglers.
Das Handelsschiff stammte aus Sansibar, und sein muslimischer Kapitän lieferte schon seit Jahren Waren an den Hof des Großkhans. Das Schiff war nach Shanghai unterwegs und mit Ebenholz, Gold und Gewürzen beladen, die gegen kostbares chinesisches Porzellan eingetauscht werden sollten. Temurs kleine Besatzung, die an Bord herzlich empfangen wurde, sah bedrückt zu, als ihr bewährter Katamaran losgeschnitten wurde und in den Pazifik davontrieb.
Der gerissene muslimische Kapitän vermutete seinerseits, dass ihm günstigere Handelsbedingungen eingeräumt werden würden, wenn er einem mongolischen Kommandeur das Leben rettete, und er wurde nicht enttäuscht. Beim Anlegen in der Hafenstadt Shanghai sorgte das Schiff sofort für Aufsehen. In Windeseile verbreitete sich die Kunde von der Rückkehr der Soldaten, die dreizehn Jahre nach dem gescheiterten Angriff auf Japan wieder aufgetaucht waren. Sendboten der Regierung nahmen Temur und seine Männer in Empfang und brachten sie zu einer Audienz beim Kaiser in die Hauptstadt Ta-tu. Auf dem Weg dorthin erkundigte sich Temur bei seinen Begleitern, was sich auf dem Schlachtfeld und im Reich während seiner Abwesenheit ereignet habe.
Ein Großteil der Nachrichten war entmutigend. Der Angriff auf Japan war eine einzige Katastrophe gewesen, berichtete man ihm, da ein Taifun mehr als zweitausend Schiffe vernichtet und fast hunderttausend Männer getötet habe. Sehr zu seinem Kummer erfuhr er, dass sein Oberbefehlshaber und viele seiner Kameraden nicht mit den Überresten der Flotte zurückgekehrt waren. Nicht weniger beunruhigend war die Mitteilung, dass die japanischen Inseln noch immer nicht erobert waren. Zwar wollte Khubilai Khan einen dritten Eroberungsversuch unternehmen, doch seine Ratgeber hatten ihm dies klugerweise ausreden können.
In etwas mehr als einem Jahrzehnt war die Vormachtstellung des gesamten Reiches erschüttert worden. Nach der Niederlage vor der japanischen Küste war auch ein Kriegszug gegen das unbotmäßige Vietnam gescheitert, und zugleich hatten die Kosten für den Ausbau des Großen Kanals nach Chung-tu beinahe zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft geführt. Zudem machte man sich um den Gesundheitszustand des Kaisers Sorgen und befürchtete Schlimmes, was seinen Nachfolger betraf. Insgeheim murrte das Volk darüber, dass das Reich der Mitte von einem Mongolen regiert wurde. Und jetzt gab es allem Anschein nach kaum noch Zweifel, dass die Yüan-Dynastie des Khubilai Khan, der 1279 die Song besiegt und China unter einem Herrscher vereint hatte, in einem langsamen Niedergang begriffen war.
Bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt Ta-tu wurden Temur und seine Männer in den kaiserlichen Palast gebracht und in die Privatgemächer des Herrschers geleitet. Temur, der Khubilai Khan in früheren Jahren des Öfteren gesehen hatte, erschrak beim Anblick seines obersten Kriegsherrn. Ein fetter, abgespannt wirkender Mann, der ihn mit einem mürrischen Blick aus seinen schwarzen Augen musterte, ruhte, in kostbare Seidengewänder gekleidet, auf einer gepolsterten Liege. Aus Trauer über den kürzlichen Tod seiner Lieblingsfrau und den Verlust seines zweiten Sohnes hatte Khubilai Khan in Speis und Trank Trost gesucht und sprach beidem im Übermaß zu. Zwar hatte er das erstaunliche Alter von achtzig Jahren erreicht, doch jetzt ruinierte die hemmungslose Völlerei die Gesundheit des Herrschers. Temur bemerkte den entzündeten, von der Gicht geplagten Fuß des Khans, der auf einem Kissen ruhte, während Krüge mit vergorener Stutenmilch in Reichweite standen.
»Temur, du bist nach langer Abwesenheit zurückgekehrt, um dich wieder deiner Pflicht zu widmen«, stellte der Khan mit heiserer Stimme fest.
»Wie der Kaiser befiehlt«, erwiderte Temur und verbeugte sich tief.
»Berichte von deinen Reisen, Temur, und dem geheimnisvollen Land, an dem du gestrandet bist.«
Kunstvoll geschnitzte Stühle wurden für Temur und seine Männer gebracht, worauf der mongolische Kommandeur von dem heftigen Taifun berichtete, der sein Schiff von Japan weggeweht hatte, und den anschließenden Entbehrungen, als sie hilflos auf dem Meer getrieben waren. Während Becher mit Stutenmilch herumgereicht wurden, schilderte er die glückliche Landung auf der grünen Insel und den Empfang durch die Eingeborenen. Dann stellte er Mahu vor und erzählte, dass ihm der Alte beim Segeln des Katamarans über die offene See geholfen habe, bis sie auf den muslimischen Händler gestoßen seien.
»Eine bemerkenswerte Fahrt«, lobte der Khan. »Waren die Ländereien, auf die du gestoßen bist, reich und fruchtbar?«
»Außerordentlich. Der Boden ist sehr ergiebig, und da das Klima mild ist und viel Regen fällt, gedeiht dort eine Vielzahl von Wild- und Nutzpflanzen.«
»Glückwunsch, mein Herr«, sagte ein runzliger Mann mit weißem Bart, der neben dem Khan stand. Der konfuzianische Ratgeber des Herrschers war offenbar nur mäßig beeindruckt von der Erzählung und den geladenen Gästen. »Ihr habt dem Reich wieder neue Ländereien gewonnen.«
»Ist es wahr, dass du eine Garnison zurückgelassen hast?«, fragte der Khan. »Stehen die Länder jetzt unter mongolischer Herrschaft?«
Temur verfluchte den konfuzianischen Ratgeber insgeheim für seine Ränke, mit denen er dem Kaiser neuen Ruhm vorgaukeln wollte. Denn er wusste, dass die Männer, die er zurückgelassen hatte, bereits vor langer Zeit das Schwert niedergelegt und sich dem Familienleben gewidmet hatten. Ihre Treue zum Khan war schon, bevor sie schiffbrüchig wurden, fraglich gewesen.
»Ja«, log Temur. »Eine kleine Abteilung herrscht in Eurem Namen über das Land.« Beschämt schaute er zu dem alten Häuptling, doch Mahu, der die Politik des Reiches offenbar verstand, nickte bloß.
Khubilai blickte über die Männer hinweg, als sehe er ein Bild weit jenseits der Mauern des Palastes. Temur fragte sich, ob der mongolische Herrscher betrunken war.
»Ich möchte diesen wundersamen Ort sehen, dieses Land, in dem die Sonne in meinem Reich aufgeht«, flüsterte der Khan schließlich verträumt.
»Ja, es ist beinahe ein Paradies auf Erden. So herrlich wie alle Ländereien unter Eurer Herrschaft.«
»Kennst du den Weg dorthin, Temur?«
»Ich verstehe nichts von Navigation auf hoher See, aber Mahu kann sich anhand der Sonne und der Sterne orientieren. Mit einem tüchtigen Schiff könnte er den Weg nach Hause finden, glaube ich.«
»Du hast dem Reich gute Dienste erwiesen, Temur. Für deine Treue sollst du reich belohnt werden«, keuchte der Khan, hustete dann und spie einen Mundvoll Stutenmilch über sein Seidengewand.
»Vielen Dank, mein Herr«, erwiderte er und verbeugte sich erneut. Dann tauchten zwei Palastwachen auf und geleiteten Temur und seine Männer aus dem Gemach des Kaisers.
Der mongolische Kommandeur war bedrückt, als er den Palast verließ. Der große Khubilai Khan war alt und müde, nur mehr ein Schatten des alten Herrschers, der eines der größten Reiche der Welt regierte. Zumal Khubilai, der weit mehr als nur ein blutrünstiger Eroberer war – wie sein Großvater – , mit einer noch nie dagewesenen Weisheit geherrscht hatte. Er hatte Händler und Forschungsreisende aus fernen Ländern willkommen geheißen, Gesetze zur Duldung anderer Religionen erlassen und die Wissenschaften, allen voran die Geographie, die Astronomie und die Medizin gefördert. Jetzt war er dem Tode nah, und ohne seine weitsichtige Herrschaft würde das Reich weitaus weniger Einfluss haben.
Als Temur den großen Palast verließ, bemerkte er mit einem Mal, dass Mahu nicht mehr bei ihm war. Offenbar, so wurde ihm nun klar, war der alte Häuptling im Gemach des Kaisers zurückgeblieben. Temur wartete auf ihn, doch nach etlichen Stunden gab er es endlich auf, verließ die Hauptstadt und begab sich in sein Heimatdorf und zu seiner Familie. Er sah den Alten, der ihn nach Hause geleitet hatte, nie wieder und fragte sich oftmals, was aus seinem Freund aus der Fremde geworden sein mochte.
Nur zwei Monate später wurde die traurige Nachricht vom Tod des großen Kaisers bekanntgegeben. Khubilai Khan war schließlich an Altersschwäche und den Folgen unmäßigen Alkoholgenusses gestorben. In Ta-tu, der Stadt, die er zu seinem ersten Regierungssitz auserkoren hatte, wurde eine aufwändige Abschiedsfeier für den toten Herrscher ausgerichtet. Später errichtete man südlich der Stadt, die heute Peking heißt, einen Altar zu seinen Ehren, der noch heute dort steht. Nach den öffentlichen Gedenkfeiern verließ ein Trauerzug die Stadt, der den Sarg des Großkhans in einer prachtvollen Kutsche mit sich führte. Von tausend Pferden und Soldaten begleitet, marschierte er langsam nach Norden, in die Mongolei, die Heimat des Großkhans. An einem geheimen Ort im Kentei-Gebirge wurde die letzte Ruhestätte des Khubilai Khan angelegt, in die man ihn mit reichen Grabbeigaben, Tieren, Konkubinen und Schätzen aus dem gesamten Reich bestattete. Damit auch im Tode niemand seinen Frieden störte, wurde die ganze Gegend von Pferden zertrampelt, um die Grabstätte zu tarnen. Die Bauarbeiter, die das Grabmal ausgeschachtet hatten, wurden auf der Stelle hingerichtet, und die Befehlshaber des Trauerzuges mussten unter Androhung der Todesstrafe schwören, das Geheimnis zu wahren. Wenige Jahre später war die Grabstätte des Mongolenherrschers vergessen und das Gedenken an Khubilai Khan von den Winden, die unermüdlich über die grünen, bewaldeten Hänge der Bergkette fegen, verweht.
Tausend Meilen weiter südlich glitt eine große chinesische Dschunke vor Anbruch der Morgendämmerung aus ihrem Liegeplatz im Hafen von Shanghai und trieb lautlos den Gelben Fluss hinab zum Pazifischen Ozean. Die mächtige Dschunke, eines von nur einer Handvoll hochseetüchtigen Handelsschiffen in der Flotte des Kaisers, war über sechzig Meter lang und hatte ein Dutzend Segel an vier hohen Masten. Da das Yüan-Reich noch immer Trauer trug, führte das Schiff nicht das übliche Staatsbanner – es hatte überhaupt keine Flaggen gehisst.
Die wenigen Menschen, die sich um diese Tageszeit am Ufer des Flusses aufhielten, wunderten sich über das frühe Auslaufen des großen Schiffes, das sonst nur unter großem Geschrei seine Segel setzte. Nur einer Handvoll Zuschauern fiel auf, dass es lediglich mit halber Besatzung bemannt war. Und nur ein paar Einzelne bemerkten den sonderbaren, dunkelhäutigen alten Mann, der mit wehendem weißem Haar neben dem Kapitän am Ruder stand und auf die Wolken und die aufgehende Sonne deutete. In einer fremden Sprache gab er den Kurs des majestätischen Schiffes vor, als es das Reich der Mitte verließ und in den weiten blauen Ozean vorstieß, unterwegs zu einem fernen Ziel, das auf keiner Karte verzeichnet war.
Spuren einer Dynastie
4. August 1937
Shang-tu, China
Der dumpfe Donner in der Ferne hallte wie der Ruf einer Kriegstrommel herüber. Erst ein trockener Knall, auf den ein paar Sekunden später ein markerschütterndes Krachen folgte. Die Stille zwischen jedem Schlag verleitete einen zu der trügerischen Hoffnung, das Getöse sei nun vorbei. Dann drang jedoch ein weiterer gedämpfter Knall durch die Luft, der allen an den Nerven zerrte, die sich in Hörweite befanden und auf den anschließenden Einschlag warteten.
Leigh Hunt stand in dem frisch ausgehobenen Graben auf, reckte die Arme hoch und stellte auf einer Mauer aus Lehmziegeln dann vorsichtig eine Schale ab. Der Archäologe, der in Oxford studiert hatte und in den Diensten des Britischen Museums stand, trug eine lange Khakihose und ein dazu passendes Hemd mit zwei Brusttaschen, beides verschwitzt und mit einer feinen Staubschicht bedeckt. Statt des typischen Tropenhelms hatte er einen zerbeulten Fedora auf, der seinen Kopf vor den Strahlen der Sommersonne schützte. Mit müden haselnussbraunen Augen spähte er durch das weite Tal in Richtung Osten, wo der Donner herkam. Zum ersten Mal konnte er durch die flimmernde Hitze der Morgensonne kleine Rauchwolken am Horizont sehen.
»Tsendyn, ich habe den Eindruck, dass die Artillerie näher rückt«, sagte er mit gleichmütigem Tonfall in Richtung Graben gewandt.
Ein kleiner Mann, der ein dünnes Wollhemd trug und eine rote Schärpe um die Taille gebunden hatte, stieg schweigend aus der Grube. Hinter ihm grub ein Trupp chinesischer Arbeiter mit schweren Spaten und Maurerkellen weiter im trockenen Erdreich. Im Gegensatz zu den chinesischen Helfern hatte der gedrungene, aber breitschultrige Mann einen dunklen, ledrigen Teint und rundliche Augen. Anhand dieser Züge erkannte jeder Chinese auf den ersten Blick, dass er es mit einem Mongolen zu tun hatte.
»Peking fällt. Die ersten Flüchtlinge sind bereits unterwegs«, erwiderte er und deutete auf eine schmale, unbefestigte Straße, die etwa eine Meile entfernt lag. Dort rollten ein halbes Dutzend Ochsenkarren durch den Staub, auf denen die Habseligkeiten mehrerer Familien verstaut waren, die nach Westen flohen. »Wir müssen die Ausgrabungen abbrechen, Sir, bevor die Japaner über uns herfallen.«
Hunt tastete unwillkürlich nach seinem Webley Fosbery, einem automatischen Revolver vom Kaliber .455, der in einem Holster an der Hüfte steckte. Zwei Abende zuvor hatte er damit auf eine kleine Bande marodierender Räuber geschossen, die eine Kiste mit ausgegrabenen Artefakten stehlen wollten. Da ganz China in Auflösung begriffen war, zogen überall Diebesbanden durch die Gegend, aber die meisten waren unbewaffnet und stellten sich nicht allzu schlau an. Ein Kampf gegen die kaiserlich-japanische Armee war etwas ganz anderes.
China brach unter dem Ansturm der japanischen Militärmacht rasch zusammen. Seit die japanische Kwantung-Armee im Jahr 1931 die Mandschurei besetzt hatte, hatte die militärische Führung Nippons eine Kolonisierung Chinas nach dem Vorbild von Korea ins Auge gefasst. Nachdem es sechs Jahre lang immer wieder zu vereinzelten Zusammenstößen und inszenierten Zwischenfällen gekommen war, brachen im Sommer 1937 offene Kampfhandlungen aus. Die kaiserlich-japanische Armee fiel in Nordchina ein, da man befürchtete, die nationalistischen Streitkräfte unter Chiang Kai-shek könnten zu stark werden.
Obwohl die chinesischen Streitkräfte zahlenmäßig weit überlegen waren, bedeuteten sie für die Japaner mit ihrer besseren Ausrüstung, Ausbildung und Disziplin keinen ebenbürtigen Gegner. Chiang Kai-shek, der seine Möglichkeiten nach besten Kräften nutzte, leistete den Japanern tagsüber Widerstand, zog sich bei Nacht zurück und versuchte ihnen so einen Abnutzungskrieg aufzuzwingen, um ihren Vormarsch aufzuhalten.
Hunt horchte auf das Donnern der näher rückenden japanischen Artillerie, die vom Fall Pekings kündete, und er wusste, dass die Chinesen in ernsthaften Schwierigkeiten steckten. Anschließend war vermutlich Nanking fällig, die Hauptstadt, was zu einem weiteren Rückzug von Chiang Kai-sheks Armee nach Westen führen würde. Mit dem dumpfen Gefühl, dass auch ihm eine Niederlage drohte, warf er einen Blick auf seine Armbanduhr und wandte sich dann an Tsendyn.
»Sagen Sie den Chinesen, sie sollen die Ausgrabungen gegen Mittag beenden. Wir sichern die Artefakte und vervollständigen heute Nachmittag den Abschlussbericht über die Grabungsstätte, dann schließen wir uns der Karawane in Richtung Westen an.« Er warf einen Blick zur Straße und sah eine Horde abgehalfterter nationalistischer chinesischer Soldaten auf der Fluchtroute entlangziehen.
»Brechen Sie morgen mit dem Flugzeug nach Nanking auf?«, fragte Tsendyn.
»Vorausgesetzt, die Maschine kommt. Aber unter diesen Umständen hat es keinen Sinn, wenn ich nach Nanking fliege. Ich habe vor, die wichtigsten Funde mitzunehmen und nach Norden zu fliegen, nach Ulan-Bator. Sie müssen zusehen, dass Sie die übrigen Sachen, die Ausrüstung und die Vorräte mit den Tragtieren wegschaffen, fürchte ich. In ein paar Wochen sollten Sie in Ulan-Bator zu mir stoßen. Ich warte dort auf Sie, bevor ich mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Westen fahre.«
»Ein kluger Entschluss. Offenbar bricht der Widerstand hier in der Gegend zusammen.«
»Die Innere Mongolei ist für die Japaner von geringer strategischer Bedeutung. Wahrscheinlich werden sie nur die Überreste der Verteidigungstruppen aus Peking jagen«, sagte er und deutete in Richtung des fernen Artilleriefeuers. »Ich nehme an, sie werden sich in Kürze zurückziehen und ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen lang Peking plündern, bevor sie die Offensive wieder aufnehmen. Damit haben wir jede Menge Zeit, uns abzusetzen.«
»Sehr bedauerlich, dass wir jetzt wegmüssen. Wir sind mit der Ausgrabung des Pavillons der großen Harmonie fast fertig«, sagte Tsendyn, während er das Labyrinth der Gräben betrachtete, die sich ringsum wie ein Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg erstreckten.
»Ein verdammter Jammer ist es«, sagte Hunt und schüttelte wütend den Kopf. »Auch wenn wir nachgewiesen haben, dass die Grabungsstätte bereits geplündert wurde.«
Hunt trat nach ein paar ausgegrabenen Bruchstücken einer Steinsäule und sah zu, wie sich der Staub über die Überreste des einst so eindrucksvollen kaiserlichen Bauwerks legte. Während der Großteil seiner Archäologenkollegen in China nach prähistorischen Grabstätten voller Bronzeartefakte suchte, konzentrierte sich Hunt auf die weitaus jüngere Yüan-Dynastie. Das hier war bereits der dritte Sommer, den er auf dem Gelände von Shang-tu zubrachte, um die Überreste des 1260 gebauten kaiserlichen Sommerpalastes freizulegen. Wenn man den trostlosen, mit frischen Erdhaufen übersäten Hang betrachtete, konnte man sich die einstige Pracht der Anlagen und des Palastes, der hier vor fast achthundert Jahren gestanden hatte, kaum vorstellen.





























