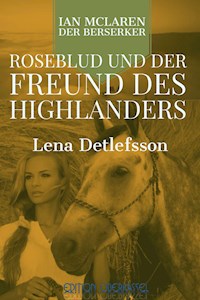2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: edition oberkassel
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Bereits seit Stunden saßen Ian McLaren, der Berserker, und der schottische Thronfolger Peter Stewart gemeinsam mit Ruaidhrí McLeod, einem schottischen Lord aus dem Süden des Landes, und seinem englischen Nachbarn Thomas Geoffrey am Verhandlungstisch, doch ein Ende der Gespräche schien weit entfernt. McLeod und Geoffrey stritten sich seit Jahren um ein Stück ihrer Ländereien. Erneut wurde ein Versuch der Schlichtung unternommen. Während sich die Männer um eine Lösung bemühen, machen sich Ians Mädchen zu einem Spaziergang auf und gelangen an den Loch Tairnach, auf dessen gegenüberliegenden Uferseite eine verfallene Ruine steht. Doch Deirdra weiß, dass es sich um ein Spukhaus handeln soll. "Es heißt, zwei Liebende seien in den Flammen umgekommen", erklärte Deirdre leise und bekreuzigte sich. "Seitdem finden ihre Seelen keine Ruhe."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Der Fluch von Tairnach House
Lena Detlefsson
edition oberkassel
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Dank an die LeserInnen
Lena Detlefsson
Impressum
Kapitel 1
Ian McLaren verdrehte seufzend die Augen und wechselte einen vielsagenden Blick mit Peter Stewart. Bereits seit Stunden saßen der Berserker und der schottische Thronfolger gemeinsam mit Ruaidhrí McLeod, einem schottischen Lord aus dem Süden des Landes, und seinem englischen Nachbarn Thomas Geoffrey am Verhandlungstisch, doch ein Ende der Gespräche schien weit entfernt. Weiter als das Meer, nach dem Ian sich gerade jetzt wieder besonders sehnte, denn die Luft in der Lord’s Hall schien immer stickiger zu werden, bis sie wie ein zäher Brei den ganzen Saal füllte.
Ians Gedanken schweiften ab. Er stellte sich vor, am Hafen zu stehen und hinaus aufs Meer zu blicken, das leise Plätschern der Wellen am Schiffsrumpf zu hören. Eine frische, salzige Brise streichelte ihm sanft über die Wange. Eines Tages, da würde er …
Ach, verdammt. Ian zwang seine Aufmerksamkeit wieder auf das Gespräch und die Anwesenden in der Lord’s Hall. Zu wichtig waren diese Verhandlungen, als dass er sich ausgerechnet jetzt seinen Tagträumen hingeben durfte.
Gerade beschwerte sich Ruaidhrí McLeod lautstark über den jungen englischen Lord, der ihm an der langen Tafel gegenübersaß: »Geoffrey, Ihr habt meine Ländereien besetzt und meine Bauern beraubt. Ihr habt meine Felder niedergebrannt und meine Männer getötet!«
Bereits seit zwei Jahren war McLeod in Grenzstreitigkeiten mit den meisten seiner englischen Nachbarn verwickelt, unter anderem mit Geoffreys Familie, doch bisher hatte McLeod außer wutentbrannten Beschwerden nichts von sich gegeben. Nichts, was Ian oder Peter hätten nutzen können, um überhaupt mit der Vermittlung beginnen zu können. McLeod zeigte sich kompromisslos auf der ganzen Linie, und Peter Stewart schlug verärgert mit der flachen Hand auf den Tisch, als McLeod erneut mit seinen Tiraden beginnen wollte: »Sagt uns etwas Neues, McLeod. Mit Euren ständigen Anschuldigungen kommen wir nicht weiter.«
Auch Ian schnaubte ungehalten und wechselte einen weiteren Blick mit seinem Schwiegersohn, der als Sohn des schottischen Königs den Vorsitz in dieser besonderen Angelegenheit übernommen hatte. Beide wussten, dass sie ohne McLeod besser dran gewesen wären, denn sein aufbrausendes Temperament sorgte immer wieder für Verzögerungen. Doch natürlich konnten sie den hochgewachsenen schottischen Lord aus dem Süden nicht von den Verhandlungen ausschließen. McLeod hatte unlängst den schottischen König um Unterstützung in den Grenzstreitigkeiten gebeten. Doch weil dieser nach einem Giftanschlag noch nicht wieder vollständig genesen war, hatte Peter Stewart dem schottischen Lord an seines Vaters Stelle sowohl militärische als auch finanzielle Hilfe zugesichert und nun auch den Vorsitz über die Verhandlungen übernommen. Allerdings lagen die Dinge ganz anders als erwartet, denn überraschenderweise war es nicht McLeod, sondern Thomas Geoffrey gewesen, der den schottischen König um Vermittlung in dieser Angelegenheit gebeten hatte.
»Geoffrey, was habt Ihr dazu zu sagen?«, wandte sich Peter nun an den jungen englischen Lord.
Ian kam nicht umhin, die Ruhe Sir Thomas Geoffreys zu bewundern, als der das Wort ergriff: »Ich habe nichts von dem befohlen, dessen McLeod mich anklagt«, sagte Geoffrey und strich sich über seine lange Nase, die seine normannische Herkunft verriet. Selbst jetzt, nachdem sich das Gespräch seit Stunden nur noch im Kreise drehte, blieb er gelassen, und seine Miene verriet nicht im Geringsten, wie es in seinem Inneren aussah.
Ungewöhnlich für einen so jungen Mann, dachte Ian, denn Thomas Geoffrey mochte nicht viel mehr als 20 Jahre zählen.
»Wie Ihr bereits wisst«, fuhr Geoffrey fort und wandte sich dabei an Peter Stewart, »bin ich erst seit Jahresbeginn Herr über Chesterdale Hills. Ich erhielt die Ländereien rechtmäßig von meinem König zu Lehen, nachdem mein Onkel im Winter seinen Verletzungen erlegen war.«
»Selbst schuld!«, polterte Ruaidhrí McLeod, verstummte aber unter dem mahnenden Blick des Thronfolgers.
»Selbstverständlich wusste ich von der Fehde, in der mein Onkel mit den McLeods lag, als ich Chesterdale Hills übernahm, und ich wollte sie nach Möglichkeit sofort beenden. Noch bevor ich bei meinem neuen Nachbarn vorstellig werden konnte, hatte dieser gleich im Frühjahr seine Männer ausgeschickt, um meine Schafe von den Weiden zu treiben und zu stehlen.«
»Es sind meine Weiden«, erklärte McLeod zornig, »und davon abgesehen sind die Schafe die Entschädigung für Eure Raubzüge und den Tod meiner Männer! Belassen wir es dabei.«
»Ich habe keinen einzigen Raubzug gegen Euch unternommen«, entgegnete Geoffrey ruhig. »Hingegen will ich nicht leugnen, dass einige Eurer Männer von den Meinen getötet wurden, während sie versuchten, mein Eigentum zu schützen. Aber die Anzahl von 180 Schafen übertrifft bei Weitem das, was ich als angemessene Entschädigung für fünf Tote verstehe. Ich bin Euch nicht mehr als 60 Schafe schuldig, den Rest verlange ich zurück.«
»Und das Weideland?«, grollte McLeod. »Was ist damit?«
»Was das Weideland betrifft, wünsche ich eine gütliche Einigung mit Euch, denn ich habe keinerlei Interesse an einer Aufrechterhaltung dieser unseligen Fehde«, erklärte Geoffrey. »Ich möchte die Angelegenheit ein für alle Mal klären.«
McLeod schnaubte unwillig und verschränkte die Arme ablehnend vor der Brust. Eine tiefe Falte erschien auf seiner Stirn.
Kompromissbereitschaft sieht anders aus, dachte Ian und räusperte sich, als Peter Stewart ihn ratsuchend ansah: »Was meinst du dazu, Ian?«
Ian dachte eine Weile nach. Der Fall war im Grunde eindeutig. Sir Thomas Geoffrey war im Recht, und er hätte seine Ansprüche mit der militärischen Unterstützung des englischen Königs problemlos durchsetzen können. Es verwunderte Ian ohnehin, dass der Engländer sich in seiner Lage nicht sofort an seinen König gewandt hatte, der bekanntermaßen nur auf einen Anlass wartete, einen Krieg gegen Schottland vom Zaun zu brechen.
Vielleicht lag Geoffrey wirklich an einer friedlichen Lösung, denn warum hätte er sonst den schottischen König um Vermittlung in dieser Angelegenheit bitten sollen? Nachdem das Bittgesuch ihn erreicht hatte, entschied Stewart, dass die Verhandlungen auf neutralem Boden unter Vorsitz seines Sohnes Peter stattfinden sollten. Dessen Wahl fiel auf Donnahew Castle als Tagungsort, weil Peter es dem englischen Lord nicht zumuten wollte, den weiten Weg bis nach Scone an den schottischen Königshof anzutreten. Für Ian, treuer Gefolgsmann und obendrein Verwandter des Königs, war es selbstverständlich, seine Burg für die Belange seines Herrschers zur Verfügung zu stellen. Zudem fühlte der Berserker sich geehrt, als sein Schwiegersohn ihn um seinen Beistand in dieser schwierigen Angelegenheit bat.
Ian beneidete Peter keineswegs um die Entscheidung, die er in den nächsten Tagen gegen seinen Gefolgsmann zu fällen hatte. Ruaidhrí McLeod war nun einmal im Unrecht, und ihn dazu zu bewegen, die geforderten 120 Schafe an Geoffrey zurückzugeben, würde kein Kinderspiel werden. Ihn aber obendrein zu einer Festlegung der Grenzen und ihrer Einhaltung zu bringen, dürfte nahezu unmöglich sein.
Wenn McLeod sich mit Geoffrey nicht gütlich einigte, würde Peter keine andere Wahl bleiben, als seinem Gefolgsmann den entsprechenden Befehl zu geben. Auch wenn dies unweigerlich dazu führen würde, dass der Clan McLeod dem König die Gefolgschaft aufkündigte, hatte der Friede mit dem Engländer Vorrang. Entschied Peter nämlich gegen ihn, würde Geoffrey mit Sicherheit den englischen König um Unterstützung bitten. Das bedeutete Krieg.
»Ich meine, wir sollten für heute Schluss machen«, sagte Ian schließlich. »Niemandem ist damit gedient, wenn wir übereilt eine so wichtige Entscheidung fällen.«
Peter wirkte erleichtert. »Gut, dann führen wir die Anhörungen morgen weiter und verhandeln dann im Anschluss über die Lösung der Streitigkeiten. Wir sehen uns zum abendlichen Bankett, zu dem auch Ihr, Sir Thomas, selbstverständlich eingeladen seid. Wir wären hocherfreut, Euch und Eure Gefolgsleute als Gäste an der Hohen Tafel begrüßen zu dürfen.«
»Ich danke Euch für die Einladung, Hoheit«, sagte Geoffrey und verneigte sich.
Ian bemerkte, dass Geoffrey während seiner höflichen Ehrerbietung Ruaidhrí McLeod nicht aus den Augen ließ. Dessen missbilligende Miene konnte dem jungen englischen Lord nicht entgehen. Ian fragte sich, wie Geoffrey wohl das abendliche Festmahl umgehen würde, denn er hielt den jungen englischen Lord für klug. Klug genug, zu erkennen, dass McLeod jede Gelegenheit, auch ein friedliches Bankett, nutzen würde, um die bestehenden Feindseligkeiten weiter zu schüren.
Kapitel 2
»Oh, das war wundervoll!« Catriona klatschte begeistert in die Hände, während der letzte Akkord der fröhlichen Melodie ausklang. Ihre Augen hingen wie gebannt an dem dunkelhaarigen Barden, der nun seine langen, kräftigen Finger über die Saiten seiner Harfe gleiten ließ und an den kleinen Wirbeln drehte, um sie zu stimmen. »Könnt Ihr bitte noch ein Lied spielen?«
»Catriona, lass dem Mann jetzt seine Ruhe«, wies Eleonore ihre kleine Schwester zurecht und tauschte mit ihren Schwestern Belltriste und Deirdre ein wissendes Lächeln. Die Kleine würde nicht lockerlassen, bis sie ihren Willen bekam.
»Vielleicht sollten wir wieder in die Burg gehen«, schlug Deirdre vor, um die kleine Schwester zu necken, und wandte sich an den Barden. »Ihr habt Euch sicherlich vor die Burg zurückgezogen, um in Ruhe zu üben, nicht wahr?«
Der Barde nickte lächelnd. »Ja, das stimmt«, sagte er mit seiner wohlklingenden dunklen Stimme, »aber wer könnte schon einem solchen Publikum widerstehen?«
»Ha, da hört ihr es!«, rief Catriona triumphierend.
»Du kannst ihm ja noch den ganzen Abend zuhören«, sagte Moira McLeod freundlich. Die jüngere Schwester Ruaidhrí McLeods war ebenso wie Belltriste anlässlich der Verhandlungen mit nach Donnahew Castle gereist, um ihre alten Freundinnen zu treffen. Sie genoss spürbar die fröhliche Gesellschaft der McLaren-Schwestern, auch wenn sie etwas bedrückt wirkte.
»Bitte nur noch eins!«, begann Catriona nun zu betteln. »Ich könnte Euch ewig zuhören.«
»Und für ein Mädchen wie dich würde ich ewig spielen …«, erwiderte der Barde.
»Ach, bitte.« Catriona bedachte den Mann mit ihrem berühmten flehenden Blick, der auch jetzt seine Wirkung nicht verfehlte.
»Also gut«, lächelte der Barde gutmütig und warf mit einer schwungvollen Kopfbewegung sein langes Haar zurück. »Ein Lied noch. Aber dann brauchen meine Finger wirklich eine Pause.«
Belltriste zog die Augenbrauen hoch, so als wollte sie sagen: »Hab ich’s doch gewusst.« Eleonore erwiderte ihren Blick mit einem breiten Grinsen, und auch Moira musste lächeln. Der kleinen Catriona konnte einfach niemand etwas abschlagen.
»Was darf ich für die junge Lady spielen?«, fragte der Barde galant und zupfte ein paar zarte Töne.
»Ich weiß nicht.« Catriona zuckte mit den Schultern.