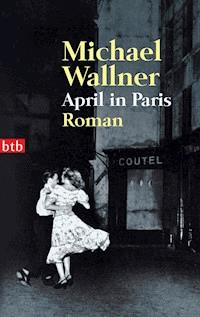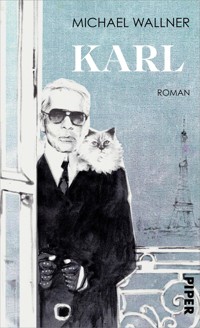26,23 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem fesselnden historischen Roman »Die gespaltene Stadt« verarbeitet Michael Wallner emotional und packend das Ereignis, das Berlin zum Symbol des kalten Krieges macht und das Leben so vieler Menschen für immer dramatisch verändert: den Bau der Berliner Mauer.
Nur schemenhaft erkennt man in der Nacht des 13. August 1961 die Panzer und Soldaten, die am Brandenburger Tor Stellung beziehen. Im Morgengrauen reißen Betriebskampfbrigaden die Straßen auf und ziehen Stacheldraht. In Ost und West sehen die Berliner ohnmächtig zu. Unter ihnen der ostdeutsche Ingenieur Harry, der fürchtet, seine Verlobte im Westen nie wiederzusehen. Oder der 12-jährige Peter, dem das Ganze so lange wie ein gigantisches Abenteuer vorkommt, bis die Mauer ihn von seiner Mutter trennt. Anja, seine Tante, arbeitet als Sekretärin von Willy Brandt. Sie will Peter und anderen Verzweifelten helfen, doch das geteilte Berlin ist zum Spielball der Weltpolitik geworden
Die fesselnde Reihe »Schicksalsmomente der Geschichte« zeigt in ebenso emotionalen wie spannenden Romanen, wie die große Geschichte das Leben einfacher Menschen prägt und dramatisch verändert.
Für diese Reihe lässt Michael Wallner in seinem Roman »Die gespaltene Stadt« seine Leser:innen die ganze Palette großer Gefühle erleben, die der Mauerbau in den handelnden Figuren weckt: Die Trauer um Angehörige, die so nah und jenseits der Mauer doch unendlich weit entfernt sind. Die Hilflosigkeit selbst der Mächtigen. Und der Mut derjenigen, die alles riskieren, um in Freiheit zu leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die gespaltene Stadt« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: t. mutzenbach design, München
Covermotiv: ullstein bild / Jung und Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
BERLIN, 1961
1
ANJA UND WILLY
27. März 1961
2
KÖPENICK
18. April
3
DIE MASERN
19. April
4
DER NEUE MIETER
4. Mai
DER GRENZGÄNGER UND DER INGENIEUR
5
AUTOMATENBUFFET
16. Mai
6
LANGUSTE AUS DER KARIBIK
26. Mai
7
HÜHNCHEN IST AUS
14. Juni
8
DER GEIST FRIESLANDS
19. Juni
9
DER LEBEMANN
21. Juni
10
NERVEN
19. Juli
11
WAHRHEIT
25. Juli
2. August
12
DIE LETZTE NACHT
11. August
AKTION ROSE
13
DAS ZERRISSENE BAND
13. August
16. August
14
DER LÄNGSTE TAG
18. August
19. August
15
KOFFERRADIO
19. August
16
EHE DER HAHN KRÄHT …
19. August, Abend
17
DAS KIND
20. August
18
DIE BRIGADE
21. August
19
PETER
22. August
20
SCHAUMWEIN
22. August, Abend
23. August
21
SABOTEURE
24. August
22
MORGEN
23
IN DIE LUFT
25. August
24
DIE DROHUNG
25. August
25
DER ALTE CARL
26. August
26
EIN RISS
26. August, Abend
27
DAS VERHÖR
26. August, Nacht
28
DAS IST DIE BERLINER LUFT
29. August
HERBST 1961
29
DER BÄCKER VON HEIDELBERG
15. September 1961
29. September
30
DIE ANGST VOR FELIX
3. Oktober
5. Oktober
31
FLUCHT NACH OSTEN
6. Oktober
10. Oktober
32
WANNSEE
13. Oktober
33
WELTBEWEGEND
17. Oktober
19. Oktober
34
DAS WUNDER
29. Oktober
2. November
35
SCHLAGER FÜR MILLIONEN
2. November, Abend
9. November
36
DIE NEUE MIETERIN
13. November
37
DAS EINFACHE LEBEN
20. November
38
ODER ZU VERNICHTEN
21. November
39
DAS PLÜSCHTIER
27. November
JAHRESZEITEN
40
UNTER DER BRÜCKE
11. April 1962
41
EIN SCHÖNER KLANG
19. Mai
3. Juni
42
LISTEN
18. Juli
4. August
43
GÖTTINGEN
30. September
44
BEGEGNUNG IM UNGEWISSEN
14. Dezember
45
EINE BERLINERIN
17. Juni 1963
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
BERLIN, 1961
1
ANJA UND WILLY
27. März 1961
»Guten Tag! Zollkontrolle der DDR. Die Erklärung bitte. Sie reisen allein?«
»Ja, ich bin allein.«
»Was ist der Grund Ihrer Reise nach Berlin?«
»Ich habe mich auf eine Stellungsausschreibung beworben.«
»Was sind Sie von Beruf, Fräulein Kaping?«
»Ich bin Stenotypistin.« Auf seinen verständnislosen Blick setzte sie hinzu: »Sekretärin.«
»Und wo haben Sie sich beworben?«
»Bei …« Auch wenn Anja wenig über die Verhältnisse in Berlin wusste, so ahnte sie doch, dass sie ihren angestrebten Arbeitsplatz hier besser nicht angeben sollte. »Bei der Verwaltung.« Sie rückte ihre Handtasche zurecht.
»Führen Sie Druckerzeugnisse mit sich, Zeitschriften, Romane, Prospekte?«
»Ich habe nur dieses Buch.« Sie nahm es heraus.
Er musterte den grellbunten Einband. »Vor Schüssen wird gewarnt? Ist das etwas Politisches?«
»Es ist ein Kriminalroman.«
Der Zollpolizist gab ihr das Buch zurück und notierte den Namen des Autors.
»Würden Sie mal die Gegenstände aus dem Gepäckfach nehmen?«
Anja hatte schlecht gepackt. Ein großer Koffer wäre praktischer gewesen. Jetzt musste sie die Ledertasche, den Pappkoffer und das verschnürte Paket anheben.
»Bitte eins nach dem anderen, damit ich dazwischensehen kann.« Mit der Taschenlampe leuchtete der Zollbeamte in das dunkle Gepäckfach. »Und was ist das?« Er deutete auf die Anstecknadel an ihrem Revers.
»Meine Brosche? Es ist eine Möwe.«
»Ist das ein politisches Symbol?«
»Es ist nur eine Möwe aus Blech. Ich finde sie einfach hübsch.«
Nachdem die Genossen der Zollverwaltung ausgestiegen waren, verließ der Zug den Grenzbahnhof im mecklenburgischen Schwanheide. Anja schaute in das flache, das schrecklich flache Land. Sie beruhigte sich nach der Prozedur nur langsam. Ihre Schwester Renate hatte ihr beschrieben, wie es an der Grenze zugehen würde. Es sei alles nicht so schlimm, wie die Westzeitungen das aufbauschten. »Du hast keine Ahnung, wie viel Schund- und Schmutzliteratur in die DDR geschmuggelt wird. Allein die Landser-Heftchen und die Pornografie. Das wollen wir hier nicht. Es ist schon gut, dass unsere Kontrolleure gründlich sind.«
Anja konnte der Landschaft nichts abgewinnen. Die Gegend um Lübeck war auch nicht gerade ein Alpengarten, aber dort fühlte man sich zwischen Hügeln und kleinen Erhebungen wenigstens geborgen. Waldstücke wechselten mit Weiden ab, das Auge hatte etwas zu schauen. Hier wurde das Auge rasch müde. Wohin man sah, nichts als Ebene und darüber der Himmel, der seine Farbe verlor, je tiefer Anja in das Land hineinfuhr. Gerade noch war sie draußen gewesen, jetzt war sie mittendrin. In der Ferne konnte sie die Zonengrenze noch erkennen: Die Demarkationslinie zwischen Ost und West war nur ein Stacheldrahtzaun zwischen Betonpfeilern. Das sollte die Grenze zwischen zwei Welten sein?
Am Grenzbahnhof Griebnitzsee dauerte die Kontrolle wieder eine halbe Stunde. Neben dem Zug patrouillierten Volkspolizisten mit Hunden. Die Tiere wurden ermuntert, bei den Rädern zu schnüffeln, ob sich ein DDR-Bürger unter den Waggon gehängt hatte. Auf Westberliner Seite fand der Übertritt ohne Personenkontrolle statt.
Das war Berlin! Anjas Herz schlug auf einmal wie verrückt. Sie, die Tippse aus Lübeck, gerade mal dreiundzwanzig, fuhr in die Stadt der Städte ein. Die leidgeprüfte Stadt, die glorreiche Stadt, die Stadt der Flitzpiepen, Luden und Nepper, die überhebliche Stadt, die sich trotz aller Katastrophen immer von Neuem erhob.
Solange Anja denken konnte, hatte Lübeck ihr genügt. Warum zog es sie auf einmal nach Berlin? Bestimmt nicht wegen ihrer Schwester. Sie und Renate waren sich nie besonders grün gewesen. An Berlins Schönheit konnte es auch nicht liegen. Selbst Jahre nach dem Krieg war es Frontstadt geblieben, umringt von der Front des anderen Systems. Berlin war nicht mehr die Stadt der goldenen Zwanziger, auch nicht die Reichshauptstadt. Trotzdem wäre Anja heute in keiner Stadt der Welt lieber gewesen.
Sie nahm die S-Bahn und stieg am Westkreuz um. Den Bahnhof Schöneberg gab es seit 1910, als Schöneberg noch eine selbstständige Stadt gewesen war. Sie hatte Bilder vom alten Bahnhof mit seinen blauen Jugendstilfliesen gesehen. Enttäuscht lief sie an den beigefarbenen Wänden vorbei. Als sie ins Freie trat, erwartete sie, die Farbenpracht der Großstadt zu sehen – Trubel, helle Häuser, grüne Parks und blauen Himmel. Aber die Welt da draußen war beige und grau. Berlin hatte kein Geld für freundliche Anstriche, Gelb und Rot kamen in seiner Palette nicht vor. Man strich die Häuser in einer Farbe, die auch in verwittertem Zustand ordentlich aussah.
Das Rathaus war ein Sandsteinbau. Auf dem Turm wehte die Berliner Fahne. Unter diesem Turm könnte sich Anjas Traum erfüllen. Falls sie durchfiel, würde sie ihrer Schwester einen Besuch in Köpenick abstatten. Für den kleinen Peter hatte sie ein Geschenk dabei. Danach musste sie Berlin wieder Adieu sagen.
Ein Blick auf die Rathausuhr – es war höchste Zeit. Sie lief zum Haupteingang, wurde von einem Ordnungsbeamten aufgehalten und belehrt. Mit ihrem Gepäck lief sie über den Rudoph-Wilde-Platz, stellte alles ab, rüttelte an verschlossenen Türen, hastete weiter, bis sie die richtige gefunden hatte. Gänge und Flure, Dutzende Türen, geschäftige Menschen, die meisten in Beige oder Grau. Hätte sie auch etwas Beiges anziehen sollen? War ihr keckes blaues Kostüm mit der schräg aufgesetzten Kappe ein unerwünschter Farbklecks im würdigen Rathaus?
Als sie sich der bewussten Abteilung näherte, sank ihr Herz ein Stück tiefer. So viele Frauen in ihrem Alter, so viele geschminkte Gesichter, so viele halblange Röcke, so viele Nylonstrümpfe. Was hatte sie denn erwartet? Von einer Ehrengarde an ihren neuen Arbeitsplatz begleitet zu werden?
Die Ausschreibung hatte nicht viel verraten: Erfahrung wurde verlangt, Offenheit und hundertzwanzig Anschläge pro Minute. Dass es eine Altersgrenze gab, war ihr nicht aufgefallen. Und doch schien keine der Wartenden älter als vierzig zu sein.
Die gepolsterte Tür ging auf, heraus trat der Büroleiter. Trotz Gepäck lief Anja schneller, um nur ja nichts zu verpassen. Eine Unebenheit im Boden, sie knickte um. Ihre Absätze waren zu hoch, das rächte sich jetzt. Anjas ulkiges Getorkel fiel dem Büroleiter auf. Er musterte sie durch seine Hornbrille.
»Haben Sie gleich Ihren ganzen Hausrat mitgebracht?«, fragte er. »Das war verfrüht.«
»Verzeihung. Ich bin …«
Der Büroleiter wartete ihre Entschuldigung nicht ab und wandte sich an die Frauen.
»Bitte, meine Damen.«
Zusammen mit den anderen betrat Anja ein Vorzimmer, das sich von typischen Amtsstuben darin unterschied, dass es vom Boden bis zur Decke getäfelt war. Auch tagsüber brannte hier der Lüster; das dunkle Holz hätte den Raum sonst düster wirken lassen.
»Nehmen Sie Platz.« Der Büroleiter wies auf eine Reihe von Stühlen. Anja hätte es gern auf den vordersten geschafft, wo sich die nächste gepolsterte Tür befand, die nirgendwohin führen konnte als ans Ziel.
»Ihre Sachen stellen Sie am besten dort ab«, sagte eine Vorzimmerdame.
Hastig stapelte Anja ihre Habseligkeiten und landete dadurch abgeschlagen auf der letzten freien Sitzgelegenheit.
»Ich darf Sie noch um einen Augenblick Geduld bitten«, erklärte der Büroleiter. »Der Regierende telefoniert. Er wird Sie in Kürze empfangen.«
Die Dritte in der Reihe, sie trug ein beiges, ziemlich tief ausgeschnittenes Kleid, hob die Hand. »Entschuldigen Sie, wie spricht man ihn denn an? Ich meine, ich kann ja wohl nicht Herr Regierender sagen.« Sie warf dem Büroleiter einen kecken Blick zu. Die anderen kicherten.
»Der Regierende Bürgermeister wird zunächst Sie begrüßen. Es empfiehlt sich keine allzu große Förmlichkeit, das schätzt er nicht. Am besten, Sie benehmen sich ganz natürlich.«
Ein grünes Licht auf dem Schreibtisch zeigte an, dass sich gleich Entscheidendes verändern würde. Anja hielt den Atem an, ihre Hände krampften sich ineinander.
»Er hat aufgelegt«, sagte die Vorzimmerdame.
Ohne anzuklopfen, öffnete der Büroleiter die gepolsterte Tür. »Die Damen sind da«, hörte Anja ihn sagen.
Darauf geschah nichts, außer dass sich jemand so laut räusperte, als hätte er sich verschluckt. Rasche Schritte, dann stand er da. Willy Brandt im dunkelblauen Anzug, Willy Brandt mit gerötetem Gesicht, das man in der Wochenschau nicht zu sehen bekam, weil sie in Schwarz-Weiß war. Willy Brandt ernst, mit Tränensäcken unter den Augen, die nicht angriffslustig guckten wie sonst, wenn er Ansprachen hielt, sondern düster, nach innen gekehrt. Anja kam es vor, als wollte er sich möglichst rasch wieder in sein Büro zurückziehen.
Wie von einer Schnur gezogen, standen alle auf. Der Regierende Bürgermeister blieb nahe der Tür. Als der Büroleiter das Schweigen beenden und mit der Vorstellung beginnen wollte, winkte Willy Brandt ab.
»Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte er zu den Frauen. Sagte er es? Oder knurrte er es? Diese Stimme gab es nur einmal auf der Welt. Sie war mit nichts, was Anja je gehört hatte, zu vergleichen. Sie könnte von einem Tier stammen, das man im Schlaf geweckt hatte, oder das Knarren einer Tür sein, die geölt werden musste. Mit einem Seufzen trat er vor die Erste im Spalier. »Wie heißen Sie?«
Die Angesprochene nannte ihren Namen. Sie war groß und schlank, hatte eine schlichte Frisur und ein graues Kostüm. Sie strahlte Selbstsicherheit aus, als könnte sie jederzeit das erste Diktat aufnehmen.
»Woher stammen Sie?«
»Aus Duisburg, Herr Regierender … Herr …«
Er nahm sich nicht die Zeit, ihr mit der Anrede zu helfen, sondern ging weiter. »Und Sie?«
»Ich bin Ruth Breitling und stamme aus Ingolstadt.«
Wortlos tat er den Schritt zur Nächsten.
»Ick bin geborene Berlinerin«, sagte die mit dem kecken Blick und dem tiefen Ausschnitt. Bei ihr nahm er sich einige Sekunden länger Zeit.
So musste man es machen, dachte Anja. In Berlin musste man geboren sein, ein freches Lachen haben und ein bisschen was von der Auslage zeigen.
Bis die Reihe an sie kam, schien eine Ewigkeit zu vergehen, in der Anja jede Hoffnung fahren ließ. Dann stand er endlich vor ihr. Das Blau ihres Kostüms erschien ihr plötzlich wie eine Frechheit. Was maßte sie sich an, die gleiche Farbe zu tragen wie Willy Brandt?
»Wie heißen Sie?« Er sah so müde aus.
»Ich heiße Anja Kaping und komme aus Lübeck, Herr Brandt.«
Etwas änderte sich in seinen Augen. Sie blickten plötzlich nicht mehr nach innen. Sie wirkten … Bildete sie sich das ein? Der Regierende Bürgermeister wirkte erleichtert.
»Eine Lübsche also, aha.« Er rührte sich nicht vom Fleck. »Wann sind Sie angekommen?«
»Gerade eben, Herr …«
»Wie war die Fahrt?«
»Lang, Herr Brandt.«
In diesem Augenblick lächelte das Gesicht, das Anja schon so lange kannte. Seit Thomas Mann war keiner, der aus Lübeck kam, so berühmt geworden wie er. Durch die besondere Situation, in der sich Berlin befand, durch die Aufmerksamkeit, die man dieser Stadt schenkte, war Willy Brandt der berühmteste Bürgermeister der Welt.
»Tja, Fräulein Kaping. Dann fangen wir am besten gleich mal an.« Ohne ein weiteres Wort kehrte er in sein Büro zurück. Als sie wie vom Donner gerührt stehen blieb, machte ihr der Büroleiter ein Zeichen. »Worauf warten Sie?«
Mit weichen Knien folgte sie Willy Brandt ins Büro des Regierenden Bürgermeisters von Berlin.
2
KÖPENICK
18. April
Peter Czischek sprang vom Balkon des zweiten Stockes. Der Balkon befand sich allerdings nicht mehr im zweiten Stock, sondern eine Etage tiefer, und so landete Peter wohlbehalten im Schutt. Im April 1945 war die Köpenicker Villa in der Pohlestraße 5 schwer getroffen worden. Nicht von einer Fliegerbombe; die Rote Armee musste Berlin zu diesem Zeitpunkt nicht mehr aus der Luft angreifen. Ihre Bataillone standen bereits diesseits der Oder. Das Haus Pohlestraße 5 war von russischer Artillerie getroffen worden.
»Es war ein Gottesurteil«, wurde Renate, Peters Mutter, nicht müde zu erklären. Sie, ihr Mann und Peter wohnten in der Pohlestraße 7 und waren verschont geblieben. In Nummer 5 hatte der alte Riemerschmidt gewohnt, ein ekelhafter, geldgieriger Mensch. Obwohl er allein lebte, hatte er eine ganze Etage bewohnt. Dicht hintereinander waren die Granaten eingeschlagen. Von Herrn Riemerschmidt war nichts übrig geblieben.
Peter sah die zerstörte Wohnung mittlerweile als seine eigene an. Täglich kam er hierher und machte sich bei Riemerschmidt breit. Selbst heute, sechzehn Jahre nach Kriegsende, fand er immer noch erstaunliche Schätze. Einen Zylinderhut, von dem nur noch das Drahtgestell übrig war, oder eine verbogene Zuckerzange.
Das Gebäude war als Abbruchhaus deklariert worden. Seit Jahren sollten die Bulldozer anrücken, aber die Genossen hatten zu viel zu tun. Häuser abzureißen war in den Hintergrund getreten, man musste neue Wohnungen bauen. Das solide Gebäude aus der Kaiserzeit dem Erdboden gleichzumachen war im Vergleich zum Hochziehen eines Plattenbaues eine Herkulesaufgabe. Die Bauverwaltung hatte Nummer 5 stehen lassen und Peter damit glücklich gemacht.
Als er an diesem Abend staubig und müde nach Hause kam, erklärte seine Mutter: »Morgen machen wir eine Fahrt.«
»In den Westen?«, fragte er enthusiastisch.
Renate schnitt ein Würstchen klein. »Salvino hat frische Ware.«
»Was denn? Persianer?«
»Ja, Karakulfelle sollen auch dabei sein.« Sie stellte ihm sein Essen hin. »Ich habe einen guten Auftrag von einem russischen Offizier.«
»Dein Offizier trägt Persianer?«
»Lass den Quatsch und iss! Die Frau des Offiziers hat bald Geburtstag.«
Peter zermanschte die Kartoffeln. »Wer verschenkt denn im Hochsommer einen Pelz?«
»Die Russen.« Renate rauchte. »Ohne die Russen hätte die Kürschnerei längst dichtgemacht. Die deutschen Genossen können sich keine Pelzmäntel leisten.«
»Wann fahren wir, Mutti?«
»Gleich frühmorgens. Ich mag das übrigens nicht, dass du jeden Tag in den Trümmern rumkletterst. Irgendwann stürzt das Haus ein. Das liest man oft über die Kriegsruinen.«
»Wir fahren in den Westen!«, rief Peter, um Mutters Strafpredigt abzukürzen.
Sie schloss das Fenster. »Nicht so laut! Die Nachbarn brauchen das nicht zu wissen.«
»Die sind nur neidisch, weil sie nicht so oft rüberfahren wie wir«, lachte Peter über dem Kartoffelgulasch.
Renate stippte die Asche von der Zigarette. »Du weißt ja, wie es abläuft: Du ziehst den Regenmantel an und darunter möglichst wenig.«
»Aber was machen wir, wenn es morgen nicht regnet?«
»Meine Knochen sagen: Morgen regnet es.«
***
Er ging auf und ab. Er sprach. Er ging hin und her. Er verharrte vor dem Fenster, kehrte an den Schreibtisch zurück, wanderte zum anderen Fenster, guckte zum Himmel und auf die Straße. Gespannte Sekunden lang hielt Willy Brandt inne, als wäre dort unten auf dem Asphalt der nächste Satz, der nächste Gedanke zu finden.
Die Pausen gaben Anja Gelegenheit, die Schreibmaschine zu justieren, das Getippte zu lesen und den Tintentod bereitzulegen. Sie schob Kohlepapier zwischen die nächsten Blätter.
Brandt wollte nicht, dass Anja Diktate mit dem Stenoblock aufnahm. Er liebte das Klappern der Schreibmaschine, es trieb ihn weiter, jagte ihn von Satz zu Satz.
»Sind Sie so weit?«, fragte er, obwohl er wusste, dass sie mühelos mitkam.
Anja sah ihm beim Gehen zu. Das waren ihre schönsten Minuten des Tages. Sie an der Maschine und er auf Wanderung. Man durfte Willy stattlich nennen. Seine Anzüge wirkten immer ein wenig zu knapp. Er liebte Blau, besaß matte und glänzende Anzüge in dieser Farbe, solche aus Wollstoff oder leichte, die man für Seide halten konnte. Grau trug er zu offiziellen Anlässen oder wenn er jemanden nicht leiden konnte. Den Senator für das Postwesen zum Beispiel: Stand der im Terminkalender, hätte Anja eine Wette darauf abgeschlossen, dass Willy Brandt Grau tragen würde.
Es gab auch schwarze Tage, an denen er nicht er selbst war. An diesen Tagen mussten alle im Büro, die Sekretäre, der Büroleiter, die Vorzimmerdame und Anja, auf ihn aufpassen. Dann war er mit sich nicht im Reinen und grüßte beim Eintreten kaum. Sein Fahrer, der ihm die Tasche trug, warf Anja dann einen vielsagenden Blick zu, der sie aufforderte: »Sei nett zu ihm.«
Nichts tat sie lieber, und nichts war schwerer. An den schwarzen Tagen schien Willy einen Panzer zu tragen. Er ließ seine Termine auf das Notwendige reduzieren, saß im Büro und starrte vor sich hin. An diesen Tagen halfen weder starker Kaffee noch der erste Cognac, dem der zweite und dritte folgten. Er bemerkte nicht einmal die hübsche Referentin aus dem dritten Stock, für die er sonst immer seinen Humor auspackte.
An den schwarzen Tagen half irgendwann nur noch Egon. Egon wusste immer, wie man Willy aus dem tiefen Brunnen holte, in den er sich hatte fallen lassen. »Willy, aufstehen, wir müssen regieren«, sagte Egon Bahr dann meistens. Willy stand auf, unwillig, murrend, aber er riss sich zusammen und regierte.
Heute war kein schwarzer Tag, sondern ein diamantener, das machte Anja glücklich. Für ihren Chef hätte sie alles getan: die Nacht durchgearbeitet, seine dunklen Phasen vertrieben, seinen Cognac versteckt, wenn unangekündigt Besuch kam. Immer noch konnte sie das Glück kaum fassen, dass Willy Brandt sie eingestellt hatte, dass sie hier sein durfte. Sie durfte ihn dabei unterstützen, die Stadt zu regieren.
Jedes Diktat war eine Wanderung. Durch seine Welt, durch seinen Kopf, durch das Büro. Alles entstand im Gehen, die schönsten und die radikalsten Gedanken. Die komplexesten Zusammenhänge fasste er in klare Worte, während er unterwegs war.
»Die Berliner haben ein Recht darauf zu wissen, wie die Lage ist.« Obwohl er und Anja zu zweit im Zimmer waren, erhob er die Stimme auf Ansprachepegel. Mit dieser Lautstärke hätte er mühelos einen kleinen Saal füllen können. »Die Menschen in dieser Stadt sind stark genug für die Wahrheit.«
Anja tippte mit fliegenden Fingern, während Willy die östliche Route durch das Büro wählte, an Ernst Reuters Porträt vorbei, rechtsherum zum Philodendron, ein Schwenk nach links, bis er hinter Anja stehen blieb und ihr über die Schulter schaute.
»Darüber hinaus haben die Berliner das Recht, unseren Freunden im Westen ihre Meinung mit der Offenheit zu sagen, die unter Freunden nötig ist«, diktierte er. »Niemand auf der ganzen Welt darf gleichgültig auf Berlin schauen. Denn in Berlin spielt sich Weltgeschichte ab.«
Als sie vor dem Anschlagen der letzten Worte zögerte, drängte er: »Worauf warten Sie? Schreiben Sie’s hin, Lütte.«
Mit einem Seufzer richtete sie sich auf. »Wird es dazu kommen?«
»Was meinen Sie?«, knurrte er mit rauer Stimme.
»Ich meine, was man so hört – die Panzer und all das?«
»Panzer haben nur einen Zweck.« Brandt lehnte sich gegen ihren Schreibtisch. »Sie sind dazu da, Grenzen zu verschieben.«
»Aber wenn sie diese eine Grenze verschieben, dann bedeutet das …«
»Krieg«, ergänzte er ohne Nachdruck. »Deshalb müssen wir den Berlinern die Wahrheit sagen.«
3
DIE MASERN
Im Frühling 1961 genossen viele Ostberliner den Vorteil, in der DDR zu leben, wo eine Wohnung für sechzig Mark monatlich zu haben war. Zur Arbeit fuhren sie in den Westsektor, tauschten ihren Lohn eins zu vier um und verdienten ein Vielfaches von denen, die im Osten ihr Gehalt bekamen.
Manche nutzten einen Kinobesuch in Westberlin zur Flucht. Von Februar bis Mai 1961 verließen zwanzigtausend Menschen die DDR durch das Schlupfloch Westberlin. Walter Ulbricht reagierte auf die Abwanderung, indem er von BRD-Bürgern bei der Einreise eine Aufenthaltsgenehmigung verlangte, die nur die Volkspolizei ausstellen konnte.
Sein Gegenspieler, der Katholik Adenauer, betrachtete das Deutschland östlich der Elbe als halb asiatisch. Dort lebten Protestanten und Sozialisten, für die Adenauer keine Sympathie empfand. Er betrachtete den Sonderstatus Berlins als Fehlentscheidung: Die Westalliierten hätten den Sowjets beim Viermächteabkommen nicht vertrauen sollen.
Als sich die großen Drei, Churchill, Roosevelt und Stalin, 1945 in Jalta trafen, beschlossen sie, das geschlagene Deutschland in vier Besatzungszonen aufzuteilen. Berlin sollte von den Alliierten gemeinsam regiert werden. Bald nach der Aufteilung entpuppten sich die drei westlichen Zonen Berlins als Insel im sowjetischen Besatzungsraum. Darauf begann Stalin, die Geschlossenheit der Westmächte zu testen: Er schaltete in Westberlin den Strom ab. Als das Fehlen von Licht und Wärme bei den Bewohnern keine Wirkung zeigte, schloss er sämtliche Grenzen nach Westberlin. In Moskau ging man davon aus, dass die Versorgung einer Millionenstadt aus der Luft unmöglich sei. Aber Stalin hatte den Willen der Alliierten unterschätzt. 1948 brachten britische und amerikanische Flugzeuge täglich siebzigtausend Tonnen Fracht nach Berlin. Die Piloten, die auch Schokolade und Süßigkeiten aus ihren Rosinenbombern warfen, wurden von den Berlinern gefeiert. Zur moralischen Unterstützung unterhielt Radio RIAS die Menschen mit Swing und Jazz.
Nachdem diese entbehrungsreiche Zeit zu Ende gegangen war, wuchs der Wohlstand in Westberlin wieder erstaunlich schnell. Berlin, das Schaufenster westlichen Erfolgs mitten im Kommunismus, wurde für die Russen zum Stachel in ihrem Fleisch. 1952 lag der Lebensstandard der Ostdeutschen niedriger als 1947. 1953 hatten sie genug von Mangel und Repression. SED-Plakate wurden zerrissen, der Ruf nach freien Wahlen ertönte. Schüsse fielen, Panzer fuhren auf, der Aufstand endete blutig. In den folgenden zwölf Monaten flohen vierhunderttausend Menschen in den Westen.
Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow durchschaute, dass Walter Ulbricht das Problem gewaltsam lösen wollte. Chruschtschow versuchte, das Schlimmste zu verhindern, und stellte dem Westen das Berlin-Ultimatum. Ein Friedensvertrag zwischen den Siegermächten sollte Berlin in eine freie Stadt verwandeln, worauf sich die Westalliierten zurückziehen müssten. Das Ultimatum scheiterte am Veto der USA.
Im November 1960 reiste Walter Ulbricht nach Moskau und beschwor Chruschtschow: Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften sei bereits so gravierend, dass die DDR ihre Wirtschaft nicht mehr lange aufrechterhalten könne. Die Regierung müsse Maßnahmen ergreifen, um die Abstimmung mit den Füßen, wie Lenin das genannt hatte, zu stoppen. Ulbricht schlug vor, Berlin durch eine Mauer zu teilen.
Der Russe weigerte sich. Nikita Chruschtschow stammte aus bäuerlichen Verhältnissen, er war ein bodenständiger Mensch, politisches Urgestein an der Spitze des Riesenlandes. Er fühlte sich dem Westen überlegen und hatte Grund dafür. Die Sowjetunion war bei der Raketentechnik weit fortgeschritten. Als Juri Gagarin als erster Mensch ins All flog und in 198 Minuten die Erde umkreiste, war dies eine schmerzliche Niederlage für die USA.
Chruschtschow hielt den neu gewählten Präsidenten Kennedy für einen schwachen Gegner und versuchte, ihn zu überzeugen, Westberlin aufzugeben. Bei ihrem Gipfeltreffen in Wien drohte Chruschtschow, die Zugangsrechte nach Berlin im Alleingang zu regeln; das hätte eine Niederlage für den glamourösen Kennedy gegen den albernden, in Wahrheit aber skrupellosen Chruschtschow bedeutet. Als die beiden nach Hause flogen, hielten die Supermächte einander an der Kehle. Riskierten sie für Berlin einen Krieg? Den Realpolitikern kam allmählich die Realität abhanden. Man brauchte weder Hegel noch Marx gelesen zu haben, um zu wissen, dass die Geschichte kein letztes Wort kannte. Seit jeher hatten geschichtliche Umwälzungen vermocht, Verträge und Absprachen vom Tisch zu fegen. Das Aufeinanderprallen zweier Systeme in Berlin ließ sich nicht wegzaubern, doch was immer die Geschichte in ihrem Schoß tragen mochte, die Existenz von zwei Städten in einer Stadt konnte es unmöglich sein.
19. April
In der Werkstatt von Signor Umberto Salvino herrschte Gelassenheit. Er war in den Fünfzigerjahren als Gastarbeiter nach Berlin gekommen, hatte die Liebe der Kürschnerstochter Agathe Sauer erobert und nach dem Tod ihres Vaters dessen Geschäft übernommen. Agathes Vater erregte die Leidenschaft seiner einzigen Erbin zu dem ausländischen Habenichts derart, dass er einem Schlaganfall zum Opfer fiel und sein Testament nicht mehr ändern konnte. Agathe heiratete Umberto, bekam vier Kinder mit ihm und zog sich aus dem Kürschnergeschäft zurück. Unverändert hieß die Firma noch Sauer Pelzwaren, aber wer in Berlin schöne Pelze brauchte, wandte sich in Wirklichkeit an Umberto Salvino.
Die gelassene Stimmung in Salvinos Pelzlager sollte Peter Czieschek, dem Transporteur brisanter Güter, jegliche Angst nehmen, dass die geplante Tour gefährlich werden könnte. Den Erwachsenen war die Gefahr allzu bewusst.
»Wie geht es Ihren Kindern?«, fragte Renate, während Salvino die Felle präparierte.
»Harald hat die Masern.« Nach Jahrzehnten in Deutschland konnte Salvino das stumme H immer noch nicht aussprechen. »Natürlich haben jetzt die andern auch die Masern.«
Aus Angst vor Ansteckung trat Renate einen Schritt zurück. »Das tut mir leid.«
»Ma no, Renate, non ti preoccupar mach dir keine Sorgen.« Salvino nähte Schnüre an die Ränder der Karakulfelle. »Ich hatte die Masern als Kind. Leider ist auch Agathe krank. Aber du kennst sie, sie will nicht im Bett bleiben.« Er warf einen Blick aus dem Fenster in den Hinterhof. »Ihr habt Glück, es beginnt zu regnen.«
»Das ist kein Glück«, sagte Renate. »Ich wusste, dass es abkühlen wird.«
»Junger Mann, bist du bereit?« Salvino schob einen Stuhl in die Mitte. »Darf ich bitten?«
Peter zog sich bis auf das Unterhemd aus, stieg auf den Stuhl und bekam vom Pelzhändler eine Schnur in die Hand gedrückt. Während Salvino das Fell an Peters Körper presste, hob der Junge die Arme. Renate wickelte eine Mullbinde um seinen Bauch. Die Schnur wurde ihm um die Schultern gebunden, damit das Fell nicht rutschte.
»Du siehst aus wie ein Faun«, lachte Salvino.
»Was ist ein Faun?«
»Halb Mensch, halb Tier, mit Hufen statt Füßen und kleinen Hörnern auf dem Kopf.«
»Ich bin ein Faun, ein Faun!« Peter scharrte auf dem Stuhl wie ein Ziegenbock.
»Nicht zu viel bewegen!«, rief Salvino. »Sonst wird es locker.«
Renate fixierte auch das zweite Fell mit einer Mullbinde. »Ich brauche aber mindestens noch eines.«
Salvino begutachtete den Jungen. »Das sieht aber komisch aus, so ein schlanker Bengel mit einem dicken Bauch.«
Sie nickte nachdenklich. »Stimmt, aber die Frau des russischen Offiziers ist eine stark gebaute Dame. Ein richtiges Schlachtschiff.«
Salvino lachte. »Die Russen mögen dicke Frauen.«
»Für eine Jacke brauche ich mindestens drei Felle.«
»Der Kunde ist König.«
Das dritte Fell wurde um Peters Bauch gebunden. »Wie fühlt sich das an, mein kleiner Faun?« Der Pelzhändler zog die Schnur stramm.
Peter stieg vom Stuhl und bewegte den Oberkörper. »Ziemlich gut.«
»Rutscht nichts?«, fragte Renate.
»Es geht schon. Wir können los, Mutti.«
Salvino drückte ihm ein Heft mit bunten Bildern in die Hand. »Magst du Micky Maus?«
Statt einer Antwort ließ sich Peter auf den Boden sinken und schmökerte, während die Erwachsenen das Geschäftliche erledigten.
»Zwei Drittel konnte ich eintauschen«, begann Renate.
»Nur zwei Drittel?« Das Licht der Schreibtischlampe schnitt Salvinos Gesicht in zwei Hälften. »Ostmark nehme ich nicht, das weißt du. Wenn ich die wechsle, gibt es Fragen. Ich mag keine Fragen. Mein Lieferant mag Fragen noch weniger.«
Sie öffnete die Brieftasche. »Ich habe zwei Drittel in D-Mark und den Rest in Rubel dabei. Anders ging es leider nicht.«
Salvino ließ sich in den Sessel sinken. »Die Zeiten ändern sich, Renate. Alles wird schwieriger. Alle sind nervös. Nur weil wir uns so lange kennen, will ich dir helfen. Aber die Geschäfte mit dem Osten …« Er wiegte den Kopf. »Die Grenze wird mit jedem Tag ein größeres Problem.«
»Lass die Grenze mal meine Sorge sein.«
Renate teilte das Vorurteil vieler Deutscher, dass die Italiener Halsabschneider waren. Jedes Mal machte der Kürschner mit der schmalzigen Locke dieses Theater, um mehr herauszuhandeln. »Das Risiko trage ich ganz allein.«
»Und ich!«, rief Peter, über das Micky-Maus-Heft gebeugt.
»Der Rubel ist so gut wie D-Mark oder Dollar.« Renate blätterte die grünen und braunen Scheine mit dem Konterfei Lenins auf den Schreibtisch. Ob fünfzig oder hundert Rubel, das Profil von Wladimir Iljitsch zierte jede Banknote. »Ich möchte drüben sein, bevor der Regen aufhört, darum lege ich dir noch was drauf.«
Salvino seufzte, um anzudeuten, er habe ein viel zu weiches Herz, bündelte das Geld und ließ es in der Schublade verschwinden. »Das nächste Mal in D-Mark bitte.«
»Komm, Peter!« Renate hielt den Regenmantel des Jungen bereit.
Er konnte sich von Micky nicht lösen. »Gleich.«
»Nein, jetzt.«
»Darf ich das Heft mitnehmen?«, fragte er Herrn Salvino.
»Von mir aus gern. Morgen liegt das neue im Kiosk. Meine Kinder warten schon darauf.«
Renate nahm Peter das Heft weg.
»Warum nicht, Mutti?«
»Wir dürfen an der Grenze nicht auffallen. Wenn die Genossen die kapitalistische Schundliteratur in deiner Tasche finden, stellen sie unnötige Fragen.«
Schweren Herzens gab Peter Micky und seine Freunde an Herrn Salvino zurück.
Der Kürschner brachte seine Kundschaft an die Hintertür. »Passt auf euch auf.«
Trotz der Zonenaufteilung Berlins fuhren U- und S-Bahn weitgehend unverändert durch die Viersektorenstadt. Probleme brachten nur die Reparationszahlungen an die Sowjetunion mit sich. Auf vielen Strecken wurden die Gleise abgebaut. Eine Ausnahme bildete die Strecke nach Frankfurt/Oder, denn sie führte direkt bis Moskau.
Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wurden Behelfsbahnsteige eingerichtet. Auch der Wagenpark war dezimiert worden, Hunderte Waggons hatten ihre Reise in die Sowjetunion angetreten.
Peter und seine Mutter saßen schweigend im mittleren Wagen der S-Bahn. Sie musterte ihren Jungen. Sein Gesicht war rot, er schwitzte stark. Persianermäntel waren dafür bekannt, gut zu wärmen, sie hielten sogar dem russischen Winter stand. Mit dem Taschentuch wischte Renate Peter den Schweiß ab. »Sitzt alles fest?«
»Alles bestens, Mutti.«
»Wir sind gleich da. Draußen ist es nicht so warm wie in der Bahn.«
»Mach dir keine Sorgen.«
»Was auch passiert: Du sagst kein Wort. Ich rede.«
»Klar, Mutti. Was soll schon passieren?«
Aus dem Lautsprecher ertönte die blecherne Stimme: »Kochstraße! Letzter Bahnhof im Westsektor!« Alle Passagiere hatten auszusteigen. Während die anderen auf die Ausgänge zueilten, blieb Peter stehen.
»Was ist denn?«
»Nur eine Minute«, bettelte er. Er wollte das Wendemanöver sehen, mit dem der Zug zurückfahren würde.
Renate nahm ihn bei der Hand. »Dafür haben wir keine Zeit.«
Während er von ihr weitergezogen wurde, warf Peter einen letzten Blick auf das Rangiermanöver. Die Lokomotive fuhr auf einem Nebengleis ans andere Ende des Zuges und wurde dort wieder angekoppelt.
»Warum machen die das, Mutti?«
»Weil die Westberliner Angst haben, dass wir ihnen die Züge klauen.«
»Klauen wir denn Züge?«
»Wir klauen niemandem etwas«, antwortete seine Mutter. »Das haben wir nicht nötig.«
Fünf Minuten später erreichten sie den Fußgängerübergang an der Sektorengrenze. Der Regen wurde stärker. Der Grenzpolizist kontrollierte Renates Papiere.
»Grund Ihres Besuchs im Westen?«, fragte er mechanisch.
»Wir haben meine Schwester besucht.«
»Was macht Ihre Schwester?«
»Sie ist Sekretärin in Schöneberg.«
Der Genosse händigte ihr die Papiere aus. Sein Blick fiel auf Peter. »Was fehlt dem Jungen?«
Peters Gesicht war knallrot, Schweiß stand ihm auf der Stirn.
»Dem fehlt nichts.« Renate blieb ruhig.
»Aber Ihr Sohn scheint Fieber zu haben.«
»Dem geht es gut.« Renates Stimme klang ein wenig höher.
»Wir sollten uns den Bengel mal genauer ansehen.« Der Grenzpolizist winkte seinem Kollegen. »Dorthinein, mein Junge.« Er zeigte auf eine zweite Baracke.
»Das ist nicht nötig«, entgegnete Renate, sichtlich nervös.
Peter trat vor den Uniformierten. »Sie haben recht, Genosse. Ich hatte gerade die Masern. Wahrscheinlich bin ich noch nicht ganz übern Berg«, sagte er mit offenem Blick.
»Masern?« Der Genosse ging auf Abstand und bedeutete dem Kollegen, das Gleiche zu tun.
»Hatten Sie die Masern noch nicht, Genosse?« Peter trat nochmals auf ihn zu.
»Und ich will sie auch nicht kriegen.« Vorwurfsvoll sah der Polizist Renate an. »Wie können Sie mit einem ansteckenden Kind die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen?«
Sie ging auf Peters Spiel ein. »Es ist schon fast vorbei, Genosse.« Sie zeigte auf Peters Hals. »Sehen Sie, er hat keine Flecken mehr. Ihm wird nur manchmal noch heiß.«
Die Schlange hinter Renate wurde länger. Der Polizist war die Diskussion leid. »Weitergehen!«
»Danke, Genosse.« Sie nahm Peter bei der Hand.
»Danke, Genosse Polizist!«, rief Peter frech.
Mutter und Sohn schritten kräftig aus. Renate ließ Peters Hand nicht los.
»Bist du böse, Mutti?« Er sah zu ihr hoch.
»Warum?«
»Weil ich nun doch geredet habe.«
»Nein, ich …« Sie warf ihm einen stolzen Blick zu. »Ich bin nicht böse. Gut gemacht.«
4
DER NEUE MIETER
4. Mai
Anja rührte in ihrer Suppe, schon wieder Suppe. Meistens hatte sie keine Lust, für sich allein etwas Besonderes zu kochen. Ihre Abende, auch den heutigen, wollte sie am liebsten überspringen. Tagsüber hätte ihr Leben nicht aufregender sein können. Diktat mit Willy, Redemanuskripte abtippen, auf seine Korrekturen warten, erneut tippen, noch einmal vorlegen, manchmal zehnmal, bis er zufrieden war. Mittags ging sie nicht in die Kantine, weil er auch nicht in die Kantine ging.
»Die Kantine ist der Ort, wo die Angestellten über ihren Chef schimpfen«, sagte er. »Deshalb darf sich der Chef dort nicht blicken lassen.«