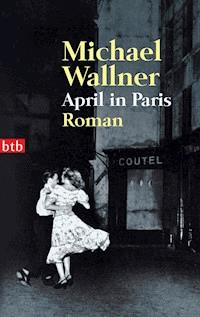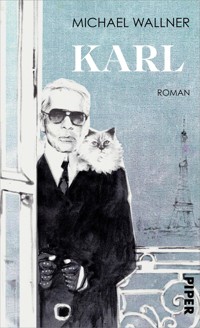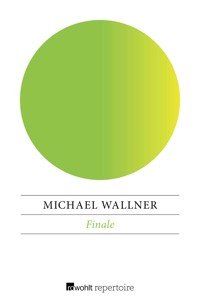
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Musik, die Liebe und der Tod – der vollendete Roman eines unvollendeten Lebens: Ein Mann kehrt nach Wien zurück. Sein Traum von einer Karriere als Konzertpianist hat sich nicht erfüllt, stattdessen war er über Jahre als Manager eines Tourneeorchesters unterwegs in aller Welt. Doch nun spürt er den Keim einer lebensbedrohlichen Krankheit und sucht den Beistand seines Arztes. Unterschlupf gewährt ihm der exzentrische Beamte Moldauer, ein alter Freund. Gleich an seinem ersten Abend in Wien geht der Mann ins Symphoniekonzert und sieht auf dem Podium eine junge Geigerin, die ihn an seine große Liebe erinnert – Klara. Doch sie kann es nicht sein, denn Klara ist tot, vor Jahren unter mysteriösen Umständen ertrunken. Die Begegnung mit ihrer Doppelgängerin weckt im müden Helden neuen Lebensmut und Tatendrang. Er ist überzeugt, Klara wiedergefunden zu haben, obgleich die junge Frau selbst davon nichts wissen will. Statt sich der dringend gebotenen Behandlung zu unterziehen, lässt er all seine Verbindungen spielen, um der Geigerin einen großen Auftritt zu verschaffen: In Klaras Geburtsort Ratten, einem düsteren Kaff in den Voralpen, will er ein neues Musikfestival aus der Taufe heben. Der hinterhältige Bürgermeister und seine Gemeinde tun alles, um diese neumodische Idee zu vereiteln. Allerdings haben sie den Kampfgeist ihres Widersachers gewaltig unterschätzt: Diesen letzten Traum wird er auf jeden Fall in die Tat umsetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Michael Wallner
Finale
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die Musik, die Liebe und der Tod – der vollendete Roman eines unvollendeten Lebens: Ein Mann kehrt nach Wien zurück. Sein Traum von einer Karriere als Konzertpianist hat sich nicht erfüllt, stattdessen war er über Jahre als Manager eines Tourneeorchesters unterwegs in aller Welt. Doch nun spürt er den Keim einer lebensbedrohlichen Krankheit und sucht den Beistand seines Arztes. Unterschlupf gewährt ihm der exzentrische Beamte Moldauer, ein alter Freund.
Gleich an seinem ersten Abend in Wien geht der Mann ins Symphoniekonzert und sieht auf dem Podium eine junge Geigerin, die ihn an seine große Liebe erinnert – Klara. Doch sie kann es nicht sein, denn Klara ist tot, vor Jahren unter mysteriösen Umständen ertrunken. Die Begegnung mit ihrer Doppelgängerin weckt im müden Helden neuen Lebensmut und Tatendrang. Er ist überzeugt, Klara wiedergefunden zu haben, obgleich die junge Frau selbst davon nichts wissen will.
Statt sich der dringend gebotenen Behandlung zu unterziehen, lässt er all seine Verbindungen spielen, um der Geigerin einen großen Auftritt zu verschaffen: In Klaras Geburtsort Ratten, einem düsteren Kaff in den Voralpen, will er ein neues Musikfestival aus der Taufe heben. Der hinterhältige Bürgermeister und seine Gemeinde tun alles, um diese neumodische Idee zu vereiteln. Allerdings haben sie den Kampfgeist ihres Widersachers gewaltig unterschätzt: Diesen letzten Traum wird er auf jeden Fall in die Tat umsetzen.
Über Michael Wallner
Michael Wallner, 1958 in Graz geboren, war Schauspieler am Wiener Burgtheater und am Schillertheater Berlin, arbeitete als Opern- und Schauspielregisseur u.a. in Hamburg, Wien, Bern und Düsseldorf. Heute lebt Michael Wallner als Schriftsteller in Berlin und führt gelegentlich Regie am Burgtheater und an anderen Bühnen. Für seinen Debütroman «Manhattan fliegt» wurde er mit dem Literaturpreis der Stadt Wetzlar ausgezeichnet, der zweite Roman «Cliehms Begabung» wurde von der Kritik gefeiert.
Inhaltsübersicht
Für Hannes und Moldauer
DER SCHLÜSSEL ERWARTETE mich im Weihwasserbecken unter der Madonna, ich wünschte, sie würde kopfüber in die Schale stürzen, doch unverrückbar stand die Statue aus Plastik da und bewachte den Schlüssel, von dem Tropfen perlten, als ich ihn ins Schloss steckte. Moldauer war nicht daheim, und auch wenn ich mich auf das Wiedersehen freute, gefiel mir die Aussicht, einfach den Koffer abstellen und mich auf das Gästebett werfen zu können. Draußen hatte ich noch die Zeitung aufgehoben, die Moldauer nie las, weil sie ihm zu dumm war, wie er sagte, das Abonnement zu kündigen wagte er jedoch nicht, um den sechsundsiebzigjährigen Zeitungsjungen nicht seiner Arbeit zu berauben. Weltwirtschaftsgipfel in Rom, Hungerkatastrophe in Gabun, Meteoreinschlag im Westen Australiens – all das fand sich auf den Seiten drei bis sechs, den Titel des kleinformatigen Blattes aber beherrschte ein einziges Thema: Misswahl wegen Schlechtwetters verschoben! Ich blätterte weiter und fand all die angestaubten Bilder der Kolumnisten wieder, als wäre ich nicht vor Jahren, sondern erst kürzlich außer Landes gegangen. Der Bürgermeister, der seine Geliebte zur Finanzstadträtin erhob, das verdiente Theatermitglied, das zum konservativen Kultursprecher avancierte, die Gerichtspräsidentin, die einen Mordprozess unterbrach, um ihre Spanieldame Gassi zu führen – ich legte die Zeitung weg. Restkarten an der Abendkasse stand als kleine Notiz auf der Rückseite. Ich hatte einen Anzug dabei, doch war er zerknittert, und die Zeit drängte. In Moldauers Schrank fand ich einen dunklen Zweireiher, er passte, nur die Hosenbeine waren zu kurz.
Ich trat in den mit roter Seide tapezierten Raum, ging zur Brüstung und schlug den schweren Vorhang zurück. Schräg unter mir eröffnete sich der Gründerzeitsaal. Zuallererst fielen mir die Nerzstolas auf, die Persianerjäckchen und Goldlamétaschen, das hochtoupierte Frauenhaar, ich hatte vergessen, dass es solche Schnurrbartspitzen noch gab, goldbehangene Dekolletés, das Monogramm im Taschentuch, mit dem über Glatzen und Brillengläser gewischt wurde, die Siegelringe und Silberspangen, Trachten und Smokings. Auch jene jungen Leute sah ich wieder, hinter denen ich draußen mit wenig Hoffnung in der Kassenschlange vorgerückt war, selbst diese Jungen trugen die gleiche hellhäutige Angegriffenheit zur Schau, den gleichen bornierten Blick.
Eben hatte die Grauhaarige am Kassenschalter das Ausverkauft-Schild aushängen wollen, als sie mich unter den Wartenden erkannte, als wären nicht zwanzig Jahre seit unserer letzten Begegnung vergangen. Krählein, hatte ich ihren Namen geflüstert, ungläubig und voller Wiedersehensfreude, sie hatte das Gitter geschlossen und mir zugewinkt, nach hinten zu kommen. Ich kannte den Weg, durch das gläserne Portal in die marmorne Wandelhalle, vorbei am steinernen Relief des letzten Monarchen zu der unscheinbaren Tapetentür hin, Krählein und ich hatten uns in den Armen gelegen, noch ehe ich mich ans Halbdunkel des kleinen Büros gewöhnt hatte. «Seit wann?», hatte sie gefragt. «Vorübergehend, ein kurzer Besuch. Schön, Krählein, wie schön, Sie wieder zu sehen.» In diesem Moment hatte der Schmerz zugebissen, er hatte die ganze Zeit gelauert, um mein Gesicht vor Krähleins Augen zu verzerren. Es war nicht mehr möglich, dem Schmerz zu entgehen. Ich hatte seine Bekanntschaft nicht häufig gemacht, ein Schnitt mit dem Messer ins Oberschenkelfleisch, ein eitriger Zahn, gelegentliches Kopfweh mit Schwindelanfällen, mehr Kämpfe hatte ich mit dem Schmerz noch nicht ausfechten müssen. War er abwesend, bekam Schmerz etwas Unwirkliches, dachte ich über die Brüstung gelehnt, wie Mönche in fernen Klöstern oder ein Wirbelsturm über Alaska. Mich war er eines Tages angesprungen, ich saß in einem ruhigen Lokal und konnte den Schrei nicht unterdrücken, andere Gäste ließen die Zeitungen sinken, Überraschung in ihren Blicken, aber auch Überlegenheit, denn der Beobachter fühlte sich immer als Überwinder, er genoss jene Sekunde ohne eigene Qual.
Ich wandte den Kopf. Unter mir das Orchester, große Besetzung an diesem Abend, eine symphonische Dichtung von Richard Strauss stand auf dem Programm. Sie hatten Platz genommen, hinten die Hornisten, Fagottisten und Kontrafagottisten, davor die Klarinetten, Oboen und Flöten, der Paukist, die blasse Triangel, der Mann an den Becken, rechts machten sich die Posaunen breit, zwei Trompeter und ein hohes Konzerthorn. Vorne die Streicher, die Celli mit auffallend vielen jüngeren Frauen, von den stehenden Kontrabassisten gleichsam bewacht, in der Mitte die Bratschen, links die Violinen. Gleich den raunenden, plappernden, krähenden Stimmen im Saal intonierten auch die Orchesterstimmen auf dem Podium ihre Einsätze einzeln, als wären sie alle Solisten und nicht in Kürze gezwungen, gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen. Als es dunkel wurde, meinte ich in der gegenüberliegenden Loge Stohlhofer zu erkennen, der große kahle Schädel mit dem schneeweißen Haarkranz, die Goldgestellbrille, er konnte es tatsächlich sein, doch da ging das Licht schon aus. Ein Treffen hatte Stohlhofers Sprechstundenhilfe es genannt, erst danach würde Stohlhofer entscheiden, ob es zu Konsultationen kam. Die Aussicht, ihn am nächsten Vormittag kennen zu lernen, war es wert gewesen, die lange Reise anzutreten, dachte ich und sank auf den samtbezogenen Stuhl.
Nicholàs stand im unterirdischen Eingang des Grabens, ich hatte seinen Frackärmel schon mehrmals auftauchen gesehen, er wartete in seiner Höhle, bis vollkommene Stille eintrat. Jetzt schnellte er vor, sprang von hinten auf die Kontrabässe zu, wich ihnen im letzten Moment aus und lief zwischen den Celli und Bratschen hindurch aufs Podest. Seit Kastoders Tod gab es niemanden, der Nicholàs die Vorrangstellung unter den Dirigenten streitig machte, er war der bedeutendste Maestro Europas und einzig gefragter Exportartikel des Landes. Für die Einheimischen aber stand er noch immer im Schatten Kastoders, des unvergessenen Übervaters, das sagten sie mit ihrem Applaus, er war wohlwollend, nicht eben stürmisch, Nicholàs würde den Anbetungsstatus Kastoders bei Lebzeiten nicht mehr erreichen. Er verbeugte sich hektisch, schob die Brille zurecht und wandte sich zu den Musikern.
In diesem Moment sah ich Klara. Es war nicht möglich, Klara zu sehen, denn Klara war tot. In der zweiten Reihe der ersten Geigen aber saß eine Frau, die ihr dermaßen ähnelte, dass mir ein Röcheln entfuhr, laut genug, dass Nicholàs den Taktstock eine Sekunde länger in der Luft zittern ließ. Ich lehnte mich rasch in die Loge zurück, Nicholàs schlug den Einsatz, forcierte das Allegro, die Violinen hatten Mühe, die schnellen Läufe in den hohen Lagen zu nehmen. Vorsichtig beugte ich mich nach vorn, die Frau unter mir hatte den Kopf schief gelegt, als wäre sie sich über die Notenfolge nicht im Klaren, und doch flogen die Finger ihrer Griffhand über die Saiten, die Finger von Klara.
Als Pianist steht dir die ganze Welt offen, fiel mir der Lieblingssatz meiner Mutter ein. Bis zu ihrem vierzigsten Geburtstag hatte sie selbst Konzerte gegeben, nicht in großen Städten und ersten Konzertsälen, doch von Zeit zu Zeit war sie aufgebrochen, um in Linz oder Bad Gastein zu gastieren. Mein Programmheft rutschte vom Knie und fiel zu Boden, ich hob es auf und sah nach, ob die Namen der Musiker aufgelistet waren. Unter mir brachte die junge Geigerin mit springendem Bogen die Zweiunddreißigstel zum Klingen, sie nützte die nächste Fermate, um eine Haarsträhne aus der Stirn zu wischen; schmal und glatt war ihr Hals, sie trug ein kurzes Kleid, schwarz, die Beine steckten in dunklen Strümpfen.
Nach wenigen Monaten hatte man mir erklärt, dass ich für die Meisterklasse nicht gut genug sei; meine Mutter war nicht müde geworden, auf den Kulturklüngel zu schimpfen, der die Söhne von Ministern und Operndirektoren hätschle, eine wahre Begabung aber verkenne. Ich spielte Klavier in Nachtcafés, bis ein befreundeter Posaunist mir vom Tod des Orchesterwartes erzählte. Der Posaunist gehörte einem Tourneeorchester an, das mit populären Programmen Drittweltländer bereiste. Es sei unter der Würde eines Künstlers, Notenpulte für andere aufzustellen, hatte meine Mutter protestiert, doch sah sie ein, dass sie uns beide mit Klavierstunden nicht länger durchbringen konnte. Bald darauf arrangierte ich die Sitzordnung auf Konzertpodesten, legte Notenstimmen in der richtigen Reihenfolge auf, sammelte sie hinterher wieder ein, man schätzte mich, der Posaunist lud mich nachts in die Bars ein, die einsame Bratschistin schüttete mir ihr Herz aus, ich reiste mit dem Orchester und lernte Städte kennen, deren Namen ich auf den Tourneelisten zum ersten Mal las.
Nicholàs dehnte die Stille zwischen dem ersten und zweiten Satz so lange, dass die Huster im Parkett den Beginn des Andante verdarben. Die Geigerin unter mir sah plötzlich hoch, für einen Moment schien mir, sie habe mich in der Loge entdeckt, doch schon hob sie die Geige wieder ans Kinn und begann das e-Moll-Thema mit langsamem Aufstrich.
Immer war es der Tod, dachte ich, der mich im Leben weitergebracht hatte. Der Chefdisponent des Orchesters war im Fahrstuhl erstickt, schon auf dem Begräbnis hatte ich mich um die Nachfolge beworben. Mit Kurverwaltungen und Konzertdirektionen telefonierte ich nun, lernte die Unregelmäßigkeiten der Flugpläne kennen, organisierte Diabetikermenüs in Ostafrika, entwickelte ein Gespür, Krankheitsfälle vorherzusehen, und ersetzte, manchmal in letzter Minute, eine schwangere Flötistin oder den depressiven Solocellisten. Obwohl ich an allen Tourneeorten die Konzertflügel begutachtete, spielte ich selbst kaum noch. Nur manchmal, wenn die Musiker nach dem Konzert schon ins Hotel gebracht wurden, setzte ich mich auf eine Klavierbank in Windhuk oder Lagos und hob den Deckel. Ich spielte die französischen Suiten von Johann Sebastian Bach, die schlanke Allemande, die fröhliche Gavotte, nach dem letzten Satz stand ich auf und lauschte einige Sekunden in den dunklen Saal. Meistens rief ich an solchen Abenden meine Mutter an, um sie mit einer Lüge glücklich zu machen. Ich erzählte, mit dem Orchester das Zweite von Rachmaninow aufgeführt zu haben, schilderte den brillanten Kopfsatz, die Begeisterung des Publikums, in Wirklichkeit war mir das Zweite Rach immer zu kompliziert gewesen, Unmengen von Noten, dabei steckte nur ein magerer musikalischer Einfall dahinter.
Ein hysterisches Bravo aus der Nachbarloge ließ mich hochfahren. Nicholás ignorierte den Applaus, verschwand nicht wie andere Dirigenten in seinem Verschlag, um sich durch Akklamation wieder aufs Podium rufen zu lassen, er schüttelte dem Konzertmeister nicht die Hand, ließ nicht einmal das Orchester zum Verbeugen aufstehen, sondern legte den Mozart beiseite und nahm die Strauss-Partitur. Durch Haltung und Geste erzwang er Ruhe, schlug die Viertelpause übertrieben deutlich und gab den Kontrabässen den Einsatz.
Klara würde mich wieder erkennen. Zwar war mein Haar an den Schläfen von grauen Fäden durchzogen, und erst vor kurzem hatte ich eine gebeugte Haltung an mir festgestellt, trotzdem hoffte ich, Klara werde mich nicht übersehen. Es war nebelig geworden, wie altmodische Gasflämmchen glommen die Glühbirnen der Laternen, die Stadt versank in graugelbem Dunst. Nach und nach traten die Musiker bei der Schwingtür heraus, blickten in den Nieselregen, fassten ihre Instrumente enger und liefen zur Tramhaltestelle. Eine Vierergruppe kam als Nächstes, dann blieb das lichte Viereck sekundenlang leer. Klara erschien in einem langen, eng anliegenden Mantel, stülpte die pelzbesetzte Kapuze über, zog den Geigenkasten an ihre Brust und machte sich auf den Weg. Die Einladung zu ihrem Begräbnis fiel mir ein, an den Trauerrand war eine Lavendelblüte geheftet gewesen. Ohne mich zu bemerken, tauchte sie in den Stadtgarten ein, aus den Sträuchern stach moosbewachsen das Schubertdenkmal hervor, Klara ging eilig, ich hatte Mühe, sie zwischen den Blutbuchen nicht aus den Augen zu verlieren. Auf der anderen Seite des Teiches, unter einer Laterne, spiegelte sich ihre Silhouette im Wasser. Es musste halb elf sein, kein Mensch war sonst in der Nähe, da ich stillstand, fühlte ich den Schweiß im Rücken und begann zu frieren. Ich blickte mich um, welcher der schnellste Weg aus dem Park sei, da kam Klara mir plötzlich entgegen. Die Allee war schmal, wir mussten so nahe aneinander vorbei, dass ein flüchtiger Gruß sich aufzwang, lange genug, um ihr in die Augen zu sehen. Kälte und Peinlichkeit waren vergessen, ich ließ ihr einen guten Vorsprung und setzte mich wieder auf die Spur.
Klaras Großmutter – Elisabeth – musste bereits in ihren Sechzigern gewesen sein, als sie bei mir als Bratschistin begann; kein Orchester hätte sie damals noch engagiert, sie war glücklich gewesen, in ihrem Alter wieder auftreten zu dürfen. Elisabeth stammte vom Land, aus einem Dorf namens Ratten, sie war etwas zu dick und trug am liebsten Blusen in Grüntönen. Nach Konzerten gingen wir manchmal gemeinsam ins Hotel oder setzten uns beim Frühstück an denselben Tisch. Ständig hatte sie von ihrer Enkelin Klara erzählt, nach Elisabeths Worten musste das Kind ein Naturtalent sein, mit phänomenalem Gehör und einer besonderen Begabung für das Geigenspiel. Ich rief mir den Abend vor Augen, als ich Klara zum ersten Mal begegnet war. An einem Adventssonntag hatte Elisabeth mit zerzaustem Haar vor meiner Tür gestanden, ein Mädchen von etwa fünf Jahren auf dem Arm. Das Kind gehorchte ohne Widerspruch, als Elisabeth es ins Wohnzimmer setzte und mich um ein Gespräch unter vier Augen bat. Klaras Vater, der Lehrer von Ratten, und ihre Mutter, die als Kellnerin gearbeitet hatte, seien gemeinsam aus dem Leben geschieden. Der Gastwirt habe die Leichen gefunden, nachdem Klaras Mutter nicht zur Arbeit erschienen sei. Er habe an ihre Tür geklopft und das Gas schon von draußen gerochen. Düster sei dieses Ratten, hatte Elisabeth gesagt, die Menschen gehässig, unmöglich könne sie das Mädchen dort lassen, wo man es als Kind der Selbstmörder behandeln werde, andere Verwandte gebe es nicht, und ein Heim, niemals werde sie ihr Herzenskind in ein Heim geben. Ich hatte Elisabeth noch einmal die Statuten erklärt: Kinder durften auf Tournee nicht mitgenommen werden. In diesem Moment war die Tür aufgegangen, nur einen Spaltbreit, Klara stand da, sie hatte Ansichtskarten in der Hand, zeigte auf die Bilder ferner Städte, und plötzlich, erinnerte ich mich, hatte sie aufgeschaut und gelächelt.
Schon von weitem hörte ich das Plätschern des Salvatiusbrunnens, Klaras Schritte hallten vor mir auf dem Pflaster, ich folgte ihr, ohne sie sehen zu müssen. Dort ging sie, der Mantel umspielte ihre Beine, ich nahm an, sie würde gleich in der Gessnergasse verschwinden, doch unvermittelt trat Klara in die Arkaden der alten Universität. Dort gab es keinen Durchgang, irgendwann musste sie aus dem Laubengang wieder hervorkommen. Menschenleer lag der Platz, aus den Mäulern der Faune, den Krügen der Nymphen sprang das Wasser, ich strengte meine Augen an, die Dunkelheit zwischen den Säulen zu durchdringen, hätte Klara über den Platz zurufen können, doch ihren Namen zu nennen scheute ich mich. Wie viel Zeit vergangen war, wusste ich nicht, im Schatten des Brunnens betrachtete ich den Himmel, die Fensterläden mit den morschen Lamellen, ich zählte die steinernen Figuren. Die Kälte drang durch den Anzug, seit meiner Ankunft war ich nicht aus den Schuhen gekommen, frierend spähte ich hinter dem Brunnen hervor und begann Fuß vor Fuß zu setzen. Ich überquerte den Platz, Klara musste meine Schritte längst hören, zwischen den Säulen trat ich ins Dunkel, erreichte die hintere Wand, tastete mich an den rauen Mauersteinen entlang, drang weiter, bis ich eine Krümmung erreichte, die mir nie aufgefallen war, und stand vor der neuen Passage. Sie hatten eine Öffnung vom Salvatiusplatz zum Lugeck geschlagen, die Nische war leer. Ich betrachtete die Lichter auf der anderen Seite, von Klara war nichts mehr zu sehen.
MIT MEINER MAPPE aus Befunden und Röntgenbildern setzte ich mich, hatte mich schon zum dritten Mal gesetzt, nachdem ich die Anmeldung und den ersten Warteraum durchlaufen musste und nun im unmittelbaren Einflussbereich Stohlhofers war. Ich hatte seine lange Silhouette mehrmals bei halb geöffneter Tür auftauchen gesehen, die kehlige Stimme gehört, wie sie Ermunterungen und Hinweise gab, und doch wurde mir klar, dass Stohlhofer Order erteilte. Sein «Bis nächste Woche» klang wie die Festsetzung eines unaufschiebbaren Lebensschnittpunktes, hinterher würde der alte Bestand nicht mehr gelten. Ich begann meine Sätze durchzugehen, hatte sie seit langem vorbereitet, kurz vor dem Eintritt bei Stohlhofer drängten sie sich nun förmlich auf; ich wollte ihm meinen Zustand sachlich schildern, bewusste Ausdrücke finden für vegetatives Geschehen, Stohlhofer sollte mich erst verstehen, bevor er die schriftlichen Meinungen der Kollegen, die durchleuchtenden Bilder sah. Es ist ein Sekunden anhaltender blähender Schmerz im Bereich des Mittelbauches, lautete der erste Satz. Ich nahm an, dass «Mittelbauch» ein veralteter Ausdruck war, vielleicht ein erfundener, doch bezeichnete er das Feindesland in meinem Körper. Ich legte die Mappe auf die Knie, entdeckte die nierenförmigen Ränder, die meine Handballen hinterließen; als ich die Hände am Hemd trockenwischte, fühlte ich einen warmen Film am ganzen Körper. Ich schwitze es aus, dachte ich, Stohlhofer wird meine Furcht schon am Schweiß erkennen.
Er sprach meinen Namen gelassen aus, gab mir nicht die Hand und ging federnd, fast wippend zum Schreibtisch, wo er stehen blieb und mir die Wahl des Platzes überließ. Ich setzte mich auf den Thonetstuhl, dessen Holz im schräg einfallenden Vormittagslicht rötlich schimmerte, auch er nahm Platz, in einem gestreiften Sessel am anderen Ende des Raumes. Wir waren mehrere Meter voneinander entfernt, und diese Distanz flößte mir Zutrauen ein. Hier war jemand, dachte ich, der sich nicht aufdrängte, sich nicht über mich hermachte wie die meisten Ärzte, ich hatte Luft, Bewegungsfreiheit, war Herr des Geschehens. Kein Kaffee wurde angeboten oder das obligate Wasser, unsere Begegnung begann neutral, wir hätten Geschäftsleute sein können oder Diplomaten zweier verfeindeter Länder. Stohlhofer hatte nichts von modernen Ärzten, die in saloppem Weiß auftraten, als würden sie auf dem Weg zum Tennisplatz kurz in der Praxis vorbeischauen, keinen grünen Kittel, nicht die fußentlastenden Sandalen oder ausgewaschenen Baumwollhosen trug er, die ihnen das Flair von Bademeistern verliehen, sondern einen Anzug aus feinem Tuch, aschgrau, dreiteilig, mit Krawatte und gestärktem Hemdkragen. Der ganze Mann wirkte wie frisch gebügelt, und doch ging nichts Steifes von ihm aus. Er ließ mich den Anfang machen, ich wies auf den Packen Papier, den ich beim Hereinkommen auf den Marmortisch gelegt hatte, er nickte bloß, als wollte er sagen, jetzt sind Sie bei mir, wir beschäftigen uns mit der Wahrheit. Ob die Wahrheit ermunternd sein würde oder vernichtend, war zweitrangig, dachte ich, Stohlhofer würde mich begleiten, zu den Wurzeln des Schmerzes, dann darüber hinaus.
«Und du hast nichts weiter wissen wollen?» Moldauer zerkleinerte den Apfel und schabte ihn auf der gläsernen Reibe, bis nur ein bräunliches Mus übrig blieb. Seit zwanzig Jahren standen die himmelblauen Hausschuhe für mich bereit, ich schlüpfte hinein. «Soll ich die Pasta schon –?» Ich machte eine Geste des Durch-den-Wolf-Drehens, Moldauer hob warnend die Hände.
«Im letzten Moment stechen wir sie erst aus», sagte er, untermischte den Apfelbrei mit mehreren Lagen Quark, Mascarpone und geschlagener Sahne und stellte das zitternde Gebäude kalt. Ich betupfte den Teig, er war weich und elastisch, wieso Nudeln aus der Packung immer steinhart seien, fragte ich, Moldauer lachte, ich hatte eine Frage aus der Welt der Nichtköche gestellt.
«Du gehst zur großen Koryphäe der Stadt und kommst mit nichts zurück als einem neuen Termin?» Er drehte den Salat in der Schleuder, der Lärm erübrigte eine Antwort. «Dekantiere doch bitte den Rotwein», sagte er, drückte mir die Karaffe in die Hand und schob mich aus der Küche.
Stanzbiopsie fiel mir ein, ich zog den Korken aus der Flasche, Stohlhofer hatte den Ausdruck verwendet, mir auch erklärt, was die Stanzbiopsie sei und warum er sie anzuwenden gedenke. Langsam goss ich den Wein in die Karaffe, sah die tiefrote Flüssigkeit im Kerzenlicht funkeln. Wie wohl ich mich in diesen Räumen fühlte. Die meterlangen Bücherwände, nicht bis zur Decke, sondern bloß zu einer Höhe reichend, wo man auch den obersten Band bequem ergreifen konnte, das Weinregal aus übereinander gestapelten tönernen Röhren, die Anrichte aus Kunststoff, der altdeutsche Tisch, der zur dreifachen Länge ausgezogen wurde, wenn Moldauer seine großen Essen gab, die Stühle mit den dunkelblauen und pfirsichfarbenen Bezügen, die Jugendstilleuchten, in Ecken gerichtet, wo sie überraschende Lichtinseln bildeten, das gerahmte Poster der Rothko-Ausstellung und die Tuschezeichnung eines knienden Mannes, der den Mond anbetete oder einen kreisrunden Gott. Hässlich war allein der kleinquadratische Parkettboden, Verunstaltung aus den siebziger Jahren, als die Wohnung noch Moldauers Mutter gehört hatte, hässlich auch der Lärm von der nur ein Stockwerk tiefer liegenden Straße, Verbindung zwischen den inneren und äußeren Stadtbezirken, aber Moldauers Fenster waren dicht, der Verkehr drang nur wie fernes Raunen ins Zimmer. Er servierte die Vorspeise, grüne Bohnen, kalt, in einer Tunke aus Knoblauch, Petersilie und Olivenöl.
«Ich habe Klara wieder gesehen», sagte ich, nachdem wir die ersten Bissen genommen hatten und ich wie immer die Augen verdrehte, es schmeckte besser als im erlesensten Restaurant. Ich brach ein Stück Brot und wartete auf Antwort.
«Wie gerne ich sie spielen gehört habe.» Er sah mich an. «Sie war das bezauberndste Wesen, das du je an diesen Tisch gebracht hast.» Moldauer weinte gerne, er tat es auch jetzt, die Tränen verteilten sich in den Falten der fünfzigjährigen Augen.
«Sie war es. Ich bin ihr gefolgt», sagte ich und aß weiter.
«Bei ihrem Begräbnis spielte ein Streichoktett», antwortete er nach einer Weile, in der das Besteck kurze helle Laute auf den Tellern machte. «Sie spielten damals … Ich weiß es noch …» Er summte die Melodie.
«Brüderlein fein.» Ich erkannte es gleich.
«Ich habe phantastisch geweint. Warum bist du nicht dort gewesen?» Moldauer pikte mit dem Messer in meine Richtung.
«Zu weit weg, zu viele Termine.»
«Klara war deine Entdeckung, du hast die Eierschale geköpft, aus der sie geschlüpft ist.»
«Darum bin ich auch so erschrocken.» Ich legte die Gabel an den Tellerrand. «Eine Verwechslung, sagte ich mir. Aber dann ging ich ihr nach, und es war Klara.»
«Sie kann es nicht sein.» Moldauer stand auf. «Behalte dein Besteck, ich bringe den Salat.» Er nahm den halb vollen Teller vor mir weg und verließ das Zimmer.
Ich schloss die Tür und sank auf das mönchische Bett, das Moldauer mit seiner gestärkten Wäsche bezogen hatte; der Raum war klein und schmal wie ein Schlauch, und doch hätte ich Monate darin verbringen können, ohne mich beengt zu fühlen. Jahrelang in den dunklen Wohnungen der Hauptstadt lebend, hatten meine Mutter und ich immer vom Süden geträumt. Nachdem ich die Leitung des Orchesters abgegeben hatte, kaufte ich ein Haus bei Urbino, drei Wochen vor dem Einzug starb meine Mutter. Man hatte die Zuckerkrankheit zu spät entdeckt, sie besaß nicht die Disziplin, auf ihre Lieblingsspeisen zu verzichten, und wurde jähzornig, wenn ich ihr keine Schaumrollen mitbrachte. Das Herz machte die außer Kontrolle geratenden Zuckerschübe nicht lange mit, sie verfiel bis zur Bettlägerigkeit und verlor die Freude am Leben. Am Sterbebett, wir nahmen an, dass es ihr Sterbebett war, hatte sie mich einen Eid ablegen lassen, das Klavierspiel niemals aufzugeben. Kurz darauf hatte sie sich erholt und verlangt, nach Italien gebracht zu werden. Die Koffer waren gepackt, ich hatte mich mit den erforderlichen Rezepten ausgerüstet, da war sie neben ihrer Barocktruhe zu Boden gesunken und nicht mehr aufgestanden. Eine Woche nach dem Begräbnis kaufte ich beim Klavierbauer von Urbino einen Flügel und ließ ihn ins Haus transportieren; das nussbraune Corpus musste mit Seilwinden durch ein Fenster gehievt werden, da die Treppe zu schmal war. Ich erinnerte mich, dass der Tod meiner Mutter und die Heiterkeit jener Landschaft mich in eine seltsame Gemütsverfassung versetzt hatten, ich wanderte durch die Gegend, bewunderte die prallen, je nach Sonnenstand wechselnden Farben, sah Wälder mit dem Horizont verschwimmen, und hinter der nächsten, der übernächsten Hügelkette an klaren Tagen das Meer. Ich begann mit Bach und stellte bald fest, dass mir die Partiten zu schwer, die Fugen zu kompliziert waren, ich wechselte zu Mozart, später zu Webern, einiges konnte ich technisch bewältigen, aber ich traf den Nerv nicht, der Geist der Werke verschloss sich mir. Verzweifelt begriff ich, dass die schöne Umgebung, die freundlichen Menschen nutzlos für mich waren, wenn es mir nicht gelang, das Klavier zu bezwingen. Von nun an übte ich täglich neun Stunden, kehrte nach monatelanger Arbeit über Schubert und Bartók zu Bach zurück und wagte mich an die französischen Suiten. Moldauer besuchte mich in jenem Frühling und schlug vor, ein Sommerkonzert zu geben. Ich setzte mir eine Frist von neun Wochen, er versprach, zum vereinbarten Termin wiederzukommen. In der Folge erfasste mich eine fieberhafte Aktivität, ich wählte eine Sonate von Donizetti, die zweite Partite von Liebersfeld und die französischen Suiten von Johann Sebastian Bach. Moldauer, zwei Tage vor dem Konzert wieder angereist, quartierte sich in einer Pension des Ortes ein, um mich nicht zu stören; in seiner Begleitung war eine Fünfzehnjährige, ich hatte sie nur einmal gesehen, schlank, mit hochgestecktem weizenfarbenem Haar, als sie durch den venezianischen Triumphbogen zum Obsthändler ging, verstummte das Gespräch auf der Piazza. Ich war voller Vorfreude, vielleicht hatte meine Mutter ja doch Recht gehabt, möglicherweise hatte ich das Zeug zum Pianisten, so träumte ich in den letzten Stunden vor dem Konzert, als sich das Haus in der Nachmittagshitze einem trügerischen Frieden überließ. Abends steckte ich die Stifte der Manschettenknöpfe durch die Schlitze der Ärmel, band die Schleife, verstaute drei Taschentücher im Jackett und verließ mein Zimmer. Die meisten Gäste waren schon eingetroffen, ich nahm Komplimente über das Haus entgegen, versprach, am nächsten Tag den Weinberg und die alte Holzpresse zu zeigen, und stellte Freunde von auswärts den Einheimischen vor. Moldauer, sonst der zuverlässigste Mensch von der Welt, kam im letzten Moment den Kiesweg hochgeeilt, in Begleitung der jungen Frau. Sie lief auf mich zu, fasste mich an den Schultern, stieg auf die Zehenspitzen und spuckte mir über die Schulter. Da erst erkannte ich Klara.
Der Donizetti war mir missglückt, dachte ich, die Decke über mich schlagend, ich machte mit dem Liebersfeld weiter. Danach verschwand ich kurz aus dem Saal, wechselte das Hemd, zwang meine Gäste durch mein Wiedererscheinen, ihre Gläser auf Balustraden und Fensterborden abzustellen, und begann mit den französischen Suiten. Ich fühlte mich in völliger Harmonie mit dem Werk und wünschte mir plötzlich, meine Mutter möge mich hören, so sehr sehnte ich mich nach der toten Mutter, dass mir die Tränen hochdrängten, weinend spielte ich die Suiten zu Ende, beendete den Gigue-Satz mit dem kräftigen Dreiklang, griff zum Taschentuch und wischte Augen und Wangen ab. Als der Applaus geendet hatte, ging ich in den Kreis meiner Freunde, hörte anerkennende Worte, sie lobten meinen Fleiß und die Anstrengung, ein Fest wie dieses auf die Beine zu stellen, schließlich stand ich vor Klara. Der Donizetti habe ihr gefallen, sagte sie, den Liebersfeld wolle sie gerne noch einmal hören, dann machte sie eine Pause und zupfte an ihren Haaren. Den Bach nehme sie mir übel. Ich hätte schwülstig gespielt, unentschlossen und, schlimmer als alles, sentimental. Es habe sie traurig gemacht und wütend auf mich, der es besser wissen müsse und der ihr, als sie noch auf ihrer Anfängergeige spielte, genau diese Gefühligkeit als größte Untugend angeprangert habe. Ich hatte ihr aufmerksam, scheinbar gelassen zugehört und begriffen, dass die glücklichen Wochen im Gefühl, ein Künstlerdasein zu führen, vorbei waren. Als Klara nach nur zweitägigem Aufenthalt mit Moldauer abreiste, war ich erleichtert, dankbar für ihre Offenheit, hätte ich ihre Anwesenheit nicht länger ertragen. Die Notenhefte verschloss ich im tiefsten Keller, sperrte den Flügel ab und hängte den Schlüssel über die Tür meines Zimmers, als Warnung, mich nie wieder über mein wahres Talent zu erheben.
Der Schmerz biss zu, heimtückisch, ich drückte das Kreuz durch und lag starr auf dem Bett. Obwohl ich wusste, dass Moldauer drei Zimmer weiter schlief, versagte ich mir zu schreien. In den peinigenden Sekunden sah ich Stohlhofers Schädel mit dem weißen Haarkranz, die ruhigen Augen hinter der Goldgestellbrille, ich sah Klara die Geige ansetzen, und während ich darauf wartete, dass sie endlich zu spielen begann, fühlte ich mich fortgetragen vom Schmerz.
«SO WERDEN WIR sie nicht finden.» Moldauer bestellte den dritten Kaffee dieses Vormittags, so wie wir bereits das dritte Kaffeehaus betraten. Ich wollte Klara nicht ausfindig machen, wie Moldauer vorschlug, ich wollte ihr wieder begegnen. Dem Zufall wollte ich vertrauen, der in der Hauptstadt mit bestürzender Zuverlässigkeit regierte. Trat man in das früher hervorragende ungarische Esslokal, das den Koch gewechselt hatte und also schlecht geworden war, und hoffte man darum, auf keinen Bekannten zu stoßen, weil die Stammkundschaft ausblieb, so sah man im Gegenteil die greise Volksdichterin am Einpersonentisch Brotstücke in ihre Suppe krümeln, man entdeckte das Schauspielerpaar, das sich angeblich getrennt hatte, im Nebenraum, und in der Nische nahm die letzte lebende Windischgrätz Platz.
Ich hatte Moldauer gebeten, mich an seinem freien Vormittag in die Stammlokale der Musiker zu begleiten, um jenem Zufall eine Chance zu geben, wir hatten auch schon etliche Musikergesichter zu sehen bekommen, einige hatten mir zugenickt, unsicher, ob ich es war, nicht zu vehement, denn war ich es nicht, hätten sie ja unsinnigerweise genickt. Aber ich war es und nickte zurück und beobachtete, wie sie überlegten, wann sie mich zuletzt und unter welchen Umständen gesehen hatten. Ich erinnerte mich bei den Musikergesichtern nicht an Menschen, sondern an Musikinstrumentgruppen, ein stiernackiger Trompeter stellte für mich das Blech der Symphoniker dar, die Blechbläser waren die häufigsten Kaffeehaussitzer, da sie entweder gar nicht oder erst spät zur Probe mussten, denn wurde nicht Wagner oder «Der Rosenkavalier» geprobt, hatten die Blechbläser frei, blieben aber nicht etwa zu Hause, sondern trafen sich mit Kollegen, aßen Würstel und besprachen den Spielplan. Ich war sicher, die Streicher erst nach dreizehn Uhr in den Kaffeehäusern auftauchen zu sehen, und blieb dennoch wachsam, denn die Dienstpläne waren unvorhersehbar und ließen auch die Möglichkeit zu, dass Klara im nächsten Augenblick durch die Tür des Café Engländer