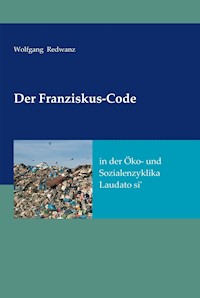
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Sozialenzyklika Laudato si' drückt Papst Franziskus den Schrei der gequälten Erde aus. Es ist ein Weckruf, eine harte Provokation für die Industriegesellschaft, aber auch eine Hoffnungsfanfare. Als "unbefugter" Laie betritt Wolfgang Redwanz die Arena der christlichen Sozialethik. In dieser Rolle kann er das an einigen Stellen vielleicht etwas unbefangener tun als der Kreis der professionellen Kommentatoren und Sozialethiker, deren Standard zu erreichen nicht sein Ziel ist. Wolfang Redwanz will zum Dialog, den Papst Franziskus so beharrlich fordert, beitragen und versuchen, Missverständnisse in der Bewertung zu vermeiden, wenn der Franziskus-Code nicht richtig gedeutet wird. Immerhin hat der bekannte Kommunikationsforscher Paul Watzlawick nachgewiesen, wie schon bei der Begegnung von Bienenstämmen nördlich und südlich der Alpen aufgrund unterschiedlicher Codes Konfusionen, Verwirrungen entstehen, Das kann auch der Fall sein, wenn erstmals ein Nichteuropäer, ein Südamerikaner eine Sozialenzyklika schreibt. Der Autor hofft, das sich kirchennahe und kirchenferne Gläubige, Konfessionslose, Agnostiker und Atheisten, an die sich die Enzyklika gleichermaßen richtet, mit dem Konzept der "ganzheitlichen Ökologie" des Papstes befassen, in dem dieser eine enge Beziehung zwischen den Armen dieser Erde und der Anfälligkeit des Planeten herstellt und somit eine Öko-Sozialenzyklika in die Diskussion eingebracht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
In der Umweltenzyklika „Laudato si‘ drückt Papst Franzikus den Schrei der gequälten Erde aus. Es ist ein Weckruf, eine harte Provokation für die Industriegesellschaft, aber auch eine Hoffnungsfanfare.
Als „unbefugter“ Laie betritt Wolfgang Redwanz die Arena der christlichen Sozialethik. In dieser Rolle kann er das an einigen Stellen vielleicht etwas unbefangener tun als der Kreis der professionellen Kommentatoren und Sozialethiker, deren Standard zu erreichen nicht sein Ziel ist.
Wolfang Redwanz will zum Dialog, den Papst Franziskus so beharrlich fordert, beitragen und versuchen, Missverständnisse in der Bewertung zu vermeiden, wenn der Franziskus-Code nicht richtig gedeutet wird. Immerhin hat der bekannte Kommunikationsforscher Paul Watzlawick nachgewiesen, wie schon bei der Begegnung von Bienenstämmen nördlich und südlich der Alpen aufgrund unterschiedlicher Codes Konfusionen, Verwirrungen entstehen. Das kann auch der Fall sein, wenn erstmals ein Nichteuropäer, ein Südamerikaner eine Sozialenzyklika schreibt. Der Autor hofft, das sich kirchennahe und kirchenferne Gläubige, Konfessionslose, Agnostiker und Atheisten, an die sich die Enzyklika gleichermaßen richtet, sich mit Konzept der „ganzheitlichen Ökologie“ des Papstes befassen, in dem dieser eine enge Beziehung zwischen den Armen dieser Erde und der Anfälligkeit des Planeten herstellt und somit eine Öko-Sozialenzyklika in die Diskussion eingebracht hat.
© 2017 Wolfgang Redwanz
Umschlaggestaltung, Illustration: Podbook
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-7439-5560-8
ISBN Hardcover: 978-3-7439-5561-5
ISBN e-Book: 978-3-7439-5669-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Wolfgang Redwanz
Der Franziskus-Code in der Öko- und Sozialenzyklka
Laudato-si‘
Der Franziskus-Code in der Öko-und Sozialenzyklika Laudato si‘
1. Laudato si – eine revolutionär neue Enzyklika?
2. Sozialenzykliken – Was sie innerkirchlich und für die säkulare Gesellschaft bedeuten
3. Der Schrei der Erde als Weckruf, als Provokation, als „Hoffnungsfanfare“
4. Ein Schrei nach sozialer Gerechtigkeit
5. „Eine ganzheitliche Ökologie“
6. „Einige Leitlinien für Orientierung und Handlung“
7. “Ökologische Erziehung und Spiritualität“
8. Eckwerte christlicher Sozialethik im Überblick
9. Anmerkungen zur Kritik an Laudato si‘
10. Zur Wirkkraft von Laudato si‘
Anmerkungen/Benutzte Literatur
"Diese Enzyklika kann man nicht einfach lesen, abhaken, beiseite legen und unverrichteter Dinge zur Tagesordnung übergehen". Diese wertschätzende Aussage hat der emeritierte brasilianische Amazonas-Bischof Erwin Kräutler nach dem Erscheinen von Laudato si‘ getroffen. „Mit der Enzyklika Laudato si‘ - Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ ist Papst Franziskus eine spannende Provokation der pluralistischen Weltgesellschaft gelungen […] Die von ihr angesprochenen Themen und Ansätze könnten das Potential haben, zusätzliche Motivationen zum Handeln freizulegen“, so urteilt Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer von Germanwatch, und mahnt an, den von Papst Franziskus gewünschten Dialog zu führen und „Ernst damit zu machen.“1)
Auch gut zwei Jahre nach Erscheinen der Enzyklika ist es – innerund außerkirchlich - wichtig, den Appell des Papstes aufzugreifen und dabei auch die Rolle von christlicher Sozialethik für die moderne Gesellschaft zu erörtern. Die am 1.6.2017 unter dem Motto „America first“ erfolgte Aufkündigung des Klimaschutzabkommens von Paris (2015) durch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, den „mächtigsten Mann der Welt“, gibt zu Sorge Anlass, nicht nur, weil von ihm einseitig Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund geschoben werden, sondern auch weil er glaubt, dafür einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung zu finden, vor allem bei sogenannten Klimaskeptikern.
So gut lesbar der Text der Enzyklika Laudato si‘ auch ist, so stellen sich doch einige Entschlüsselungsprobleme. Natürlich bedarf es keines Geheimcodes, um die Enzyklika zu verstehen. Das ist nicht die Welt des „Da Vinci Codes“ oder von ähnlichen sensationsheischenden Filmen. Aber fundamentale Missverständnisse sind möglich und gibt es auch beim Versuch, der Enzyklika gerecht zu werden, sie angemessen zu verstehen. Und das ist die Voraussetzung dafür, sie kritisch zu würdigen und ggfs. zu anderen Schlussfolgerungen zu gelangen.
Der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick führt ein Beispiel aus dem Tierreich an. Einige Bienenvölker nördlich der Alpen unterscheiden sich demnach von italienischen im „Dialekt“, in ihrer Körpersprache. Bienen zeigen mit „Rund-, Sichel- und Schwänzeltanz“ ihren Artgenossen an, wie weit die Entfernung zu einer ergiebigen Futterstelle ist. Und da ist der Code nördlich und südlich der Alpen jeweils ein anderer. Kommt es zur Kreuzung solcher Völker, entsteht Konfusion, Verwirrung, weil man die Botschaften nicht dekodieren, nicht angemessen entschlüsseln kann. 2) Gibt es bei der Verständigung über Laudato si‘ ein Nord-Süd-Problem, eine beidseitige Verwirrung, wenn „lateinamerikanisches“ contra „westliches“ Denken steht?
Ein Zweites, das damit zusammenhängt: Lässt sich die gigantische techno-ökonomische Entwicklung, die sich zudem in Hochgeschwindigkeit permanent weiter entwickelt und die die heutige Konsumgesellschaft in Industriestaaten hervorgebracht hat, mit dem alttestamentlichen Turmbau zu Babel vergleichen? Gibt es eine Parallele zu einer menschlichen Anmaßung und Selbstüberschätzung, die damals schließlich eine Sprachverwirrung hervorgerufen und den Weiterbau gestoppt hat? Kann es eine Verständigung zwischen denjenigen – vor allem auch innerhalb der Industriegesellschaft - geben, die produzierend und konsumierend am „Konsumpalast“ weiterbauen wollen und denjenigen, die ihn ernsthaft umbauen, einen grundlegenden Strukturwandel der Wirtschafts- und Arbeitswelt und damit auch eine Wende zu einem anderen, einfacheren Lebensstil herbeiführen wollen? Sind die „Kinder der Konsumgesellschaft“ zu mehr in der Lage, als kleinere Korrekturen am Lebensstil vorzunehmen? Und sind diese ausreichend, um die Erderwärmung zu stoppen, den Ressourcenverbrauch ernsthaft zu reduzieren und gleichzeitig die weltweite Armut wirksam und zeitnah zu bekämpfen?
Nach Watzlawick geht die Möglichkeit von Konfusion in der Kommunikation auch darauf zurück, „dass eine Sprache nicht nur Information übermittelt, sondern auch Ausdruck einer ganz bestimmten Wirklichkeitsauffassung ist.“3) Und da kommen schnell Interessen und Ideologien ins Spiel. „Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee“; das ist einer der Kernsätze, die bei Papst Franziskus ganz im Vordergrund stehen.
Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimaforschung PIK), bilanziert: „Die Enzyklika ist sehr einzigartig, indem sie zwei starke Pole zusammenbringt: auf der einen Seite Glaube und Moral und auf der anderen Seite Forschung und Vernunft.“ Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, welche Dissonanzen und Spannungen sich zwischen diesen Polen, vor allem zwischen ökonomischen und ethischen Grundvorstellungen auftun können. Die Enzyklika mahnt durchgehend das Miteinander an. Hinzu kommen weitere Codierungen, auf die Christoph Bals verweist: die Codierung der Enzyklika für Gläubige und Nichtgläubige gleichermaßen und die Codierung in Rationalität einerseits und Emotionalität andererseits, Letzteres konkretisiert in Sprache, Ästhetik und Poesie.Papst Franziskus erhält darin Schützenhilfe von Alexander von Humboldt (1769-1850), für den die „Verbindung von Wissen, Kunst und Dichtung, zwischen Erkenntnissen und Gefühlen“ für Verständnis und Erhaltung von Natur unabdingbar ist und helfen kann „zu begreifen, dass wir nur schützen werden, was wir lieben.“4)
Ein weltweites Rundschreiben wird - unvermeidlich ? - vorrangig mit der Brille der jeweiligen von historischen, ökonomischen, kulturellen und politischen Strukturen geprägten Region gelesen. Nicht jeder Region muss jeder Schuh der päpstlichen Kritik gleichermaßen passen. Auch innerhalb einer Region gibt es ganz unterschiedliche Schuhgrößen; da kann nicht alles über einen Leisten geschlagen werden. Aber es bleiben in dieser Enzyklika genügend Schuhe für jedermann übrig.
Für die Auseinandersetzung mit Laudato si', die Weiterführung ihrer Impulse und für Grundfragen der christlichen Sozialethik gibt es viele Berufene. Als Laie an die Tür der Expertenarena zu klopfen, ist kein leichtes Unterfangen. Ich bin im doppelten Sinne Laie und als Pädagoge mit einem Schwerpunkt auf politische Bildung kein ausgewiesener Experte für christliche Sozialethik, trotz kontinuierlichem Interesse an der Thematik. Außerdem bin ich auch im innerkirchlichen Sinne Laie, in keiner Weise mit Weihen oder Ämtern gesegnet oder beschwert. Viele Experten schreiben bisweilen mehr für Experten oder Multiplikatoren. Analysen vieler professioneller Sozialethiker habe ich stets mit großem Gewinn gelesen, insbesondere auch für die Gestaltung von Vorträgen über einzelne Sozialenzykliken. Als „Unbefugter“ verfüge ich nicht über deren Fundus, und mir fehlt auch der Ehrgeiz, Mitglied in dieser Wissenschaftscommunity zu werden. Ein Laie, ein „Unbefugter“ darf durchaus mit gutem Gewissen unbekümmert die Herausforderung annehmen, wenn er mit dazu beiträgt, auf die Botschaft von Laudato si‘ aufmerksam zu machen, sie wach zu halten und einen bescheidenen Beitrag zum von der Enzyklika angestrebten Dialogprozess zu leisten, vor allem, wenn er auch in Einzelfällen einige weniger übliche Perspektiven, Veranschaulichungen und Akzente einzubringen versucht. Schließlich verbindet er damit die Hoffnung, zumindest teilweise damit auch einen anderen Leserkreis anzusprechen und nachdenklich zu machen. Ein katholischer Laie darf sich auch deshalb herausgefordert fühlen, weil man die Kritik nicht ganz ignorieren kann, die gerade in der deutschen Kirche die Auseinandersetzung mit Laudato si‘ und die Wei-terarbeit an und mit ihr für optimierbar hält.
Christliche Sozialethik, rückblickend, aktuell und zukunftsbezogen, insbesondere ihre Versuche der Konkretisierung, der Erfassung der „Zeichen der Zeit“ und der daraus resultierenden Leitlinien und Vorschläge mischt sich in spannende gesellschaftliche Entwicklungsprozesse ein. Die Leserinnen und Leser werden eingeladen, mit Schwerpunkt auf Laudato si‘ den päpstlichen Gedankengängen zu folgen und sie kritisch zu würdigen. Papst Franziskus baut auf Grundsätzen auf, die seine Vorgänger seit 1891 in Form von Sozialenzykliken grundgelegt haben; deshalb können sich auch einige Rück- und Überblicke als hilfreich erweisen. Die evangelischen Brüder und Schwestern mögen die „katholische Schlagseite“, die der Sozialisation des Autors geschuldet ist, nachsehen. Wo sonst gibt es ein so hohes Maß an Übereinstimmung zwischen den beiden Konfessionen wie in den sozialethischen Verlautbarungen ihrer Kirchen und ihrer Stellungnahmen zu Klimawandel und Umweltpolitik. Da macht zudem mit Blick auf die Umwelt das Wort von einer „existentiellen Ökumene“die Runde, die heute weit wichtiger sei als einige theologische Differenzen. Gläubige Christen, ob kirchennah oder fern, Mitglieder anderer Religionen, Agnostiker und Atheisten können unschwer feststellen, dass sie zu den Adressaten dieser Enzyklika gehören. Sie werden möglicherweise von einem hohen Maß an Gemeinsamkeiten überrascht sein.
1. Laudato si‘ – eine revolutionär neue Enzyklika?
Auch frühere Sozialenzykliken haben in der Regel ein starkes und gemischtes Echo ausgelöst, von begeisterter Zustimmung bis zu schroffen Ablehnungen. Maßstab dabei war in der Regel die Übereinstimmung der Enzyklika mit eigenen Grundpositionen, so dass Beifall oder Kritik aus unterschiedlichen Lagern gekommen sind.
Von einem „Donnerwetter des Papstes“1) war in den Medien die Rede als Papst Franziskus zu Pfingsten 2015 mit Laudato si' seine erste Sozialenzyklika veröffentlichte. Sie ist gleichzeitig die erste Umweltenzyklika aus der Feder eines Papstes. Diese hat sowohl in inner - als auch in außerkirchlichen Bereichen ein gewaltiges Echo ausgelöst und auch kurzzeitig auf der Bestsellerliste Platz gefunden. Christoph Bals führt beispielhaft Stimmen der weltweit positiven Resonanz an:
„Vom ‚erstaunlichsten und vielleicht ambitioniertesten Papier eines Papstes in den letzten hundert Jahren‘ spricht die britische Zeitung The Guardian; von der ‚Magna Charta einer integralen Ökologie‘ der brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff; von einem poetischen, couragierten Dokument, das über die katholische Kirche hinaus zu jedem Erdenbürger‘ spreche, die kanadische Aktivistin Naomi Klein, die sich selbst als säkulare Person mit jüdischem und feministischem Hintergrund bezeichnet. US-Präsident Barak Obama drückte seine Hoffnung aus, dass im Vorfeld des Klimagipfels in Paris ‚alle Weltführer und alle Kinder Gottes über den Aufruf von Papst Franziskus nachdenken, uns zusammen um das gemeinsame Zuhause zu kümmern‘. Der frühere DDR-Bürgerrechtler und Träger des deutschen Friedenspreises, Friedrich Schorlemmer, spricht von einer ‚Hoffnungsfanfare‘. US-Umweltaktivist Bill McKibben nennt es ‚eins der einflussreichsten Dokumente in jüngerer Zeit‘. Der Philosoph und Theologe Hermann Häring sieht eine ‚weithin leuchtende Rakete‘ am Start: ‚Die Rakete ist gestiegen. Als Mitbewohner dieser Erde wünschen wir ihr eine stabile Umlaufbahn im Orbit unserer geschundenen, doch immer noch blau leuchtenden Erde.‘ Der ehemalige Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen Klaus Töpfer nennt die Enzyklika eine ‚Therapieanleitung für unsere Gesellschaft‘. Mit ihr sei Franziskus vielen auf die Füße getreten und die verdienen das auch‘“.2) Der Kirchenhistoriker Dr. Hubert Wolf sieht in der Enzyklika einen „kostbaren Schatz“ in kirchenhistorischer Dimension. Laudato si‘ eröffnet „ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre“, so sieht es Markus Vogt, Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Sozialethik an der LMU München.3) Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer des Bischöflichen Hilfswerks Misereor bescheinigt Papst Franziskus, dass ihm mit der Enzyklika „ein großer Wurf“ gelungen sei.
Von Pfarrer Friedrich Schorlemmer stammt zudem der Rat an katholische Kollegen, doch anstelle von selbst erstellten Predigten im Gottesdienst häufiger ausgewählte Text von Laudato si‘ zu verlesen. Viel Lob, Befürwortung und Anerkennung hat der Papst von führenden Klimaforschern und von Nichtregierungsorganisationen wie Germanwatch erhalten. Selbstverständlich gab und gibt es viel Zustimmung aus dem innerkirchlichen Bereich, natürlich auch von Bischöfen und kirchlichen Organisationen, in der Regel doch deutlich mehr als Pflicht- und Höflichkeitsapplaus.
Es fehlt aber auch nicht an distanzierten Würdigungen, an Ablehnung und schroffer Kritik. Die Enzyklika ist in einigen Medien vor allem wegen der harschen Kapitalismus-Schelte kritisiert worden. Jeb Bush, Mitbewerber bei den Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA polterte: "Ich beziehe meine Wirtschaftspolitik weder von meinen Bischöfen noch von meinen Kardinälen noch von meinem Papst". Mit anderen Worten, warum bleibt der Papst nicht bei „seinen Leisten“ und überlässt die „irdischen Fragen“ der Politik? Andere fragen, ob der Papst ein Grüner sei. Er zeige die Probleme auf. „Doch bei der Lösung irrt er.“4)
In der Tat ist Papst Franziskus schon mit seinem innerkirchlichen Rundschreiben Evangelii gaudium (2013) und der darin enthaltenen harten Kritik an der „jetzigen Wirtschaft“ - ohne dass der Begriff Kapitalismus auftaucht – auf starken Widerstand gestoßen. Für andere beinhaltet die Enzyklika einen antimodernistischen, rückwärtsgewandten und zur Sozialromantik neigenden Irrweg des Papstes. Solche Stimmen vernimmt man auch aus dem innerkirchlichen Raum. Johannes Rösner zitiert zwar den kalifornischen Neurowissenschaftler Steven R. Quartz, baut dessen Überlegungen jedoch durchaus in seinen Gedankengang ein: „Den Trend, Erzählungen des Niedergangs zu verstärken, über die böse Welt zu klagen, sieht der Hirnforscher auch in den Kirchen, sogar in Lehrschreiben von Papst Franziskus, in den - wie Quartz sie bezeichnet ‚antimodernistischen‘ Auffassungen von Wirtschaft, Technik, Biomedizin, Umwelt usw. Die Christen scheinen - je mehr sie religiös in die Defensive geraten, umso mehr gesteigert – gern zu Unheilspropheten mit tiefer Fortschrittsskepsis zu werden.“5)
Man geht auch der Frage nach, ob Laudato si‘ eine „revolutionär neue Enzyklika“ sei. Die katholischen Sozialethiker Bernhard Edmunds und Matthias Möhring Hesse haben in ihrem ebenso umfänglichen wie fundierten Kommentar bei einer insgesamt sehr positiven Würdigung der Enzyklika resümierend diese Frage verneint:
„So viel Neues leistet Laudato si‘ weder für die Welt, noch für die Kirche, weder für die Klimapolitik, noch für die Theologie und Ethik. Sie bringt weder eine Revolution, noch bedeutet sie eine 'Wende'“. So artikulieren sie es im Kommentar der Herder-Ausgabe der Enzyklika.6) Man kann, um mit einer Wertung nicht zurückzuhalten, auch mit einem sachlich durchaus nachvollziehbaren Satz einen falschen Akzent setzen. Für Papst Franziskus ist es vermutlich gar nicht wichtig, viel wirklich Neues zu verkünden: Ihm geht es vor allem um einen möglichst wirksamen Weckruf, um einen energischen Appell, einen „Ruck“, eine Umkehr, eine Verhaltensänderung, um wirksame Reformen und Kontrollen- lokal, national und international - im Bereich des Umweltschutzes, um einen neuen Fortschrittsbegriff, und das alles untrennbar verknüpft mit einer Option für die Armen, die Ausgegrenzten dieser Erde. Dieser Appell verbunden mit der Amtsautorität des Papstes und seinem unbestreitbaren Charisma hat weltweit innerund außerkirchlich eine Beachtung gefunden wie kaum ein anderer programmatischer Text. Einigen katholischen Kommentatoren würde man etwas mehr Emotion wünschen, die über nüchterne Bilanzierung und Würdigung hinausgeht.
Die Kritik an der Enzyklika ist jedoch ein Beleg dafür, dass man in jedem weltanschaulichem Lager, auch in einer weitgehend pluralen und säkularisierten Gesellschaft der Frage nach der ethischen Fundierung ökonomischen und ökologischen Handelns nicht ausweichen will, darf oder kann. Da gibt es zahlreiche Grundübereinstimmungen zwischen religiösen und säkularen Lagern, die durchaus Bündnisse, eine „Koalition der Willigen“ in Sachen Wirtschaftsethik ermöglichen, erst Recht bei den drohenden Gefahren einer Klimakatastrophe. „Die Einheit ist wichtiger als der Konflikt“, so lautet einer der Kernsätze von Papst Franziskus.
Doch vorab kann ein kleiner Exkurs über die Frage hilfreich sein, was Enzykliken sind, was sie inner - und außerkirchlich bedeuten und wie Laudato si‘ in die bisherige Tradition einzuordnen ist. Wer schneller „zur Sache“, zu Laudato si‘ gelangen möchte, kann das Kapitel zunächst überschlagen.
2. Sozialenzykliken - Was sie innerkirchlich und für die säkulare Gesellschaft bedeuten
Allgemeiner Überblick
Enzykliken (gr.) – lat. Epistulae encyclikae oder litterae encyclicae-sind päpstliche Rundschreiben - in denen allgemeine Fragen der kirchlichen Lehre für die ganze Kirche in feierlicher Form verbindlich dargelegt werden, und zwar außerhalb der in Dogmen festgelegten Unfehlbarkeit.
Als Sozialenzykliken werden diejenigen Rundschreiben bezeichnet, die sich schwerpunktmäßig zu grundsätzlichen sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen der Zeit äußern und Aussagen zur gesamtge-sellschaftlichen Ordnung und ihren Bauprinzipien enthalten. Verlautbarungen zur Soziallehre finden allerdings nicht nur in Sozialenzykliken statt, sondern auch in anderen Rundschreiben und besonderen Ansprachen der Päpste. Auch Enzykliken, die nicht als Sozialenzykliken bezeichnet werden, behandeln wichtige Einzelfragen, die direkt oder indirekt die gesamtgesellschaftliche Ordnung betreffen. Darüber hinaus ist christliche Sozialethik nicht nur eine Sache des Papstes oder des Episkopats, sondern aller innerhalb und außerhalb der Kirchen. Der Geist weht bekanntlich, wo er will.
Den Anfang mit päpstlichen Sozialenzykliken hat Papst Leo XIII. mit Rerum novarum (1891) gemacht. Seitdem finden in bestimmten Abständen, jeweils nach einer Analyse der neuen „Zeichen der Zeit“, Fortschreibungen statt, und es werden neue thematische Schwerpunkte aufgegriffen.
Unverkennbar ist an den Erscheinungsjahren einiger Sozialenzykliken (Qudragesimo, Oktogesima, Centesimus) die bewusste Anknüpfung an Rerum novarum, die „Magna Charta“ der katholischen Sozialethik erkennbar. Auch Mater et magistra (1961), zum 70. Jahrestag und Laborem exercens (1981) mit dem Titel „‘Über die menschliche Arbeit‘ zum neunzigsten Jahrestag der Enzyklika Rerum novarum“ reihen sich hier im Erscheinungsdatum in diese Erinnerungslinie ein.
Es gibt eine zweite Traditionslinie, beginnend mit Populorum progressio (1987). Sollicitudo rei socialis trägt den Untertitel „Zwanzig Jahre nach der Enzyklika Populorum progressio“. Die Sozialenzyklika Caritas in veritate (2009) von Papst Benedikt XVI. sollte eigentlich schon 2007, zum 40. Jahrestag erscheinen. Der Papst hat mit „Caritas in veritate – über die ganzheitliche Entwicklung des Menschen in der Liebe und in der Wahrheit“ ausdrücklich den Faden von Populorum progressio aufgegriffen und fortgeführt.
Die folgende Zusammenstellung bietet einen Überblick über die bisher herausgegebenen zehn Sozialenzykliken der Päpste. Das trifft nicht auf die drei blau unterlegten Dokumente zu. Die Pastoralkonstitution Gaudium et spes ist ein Dokument des Konzils. Sie ist von Papst und Konzil gemeinsam verfasst und steht mindestens „auf Augenhöhe“ mit einer Sozialenzyklika. Octogesima adveniens fällt in die Kategorie eines „Apostolischen Schreibens“. Aus der Feder von Papst Franziskus stammt das Apostolische Schreiben „Evangelii gaudium – Über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute“ (2013). Es ist ein innerkirchliches Schreiben; darin sind jedoch auch etliche Aussagen zur Armut und der jetzigen Wirtschaft enthalten, auf die der Papst sich mehrfach in Laudato si‘ bezieht.
Päpstliche Sozialenzykliken im Überblick
Was auffällt, sind die kürzeren Zeitabstände, in denen Sozialenzykliken seit 1961 erscheinen. In den ersten 70 Jahren von 1891 bis 1961 handelt es sich um drei Enzykliken. Von 1961 bis 2017, also in einem Zeitraum von 56 Jahren sind es 10 der angeführten Dokumente. Dafür gibt es zwei Hauptursachen: zum Einen die Schnelligkeit der Entwicklung seit dem Beginn der Industrialisierung mit gravierenden ökonomischen und sozialen Auswirkungen und zum Anderen die weltweiten Perspektiven, die in Fragen des Friedens, der Menschenrechte, der sozialen Gerechtigkeit und der Ökologie in den Vordergrund getreten sind.
Die erste Traditionslinie setzt schwerpunktmäßig bei den sozialen Fragen der Industriegesellschaft an und behandelt Grundfragen der Arbeit und der gesellschaftlichen Ordnung. Die zweite Linie rückt die Situation der Entwicklungsländer in den Vordergrund, wobei es von der Sache her zahlreiche Überschneidungen gibt und die Situation von Entwicklungsländern nicht ohne die Rolle der Industriegesellschaften dargestellt werden kann. Auch der zentrale Begriff einer „ganzheitlichen Entwicklung“ betrifft alle Länder.
Thematisch eher singulär steht eine wichtige Enzyklika von Papst Johannes XXIII da: „Pacem in Terris. Über den Frieden unter den Völkern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit“.
Papst Franziskus macht mit der Enzyklika Laudato si‘ einen dritten Aufschlag mit dem Schwerpunkt Umwelt, was sicherlich auch schon von einigen Vorgängern ins Blickfeld gerückt worden ist, aber nicht als Hauptthema und nicht mit dieser Systematik. Von daher kann man nachvollziehen, dass Laudato si‘ häufig als Umweltenzyklika bezeichnet wird. Sie ist jedoch eine „öko-soziale Enzyklika“ 1) , da in der von Papst Franziskus vertretenen „ganzheitlichen Ökologie“ das Soziale eine unverzichtbare, ja gleichrangige Komponente, gleichsam eine untrennbare Einheit bildet. Lange war es üblich, das Fundament dieser Sozialethik im Dreieck von Personalität, Solidarität und Subsidiarität (vgl. Kapitel 8) zu verorten. Nun kann niemand mehr auf das vierte Element verzichten. Die soziale Ordnung muss die Umwelt, unsere „Mitwelt“ mit einbeziehen.
Wer hat mitgewirkt bei der Abfassung von „Laudato si“?
Es versteht sich, dass kein bisheriger Papst eine Sozialenzyklika allein geschrieben hat, so auch Papst Franziskus nicht. Enzykliken, denen man häufiger auch schon einmal vorwirft, dass sie sehr spät zu einer Entwicklung Position beziehen, basieren selbst auf vielerlei sozialethischen Vorarbeiten im theologischen, ökosozialen und wissenschaftlichen Bereich.
So schreibt Papst Johannes Paul II.in Centesimus annus (1991) im Rückblick über die Sozialenzyklika Rerum novarum von Papst Leo XIII.: „Er wurde angeregt von wissenschaftlichen Studien der Laien, von der Tätigkeit katholischer Bewegungen und Vereinigungen und von den konkreten sozialen Werken, die das Leben der Kirche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kennzeichneten.“(4) Sozialenzykliken sind – trotz zahlreicher belegter Zitate und Quellen - jedoch keine wissenschaftlichen Abhandlungen, in denen man exakt vermerkt, wer wann wo und wie Einfluss genommen hat.
Schon bald nach seinem Amtsantritt hat Franziskus eine Umweltenzyklika angekündigt. Es ist kein Geheimnis, dass diese schließlich bewusst im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Paris (30. November bis 11. Dezember 2015) erscheinen sollte, um mit päpstlicher Autorität dem Klimaschutz Nachdruck zu verleihen. Papst Franziskus „erklärt, dass ihn die Klimakonferenz von Lima (Peru) enttäuscht habe und seine Enzyklika rechtzeitig vor der Konferenz in Paris erscheinen werde, ‚damit sie einen Beitrag leiste‘ [...].Hoffen wir, dass in Paris die Vertreter mutiger sein werden, um in dieser Sache voranzukommen.“2)
Am 28. April 2014 veranstaltete die Päpstliche Akademie der Wissenschaften unter der Überschrift „Protekt the Earth. Dignify Humanity. The Moral Dimensions of Climate Change and Sustainable Humanity“ gemeinsam mit dem UN Sustainable Development Solutions Network und Religions for peace eine Konferenz, bei der Generalsekretär Ban-Ki-moon die Eröffnungsrede hielt.3) Der erste Entwurf der Enzyklika wurde vom Rat Justitia et pax erstellt. Für einige Teile der Enzyklika gilt der im Dezember 2015 emeritierte Bischof der brasilianischen Diözese Xingu im Amazonasgebiet Erwin Kräutler als Ko-Autor.
Nach mehrfachen Überarbeitungen, an denen das Staatssekretariat und die Glaubenskongregation beteiligt waren, erfolgte im März 2015 die Endredaktion. Papst Franziskus soll sich dafür mehrere Tage zurückgezogen haben. Es ist kein Zufall, dass der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Hans Joachim Schellnhuber den Text der Enzyklika in Rom mit vorgestellt hat, was sicherlich auch auf wissenschaftlichen Einfluss von dieser Seite schließen lässt. Die Enzyklika ist von Papst Franziskus am 24.Mai 2015, dem Pfingstsonntag, erlassen worden. Die Urfassung der Enzyklika ist – das ist neu- in spanischer Sprache verfasst worden.
Der Vatikan-Journalist Sandro Magister brach die Sperrfrist und stellte einen ihm vorliegenden Text vorzeitig online; daraufhin wurde ihm vom Vatikan die Akkreditierung entzogen.
Es fällt nicht schwer, die ganz persönliche Handschrift von Papst Franziskus in Inhalt und Sprache aufzuzeigen; er hat den gesamten Prozess initiiert, gesteuert und begleitet und in vielen Passagen letzte Hand angelegt. Das gilt auch für seine Vorgänger. Der persönliche gedankliche und sprachliche Duktus ist auch bei anderen Päpsten unverkennbar, etwa bei Papst Benedikt XVI.
In allen Sozialenzykliken nach Rerum novarum (1891) ist es üblich, dass Päpste ausführlich vorangegangene Päpste zitieren, um die Kontinuität der Sozialethik aufzuzeigen, was es dem Leser nicht immer erleichtert, neue Akzentsetzungen und Veränderungen aufzuspüren. Papst Franziskus ergänzt das um eine neue Dimension. Er baut in Laudato si' vielfach Aussagen von regionalen Bischofskonferenzen mit ein. Dazu vermerkt Kardinal Rainer Marx: „Wir freuen uns, dass dazu auch zwei Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz zählen. Mit dem Verweis auf die Erklärungen der Bischofskonferenzen wird klar, dass er in neuer Weise ernst macht mit dem gemeinsamen Lehramt der Bischöfe. Die zahlreichen Verweise machen auch deutlich, wie viel inhaltliche Arbeit in den Bischofskonferenzen bereits zur ökologischen Problematik geleistet worden ist.“ 4)
Kardinal Marx ist dabei sicherlich nicht entgangen, dass lateinamerikanische Bischofskonferenzen weit häufiger zitiert werden als europäische. Ist das ein Zeichen für einen Paradigmenwechsel, für einen Perspektivwechsel vom europäisch geprägten industriellen Norden zu Ländern der südlichen Hemisphäre mit vorherrschend Entwicklungs- und Schwellenländern? Liegt da ein Schlüssel zum Zugang, zum Verständnis von Franziskus' Botschaft in Laudato si‘? Bisher haben europäische Päpste Sozialenzykliken geschrieben, mit Leo XIII., Pius XI., Johannes XXIII., Paul VI. vier Italiener, mit Johannes Paul II. ein Pole und mit Benedikt XVI ein Deutscher. Und nun mit Papst Franziskus ein Argentinier, ein Südamerikaner. Ist das der Schlüssel zu einem neuen Code? Sicherlich eine Frage, die man nicht so leicht mit „ja“ oder „nein“ beantworten kann.
Oft sind bereits die Anfangswörter der Sozialenzykliken gleichsam Schlüsselwörter und ein Hinweis auf den inhaltlichen Schwerpunkt und die gewählte Akzentsetzung. In der Tat handelt Rerum novarum (1891) von „Neuen Dingen“, vom „Geist der Neuerung“ beim endgültigen Eintritt in das Industriezeitalter im 19.Jahrhundert. Mit Laudato si‘ greift Papst Franziskus den Sonnengesang des heiligen Franziskus von Assisi auf. Das ‚Laudato si, mi Signore‘ ist bereits seit einigen Jahrzehnten ein in Kirchenkreisen verbreitetes Lied zum Lob und zur Bewahrung der Schöpfung. Die Melodie in einer „Endlosschleife“ gesungen, trifft „den Grundton der Enzyklika, die Leidenschaft und das optimistische Zutrauen in die Menschen, die Papst Franziskus auch in dieses Rundschreiben legt – trotz des Themas, der drohenden Zerstörung der Erde, und trotz des dramatischen Appells zur gemeinsamen ‚Sorge‘ für dieses ‚gemeinsame Haus‘“, so die Bewertung in der Herder-Ausgabe. 5)





























